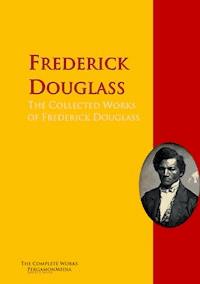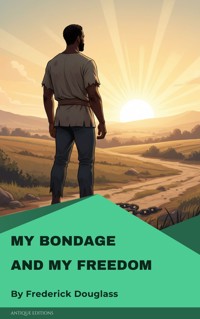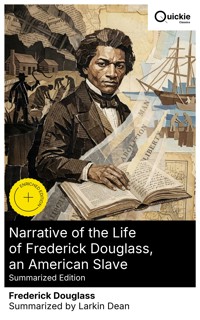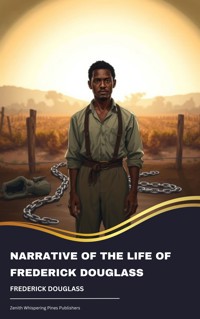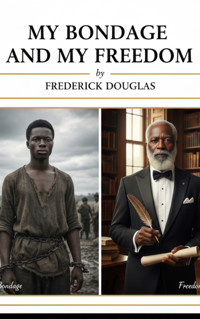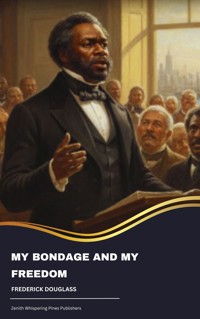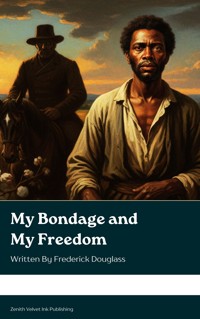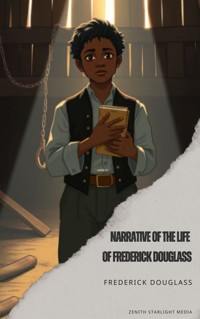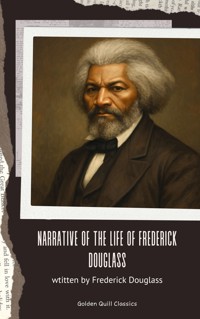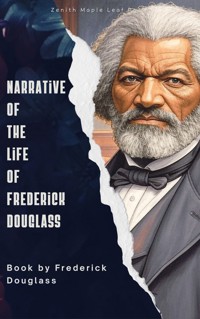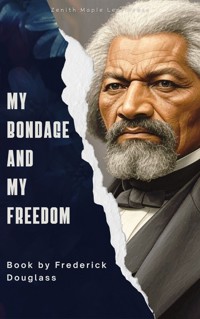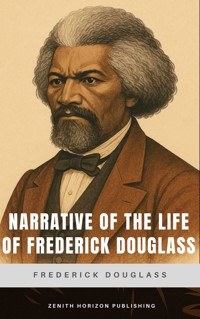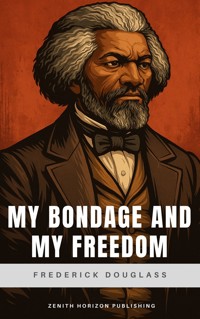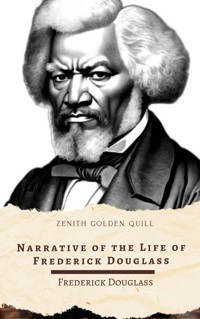7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Sklaverei und Freiheit" hat Frederick Douglass, der wohl bekannteste ehemalige Sklave der Weltgeschichte, seine 1855 veröffentlichte Autobiographie genannt. Es ist der zweite von insgesamt drei solcher Berichte, die er verfasst hat, und eine sehr viel detaillierte Ergänzung zu seinem ersten Werk, "Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave." Das Buch beschreibt seinen Übergang von der Sklaverei in die Freiheit. Nach seiner Befreiung wurde Douglass zu einem prominenten Abolitionisten, Redner, Autor, Zeitungsverleger und Verfechter der Frauenrechte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sklaverei und Freiheit
FREDERICK DOUGLASS
Sklaverei und Freiheit, Frederick Douglass
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681232
Übersetzerin: Ottilie Assing
Druck: Bookwire GmbH, Voltastr. 1, 60486 Frankfurt/M.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorrede.1
Erster Teil. Sklavenleben.5
Erstes Kapitel. Kindheit.5
Zweites Kapitel. Das Verlassen der ersten Heimat.11
Drittes Kapitel. Herkunft.16
Viertes Kapitel. Allgemeine Übersicht der Sklavenpflanzung.22
Fünftes Kapitel. Einweihung in die Geheimnisse der Sklaverei.33
Sechstes Kapitel. Behandlung der Sklaven auf Lloyds Pflanzung.39
Siebtes Kapitel. Leben im großen Haus.50
Achtes Kapitel. Ein Kapitel voll Gräuel.57
Neuntes Kapitel. Persönliche Behandlung des Verfassers.63
Zehntes Kapitel. Leben in Baltimore.70
Elftes Kapitel. "Ein Wechsel kam über den Geist meines Traums.". 76
Zwölftes Kapitel. Neue Errungenschaften im Wissen.82
Dreizehntes Kapitel. Wechselfälle des Sklavenlebens.86
Vierzehntes Kapitel. Erfahrungen in St. Michael.93
Fünfzehntes Kapitel. Covey, der Negerabrichter.103
Sechzehntes Kapitel. Abermalige Leiden unter den Klauen des Tyrannen.112
Siebzehntes Kapitel. Die letzte Züchtigung.118
Achtzehntes Kapitel. Neue Beziehungen und Pflichten.128
Neunzehntes Kapitel. Die Verschwörung zur Flucht.139
Zwanzigstes Kapitel. Lehrlingszeit.158
Einundzwanzigstes Kapitel. Meine Flucht aus der Sklaverei.168
Zweiter Teil. Freiheit.176
Zweiundzwanzigstes Kapitel. Die gewonnene Freiheit.176
Dreiundzwanzigstes Kapitel. Bekanntwerden mit den Abolitionisten.188
Vierundzwanzigstes Kapitel. Einundzwanzig Monate in Großbritannien.193
Fünfundzwanzigstes Kapitel. Verschiedene Vorfälle.207
Vorrede.
Wäre diese Lebensgeschichte ein Werk der Dichtung, eine künstlerische Schöpfung, so müsste man bedauern, dass sie nicht einige Jahre früher erschien, ehe das Interesse für solche Schilderungen durch die fast unzähligen Darstellungen des Sklavenlebens, welche seit dem Erscheinen des berühmten "Uncle Tom" einen eigenen Zweig der Literatur ausmachen, fast erschöpft war; allein das vorliegende Werk ist keine solche Schöpfung, sondern eine wahre Geschichte, die Aneinanderreihung nackter, ungeschmückter, schrecklicher Tatsachen, welche, da es sich um eine Frage der Wirklichkeit mit allen ihren Konsequenzen handelt, auf Diejenigen, welche die Wahrheit vertragen können, ungleich einschlagender, ergreifender und überzeugender wirken muss, als alle Werke der Dichtung. Keine erfundene Gestalt bildet den Mittelpunkt der mitgeteilten Ereignisse; der Verfasser, welcher sie erlebte, lebt unter uns, er ist Einer von Amerikas berühmten Männern, obgleich er jener unterdrückten Rasse, den Parias der amerikanischen Gesellschaft angehört, die nach der im vorigen Jahre erfolgten Entscheidung des höchsten Gerichts der Vereinigten Staaten in ihrem eigenen Vaterland niemals Bürger werden können und keine Rechte besitzen, welche die Weißen anzuerkennen verpflichtet wären, und der ganze Mensch mit seinem edlen Selbst, der feurige, geistreiche, begabte und energische Mann mit der glühenden Freiheitsliebe und der Virtuosität des unversöhnlichsten Hasses gegen Sklaverei und Sklavenhalter ist es, welcher dem Leser darin unwiderstehlich anziehend und bedeutend entgegentritt. Die Wirkung seiner Lebensgeschichte war im Norden der Vereinigten Staaten einschlagend und überwältigend über alles Erwarten, und seit dem Jahre 1855, in welchem sie zuerst erschien, sind nicht weniger als 20,000 Exemplare davon aufgelegt worden, trotzdem die Sklavereifrage täglich in allen Blättern der Gegenstand zahlloser Besprechungen und Kontroversen ist, in Folge deren das lesende Publikum nur noch dem Hervorragendsten, Bedeutendsten auf diesem Gebiet Beachtung zu schenken geneigt ist.
Die Lebensgeschichte des Verfassers liefert den treuesten Abdruck seiner Individualität, und bedarf demnach keiner weiteren Erläuterung. Der Leser wird ihn selbst daraus kennen lernen, mit Ausnahme jedoch seines glänzenden Rednertalents, dem er hauptsächlich seine gegenwärtige hervorragende Stellung verdankt. In diesem an großen Rednern so reichen Land ist Frederick Douglass einer der größten. Vollkommene Beherrschung des Gegenstandes, Schärfe, glänzende Dialektik und richtiges Maß bei aller Leidenschaft sind ihm in hohem Grad eigen. Oft erhebt er sich zu einer tragischen Höhe, und dann beleuchtet er den Gegenstand wieder mit brillanten Schlaglichtern des Witzes und Humors, spricht zum Herzen des Zuhörers, oder unterhält ihn zur Abwechslung mit leichtem Scherz. Alles ist frisch, ursprünglich und anziehend. Alle diese Vorzüge werden durch eine vollendete Beherrschung der Sprache gehoben, und durch ein Organ, so weich, wohlklingend, biegsam und zum Herzen sprechend, als ich jemals gehört habe. Welchen Reichtum von Geist, Frische und Originalität er besitzt, kann man daraus entnehmen, dass er in seinen Reden bereits seit siebenzehn Jahren denselben Gegenstand behandelt, welchen außer ihm schon alle großen Redner des Landes ausgebeutet haben, ohne in Wiederholungen zu verfallen oder für das Publikum abgestanden zu werden. Die äußeren Umstände, welche ihm bei seinem ersten Auftreten zu Statten kamen, damals, als ein flüchtiger Sklave auf der Rednerbühne eine Seltenheit war und er den Vorteil genoss, eine ganz neue Erscheinung zu sein, können ihn gegenwärtig nicht mehr tragen; trotzdem aber sind seine Erfolge und sein Einfluss noch immer im Wachsen begriffen. Im ganzen Norden der Vereinigten Staaten gibt es keine Stadt und kein Dorf, worin nicht die Ankündigung seines Namens genügte, um die Zuhörerräume bis auf den letzten Plag zu füllen, selbst das verwöhnte, schwer zu befriedigende Publikum von New York nicht ausgenommen, das ich –– obgleich er alljährlich vor dasselbe tritt –– von ihm hingerissen und begeistert gesehen habe, als wenn plötzlich ein neuer Apostel ihm zum ersten Male eine Wahrheit verkündigt hätte, welche bis dahin unausgesprochen in dem Herzen eines Jeden lag.
Vor zwei Jahren lernte ich Frederick Douglass bei einem Besuch in Rochester persönlich kennen, und entnehme der Skizze, die ich nach jener ersten Begegnung schrieb, den folgenden Auszug, welchem ich hinzuzufügen habe, dass jener günstige Eindruck sich durch näheres Bekanntwerden nur befestigt und gesteigert hat.
"Zuerst suchte ich Frederick Douglass in seinem Redactions-Bureau auf, welches über der Haustür in großen Buchstaben die Inschrift: "The North Star Office" trägt, zum Zeichen für die flüchtigen Sklaven, deren einziger Wegweiser auf der Flucht oft der Polarstern ist, den sie Alle kennen, und welche von Rochester zu Hunderten auf der sogenannten unterirdischen Eisenbahn nach Canada befördert werden. Da ich Douglass hier nicht traf, besuchte ich ihn in seiner Wohnung, etwa eine halbe Stunde vor der Stadt. Auf einem Hügel, welcher den Überblick über dieselbe gewährt, liegt, von einem großen Garten umgeben, das stattliche, villaartige Haus in einer freundlichen, ländlichen Gegend. Douglass ist ein ziemlich heller Mulatte von ungewöhnlich großer, schlanker und kräftiger Gestalt. Seine Züge sind markiert, und eine stark gewölbte Stirn mit einem eigentümlich tiefen Einschnitt an der Nasenwurzel, gebogene Nase und schmale, schön geschnittene Lippen verraten mehr von der weißen als von der schwarzen Abstammung. Das dichte, schon hie und da mit Grau gemischte Haar ist kraus und aufstehend, doch nicht wollig. In seiner ganzen Erscheinung, welche von vergangenen Stürmen und Kämpfen erzählt, liegt der Ausdruck großer Energie und Willenskraft, die vor keinem Hindernis zurückbebt, und vermöge deren allein es ihm in der Tat auch möglich war, den Verhältnissen zum Trotz, sich zu seiner jetzigen Stellung emporzuarbeiten, und man begreift es sehr wohl, wenn man in seinem Leben liest, dass er, fast noch ein Knabe, als sein Herr ihn misshandeln wollte, sich gegen ihn zur Wehr setzte und ihn wirklich einschüchterte, oder dass er, als er in Baltimore auf den Schiffswerften arbeitete und die weißen Arbeiter ihn nicht unter sich dulden wollten, seinen heftigsten Gegner ergriff und ins Wasser warf. - Sein ganzes Wesen trägt das Gepräge einer reichen, ursprünglichen, trotz allen Druckes glücklich entwickelten Natur. Alles in ihm ist frisch, echt, wahr und gut. Er besitzt ein ungewöhnliches Konversationstalent, versteht es, den Andern anzuregen und emporzuheben, und zeigt sich in der Unterhaltung heiter, belebt, geistreich und auf der Höhe der Bildung stehend. Von Leidenschaft für die Sache durchglüht, der er sein Leben gewidmet, ist er zu vielseitig begabt, um darum nicht auch jeden anderen Gegenstand, der es verdient, mit Lebhaftigkeit zu ergreifen. Die verschiedenartigsten Dinge, große und kleine, allgemeine und persönliche wurden im Lauf der Unterhaltung berührt, und über alle traf ich Verständnis und Sympathie. Douglass' Frau ist ganz schwarz, und seine fünf Kinder tragen deshalb weit mehr vom Negertypus an sich als er selbst."
Wäre Frederick Douglass zufällig ein Weißer, so hätte er, wenn auch im niedrigsten Stande geboren, bei seinem Talent, seiner Ausdauer und Energie sicher eine glänzende Laufbahn zurückgelegt und irgendeine hervorragende Stellung erreicht. Als Mulatte ist er dagegen, obgleich ein berühmter Mann, den sprechen zu hören man sich drängt, dessen Bedeutung und Einfluss Niemand in Abrede stellen kann, obgleich der wahren Elite der Gesellschaft angehörig, trotz Geist, persönlicher Liebenswürdigkeit und des reinsten Charakters nicht nur von jeder öffentlichen Stellung, sondern auch von Dem ausgeschlossen, was sich vorzugsweise die gute Gesellschaft nennt. Umso größer ist indessen die Verehrung und Liebe, deren er unter den Freunden der Emanzipation der Sklaven genießt, und man schlägt sein Wirken und den Einfluss seiner Persönlichkeit nicht zu hoch an, wenn man ihm einen bedeutenden Anteil an dem Umschwung der öffentlichen Meinung im Norden zu Gunsten der Farbigen zuschreibt, der sich seit einer Reihe von Jahren, wenngleich langsam in seinem Fortschritt, doch unverkennbar kundgibt.
Möge diese Biographie dazu beitragen, das Interesse für die Repräsentanten und die Sache einer Rasse zu erhöhen, welche unter einer sogenannten republikanischen Regierungsform in einer Knechtschaft gehalten wird, von deren Härte man in der Geschichte anderer Völker und Länder kaum ein Beispiel findet.
New York, im Sommer 1858.
Ottilie Assing.
Erster Teil. Sklavenleben.
Erstes Kapitel. Kindheit.
In Talbot County, am östlichen Ufer von Maryland, in der Nähe von Easton, dem Hauptort der County, liegt ein kleiner, schwach bevölkerter Bezirk, der meines Wissens nur durch seinen dürren, sandigen und wüsten Boden, den Verfall der Farmhäuser und Zäune, den dürftigen schwerfälligen Habitus der Bewohner und das Vorwalten von Wechselfiebern bemerkenswert ist.
Dieser auffallend verwahrloste und in der Tat von Mangel heimgesuchte Bezirk heißt Tuckahoe, ein Namen, der allen Marylandern, Weißen wie Schwarzen wohl bekannt ist. Wahrscheinlich wurde er diesem Teil des Landes ursprünglich nur als ein Spottnamen beigelegt, weil einer seiner früheren Bewohner sich einmal das geringfügige Vergehen zu Schulden kommen ließ, einen Spaten zu stehlen oder zu nehmen, der ihm nicht gehörte. Die Bewohner des östlichen Users sprechen das Wort "took" (nahm, von to take, nehmen) gewöhnlich "tu" aus, Took-a-hoe (nahm einen Spaten) heißt daher im Dialekt von Maryland Tuckahoe. Woher dieser Namen nun auch stammen mag, so viel ist gewiss, dasser dem erwähnten Bezirk geblieben ist, und dass dieser selten anders als mit Geringschätzung und Spott über die Dürre des Bodens und die Unwissenheit, Schwerfälligkeit und Armut seiner Bewohner erwähnt wird. Überall sind Verfall und Elend sichtbar, und die spärliche Bevölkerung des Ortes würde diesen längst verlassen haben, wenn der Choptank sie nicht hielte, der sie reichlich mit Shads, Heringen und Wechselfiebern versorgt.
In diesem traurigen, flachen und unwirtbaren Bezirk, oder in seiner Nähe, war es, inmitten einer auf der niedrigsten Stufe befindlichen weißen Bevölkerung, deren Trägheit und Trunksucht sprichwörtlich geworden, und unter Sklaven, welche jedes Mal, wenn sie einen Spaten in die Hand nehmen, zu fragen schienen: "Ach, was hilft es!", wo ich ohne mein Verschulden geboren wurde und die ersten Jahre meiner Kindheit verlebte.
Der Leser mag mir verzeihen, dass ich so viel über meinen Geburtsort sage; doch ist es immer von einiger Bedeutung, zu wissen, wo ein Mensch geboren ist, wenn es überhaupt der Mühe wert ist, diesen selbst kennen zu lernen. In Betreff der Zeit meiner Geburt bin ich weniger sicher als hinsichtlich des Ortes, und eben so wenig vermag ich nähere Auskunft über meine Eltern zu geben. Unter den Sklaven gedeihen keine Stammbäume! Jener hier im Norden so wichtige Name, welcher als Vater bezeichnet wird, ist nach Sklavengesetz und Sklavengebrauch abgeschafft. Nur in einzelnen Fällen findet man eine Ausnahme von dieser Behauptung. Ich habe niemals einen Sklaven gesehen, der zu sagen vermochte, wie alt er war. Nur wenige Sklavenmütter wissen das Mindeste von den Monaten des Jahres und den Tagen des Monats. Sie führen kein Familienverzeichnis über Heiraten, Geburten und Todesfälle. Sie berechnen das Alter ihrer Kinder nach Frühlingen und Wintern, der Ernte- oder Pflanzzeit und dergleichen mehr; doch diese Merkzeichen verwischen sich bald und werden vergessen. Gleich anderen Sklaven weiß ich nicht, wie alt ich bin. Dieser Mangel gehörte zu meinen frühzeitigsten Sorgen. Als ich heranwuchs, hörte ich, dass mein Herr, gleich den meisten Sklavenhaltern, seinen Sklaven nicht gestattete, Fragen hinsichtlich ihres Alters an ihn zu richten. Dergleichen Fragen werden als Beweise von Ungeduld oder selbst von frecher Neugier betrachtet. Aus verschiedenen Ereignissen indessen, deren Data ich seitdem in Erfahrung gebracht habe, vermute ich, dass ich im Jahre 1817 geboren bin.
Die ersten Lebenseindrücke, deren ich mich nur noch dunkel erinnere, empfing ich bei meinen Großeltern, Isaac und Betsey Bailey. Beide waren schon alt, und hatten seit langer Zeit auf demselben Fleck gewohnt. Sie wurden in der Nachbarschaft als alte Einwohner betrachtet, und aus verschiedenen Umständen entnehme ich, dass besonders meine Großmutter in weit höherer Achtung stand, als das Los der Farbigen in den Sklavenstaaten es gewöhnlich mit sich bringt. Sie war eine vortreffliche Krankenpflegerin und besaß besondere Geschicklichkeit im Verfertigen von Netzen für den Shad- und Heringsfang, die sowohl in Tuckahoe, als in den benachbarten Dörfern Denton und Hillsboro in großer Nachfrage standen. Sie machte indessen nicht nur Netze, sondern genoss selbst einigen Rufes wegen ihres Glücks beim Fang dieser Fische. Ich habe sie mitunter halbe Tage im Wasser zubringen sehen. Die Großmutter war ebenfalls in der Erhaltung der Saatpflanzen der süßen Kartoffeln umsichtiger als die meisten ihrer Nachbaren, und stand, gleich allen sorgsamen und vorsichtigen Menschen, die inmitten einer unwissenden und nachlässigen Umgebung leben, in dem Ruf, dass sie mit "gutem Glück" geboren sei. Ihr "gutes Glück" lag indessen nur in der großen Sorgfalt, mit der sie die saftige Wurzel beim Graben vor jeder Verletzung bewahrte und vor dem Frost schütte, indem sie sie während des Winters in ihrer Hütte unter dem Herd vergrub. Während der Zeit, dass die süßen Kartoffeln gesetzt wurden, schickte man von allen Seiten nach "Großmutter Betty", wie man sie vertraulich nannte, um die Kartoffeln zu sehen; denn der Aberglaube behauptete, dass sie sicher wachsen und gedeihen würden, wenn Großmutter Betty sie beim Pflanzen nur berührt hätte". Dieser Ruf gereichte ihr und den Kindern, die sie bei sich hatte, zu großem Vorteil. Wenngleich Tuckahoe nur wenig von dem Reichtum der Erde besaß, erhielt doch die Großmutter von dem, welchen es hatte, ihren vollen Anteil in Geschenken. Wenn die Kartoffeln, die sie gesetzt hatte, eine reiche Ernte lieferten, wurde sie nicht von Denjenigen vergessen, für die sie pflanzte, und was sie erhielt, kam auch den hungrigen Kleinen zugute, die sie umgaben.
Die Wohnung meiner Großeltern war anspruchslos genug. Es war ein Blockhaus, oder eine Hütte, aus Lehm, Holz und Stroh erbaut. Aus der Entfernung glich sie, obgleich sie viel kleiner, viel weniger bequem und massiv war, den Hütten, welche die ersten Ansiedler in den westlichen Staaten zu errichten pflegen. Meinem Kinderauge erschien sie jedoch als ein großartiges Gebäude, das hinsichtlich seiner Wohnlichkeit und seiner Vorzüge allen Ansprüchen der Bewohner vollkommen genügte. Ein paar ungehobelte virginische Zaunplanken, die lose über die oberen Balken geworfen waren, dienten als Fußboden, Decke und Bettstellen einem dreifachen Zweck. Freilich konnte man zu diesem oberen Gemach nur vermittelst einer Leiter gelangen, aber was auf der Welt konnte schöner zum Klettern sein, als eine Leiter? Für mich war diese Leiter in der Tat eine herrliche Einrichtung; es lag eine Art Zauber darin, und mit wahrer Wonne pflegte ich auf ihren Sprossen zu spielen. In dieser kleinen Hütte, lebten viele Kinder; wie viele, weiß ich nicht. Meine Großmutter genoss, vielleicht weil sie zu alt für die Feldarbeit war, oder weil sie in früherer Zeit ihre Pflichten so treulich erfüllt hatte, das hohe Vorrecht, in einer eigenen Hütte, getrennt von dem Sklavenquartier zu leben, ohne andere Obliegenheiten als die Sorge für ihren Unterhalt und die nötige Aufsicht über die kleinen Kinder. Sie betrachtete dies augenscheinlich als ein großes Glück. Die Kinder waren nicht ihre eigenen, sondern ihre Enkel, die Kinder ihrer Töchter, und es gewährte ihr großes Vergnügen, sie um sich zu haben und für ihre geringen Bedürfnisse zu sorgen. Der Gebrauch, die Kinder von ihren Müttern zu trennen, und die letzteren in solcher Entfernung zu vermieten, dass sie dieselben nur in großen Zwischenräumen sehen können, ist ein charakteristischer Zug der Grausamkeit und Barbarei des Sklavereisystems, allein er stimmt mit dem großen Ziel der Sklaverei überein, welches immer und überall darin besteht, den Menschen auf eine Stufe mit dem Tier herabzuwürdigen. Es ist dies ein sicheres Verfahren, um in dem Geist und Herzen des Sklaven jeden Begriff von der Heiligkeit der Familie zu vernichten.
Hier gehörten indessen die meisten der Kinder den Töchtern meiner Großmutter, und hatten daher mehr Gelegenheit, den Begriff der Familie und deren Wohltaten und gegenseitige Pflichten kennen zu lernen, als wenn sie, wie es oft geschieht, der Aufsicht Fremder übergeben werden, die sich nicht weiter um sie kümmern, als der Willen des Herrn verlangt. Meine Großmutter hatte fünf Töchter, welche Jenny, Esther, Milly, Priscilla und Harriet hießen. Die letztere war meine Mutter, von welcher der Leser bald mehr erfahren wird.
Indem ich auf diese Weise bei meinen lieben alten Großeltern lebte, dauerte es lang, ehe ich erfuhr, dass ich ein Sklave war. Ich wusste viele andere Dinge, ehe ich dies wusste. Die Großmutter und der Großvater waren für mich die vornehmsten Leute auf der Welt, und da ich so behaglich mit ihnen in ihrer eigenen kleinen Hütte lebte ––^ich setzte voraus, dass sie ihnen gehörte –– und keine höhere Macht über mir und den anderen Kindern kannte als die der Großmama, gab es eine Zeitlang nichts, das mich hätte beunruhigen können. Als ich indessen größer und älter wurde, erfuhr ich nach und nach die traurige Tatsache, dass die kleine Hütte und der Boden, auf dem sie stand, nicht meinen lieben alten Großeltern, sondern einem Manne gehörte, der weit entfernt wohnte, und von der Großmutter der alte Herr" genannt wurde. Ich erfuhr ferner die noch traurigere Tatsache, dass nicht nur das Haus und der Boden, sondern auch die Großmutter selbst (der Großvater war frei) und alle die kleinen Kinder, die sie bei sich hatte, derselben geheimnisvollen Persönlichkeit gehörten, welche die Großmutter mit allen Zeichen der Ehrerbietung den "alten Herrn nannte. So trübten Wolken und Schatten früh zeitig meinen Pfad. Einmal auf der Spur –– Sorgen kommen niemals einzeln –– währte es nicht lang, bis ich noch eine andere Tatsache ausfindig machte, die meinem kindischen Herzen noch schmerzlicher war. Es wurde mir nämlich gesagt, dass dieser "alte Herr", dessen Namen stets mit Angst und Schauer genannt zu werden schien, den Kindern nur bis zu einer bestimmten Zeit gestattete, bei der Großmutter zu bleiben, und dieselben, sobald sie groß genug seien, sogleich fortgenommen würden, um bei dem "alten Herrn" zu leben. Das waren in der Tat trostlose Eröffnungen, und obgleich ich noch zu jung war, um das volle Gewicht dieser Mitteilung zu begreifen, und den größten Teil jener Kinderzeit in vergnügten Spielen mit den anderen Kindern zubrachte, so lag doch ein Schatten von Unruhe auf mir.
Die unumschränkte Macht jenes entfernten "alten Herrn hatte meinen jugendlichen Geist erst mit der Spitze ihres kalten grausamen Eisens berührt, und mir ein Etwas zurückgelassen, dem ich nach dem Spiel und in Augenblicken der Ruhe nachgrübelte. Die Großmama war zu jener Zeit in der Tat meine ganze Welt, und der Gedanke, von ihr getrennt zu werden, war mehr als ein unwillkommener Eindringling, er war unerträglich.
Kinder haben ihren Kummer, so gut als Erwachsene, und in unserm Verhalten gegen sie sollten wir dessen eingedenk sein. Sklavenkinder sind Kinder wie andere, und machen keine Ausnahme. Der Gedanke, von meiner Großmutter getrennt zu werden und sie selten oder nie wiederzusehen, verfolgte mich unaufhörlich. Ich schauderte bei der Vorstellung, dass ich bei jenem geheimnisvollen "alten Herrn" leben sollte, dessen ich nie mit Liebe, sondern nur mit Furcht erwähnen hörte. Ich blicke auf diese Angst als auf eine der schwersten Sorgen meiner Kinderjahre zurück. Meine Großmutter! meine Großmutter und der vergnügte Kreis unter ihrer Pflege; vorzüglich aber sie selbst, über deren Fortgehen wir so traurig waren, wenn sie uns nur auf eine Stunde verließ, als wir uns ihres Wiederkommens freuten. Wie sollte ich es ertragen, sie und die teure gewohnte Häuslichkeit zu verlassen!
Allein wie in späterem Alter die Freuden, so sind in der Kindheit die Sorgen nur vorübergehend. Selbst die Sklaverei ist nicht fähig, das Herz des Kindes auf einmal mit unauslöschlichem Kummer zu erfüllen, und Alles erwogen, ist zuletzt wenig Unterschied zwischen dem Maß von Zufriedenheit, welches das vernachlässigte Sklavenfind empfindet, und dem des wohlgepflegten und verzogenen Kindes des Sklavenhalters. Es waltet in dieser Beziehung eine Art Gerechtigkeit zu Gunsten der Jugend.
Der Sklavenhalter hat von der ohnmächtigen Kindheit nichts zu fürchten, und fühlt sich daher nicht zu grausamen Strafen veranlasst, und wenn Kälte und Hunger nicht an dem zarten Körper nagen, so ist das Leben des Sklavenjungen während der ersten sieben bis acht Jahre vollkommen so genussreich, als das des bevorzugtesten weißen Kindes, während er vielen Widerwärtigkeiten entgeht, die seinen weißen Bruder quälen. Er hat nur selten Vorlesungen über anständiges Betragen und ähnliche Dinge anzuhören. Er kann nicht ausgescholten werden, weil er Messer und Gabel ungehörig und ungeschickt gebraucht hat, denn er benutzt nichts dergleichen. Es wird ihm nicht verwiesen, dass er das Tischtuch begossen habe, denn er verzehrt sein Mahl auf dem Lehmboden. Er hat bei seinen Spielen nie das Unglück, seine Kleider zu zerreißen oder zu beschmutzen, denn er besitzt fast nichts, das zerrissen oder beschmutzt werden könnte. Man verlangt von ihm nie, dass er sich wie ein artiger kleiner Herr betragen solle, denn er ist nur ein roher kleiner Sklave. Solchergestalt, von jedem Zwang frei, kann der Sklavenjunge in Lebensweise und Betragen ein echter Knabe sein und Alles tun, was seine knabenhaften Neigungen ihm eingeben, alle Sprünge und Streiche der Pferde, Hunde, Ferkel und des Geflügels auf dem Hühnerhof ausführen, ohne seiner Würde zu vergeben, oder sich einen Verweis zuzuziehen. Er läuft buchstäblich wild herum, braucht weder in der Kinderstube niedliche Verse zu lernen noch artige Anreden an Tanten, Onkel und Vettern zu halten, um zu zeigen, wie gescheut er ist, und wenn er sich nur vor den Fußtritten und Fäusten der größeren Sklavenjungen zu hüten weiß, so kann er sich in seinen muntern ausgelassenen Streichen vollkommen so glücklich ergehen, als irgendein kleiner Heide unter den Palmen Afrikas. Freilich, wenn er seinem Herrn in den Weg stolpert –– und dies lernt er frühzeitig vermeiden –– so wird er gelegentlich erinnert, dass er sich in seiner goldenen Zeit befindet und bald etwas Anderes kennen lernen wird. Die Drohung ist bald vergessen; der Schatten zieht rasch vorüber, und unser schwarzer Junge fährt in vollkommener Freiheit fort, sich nach Herzenslust im Sand zu wälzen oder im Schmutz zu spielen. Wenn Schmutz und Staub ihm lästig werden, so ist das Wasser nicht weit; er kann sich in den Fluss oder Teich tauchen, ohne erst die Weitläufigkeit des Entkleidens durchzumachen, oder Furcht zu hegen, seine Kleider nass zu machen; sein sackleinenes Hemd –– denn mehr hat er nicht an –– ist leicht getrocknet, und bedurfte der Wäsche nicht weniger als seine eigene Haut. Seine Nahrung ist von der geringsten Art, und besteht größtenteils aus Welschkornbrei, der oft in einer Austerschale den Weg von der hölzernen Schüssel zu seinem Munde findet. Wenn das Wetter gut ist, bringt er den Tag in der freien Luft und im Sonnenschein zu. Er schläft immer in luftigen Zimmern, und braucht keine Pulver und mit Zucker überzogenen Pillen zu nehmen, um sein Blut zu reinigen oder seinen Hunger zu vermehren. Er erhält weder Konfekt noch Bonbons, hat immer guten Appetit, weint nur selten, da Niemand darnach fragt, und lernt die Beulen, welche er erhält, geringachten, weil Andere sie für nichts ansehen. Mit einem Wort, während der ersten acht Jahre seines Lebens ist er gewöhnlich ein lebendiger, munterer, ausgelassener und glücklicher Junge, auf welchen Widerwärtigkeiten nicht schwerer fallen als Wasser auf den Rücken einer Ente; und solch ein Junge war, soweit ich mich erinnern kann, Derjenige, dessen Leben in der Sklaverei ich jetzt erzähle.
Zweites Kapitel.Das Verlassen der ersten Heimat.
Jenes geheimnisvolle Individuum, dessen ich unter dem ominösen Namen des "alten Herrn" als eines Gegenstandes des Schreckens für die Bewohner unserer kleinen Hütte erwähnte, war wirklich ein Mann von einiger Bedeutung. Er besaß verschiedene Farmen in Tuckahoe, war der Hauptsekretär und Verwalter auf der Hauspflanzung des Obersten Edward Lloyd, hielt auf seinen eigenen Farmen Aufseher, und führte die Aufsicht über Diejenigen, welche in Oberst Lloyds Diensten standen. Diese Pflanzung liegt am Wye, dessen Namen ohne Zweifel von Wales kommt, von woher die Lloyds stammen. Diese, eine alte und in Maryland geachtete Familie, sind sehr reich. Die Hauspflanzung, auf der sie wohl ein Jahrhundert und darüber gewohnt haben, ist eine der größten, fruchtbarsten und wohlgeordnetsten des Staates.
Der Leser kann sich vorstellen, dass ich im höchsten Grad neugierig auf Alles war, was sich über diese Pflanzung und jenen seltsamen alten Herrn in Erfahrung bringen ließ, welcher mehr als ein Mensch, und schlechter als ein Engel sein musste. Unglücklicherweise trug Alles, was ich erfuhr, nur dazu bei, die Angst zu vermehren, welche ich vor der Vorstellung hegte, dorthin geschickt zu werden und, von meinen Großeltern getrennt und ihres Schutzes beraubt, dort leben zu müssen. Oberst Lloyds Pflanzung war gewiss ein höchst merkwürdiger Ort, und ich war nicht ohne einige Neugier, sie kennen zu lernen, aber nichts auf der Welt hätte mich zu dem Wunsch vermögen können, dort zu bleiben. So groß war meine Scheu, die kleine Hütte zu verlassen, dass ich ewig klein zu bleiben wünschte, denn ich wusste, je größer ich wurde, um so kürzer mein Bleiben. Die alte Hütte mit ihrem Bretterboden und ihren Lattenbettstellen im oberen Stockwerk, ihrem Fußboden und Kamin aus Lehm zu ebener Erde, ihren fensterlosen Seitenwänden, und vor allem jenem höchst merkwürdigen Meisterwerk, der Leiter, und dem sonderbar ausgegrabenen Loch vor dem Herd, in dem die Großmama die süßen Kartoffeln vor dem Frost schützte, sie war meine Heimat –– die einzige Heimat, welche ich jemals hatte, und ich liebte sie und Alles, was damit zusammenhing. Die alten Zäune, welche sie umgaben, die Baumstümpfe in der Nähe, am Rande des Waldes, und die Eichhörnchen, die darauf herumliefen, sprangen und hüpften, waren Gegenstände des Interesses und der Zuneigung. Dort, dicht neben der Hütte stand auch der alte Brunnen mit seinem ansehnlichen emporgerichteten Ballen, der so geschickt zwischen die Äste eines abgehauenen Baumes gelegt war, und ein so richtiges Gleichgewicht hatte, dass ich ihn mit einer Hand auf und nieder bewegen und mir einen Trunk Wasser holen konnte, ohne erst Hilfe zu fordern. Wo sonst in der Welt gab es noch solch einen Brunnen und solch ein Haus? Und doch waren dies noch nicht alle Anziehungspunkte dieses Ortes. Unten, in einem kleinen Tal, nicht weit von Großmamas Hütte, stand Herrn Lees Mühle, wohin die Leute oft in großer Anzahl kamen, um ihr Korn mahlen zu lassen. Es war eine Wassermühle, und es wäre mir unmöglich, Alles wiederzuerzählen, was ich dachte und fühlte, während ich am Ufer saß und die Mühle betrachtete und dem Drehen des großen Rades zusah. Der Mühlteich hatte ebenfalls seinen Reiz, und wenn ich auch mit meinem Stecknadelhaken und meiner Zwirnsfadenleine keine Fische fangen konnte, so bissen sie doch wenigstens an. Allein bei allen meinen Spielen und Vergnügungen und ihnen zum Trotz schlich sich immer dann und wann das schmerzliche Vorgefühl ein, dass hier nicht mehr lang meines Bleibens sei, und der alte Herr mich bald rufen lassen würde.
Ich war ein Sklave, ein geborener Sklave, und obgleich diese Tatsache mir unverständlich war, teilte sich mir dadurch doch der Begriff meiner gänzlichen Abhängigkeit von dem Willen eines "Jemand" mit, den ich nie gesehen hatte, und aus einer und der anderen Ursache fürchtete ich diesen Jemand mehr als irgendetwas auf der Welt. Zum Vorteil eines Andern geboren, sollte ich bald als der Erstling der Herde ausgewählt und jenem schrecklichen und unerbittlichen Halbgott zum Opfer gebracht werden, dessen riesiges Bild mich in meinen kindischen Phantasten so oft verfolgt hatte. Als über den Zeitpunkt meines Fortgehens entschieden war, hielt meine Großmutter, da sie meine Angst kannte, mir das gefürchtete Ereignis aus Mitleid gütig verborgen. Bis zu dem Morgen, an dem wir aufbrachen (einem schönen Sommermorgen) und selbst während der Reise, deren ich mich, ein Kind wie ich war, doch noch so deutlich erinnere, als wenn ich sie gestern gemacht hätte, ließ sie mich den traurigen Zweck nicht ahnen. Diese Zurückhaltung war nötig, denn hätte ich Alles gewusst, so würde ich es der Großmutter schwer gemacht haben, mich fortzubringen. Wie die Sachen standen, war ich hilflos, und sie — die gute Frau! –– führte mich an der Hand, indem sie mit der Zurückhaltung und Feierlichkeit einer Priesterin allen meinen fragenden Blicken bis zuletzt widerstand.
Die Entfernung von Tuckahoe bis nach Wye River, woselbst mein alter Herr wohnte, betrug volle zwölf Meilen, und der Weg dahin war eine harte Probe für meine Ausdauer. Die Reise würde zu anstrengend für mich gewesen sein, wenn meine liebe Großmama mir nicht gelegentlich zu Hilfe gekommen wäre, indem sie mich auf den Schultern trug. Die Großmutter, obgleich schon bejahrt, wie manches graue Haar bewies, das sich unter den breiten und graziösen Falten ihres frischgeglätteten ostindischen Turbans hervorstahl, war noch eine kräftige, rüstige Frau. Sie war auffallend gerade von Gestalt, elastisch und muskulös. Ich schien für sie kaum eine Last zu sein. Sie würde mich auch noch weitergetragen haben, hätte ich mich nicht schon zu sehr als Mann gefühlt, um dies zuzugeben, und deshalb darauf bestanden, zu gehen. Indem ich die Großmama der Mühe überhob, mich zu tragen, fühlte ich mich doch durchaus nicht unabhängig von ihr, als wir durch die finstern Wälder kamen, welche zwischen Tuckahoe und Wye River lagen. Sie fühlte dann oft, dass ich ihre Hand fester drückte und sie am Kleid festhielt, damit nicht etwas aus dem Walde herauskommen und mich fressen möchte. Einige alte Baumstämme und Stümpfe machten mir auch viel zu schaffen, da ich sie für wilde Tiere ansah. Ich sah ihre Beine, Augen und Ohren, oder vielmehr, ich sah etwas gleich Augen, Beinen und Ohren, bis ich nahe genug kam, um zu sehen, dass die Augen Knorren waren, die der Regen weiß gewaschen hatte, die Beine gebrochene Zweige und die Ohren nur Ohren von dem Punkt aus, von dem ich sie zuerst gesehen, wodurch ich frühzeitig begriff, dass es darauf ankommt, aus welchem Gesichtspunkt man eine Sache betrachtet.
Als der Tag vorrückte, nahm die Hitze zu, und erst am Nachmittag erreichten wir das gefürchtete Ziel unserer Reise. Ich sah mich in der Mitte einer Gruppe Kinder von allen Farben; schwarz, braun, kupferfarbig und fast ganz weiß. Ich hatte bis dahin noch nicht so viele Kinder beisammen gesehen. Auf verschiedenen Seiten erhoben sich hohe Gebäude, und in den Feldern waren viele Männer und Frauen an der Arbeit. Aller dieser Lärm, dies Treiben und Singen stach sehr gegen die Stille in Tuckahoe ab. Als ein neuer Ankömmling war ich der Gegenstand spezieller Neugier, und nachdem die Kinder lachend und schreiend um mich herumgesprungen waren und alle möglichen Ausgelassenheiten verübt hatten, forderten sie mich auf, hinauszukommen und mit ihnen zu spielen. Ich schlug dies aber ab, weil ich vorzog, bei der Großmama zu bleiben. Ich fühlte, dass unser Hiersein für mich nichts Gutes bedeutete, und auch die Großmama sah traurig aus. Sie sollte bald wieder einen Gegenstand ihrer Zuneigung verlieren, wie sie deren schon so viele verloren hatte. Ich sah, dass sie sich unglücklich fühlte, und der Schatten ging von ihrer Stirne auf die meinige über, ich wusste nicht warum.
Jede Ungewissheit muss indessen ihr Ende erreichen, und das der meinigen war nahe. Die Großmama streichelte mir liebevoll den Kopf, und indem sie mich ermahnte, ein guter Junge zu sein, befahl sie mir zu gehen und mit den Kindern zu spielen. "Sie sind mit dir verwandt," sagte sie, "geh' und spiel' mit ihnen."
Die Großmutter zeigte mir meinen Bruder Perry und meine Schwestern Sarah und Eliza, die sich unter den Andern befanden. Ich hatte weder meinen Bruder noch meine Schwestern zuvor gesehen, und obgleich ich zuweilen von ihnen gehört hatte und eine Art von neugierigem Interesse an ihnen nahm, begriff ich wirklich nicht, was sie mir waren, oder ich ihnen. Wir waren Brüder und Schwestern, aber was weiter? Warum sollten sie mir zugetan sein, oder ich ihnen? Wir waren Brüder und Schwestern durchs Blut, allein die Sklaverei hatte uns einander fremd gemacht. Ich hörte die Wörter: Bruder und Schwester, und wusste, dass sie etwas bedeuten mussten, aber die Sklaverei hatte diese Ausdrücke ihres wahren Sinnes beraubt. Die Erfahrung, welche ich jetzt machte, hatten sie schon früher gemacht. Sie waren schon in die Geheimnisse der Häuslichkeit des alten Herrn eingeweiht, und schienen mit einem gewissen Mitleid auf mich zu blicken; mein Herz hing indessen nur an meiner Großmutter. Halte es nicht für befremdlich, lieber Leser, dass zwischen uns so wenig Sympathie herrschte. Die Bedingungen der brüderlichen und schwesterlichen Gefühle fehlten; uns hatte nie ein Nest umfangen, und wir hatten nie zusammengespielt. Meine arme Mutter! gleich so vielen anderen Sklavinnen, hatte sie zwar viele Kinder, aber keine Familie! Der häusliche Herd mit seinen Lehren und allem, was ihn teuer macht, ist für die Sklavenmutter und ihre Kinder abgeschafft. "Kinder, liebt Euch einander," sind Worte, die man selten in einer Sklavenhütte hört.
Ich wünschte wirklich mit meinem Bruder und meinen Schwestern zu spielen, aber sie waren mir fremd, und außerdem war ich voll Angst, dass die Großmutter fortgehen möchte, ohne mich mitzunehmen. Da sie mich indessen auch dringend dazu aufforderte, ging ich in den hinteren Teil des Hauses, um mit ihnen und den anderen Kindern zu spielen. Ich tat dies indessen nicht, sondern stand an eine Wand gelehnt und sah ihnen zu. Endlich, während ich noch dort stand, kam eins der Kinder, das in der Küche gewesen war, auf mich zu gerannt, und rief mit einer gewissen schelmischen Freude aus: "Fed, Fed! Großmama fort! Großmama fort!" Ich konnte es noch nicht glauben; da ich aber das Schlimmste fürchtete, rannte ich in die Küche, um selbst zu sehen, und fand es nur zu wahr. Die Großmama war wirklich fortgegangen, und war jetzt schon weit weg, mir längst aus den Augen. Ich brauche nicht zu erzählen, was jetzt geschah. Das Herz brach mir fast bei dieser Entdeckung; ich sank auf den Boden, weinte die bittersten Tränen, die ein Kind vergießen kann, und lehnte jeden Trost ab. Mein Bruder und meine Schwestern umgaben mich und sagten: "wein' doch nicht!" ́indem sie mir Pfirsiche und Birnen gaben, allein ich schleuderte sie fort, indem ich alle ihre freundlichen Anerbietungen zurückwies. Ich war noch niemals zuvor getäuscht worden, und war deshalb nicht nur trostlos über die, wie ich voraussetzte, ewige Trennung von der Großmutter, sondern auch empört darüber, dass man mir in einer so ernsten Angelegenheit einen solchen Streich gespielt hatte.
Es war jetz spät am Nachmittag. Der Tag war aufregend und ermüdend gewesen, und obgleich ich mich des Wie und Wo nicht mehr erinnere, so vermute ich doch, dass ich mich selbst in Schlaf weinte. Die Fittiche des Schlafes üben ihre Heilkraft selbst auf den Sklavenjungen, und niemals war ihr Balsam irgendeinem verwundeten Herzen willkommener, als er dem meinen in jener ersten Nacht war, die ich in der Wohnung des alten Herrn zubrachte. Der Leser mag erstaunen, dass ich ein scheinbar unbedeutendes Ereignis, das sich zutrug als ich erst sieben Jahre alt war, so ausführlich erzähle; allein da ich eine treue Geschichte meiner Erfahrungen in der Sklaverei zu geben wünsche, kann ich ein Ereignis nicht umgehen, welches mich zu jener Zeit so tief ergriff. Außerdem war dies in Wahrheit meine erste Einführung in die Wirklichkeit der Sklaverei.
Drittes Kapitel. Herkunft.
Wenn der Leser mir jetzt Zeit gestatten will zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln, so werde ich ihm nach und nach Einiges aus dem Sklavenleben erzählen, wie ich es auf der Pflanzung des Obersten Edward Lloyd und in dem Hause des alten Herrn kennen lernte, in das ich mich jetzt gegen meinen Willen, plötzlich, obgleich nicht unerwartet, hineinversetzt sah. Inzwischen will ich meinem Versprechen nachkommen, noch Einiges über meine teure Mutter zu sagen.
Ich sage nichts über meinen Vater, denn er ist in ein Dunkel gehüllt, das ich nie zu durchdringen vermochte. Die Sklaverei schafft den Vater ab, wie sie die Familie abschafft. Die Sklaverei kann weder Väter noch Familien brauchen, und ihre Gesetze erkennen das Dasein derselben nicht in der sozialen Einrichtung der Pflanzung an. Wenn sie trotzdem existieren, so entspringen sie nicht aus dem Wesen der Sklaverei, welches ihnen feindlich ist. Die Ordnung der zivilisierten Welt ist hier umgestoßen. Man setzt nicht voraus, dass das Kind den Namen seines Vaters tragen müsse, und seine Stellung hat keinen notwendigen Einfluss auf die des Kindes. Er mag Herrn Tilgmans Sklave sein, und sein Kind mag als der Sklave des Herrn Groß geboren werden. Er mag ein freier Mann sein, und sein Kind trotzdem ein Eigentum." Er mag weiß sein, stolz auf die Reinheit seines anglo-sächsischen Blutes, und sein Kind mag auf einer Stufe mit den schwärzesten Sklaven stehen. Er kann in der Tat –– und ist es oft –– der Vater und der Herr desselben Kindes sein. Er kann Vater sein und sein Kind verkaufen, ohne sich darum einen Vorwurf zuzuziehen, wenn es das Kind einer Frau ist, in deren Adern nur der zweiunddreißigste Teil afrikanischen Blutes fließt. Mein Vater war ein Weißer, oder doch fast weiß. Mitunter flüsterte man sich zu, dass mein Herr mein Vater sei.
Doch um zu meiner Mutter zurückzukehren, oder vielmehr von ihr anzufangen! Meine Erinnerung in Betreff ihrer ist sehr spärlich, doch sehr deutlich. Ihre Erscheinung und Haltung sind meinem Gedächtnis unauslöschlich eingeprägt. Sie war groß und wohlgebaut, von tiefschwarzer glänzender Farbe, ihre Gesichtszüge waren regelmäßig, und sie zeichnete sich unter den übrigen Sklaven durch ein ungewöhnlich gesetztes Wesen aus. In, "Pritchards Natural History of Man" S. 157 befindet sich der Kopf einer Gestalt, dessen Züge denen meiner Mutter so ähnlich sind, dass ich ihn oft mit einem Gefühl betrachte, gleich dem, mit welchem Andere die Bilder teurer Verstorbener ansehen mögen.
Ich kann indessen nicht sagen, dass ich mit tiefer Zuneigung an meiner Mutter hing, sicher nicht mit so tiefer, als ich getan hätte, wenn unsere Beziehungen während meiner Kindheit von anderer Art gewesen wären. Wir wurden, wie es gebräuchlich ist, getrennt, als ich noch ein zu kleines Kind war, um sie als meine Mutter zu kennen.
Alle Keime der Zuneigung hatten sich in ihrem Wachstum nach jener liebevollen Großmutter gerichtet, deren gütige Fürsorge das Erste war, was ich mit meinem kindischen Begriffsvermögen verstehen und schätzen lernte. Die zärtlichste Zuneigung, welche ein gütiger Gott der Mutter als teilweise Entschädigung für alle Schmerzen gewährt, die ihr Herz durchdringen, war demnach in mir durch die neidische, gierige und verräterische Hand der Sklaverei von ihrem wahren natürlichen Gegenstand abgelenkt worden.
Die Sklavenmutter kann lang genug bei der Feldarbeit entbehrt werden, um die Leiden einer Mutter in ihrer ganzen Bitterkeit durchzumachen, wenn dem Verzeichnis des Herrn dadurch ein neuer Namen hinzugefügt wird; doch nicht lang genug, um von dem ersten bewussten Lächeln ihres Kindes die erfreuliche Belohnung zu ernten. Ich kann an dies schreckliche Eingreifen der Sklaverei in meine kindlichen Zuneigungen, welche dadurch von ihrem natürlichen Lauf abgeleitet wurden, nie ohne Gefühle denken, denen ich vergeblich den entsprechenden Ausdruck zu geben strebe.
Ich erinnere mich nicht, meine Mutter jemals bei der Großmutter gesehen zu haben. Ich kann mich ihrer nur bei Gelegenheit der Besuche erinnern, welche sie mir auf Oberst Lloyds Pflanzung und in der Küche meines alten Herrn machte. Ihre Besuche bei mir waren selten, kurz, und fanden größtenteils bei Nacht statt. Die Anstrengungen, die sie machte, und die Beschwerlichkeiten, welche sie ertrug, um mich zu sehen, sagen mir, dass sie das Herz einer wahren Mutter besaß, und dass die Sklaverei Hindernisse fand, dasselbe mit unmütterlicher Gleichgültigkeit zu erfüllen.
Meine Mutter war einem Herrn Stewart vermietet, der ungefähr zwölf Meilen von meinem alten Herrn entfernt wohnte, und da sie auf dem Feld arbeitete, hatte sie bei Tage selten Zeit zu dieser Reise. Die Nacht wie die Entfernung legten ihren Besuchen Hindernisse in den Weg. Sie war genötigt, den Weg zu Fuße zurückzulegen, wenn das Glück ihr nicht eine Gelegenheit zu fahren in den Weg führte, allein selbst dann musste sie immer wenigstens einmal gehen. Einer schwarzen Sklavenmutter ein Pferd oder Maultier zu gestatten, um darauf vierundzwanzig Meilen zu machen, während sie die Entfernung zu Fuß zurücklegen konnte, wäre ein größerer Luxus gewesen, als die Sklaverei erlauben kann. Es wird sogar als eine törichte Laune betrachtet, wenn eine Sklavenmutter das Verlangen kund gibt, ihre Kinder zu sehen, und aus einem Gesichtspunkt betrachtet, steht die Sache allerdings fest: sie kann nichts für sie tun. Sie hat keine Macht über sie; in Allem, was das Schicksal ihres Kindes betrifft, hat der Herr größere Gewalt als sie. Weshalb sollte sie sich deshalb Sorge darum machen? Sie hat ja keine Verantwortlichkeit! Dies ist das Räsonnement und die Praxis. Das eiserne Gesetz der Sklaverei, welches in jener Gegend immer mit Leidenschaftlichkeit und Heftigkeit durchgeführt wird, setzt Peitschenhiebe als Strafe für Diejenigen fest, welche versäumen, des Morgens vor Sonnenaufgang im Feld zu sein, es sei denn, dass der abwesende Sklave die spezielle Erlaubnis dazu erhalten hat. "Ich ging, mein Kind zu sehen", gilt weder in dem Ohr noch dem Herzen des Aufsehers als Entschuldigung.
Besonders lebhaft erinnere ich mich eines Besuchs meiner Mutter, während ich bei dem Obersten Lloyd war, da er mir den hellen Strahl der Liebe und Fürsorge einer Mutter gewährte.
Ich hatte an jenem Tage "Tante Kath" (aus Ehrfurcht "Tante" genannt), die Köchin im Haus des alten Herrn, erzürnt. Ich erinnere mich nicht mehr der Art meines Vergehens, denn meine Verbrechen waren dort jetzt zahlreich, obgleich sie hinsichtlich des Grades ihrer Strafwürdigkeit großenteils durch Tante Katys Laune bedingt wurden. Sie befolgte an jenem Tage ihre Lieblingsmethode, mich zu bestrafen, nämlich mir, nachdem das Frühstück vorüber war, den ganzen Tag nichts mehr zu essen zu geben. Während der ersten zwei Stunden nach dem Mittagessen hielt ich mich ziemlich gut aufrecht; allein, obgleich ich den Feind vortrefflich bestand und den Nachmittag hindurch tapfer kämpfte, wusste ich doch, dass ich erliegen müsste, wenn ich nicht bei Sonnenuntergang die gewohnte Verstärkung einer Schnitte Welschkornbrot erhielte. Sonnenuntergang kam, allein kein Brot, stattdessen aber die Drohung, welche Tante Kath mit einem finstern Gesicht begleitete, das mit dem schrecklichen Inhalt derselben vollkommen übereinstimmte, dass sie das Leben aus mir heraushungern wolle". Ihr Messer schwingend, schnitt sie den anderen Kindern große Stücke ab und legte dann das Brot weg, während sie ihre grausamen Absichten gegen mich ausstieß. Ich machte eine letzte Anstrengung, meine Würde gegen diese Enttäuschung zu behaupten, denn ich hatte erwartet, dass sie endlich erweicht sein würde; als ich aber die anderen Kinder alle mit vergnügten zufriedenen Gesichtern sah, konnte ich es nicht länger aushalten. Ich ging hinten zum Hause hinausund weinte nach Herzenslust. Als ich dies satt hatte, kehrte ich in die Küche zurück, setzte mich an's Feuer und grübelte über mein hartes Los nach. Während ich dort in der Ede saß, fiel mir ein Kolben Welschkorn auf einem oberen Børt der Küche in die Augen. Ich wartete die Gelegenheit ab, ergriff es, schälte einige Körner heraus und legte es wieder an seine Stelle. Die Körner, welche ich erbeutet hatte, legte ich in die heiße Asche, um sie zu rösten. Alles dies tat ich auf die Gefahr hin, harte Püffe dafür zu erhalten, denn Tante Katy konnte mich sowohl schlagen als hungern lassen. Mein Korn war bald fertig, und bei meinem nagenden Hunger lag mir auch nicht daran, ob die Körner ganz geröstet waren oder nicht. Begierig nahm ich sie heraus und legte sie in einem Häufchen vor mich auf meinen Stuhl. Gerade als ich anfing, mein trockenes Mahl zu verzehren, trat meine geliebte Mutter herein, und nun, lieber Leser, erfolgte ein Auftritt, der Mühe wert, dabei gegenwärtig zu sein, und der für mich so lehrreich als interessant war. Der freundlose hungrige Knabe sah sich in seiner höchsten Noth, als er nicht wagte, nach Hilfe auszusehen, in den starken schützenden Armen einer Mutter; einer Mutter, welche, da sie so viel Entschiedenheit in ihrem Wesen, als körperliche Kraft besaß, allen seinen Feinden mehr als gewachsen war. Ich werde nie den unbeschreiblichen Ausdruck ihres Gesichts vergessen, als ich ihr erzählte, dass ich seit dem Morgen nichts zu essen erhalten hätte, und dass Tante Katy sagte, sie wolle das Leben aus mir heraushungern". In ihrem Blick lag so viel Mitleid mit mir, als Zorn und Empörung gegen Tante Katy, und indem sie mir das Korn wegnahm und mir dafür einen großen Ingwerkuchen gab, hielt sie Tante Kath eine Vorlesung, welche diese nie vergaß. Sie drohte, dass sie sich meinethalben bei dem alten Herrn beklagen würde, denn dieser, obgleich manchmal selbst hart und grausam, billigte darum doch nicht die Gemeinheit, Ungerechtigkeit, Parteilichkeit und Tyrannei, welche Tante Kath in der Küche ausübte. An jenem Abend erfuhr ich, dass ich nicht nur ein Kind, sondern Jemandes Kind war. Der Kuchen, den meine Mutter mir gegeben, hatte die Form eines Herzens, mit einem dunkeln glacierten Kreis am Rand; für den Augenblick triumphierte ich und war glücklich, und fühlte mich auf dem Schoß meiner Mutter stolzer als ein König auf seinem Thron. Allein mein Triumph währte nicht lang. Ich sank bald in Schlaf und erwachte am Morgen nur, um zu finden, dass meine Mutter fort war und ich mich wieder in der Gewalt der schwarzen Virago befand, die in meines alten Herrn Küche herrschte, und deren Zorn mein beständiger Schrecken war.
Ich erinnere mich nicht, meine Mutter nach diesem Vorfall wiedergesehen zu haben. Der Tod endete bald die geringe Beziehung, welche zwischen uns stattgefunden hatte, und, nach ihrem abgespannten, traurigen und niedergeschlagenen Aussehen und ihrem stillen Wesen zu schließen, ein Leben voll tiefgefühlten Kummers. Es war mir weder gestattet, sie während ihrer langen Krankheit zu besuchen, noch sah ich sie in langer Zeit ehe sie krank wurde und starb. Die herzlose gespenstische Gestalt der Sklaverei erhebt sich selbst am Sterbebette zwischen Mutter und Kind. Die Mutter, am Rande des Grabes, kann ihre Kinder nicht um sich versammeln; sie lebt als Sklavin, um verlassen, wie ein Tier zu sterben, und oft wird ihr geringere Aufmerksamkeit gewidmet, als etwa einem Lieblingspferd. Mein ganzes Leben lang war es mein Kummer, dass ich so wenig über meine Mutter wusste und so frühzeitig von ihr getrennt wurde. Ihr Profil ist meinem Gedächtnis eingeprägt, und ich tue wenig entscheidende Schritte im Leben, ohne ihre Gegenwart zu fühlen; allein das Bild ist stumm, und ich habe kein bezeichnendes Wort von ihr bewahrt.
Nach dem Tode meiner Mutter erfuhr ich, dass sie Lesen konnte, und unter allen Sklaven und Farbigen in Tuckahoe die einzige war, welche sich dieses Vorzugs erfreute. Ich weiß nicht, wie sie sich diese Kenntnis angeeignet hatte, denn Tuckahoe ist der letzte Ort auf der Welt, in dem sie Gelegenheit zum Lernen hätte finden können. Mit Vergnügen und Stolz schreibe ich ihr daher eine tiefe Neigung zum Wissen zu. Es ist schon bemerkenswert, wenn eine Sklavin, die auf dem Felde arbeitet, in irgendwelchem Sklavenstaat lesen lernt, allein in meiner Mutter war diese Fähigkeit in Betracht des Ortes, an dem sie sie erlangt hatte, durchaus außergewöhnlich, und ich bin deshalb geneigt, alle Liebe für Literatur und Wissenschaft, die ich nur besitzen mag und die mir, trotz aller Vorurteile, nur zu hoch angerechnet wird, nicht meiner erwiesenen angelsächsischen Abstammung von väterlicher Seite, sondern der natürlichen Anlage meiner schwarzen, schutzlosen, ungebildeten Mutter zuzuschreiben, einer Frau, die einer Rasse angehörte, auf deren geistige Begabung man heutzutage nur mit Geringschätzung und Verachtung herabzublicken pflegt.
So frühzeitig als meine Mutter hinweggerafft wurde, während ihrer ganzen Krankheit durch den unüberschreitbaren Abgrund der Sklaverei von mir getrennt, starb sie, ohne mir die geringste Andeutung hinsichtlich meines Vaters zu hinterlassen. Es ging ein Gerücht, dass mein. Herr mein Vater wäre; doch war es nur ein Gerücht, dem ich eigentlich niemals Glauben schenkte. Ich habe in der Tat jetzt Gründe, zu vermuten, dass er es nicht war; allein die Tatsache steht nichtsdestoweniger in ihrer ganzen Abscheulichkeit fest, dass, den Gesetzen der Sklaverei gemäß, die Kinder in allen Fällen dem Stande der Mutter angehören. Diese Einrichtung erlaubt rohen Sklavenhaltern und ihren ausschweifenden Söhnen, Brüdern, Verwandten und Freunden die größte Ungebundenheit, und fügt zu dem Reiz des Lasters noch die Anlockung des Gewinns. Man könnte einen ganzen Band über diesen einzelnen Zug der Sklaverei fallen, wie ich ihn beobachtet habe.
Man könnte denken, dass die Kinder aus solchen Verhältnissen von ihrem Herrn besser als andere Sklaven behandelt würden; doch findet gerade das Gegenteil statt, und mit etwas Nachdenken wird man finden, dass es so sein muss. Einem Mann, der sein eigenes Blut in Sklaverei halten kann, lässt sich nicht viel Großmut zutrauen. Die Menschen lieben Diejenigen nicht, welche sie an ihre Sünden erinnern, es sei denn, dass sie zur Reue geneigt wären, und das Gesicht des Mulattenkindes ist eine fortdauernde Anklage gegen seinen Vater und Herrn. Noch schlimmer ist es vielleicht, dass dessen Frau unaufhörlich an einem solchen Kinde Anstoß nimmt. Sie hasst seine Gegenwart, und wenn eine Sklavenhalterin hasst, so braucht sie nicht erst nach Mitteln zu suchen, um diesem Hass Folge zu geben. Die Frauen –– ich meine die weißen Frauen –– sind im Süden Götzen, aber nicht Frauen, denn in vielen Fällen werden die Sklavinnen vorgezogen, und wenn diese Götzen nur nicken oder einen Finger erheben, dann wehe dem armen Opfer! Fußtritte, Stöße und Hiebe sind die sichere Folge. Die Herren sind oft genötigt, solche Sklaven aus Rücksicht für die Gefühle ihrer weißen Frauen zu verkaufen; und so anstößig und schändlich es auch scheint, wenn ein Mann sein eigenes Blut dem Menschenfleischhändler verkauft, so ist es doch häufig ein Act der Menschlichkeit gegen das Sklavenkind, welches dadurch seinen unbarmherzigen Quälern entzogen wird.
Es liegt nicht in dem Plane meiner einfachen Geschichte, jede Phase der Sklaverei außerhalb meiner eigenen Erfahrung zu beleuchten, indessen mag es mir gestattet sein, zu bemerken, dass, wenn der Bibel zufolge nur die direkten Nachkommen Hams in Sklaverei leben sollen, die Sklaverei in diesem Lande bald eine sehr unbiblische Institution sein wird, da jährlich Tausende geboren werden, welche, gleich mir, ihr Dasein weißen Vätern, und gewöhnlich ihren Herren oder deren Söhnen verdanken. Die Sklavin ist dem Vater, den Söhnen und Brüdern ihres Herrn preisgegeben. Das Übrige weiß man.
Nach dem, was ich über die Verhältnisse meiner Mutter und meine Beziehungen zu ihr gesagt habe, wird der Leser sich nicht wundern oder mich tadeln, wenn ich die einfache Wahrheit bekenne, dass ich bei der Nachricht ihres Todes weder tiefes Bedauern mit ihr noch großen Schmerz über ihren Verlust empfand. Ich lernte ihren Wert erst lang nach ihrem Tode schätzen, als ich die Hingebung anderer Mütter für ihre Kinder sah.
Es gibt auf der Erde keinen so zerstörenden Feind aller Familienbaude, als die Sklaverei. Sie hatte mir meine Brüder und Schwestern entfremdet, sie machte mir die Mutter, die mich geboren hatte, zur Mythe; sie hüllte meinen Vater in geheimnisvolles Dunkel und ließ mich ohne einen wahrnehmbaren Ursprung auf der Welt.
Meine Mutter starb, als ich nicht älter als acht bis neun Jahre alt sein konnte, auf einer der Farmen des alten Herrn in Tuckahoe, in der Nähe von Hillsborough. Ihr Grab ist, wie das Derjenigen, welche auf dem Meer sterben, weder durch einen Stein noch durch eine Tafel bezeichnet.
Viertes Kapitel. Allgemeine Übersicht der Sklavenpflanzung.
Man glaubt allgemein, dass die Sklaverei im Staat Maryland in der mildesten Form bestände, sich dort aller jener harten, schrecklichen Eigentümlichkeiten entäußert habe, welche das Sklavereisystem in den südlichen und südwestlichen Staaten der amerikanischen Union charakterisieren. Als Beweis für diese Meinung gilt die Nähe der freien Staaten und die vor dem moralischen, religiösen und menschlichen Gefühl ihrer Bewohner kloßgestellte Beschaffenheit der Sklaverei in Maryland.
Ich beabsichtige nicht, diese Behauptung zu widerlegen, s weit sie sich auf die Sklaverei in jenem Staat im Allgemeinen bezieht; vielmehr räume ich ein, dass sie bis zu diesem allgemeinen Punkt wohlbegründet ist. Die öffentliche Meinung setzt in der Tat der Grausamkeit und Barbarei der Herren, Aufseher und Sklaventreiber sichere Schranken, wo und wann sie sie nur erreichen kann; allein es gibt selbst im Staat Maryland abgesonderte entlegene Plätze, bis zu welchen selten ein Strahl der Öffentlichkeit dringt, wo die Sklaverei, in das ihr wahlverwandte mitternächtige Dunkel gehüllt, alle ihre bösartigen anstößigen Eigentümlichkeiten ungestraft entfaltet; dort ist es, wo die Unsittlichkeit keine Schande bringt, die Grausamkeit keinen Schauer erregt, und selbst der Mörder keine Bloßstellung fürchten muss.
Solch ein abgesonderter, finsterer, entlegener Ort ist die "Haus Pflanzung" des Obersten Edward Lloyd auf dem östlichen Ufer von Maryland. Sie liegt weit entfernt von allen großen Straßen, und weder Stadt noch Dorf befindet sich in der Nähe. In der ganzen Nachbarschaft gibt es kein öffentliches Gebäude oder Schulhaus. Ein Schulhaus wäre auch überflüssig, denn es gibt keine Kinder, welche in die Schule gehen könnten. Oberst Lloyds Kinder und Enkel wurden zu Hause von einem Hofmeister, Herrn Page, unterrichtet, einem langen, hagern, hochaufgeschossenen Mann, der im Laufe des Jahres nicht zwölf Worte mit den Sklaven sprach. Des Aufsehers Kinder gehen anderswo zur Schule und bringen deshalb kein fremdes gefährliches Element von außen, welches die natürliche Wirkung des Sklavereisystems im Orte stören könnte. Nicht einmal die Handwerker, unter denen auf anderen Pflanzungen gelegentlich ein ehrlicher und offener Ausbruch der Empörung über Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten stattfindet, die dort verübt werden, sind auf dieser Pflanzung Weiße. Ihre ganze Bevölkerung ist in drei Klassen eingeteilt: Sklavenhalter, Sklaven und Aufseher. Grobschmiede, Rademacher, Schuster, Weber und Küper, alle sind Sklaven. Nicht einmal dem Handel, egoistisch, hartherzig und bereitwillig, wie er immer ist, die Partei des Starken gegen den Schwachen, des Reichen gegen den Armen zu ergreifen, ist es gestattet, in diesen abgeschlossenen Bezirk einzudringen. Ich weiß nicht, ob es geschieht, um das Lautwerden ihrer Geheimnisse zu verhindern, aber gewiss ist, dass jedes Blatt und Körnchen des Ertrages dieser Pflanzung und der benachbarten Farmen Oberst Lloyds auf seinen eigenen Schiffen nach Baltimore geschickt wird; jeder Mann und jeder Junge an Bord, mit Ausnahme des Capitains, gehört ebenfalls ihm. Alles, was nach der Pflanzung gebracht wird, gelangt auf demselben Wege dahin. So ist selbst das flackernde unstete Licht des Handels, das mitunter einen zivilisierenden Einfluss übt, von diesem verbotenen Platz abgeschlossen.