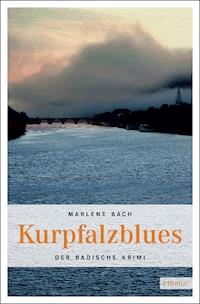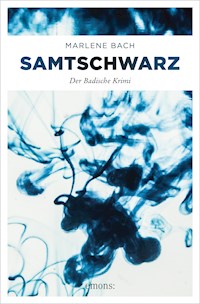Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einfühlsamer Liebesroman, eine außergewöhnliche Geschichte. Es sollte einer der schönsten Tage ihres Lebens sein, doch der Heiratsantrag ihres Freundes Deniz stürzt Franca in tiefe Zweifel. Als sie überraschend ein Haus am Niederrhein erbt, nutzt sie die Chance auf eine Auszeit, um in der ländlichen Ruhe Antworten zu finden. Doch ein Verbrechen hat die liebenswert-skurrile Dorfgemeinschaft in Aufruhr versetzt. Und auch Francas Leben droht aus den Fugen zu geraten: Sie begegnet dem attraktiven Lars, über den es dunkle Gerüchte gibt. Denn Lars ist so charmant wie verwirrend – und bewahrt ein besonderes Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Marlene Bach wurde 1961 in Rheydt geboren und wuchs nahe der niederländischen Grenze auf. 1997 zog die promovierte Psychologin nach Heidelberg, wo sie seit 2006 als Schriftstellerin tätig ist. Neben Kriminalromanen schreibt sie Kurzgeschichten, mit denen sie unter anderem den Walter-Kempowski-Literaturpreis gewann.
www.marlene-bach.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/jaroslava V
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-167-6
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Liebster Anton,
… Ich würde mir wünschen, Neeskamp wird so etwas wie ein Virus, das sich vermehrt. Aber eines, das Gutes bringt. Das uns wieder spüren lässt, dass füreinander da zu sein, Wohlwollen und Freundlichkeit allen besser tut als Egoismus.
Deine Rosa
1
Die Liebe ihres Lebens hatte dunkle Schatten unter den Augen und sah so herablassend in die Runde, dass Franca am liebsten aufgestanden und gegangen wäre. Es gab eine Zeit, da hatte sie seine Küsse auf ihrer Haut genossen und sich nach seinen Berührungen gesehnt. Sie hatte ihn so sehr geliebt, dass sie ihm bis ans Ende der Welt gefolgt wäre. Wenn er sich denn von seiner Frau getrennt hätte.
Was für ein Glück, dass er es nicht getan hatte.
Das Opfer für die heutige Dienstbesprechung war schon gefunden, eine der neuen Kolleginnen. Hemingway war nüchtern, so wie immer, wenn er in der Klinik auftauchte. Aber seinen Spitznamen hatte er nicht bekommen, weil er ein begnadeter Schriftsteller gewesen wäre. Es war allgemein bekannt, dass der Herr Oberarzt jeden Abend in einer anderen Kneipe versackte, genauso wie seine Vorliebe für Whiskey.
Lena, die Kollegin, die erst seit zwei Monaten in der Klinik arbeitete, lief schon rot an. Franca wusste aus ihrer eigenen Anfängerzeit nur zu gut, wie es sich anfühlte, vor dem Kollegium berichten zu müssen, unsicher, gestresst, mit dem Gefühl, dass der Arztkittel noch eine Nummer zu groß war.
»Wenn Sie etwas lauter sprechen würden, könnten wir Sie auch hören«, ätzte Hemingway.
»Wir haben im –«
»Wie bitte?«, rief er und legte demonstrativ die Hand hinter das Ohr.
»Wir haben im CT einen kreisförmigen Herd in –«
»Bitte, was?« Hemingway reckte den Kopf nach vorn, die Hand immer noch hinter dem Ohr.
»Ich sagte, wir ha–«
»Ach, Sie haben wirklich etwas gesagt? Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, draußen auf dem Gang hätte jemand etwas geflüstert.«
Franca sah, wie Lenas Augen anfingen zu glänzen. Wenn sie jetzt weinen würde, war das ihr Ende, dann würde Hemingway sie auf jeden Fall niedermachen.
»Es ist ein Zeichen des Respekts, so laut zu sprechen, dass andere hören können, was man sagt«, fuhr er sie an. »Wollen Sie mit diesem Piepsstimmchen einem Patienten mitteilen, wie er seine Medikamente einzunehmen hat? Glauben Sie wirklich, ein Achtzigjähriger würde irgendetwas von dem mitbekommen, was Sie sagen?«
»Ich … Ich werde mich bemühen …«
»Bemühen ist nicht nötig. Machen Sie einfach den Mund auf, wenn Sie reden. Das würde schon völlig reichen!«
Alle schauten betroffen nach unten. Niemand sagte etwas.
Wäre Franca nicht so müde gewesen, wäre es vielleicht nicht passiert. Aber die Energie, die sie gebraucht hätte, um den Mund zu halten, hatte sie nicht mehr. Zu viele Überstunden, zu viele Dienste. Wochen und Monate, in denen sie über ihre Kräfte hinaus gearbeitet hatte. Alles für die Klinik. Und damit auch für diesen Tyrannen, der andere schikanierte, wann immer er konnte. Wie hatte sie sich in einem Menschen nur so irren können? Die Wörter bahnten sich ihren Weg und entwichen ihr, unzensiert wie ein Seufzer.
»Du versoffenes Wrack.«
Alle Köpfe drehten sich zu ihr. Hatte sie das wirklich laut gesagt? Doch das Entsetzen hing in der Luft, als hätte sie gerade die nächste Pandemie verkündet. Die Blicke wanderten zwischen Hemingway und ihr hin und her. Die Kollegen warteten darauf, dass der Wolf sich auf sie stürzte und in Stücke riss.
Franca aber konnte in Hemingways Augen sehen, wie sehr sie ihn getroffen hatte. Damit hatte er nicht gerechnet, vor allem nicht von ihr.
»Frau Sallner, möchten Sie Ihren Kommentar noch einmal wiederholen? Anscheinend sind auch Sie der Flüsterfraktion beigetreten.«
Das »versoffene Wrack« tat so, als hätte er sie nicht verstanden. Er ließ ihr ein Mauseloch, aus dem sie entkommen konnte.
»Nun, da Frau Sallner nicht nur der Flüsterfraktion beigetreten, sondern gleich ganz verstummt ist, fahren wir fort. Also, wiederholen Sie den Befund«, forderte Hemingway die Kollegin auf. »Und zwar so laut, dass alle davon etwas mitbekommen.«
Nachdem sich die Runde aufgelöst hatte, ging Franca auf ihre Station und begann, den üblichen Berg abzuarbeiten: Visite, Berichte, Telefonate. In der ersten Stunde wartete sie noch darauf, dass Hemingway sie rufen ließ und ihr mitteilte, dass er für ihre Entlassung sorgen würde. Nichts geschah. Sollte sie zu ihm gehen und sich entschuldigen? Aber wofür? Weil sie die Wahrheit gesagt hatte?
Einige der Kollegen schauten vorbei, manche bewundernd, manche voller Sorge, was nun mit ihr geschehen würde. Franca war auch nur ein Rad im Klinikbetrieb, aber ein wichtiges, weil sie immer ein offenes Ohr hatte und da war, wenn jemand gebraucht wurde. Die meisten Mitarbeiter hätten liebend gern auf Hemingway verzichtet, aber sicher nicht auf Franca. Doch es geschah nichts, und Franca versuchte, die Gedanken an den Eklat beiseitezuschieben.
Wie üblich hastete sie durch den Tag. Die Zeiger der kleinen Uhr auf ihrem Schreibtisch rückten unerbittlich vorwärts, während in ihrem Kopf hin- und herraste, was noch zu erledigen war, so rasch wie der Schnellzug zwischen Beijing und Schanghai. Die Arbeit passte einfach nicht in die wenigen Stunden hinein.
Aber das war es nicht allein. In den letzten Wochen schien ihr alles mühsamer geworden zu sein. Sie brauchte immer länger, selbst für Dinge, die längst Routine waren, und wenn sie innehielt, fiel die Müdigkeit über sie her, als hätte sie nur auf den Moment gelauert, in dem Franca endlich einmal zur Ruhe kam. Dann musste sie gegen den Drang ankämpfen, einfach den Kopf auf den Schreibtisch zu legen und die Augen zu schließen. Deshalb trank sie Kaffee, so viel und so schwarz, dass er bitter schmeckte und ihr Herz raste.
Franca sah das Display ihres Handys aufleuchten, das auf dem Tisch lag. Eine Nachricht von Deniz. Doch bevor sie sie lesen konnte, klopfte es an der Tür. Pfleger Max bat sie, nach einer Patientin zu sehen.
Als Franca am Abend einen Bericht diktierte und dabei zum dritten Mal den Faden verlor, gab sie auf. Sie fuhr den Computer runter und zog ihren Mantel an. Wie üblich war sie eine der Letzten.
Im Flur stand die Tür zu Hemingways Büro offen. Franca musste dort lang, um zum Aufzug zu kommen. Sie hätte einfach vorbeigehen können, den Blick geradeaus gerichtet. Aber sie schaute hinein, sie konnte nicht anders. Er saß hinter seinem Schreibtisch und hatte wohl ihre Schritte auf dem Gang gehört, denn er hob den Kopf. Sein Gesicht war aschfahl, um seinen Mund lag ein verächtlicher Zug.
Sie sollte sich doch entschuldigen. Was sie getan hatte, war unmöglich, egal wie er sich aufgeführt hatte. Sie musste sich ja nicht so verhalten wie er.
»Das heute Morgen«, begann sie, »es –«
Aber er ließ sie nicht ausreden.
»Noch ein Mal, nur noch ein Mal etwas in der Art«, unterbrach er sie mit heiserer Stimme, »und ich mache dich fertig.«
Da drehte sie sich wortlos um und ging.
Die große Liebe. Was für ein Irrtum.
Hemingways Drohung fuhr mit ihr nach Hause. Was konnte er ihr anhaben? Sie bloßstellen, weil sie Fehler machte? Im Moment wäre sie ein leichtes Opfer für ihn. Er würde bestimmt etwas finden, das er gegen sie verwenden konnte. Oder sie würde wieder einmal den Mund nicht halten können. Ungerechtigkeit hatte sie schon immer rebellisch werden lassen. Aber jetzt war Freitagabend, und sie hatte am Wochenende ausnahmsweise einmal keinen Dienst. Vor ihr lagen ganze zwei Tage ohne Hemingway. Hoffentlich Zeit genug, um sich so weit zu erholen, dass sie ihn am Montag wieder ertragen konnte.
Die Suche nach einem Parkplatz in der Nähe ihrer Wohnung wurde wie jeden Abend zum Desaster. Es dauerte ewig, bis sie endlich das Auto abgestellt hatte und auf das Haus zuging, in dem sie schon seit ihrem Studium wohnte. Sie lebte gern in Heidelberg, in dem hohen alten Haus mit der üppigen Verzierung an der Fassade, auch wenn ihre Wohnung im fünften Stock lag.
Die Holzstufen ächzten unter ihren Füßen, als wüssten sie, wie anstrengend ihr Tag gewesen war. Ihre Beine waren bleischwer und mindestens so müde wie ihr Kopf, und die Treppe schraubte sich schier endlos in die Höhe. Ab dem zweiten Stock flimmerte es vor Francas Augen. Im vierten blieb sie stehen und lehnte sich an die Wand, holte kurz Luft, bis sie wieder etwas sehen konnte. Sie war am Ende. Fertig. Wollte nicht mehr denken, nicht mehr reden, sondern nur noch ins Bett und diesen Tag vergessen. Doch als sie ihre Wohnungstür aufzog, sah sie Deniz’ Jacke an der Garderobe hängen. Seine geliebte alte Lederjacke, die an den Ärmeln schon abgestoßen war.
Im Wohnzimmer lief der Fernseher. Deniz hatte seine eigene Wohnung, aber oft kam er nach seiner Arbeit bei der Kripo zu ihr. Er lag schlafend auf dem Sofa, dabei ragten seine Füße über die Seitenlehne hinaus. Ein eins neunzig großer Mann passte nicht auf dieses Sofa, aber Franca hatte es gekauft, lange bevor sie ihn kennengelernt hatte. Noch zusammen mit Sophie, ein Grund, warum sie sich nicht davon trennen konnte.
Vor der Couch standen Deniz’ Schuhe. Keine Turnschuhe, wie er sie sonst immer trug, sondern seine schwarzen Lederschuhe. Größe 48. Kleine U-Boote. Wenn Deniz solche Schuhe anhatte, war etwas Besonderes los in seinem Leben. Irgendeine Feierlichkeit, ein hochoffizieller Termin oder die Beerdigung einer Tante. Hatte sie etwas nicht mitbekommen?
Franca ließ ihn schlafen und ging in die Küche, um zu sehen, was noch im Kühlschrank war. Auch hier brannte Licht, und es roch verführerisch nach gebratenen Zwiebeln und Speck. Auf dem Herd standen mehrere Töpfe, und der Tisch unter dem Dachfenster war gedeckt. Zwei Teller, Besteck, sogar Servietten. Neben einem der Teller lag eine kleine Schachtel.
Ihr Herz begann so heftig zu schlagen, dass sie es bis in den Hals hinein spüren konnte. Was für ein Tag war heute? Es war März, der wievielte März? Sie wusste es genau, sie hatte das Datum in der Klinik zigmal geschrieben und doch vergessen, dass es nicht irgendein Tag war. Es war der vierundzwanzigste! Franca nahm die Schachtel und klappte sie auf. Der schmale goldene Ring, der darin lag, hatte einen kleinen Stein, glitzernd wie ein Stern, der vom Himmel gefallen war.
»Und, gefällt er dir?«
Erschrocken drehte sie sich um. Deniz stand in der Tür, in Jeans, T-Shirt und mit kleinen Knitterfalten im Gesicht, die das Sofakissen darauf hinterlassen hatte.
Sie hatte ihren Jahrestag vergessen. Ihren dritten Kennenlerntag. Sie hatte auch vergessen, dass Deniz vorbeikommen und etwas für sie kochen wollte. Es war in der Lawine von Patienten und Berichten untergegangen. Genauso wie seine Nachricht auf ihrem Handy.
»Es tut mir so leid, Deniz. Ich habe es total vergessen. Das war so ein Scheißtag heute. Ich hatte Ärger mit dem Chef, zwei Kolleginnen sind krank und …«
»Schon gut.« Er kam auf sie zu und strich ihr mit einer zärtlichen Geste eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Franca hätte nichts lieber getan, als sich an ihn zu lehnen und einfach nur die Augen zu schließen. Wohlbehütet in seinen Armen zu schlafen, bis die bleierne Müdigkeit endlich verschwunden war. Doch Deniz schaute sie erwartungsvoll an.
»Und, was sagst du?«
»Er ist wirklich sehr schön. Wunderschön.«
»Wir kennen uns heute drei Jahre, Franca. Und es waren drei tolle Jahre. Wir passen so gut zueinander. Ich finde, wir sollten mehr daraus machen.«
Deniz hatte den ganzen Abend gewartet, jetzt wartete er nicht mehr.
»Ich schlage vor, wir suchen uns eine Wohnung, in der es ein Kinderzimmer gibt. Wir beide gehören zusammen. Das spürst du doch auch, oder? Willst du mich heiraten, Franca?«
Sie hatten einmal übers Heiraten gesprochen, aber das war schon eine Weile her. Über gemeinsame Kinder. Sie waren sich einig gewesen. Theoretisch. In einer fernen Zukunft.
Sie hatte sich schon einmal geirrt, so gründlich, dass sie sich heute selbst nicht mehr verstand. Hemingway hätte sie damals sofort geheiratet. Dann wäre sie jetzt mit einem versoffenen bösartigen Wrack zusammen. Oder schon wieder geschieden.
»Ich …« Das Flimmern vor ihren Augen kehrte zurück. Franca musste sich auf einen der Stühle setzen, weil sie Angst hatte, ihre Beine könnten versagen. »Das kommt jetzt sehr plötzlich.«
Das Einzige, was sie spürte, war ein Druck in der Brust, als würde sich ein eiserner Ring darum spannen, der sich immer mehr zuzog. Er nahm ihr fast die Luft zum Atmen.
»Ich weiß das zu schätzen, Deniz. Wirklich.« Sie stellte das Kästchen zurück auf den Tisch. »Aber ich kann das jetzt nicht entscheiden.«
»Ach«, sagte Deniz. Ein einziges kleines Wort, in dem so viel Enttäuschung lag. »Und was denkst du, wann kannst du das entscheiden?«
»Ich weiß nicht … Jetzt geht es einfach nicht.« Im Moment konnte sie gar nichts mehr entscheiden. »Lass mir einfach etwas Zeit, okay? Ich bin so fertig, ich kann nicht mehr. Ich brauche nur ein bisschen Zeit zum Ausruhen. Und zum Nachdenken.«
Ein bisschen viel Zeit. Hundert Stunden Schlaf. Mindestens.
Wenig später fiel die Tür ins Schloss. Es tat ihr leid, so entsetzlich leid, dass sie Deniz am liebsten hinterhergelaufen wäre. Wäre sie nicht so verdammt müde gewesen. Morgen würde sie ihm eine Antwort geben, wenn sie wieder klar denken konnte. Wenn es nicht mehr vor ihren Augen flimmerte.
Da ahnte sie noch nicht, dass zwischen ihr und diesem Morgen noch ein ganzes Dorf und ein Mord lagen.
2
Franca legte sich im Schlafzimmer auf das geblümte Bettzeug. Kaum hatte sie die Augen geschlossen, tauchten die Bilder auf. Sophie, die im Brautkleid vor dem Spiegel stand und sich zu ihr drehte: Und, was sagst du dazu, Schwesterherz? Meinst du, das ist es? Sophie, mit ihrem schönen breiten Mund und den Sommersprossen auf den Wangen. Sophie, mit dem kleinen Tom auf dem Arm. Sophie, wie sie sich mit beiden Händen durch das lockige Haar fuhr.
Die Bilder schwirrten durch Francas Kopf wie die Schwalben am Himmel, doch sie war zum Glück so müde, dass sie bald in einen dumpfen, traumlosen Schlaf hinüberglitt.
Als sich das Licht des nächsten Tages zwischen dem Spalt der Vorhänge hereindrängte, gab ihr Handy den vertrauten Signalton von sich. Eine Nachricht von Deniz. »Sollen wir zusammen frühstücken? Du kannst ja danach weiter über meine Frage nachdenken.« Aber sie fühlte sich nicht besser als am Abend zuvor. Im Gegenteil. Franca hatte den Eindruck, kaum die Augen aufhalten zu können. »Melde mich nächste Woche, muss erst ausschlafen, tut mir soooo leid«, schrieb sie und schickte mit schlechtem Gewissen einen Kuss hinterher.
Sie schlief wie betäubt, Stunde um Stunde. Ab und zu stand sie auf, um etwas zu trinken oder um ins Bad zu gehen, dann schlief sie weiter. Draußen brach die nächste Nacht herein und wurde von der aufgehenden Sonne vertrieben, bis es erneut dunkel wurde. In den kurzen Momenten, in denen sie wach lag, war sie erleichtert, dass die Bilder von Sophie verschwunden waren. Keine Bilder, keine Gefühle, nichts. Franca Sallner war außer Betrieb. Ihr Kopf hatte seine Arbeit endgültig eingestellt. Der Zug fuhr nicht mehr. Endlich schlafen. An nichts mehr denken, sich um niemanden mehr kümmern müssen. Ein Zustand, in dem sie gern für den Rest ihres Lebens verblieben wäre, hätte nicht eine Stimme sie zurückgeholt.
»Hallo! Frau Sallner!«
Über ihr schwebte ein Gesicht mit mandelförmigen Augen.
»Frau Sallner! Was ist denn los? Sind Sie krank?«
»Selma?« Franca richtete sich auf. »Was machen Sie denn hier?«
»Ich? Was machen Sie hier? Es ist neun Uhr. Müssen Sie nicht in die Klinik?«
Wenn Selma da war, dann musste schon Montag sein! Franca ließ sich zurück aufs Bett fallen. Nach ihrer Nachricht an Deniz hatte sie das Handy ausgestellt. Niemand war bis zu ihr durchgedrungen. Sie hatte tatsächlich das Wochenende über nur im Bett gelegen und fast die ganze Zeit geschlafen.
»Frau Sallner!«
Sie würde im Bett bleiben, weiterschlafen. Sie wollte nicht aufstehen. Nicht zurück in die Mühle. Nicht zurück zu Hemingway, dem Tyrannen.
»Hallo!« Selma schlug ihr auf die Wange. »Verdammt, ich bin Ihre Putzfrau und nicht Ihr Kindermädchen. Jetzt stehen Sie auf!«
»Rufen Sie in der Klinik an«, sagte Franca leise, ohne die Augen zu öffnen. »Ich komme nicht mehr. Nie mehr.«
»So ein Blödsinn«, schimpfte Selma und verschwand.
Franca hörte, wie sie telefonierte. »… mich durchstellen? Danke … Ja, es geht um … Sallner … Franca Sallner, Ärztin auf der … Hallo? Ich wollte nur Bescheid geben, dass Frau Sallner … krank, ja …«
Kurz darauf stand Selma wieder vor ihrem Bett.
»Ich habe Ihnen gesagt, das geht nicht gut, wenn Sie weiter so viel arbeiten. Aber Ihnen kann man ja sagen, was man will. Wie lange haben Sie nichts mehr gegessen?«
Wann hatte sie etwas gegessen? Am Freitag. Vor der Besprechung. Oder war sie doch gestern irgendwann am Kühlschrank gewesen?
»Hallo, ich rede mit Ihnen!«
»Es tut mir leid, Selma.«
Es tat ihr wirklich leid. Aber sie würde dieses Bett nicht mehr verlassen.
Selma rief Deniz an. Eine halbe Stunde später stand er in der Tür, in Turnschuhen und mit sorgenvollem Gesicht. Er redete so lange auf sie ein, bis sie schließlich doch aufstand. Dann brachte er sie zu ihrer Hausärztin. Man nahm ihr Blut ab, und sie hatte ein Gespräch, bei dem sie nicht viel sagte. Deniz, der dabei war, sprach dafür umso mehr. Er berichtete von ihrem Arbeitspensum, ihrer Erschöpfung und ihrer ständigen Müdigkeit. Mit dem Etikett »Burn-out« fuhr er sie wieder nach Hause und versprach, die Krankschreibung bei der Klinikverwaltung vorbeizubringen. Am Abend kehrte Deniz zurück, brachte ihr Essen und versuchte, sie dazu zu bewegen, wieder aus dem Bett zu kommen. Doch Franca streikte, stand nur auf, wenn es unbedingt nötig war, lag mit geschlossenen Augen da, froh um jede Minute, in der niemand etwas von ihr wollte.
So ging es am nächsten, am übernächsten und am überübernächsten Tag. Deniz, der sonst so pragmatisch war und für alles eine Lösung hatte, kam nach der Arbeit zu ihr und saß schweigend an ihrem Bett. Franca aber fand keine Worte für ihn, aus lauter Angst, er könnte seinen Antrag wiederholen, wenn sie miteinander redeten. Sie konnte jetzt keine Entscheidungen treffen. Völlig unmöglich.
Sobald sie auch nur anfing, über Deniz’ Frage nachzudenken, landete sie in einem Sumpf. Dann sah sie ihn mit einer Whiskeyflasche auf dem Sofa liegen, aufgeschwemmt und mit dem gleichen verächtlichen Blick, den sie von Hemingway kannte. Oder sah, wie er mit einer Frau im Hotel verschwand, während sie mit einem Kinderwagen von der anderen Straßenseite aus zusah. Ihr Kopf produzierte nur noch Horrorvisionen. Also versuchte sie erst gar nicht, weiter darüber nachzudenken.
Doch der Heiratsantrag stand wie ein Elefant im Raum, und die Stille zwischen ihnen machte beiden das Herz schwer.
»Willst du, dass ich nicht mehr komme?«, fragte Deniz am Ende der Woche, und es hörte sich so nach Abschied an, dass Franca einen Schrecken bekam.
»Nein, nein, so ist das nicht. Auf keinen Fall«, versicherte sie rasch und schob hinterher: »Es ist nur alles so anstrengend im Moment.«
Und dann vertrieb Deniz den Elefanten. Vorerst zumindest.
»Weißt du, vielleicht war das kein guter Zeitpunkt für einen Heiratsantrag. Werde erst einmal wieder gesund.«
Die kleine Schachtel mit dem Ring legte Franca ins Regal, dorthin, wo das Bild von Sophie stand. Danach kam Deniz nur noch ab und zu. Aber er war so wie immer, und Franca war ihm unendlich dankbar, dass er den Druck von ihr genommen hatte.
Es war Selma, die sie in der Zeit versorgte. Die gute Selma, die seit fünf Jahren ihren Haushalt managte, flößte ihr Kräutertee ein und schmierte Brote mit Honig, auf die sie großzügig Kügelchen aus einer kleinen braunen Flasche streute. Selma kam jeden Tag und schaufelte Kohlen in den Brenner der Dampflok. Es dauerte zwar fast vier Wochen, aber dann fuhr immerhin wieder ein Bummelzug. Franca stand auf, fing an fernzusehen, freute sich über die Blumen, die die Kollegen ihr schickten, auch wenn sie das schlechte Gewissen plagte, weil sie sie mit dem versoffenen Wrack allein gelassen hatte.
Auf dem winzigen Balkon ihrer Wohnung, auf dem sie in der wärmenden Frühlingssonne saß wie ein Vogel im Nest, klärte sich nach und nach, was in ihr herumschwirrte: Sie liebte Deniz. Und auch wenn ihr Kopf andere Bilder produzierte, so wusste sie doch, dass er niemals wie Hemingway werden würde. All die düsteren Zukunftsvisionen waren nicht unmöglich, aber doch unwahrscheinlich. Als müsste sie sich das, was sie eigentlich wollte, schwarzmalen – vor lauter Angst, es gar nicht bekommen zu können. Denn der Mann, der ihr einen Antrag gemacht hatte, der mit ihr zusammenleben und eine Familie gründen wollte, ahnte nicht, wer sie wirklich war.
Das war der Stein, der vor der Tür zu ihrer Zukunft lag. Nein, es war eher ein Felsbrocken. Und auch wenn es ihr besser ging, im Moment fehlte ihr die Kraft, ihn wegzurollen. Vor allem aber, mit dem umzugehen, was vielleicht danach kommen würde.
Selma schien ihre Betrübnis zu spüren und hatte eine Idee:
»Was Sie brauchen, ist ein bisschen Abwechslung. Sie müssen endlich mal hier weg. Am besten, Sie fahren wohin, wo nicht so viel los ist. Aufs Land. Sie sagen doch immer, Sie wollen aufs Land ziehen.«
Manchmal sehnte Franca sich danach, auf dem Land zu leben, irgendwo, wo weniger Trubel war. Sie hatte Selma davon erzählt, so wie von manch anderem.
»Solange Sie hierbleiben, rennen Sie garantiert in die Klinik, sobald Sie wieder kriechen können. Seit dem Unglück mit Ihrer Schwester tun Sie doch nichts außer arbeiten. Wirklich, Sie sollten mal raus hier.« Selma zupfte einen Grashalm aus dem Balkonkasten. »Sie könnten Ihren Freund mitnehmen. Täte Ihnen beiden vielleicht gut. Ist sowieso ein Wunder, dass der Ihre Arbeiterei die ganze Zeit mitgemacht hat. Was hat er denn angestellt, dass Sie ihn weggeschickt haben? Hat er mit einer anderen rumgevögelt?«
Franca hatte schon darauf gewartet. Wenn Selma mitbekam, was in ihrem Leben los war, sparte sie nicht mit Kommentaren. Selma war zwar nur wenig älter als Franca, wusste aber immer ganz genau, was richtig oder falsch war.
»Ich habe ihn nicht weggeschickt. Er kommt nur nicht so oft wie sonst, weil ich Ruhe brauche. Es ist alles in Ordnung.«
»Wenn er anruft, sitzen Sie angeblich auf dem Klo, und wenn er Sie besuchen kommt, schlafen Sie nach zehn Minuten ein. Was ist daran in Ordnung? Als Hauptkommissar bei der Kripo ist der doch sicher Beamter.« Selma warf den grünen Halm über die Balkonbrüstung. »In Ihrem Alter sollte man zugreifen, wenn sich noch etwas Ordentliches bietet. Erst recht, wenn es ein Beamter ist. Sicherer Job, sicheres Einkommen.«
»Ich kann für mich selbst sorgen.«
Wusste Selma Bescheid über Deniz’ Antrag? Sie hatte bestimmt das Schmuckkästchen neben Sophies Bild entdeckt. Gut möglich, dass sie reingeschaut hatte.
»Außerdem bin ich erst zweiunddreißig.«
»Eben. Fünfunddreißig ist die Schallmauer«, wusste Selma. »Danach wird es schwierig. Sie werden schon grau.«
Mit kritischem Blick musterte sie Francas schwarze Haare, in denen die ersten Silberfäden zu sehen waren.
»Ich würde es mal mit einer Tönung versuchen. Noch ein paar Pfund mehr könnten Ihnen auch nicht schaden. Dann ein hübsches Kleid und ein paar schicke Schuhe statt der Bequemtreter, die Sie immer anhaben, und Sie können sich vielleicht noch etwas Zeit lassen. Aber allzu lange rumtrödeln würde ich nicht mehr. Wenn Sie Kinder haben wollen, ist es sowieso schon höchste Eisenbahn.«
»Vielleicht sollte ich auch ein paar Zentimeter wachsen. Alles unter eins siebzig geht heute auf dem Heiratsmarkt bestimmt nicht mehr weg.«
Sie war nur eins neunundsechzig. Klein, aber zäh, hatte ihr Vater oft über sie gesagt.
»Sie nehmen das nicht ernst genug«, legte Selma nach. »Das Gejammer kommt dann, wenn der Zug abgefahren ist. Also ich würde Ihren Deniz nicht von der Bettkante schubsen. Da muss man schon eine ziemliche Macke haben, wenn man so einen Kerl laufen lässt.«
Franca schätzte Menschen, die direkt waren, doch manchmal überspannte Selma den Bogen.
»Danke für das Kompliment. Der Tee schmeckt übrigens wunderbar. Ist davon noch etwas da?«
Ende der Diskussion. Themenwechsel.
»Ich meine es ja nur gut.« Selma klang ein bisschen beleidigt. Sie stand auf und verschwand. »Nein, Tee ist überhaupt keiner mehr da«, rief sie aus der Küche. »Ich gehe welchen holen.«
Mit einem dumpfen Geräusch fiel kurz darauf die Haustür ins Schloss. Doch Selma brauchte nicht lange. Als sie zurückkehrte, hatte sie nicht nur Tee dabei, sondern auch die Post, die unten im Briefkasten gesteckt hatte. Ein Einwurfeinschreiben. Erst dachte Franca, Hemingway habe es sich doch noch anders überlegt und es sei ihre Kündigung. Aber der Brief kam nicht von der Klinik. Der Umschlag enthielt ein formell aussehendes Schriftstück, an das mit einer Büroklammer ein Blatt und ein Foto geheftet waren. Auf dem Bild sah man zwei junge Frauen, im Hintergrund hingen Lampions wie Monde über einer dunklen Fläche. Anscheinend standen die beiden vor einem Tanzboden, in Kleidern, die aussahen, als wären sie aus einem Film mit Liselotte Pulver.
»Sehr geehrte Frau Sallner«, stand in dem Anschreiben. »Hiermit übersende ich Ihnen eine Kopie des Testaments von Rosa Maria Dissler, das nach deren Ableben in ihrem Haus gefunden wurde. Das Original habe ich an das Amtsgericht geschickt, das sich in den nächsten Wochen bei Ihnen melden wird. Das Anwesen von Frau Dissler befindet sich in der Nöllchenstraße 27 in Neeskamp. Ich habe den Schlüssel an mich genommen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie sich das Haus ansehen wollen. Sprechstundenzeiten siehe unten, Adresse siehe Briefkopf. Mit freundlichen Grüßen, Tiss Rühlert, Bürgermeister von Neeskamp.«
»Ein Testament?« Selma hatte sich hinter sie gestellt und las mit. »Haben Sie etwas geerbt?«
Franca überflog das angehängte Blatt mit der zittrigen Schrift. »… hätte ich gern meiner Freundin Ingrid Sallner vermacht, die leider vor mir verstorben ist. Daher vererbe ich mein gesamtes Eigentum nun ihrer Tochter. Ingrid hat mir einmal in großer Not geholfen, dafür bin ich ihr ewig dankbar. Ich hoffe, dass ihre Tochter Franca Freude an meinem Hab und Gut hat und dass es meine Schuld tilgt. Rosa Maria Dissler.«
»Testament« stand darüber, Unterschrift und Datum darunter.
»Wer ist das da auf dem Foto?«
Selma streckte die Hand danach aus, aber Franca gab es nicht her. Sie hatte sie erst nicht erkannt: Eine der Frauen war ihre Mutter, mit halblangen Haaren und glatter Haut. Die Frau daneben sah aus, als wäre sie etliche Jahre älter. Beide lachten unbeschwert in die Kamera. Es schnürte Franca die Kehle zu. Obwohl das Foto etwas unscharf war, gab es keinen Zweifel daran, dass es ihre Mutter war. Vielleicht mit Anfang zwanzig. Franca besaß auch solche Bilder von ihrer Mutter, aber sie schaute sie nicht mehr an, weil es nur wehtat.
»Wo liegt Neeskamp?«, wollte Selma wissen. »Gehört das Haus jetzt Ihnen?«
Wo lag Neeskamp? Franca hatte von diesem Ort noch nie gehört. Genauso wenig wie von einer Rosa Maria Dissler.
3
Neeskamp war ein kleiner Ort am Niederrhein. Das Internet verriet es Franca, auch wenn sie außer der Tatsache, dass dieser Ort existierte, kaum etwas darüber finden konnte.
War das Schreiben vielleicht ein Trick, um eine Ärztin in ein aussterbendes Dorf zu locken, so wie sie es einmal in einem Film gesehen hatte? Bei dem Ärztemangel auf dem Land schien Franca der Gedanke nicht ganz abwegig, doch als sie Herrn Rühlert, den Bürgermeister, anrief, musste sie feststellen, dass man in Neeskamp offensichtlich kein allzu großes Interesse an ihrer Person hatte. Herr Rühlert war in Eile und versuchte, sie abzuwimmeln.
»Ist jetzt gerade ganz schlecht. Ich muss zur Versammlung.«
Welche Versammlung, ließ er offen, aber sein Tonfall machte klar, dass sie von enormer Wichtigkeit sein musste. Immerhin konnte Franca ihm entlocken, dass Rosa Maria Dissler seit vielen Jahren allein in ihrem Haus in Neeskamp gelebt hatte. Frau Dissler war Lehrerin gewesen und hatte bis zu ihrer Berentung die Kinder am Gymnasium im Nachbarort Lütenkamp unterrichtet. Verwandtschaft war nie gesehen worden, eigene Kinder gab es nicht. Als der Tod sie dahinraffte, war Rosa Maria Dissler einundachtzig Jahre alt.
»Sicher das Herz«, meinte Herr Rühlert fachkundig.
Das Testament hatte im Haus gelegen, zusammen mit dem Foto der beiden Frauen und einem Zettel mit Francas Adresse. Frau Dissler war vor drei Tagen beigesetzt worden.
»Das mit dem Amtsgericht ist nur noch eine Formsache. Andere Erben gibt’s ja nicht. Falls Sie sich das Haus schon ansehen wollen, sprechen Sie mir aufs Band, am besten mindestens einen Tag vorher. Ich stecke dann den Schlüssel bei der Dissler auf die Haustür. Ich muss aufs Feld, wenn das Wetter danach ist«, erklärte Herr Rühlert. »Wir haben hier Besseres zu tun, als im Büro zu hocken und darauf zu warten, dass jemand kommt.«
»Wenn Sie mir Ihre Handynummer geben, kann ich Sie auch –«
»Handy funktioniert hier nicht. Wir haben da ein Problem mit dem Sendemast. Und jetzt muss ich voranmachen. Tag, Frau … Frau …«
»Sallner. Franca Sallner.«
»Ja, tschüss denn.«
Nach diesem freundlichen Telefonat startete Franca einen Rundruf in der Verwandtschaft. Es gab niemanden, dem ihre Mutter von einer Rosa Maria Dissler oder von Neeskamp erzählt hätte. Das machte die Erbschaft nicht weniger mysteriös, und doch war sie erleichtert. Es war nicht etwas, von dem nur sie nichts wusste. So wie der Mann, der beim Begräbnis ihrer Mutter bitterlich geweint hatte und den andere offensichtlich als deren neuen Partner kannten.
Deniz war skeptisch, als sie ihm von dem unerwarteten Erbe erzählte. »Seltsame Geschichte«, sagte er, und die kleine Falte zwischen seinen Augenbrauen wurde ein wenig steiler.
Wenn das Amtsgericht das Testament erst einmal offiziell eröffnet hatte, würde sie binnen weniger Wochen erklären müssen, ob sie das Erbe annehmen wollte. Es konnte nicht schaden, sich das Haus anzusehen, denn erben würde sie alles, auch Schulden, die es möglicherweise gab. Vielleicht fand sie im Haus Unterlagen, die wichtig für sie waren, und konnte in Neeskamp etwas darüber erfahren, was ihre Mutter und die unbekannte Rosa Dissler so eng miteinander verbunden hatte.
Vor allem aber würde es ihr Zeit verschaffen. Noch einmal tief Luft holen, bevor sie mit Deniz reden würde. Immer noch vergaß sie manches, immer noch wurde sie müde, wo sie sonst noch Kraft und Energie gehabt hätte. Wenn sie mit Deniz sprach, wollte sie fit sein, dann musste ihr Kopf funktionieren. Ein paar unbeschwerte Tage auf dem Land konnten da nur guttun. Und dann würde sie alles klären.
Noch bevor sie den Gedanken, nach Neeskamp zu fahren, überhaupt äußerte, hatte Selma schon eine klare Meinung dazu: Franca müsste unbedingt an den Niederrhein, und am besten sollte sie gleich ein paar Wochen dableiben. Dieses Erbe sei wie ein Auftrag, den gutmeinende Schicksalsmächte ihr hatten zukommen lassen, damit sie sich endlich eine Auszeit gönnte. Und so wie Franca »drauf« wäre, könnte sie sowieso noch nicht arbeiten. Francas Hausärztin formulierte es etwas anders, sah es aber durchaus ähnlich und schrieb sie weiter krank.
Also rief Franca Deniz an, um ihm mitzuteilen, dass sie plante, an den Niederrhein zu fahren, um ihr Erbe in Augenschein zu nehmen.
»Ja, das ist sicher vernünftig«, sagte er zunächst, um dann völlig unvermittelt zu fragen: »Liebst du mich noch, Franca?«
»Natürlich liebe ich dich.«
»Oder läufst du davon, weil du Sorge hast, ich könnte meinen Antrag wiederholen? Wenn du mich nicht heiraten willst, sag es einfach.«
»Nein, so ist das nicht. Bestimmt nicht. Ich möchte nur herausfinden, warum eine völlig Fremde mir ein Haus vermacht und was sie mit meiner Mutter zu tun hat. Ich werde mich auf dem Land noch ein bisschen erholen, und dann reden wir übers Heiraten. Da oben kann ich mir alles in Ruhe überlegen.«
Wie schrecklich sich das anhörte. Als müsste sie eine lange Liste schreiben, auf der sie Pro und Kontra einer Ehe mit Deniz abwog. Es tat ihr leid, kaum dass sie es ausgesprochen hatte.
»Ich gebe dir eine Antwort, Deniz. Bald. Sehr bald. Ich verspreche es dir.«
»Na dann.« Zum Glück hörte er sich wieder an wie immer. »Hoffentlich tut dir dieses Neeskamp gut.«
Als sie aufgelegt hatte, schnürte es Franca die Kehle zu. Natürlich lief sie davon.
An einem Tag, der schönes Wetter versprach, reiste sie ab. Nur mit Müh und Not schaffte sie es, den riesigen Koffer das Treppenhaus hinunterzuschleifen. Selma hatte sie gedrängt, alles Mögliche mitzunehmen, das Franca eigentlich überflüssig erschien. Einen dicken Pullover, eine Mütze, Flanellbettwäsche. Bestimmt sei es da oben noch ziemlich kalt. Eine Helikoptermutter konnte nicht schlimmer sein als ihre Putzfrau.
Schon bald ließ sie die Hügel des Odenwaldes hinter sich und fuhr an Mainz und Koblenz vorbei. In einem der kleinen Orte am Rhein hatte sie mit Deniz noch kurz vor ihrer Krankschreibung seine älteste Schwester Celina besucht. Den ganzen Nachmittag über hatten seine drei kleinen Nichten an ihm geklebt wie Kaugummi, so lange, bis der Herr Hauptkommissar sich beim Rumtoben den Fuß verstaucht hatte.
Deniz war schnell der Star bei Kindern, denn er konnte genauso ausgelassen sein wie sie. Wenn man ihn sah, einen großen, breitschultrigen und auf den ersten Blick eher ernst wirkenden Mann, kam man nicht unbedingt auf die Idee, dass er zusammen mit einer Schar Kinder, quakend wie eine Ente, durch die Gegend lief und dabei einen Riesenspaß hatte. Aber man hätte auch nicht gedacht, dass der Mann mit dem eckigen Kinn gern Liebesfilme schaute und phantastisch backen konnte.
Deniz liebte seine Schwestern, seine Nichten und seine Eltern. Für ihn kam Familie vor allem anderen. So hatte er auch nach ihrem Kennenlernen nicht lange mit seiner Frage gewartet, ob sie Kinder haben wollte. Damals war das alles noch weit weg, da war es einfach gewesen, Ja zu sagen. Da hatte sie noch geglaubt, wenn nur mehr Zeit verginge, würde der Gedanke leichter, ein Baby auf dem Arm zu halten. Aber sobald sie daran dachte, sah sie den kleinen Tom vor sich, ihren Neffen. Sie hatte jetzt seit über fünf Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. Wie groß Tom wohl inzwischen sein mochte? Ob er Sophie noch ähnlicher geworden war?
Franca ließ das Fenster runter, ein Schwall frischer Luft kam herein. Weg mit den Gedanken. Bloß fort damit.
Nachdem sie von der Autobahn abgefahren war, kam Franca an scheinbar endlosen Feldern vorbei, auf denen der Pflug die Erde in dicken Schollen aufgebrochen hatte. Auf anderen blühte der Raps so leuchtend gelb, dass sie kaum den Blick davon wenden konnte. Sie fuhr durch Dörfer mit rotbraunen Backsteinhäusern und Kirchen, die mit spitzen schiefergedeckten Türmen in den Himmel ragten. Hier gab es keine Berge, die ein enges Tal bildeten, dafür eine offene, weite Landschaft, in der ab und zu kleine Waldinseln lagen. Franca hatte sich vor der langen Fahrt gefürchtet und Sorge gehabt, bald müde zu werden. Aber das Gegenteil war der Fall, als ob mit jedem Kilometer, den sie sich von Heidelberg entfernte, etwas von ihrer Energie zurückkehrte.
Beim ersten Hinweisschild auf Neeskamp wusste sie auf jeden Fall, dass die passende Beschreibung dafür, wo dieser Ort lag, nur lauten konnte: am Arsch der Welt. Aber es war zugegebenermaßen ein sehr schöner Arsch. Rechts und links der Straße, die in das Dorf hineinführte, trotzten Platanen dem Wind, die Äste leicht gebeugt, als wollten sie für die Ankömmlinge ein Spalier bilden. Auf das Ortsschild hatte jemand in roter Farbe »We love« über den Namen »Neeskamp« geschrieben.
Im Schritttempo fuhr Franca die Hauptstraße entlang. Hier sah es ähnlich aus wie in den anderen Dörfern, durch die sie gekommen war. Backsteinhäuser, Vorgärten mit Blumen und Büschen und halbhohen Zäunen darum. Franca bog ab, um auf die Nöllchenstraße zu gelangen, und spähte nach den Hausnummern. Bis ein heller Fleck ihren Blick auf sich zog.
In etwa zwanzig Metern Entfernung stand mitten auf der Fahrbahn eine Gans, so groß, dass man sie auf der schmalen Straße nicht umfahren konnte, ohne dabei den nächsten Gartenzaun zu streifen. Franca hupte und fuhr im Schritttempo auf sie zu, die Gans aber ließ sich auf der Straße nieder. Anscheinend bestand sie auf einer persönlichen Aufforderung, um den Weg freizugeben.
Franca stieg aus, ging ein paar Meter auf das gefiederte Verkehrshindernis zu und klatschte in die Hände. In erstaunlicher Geschwindigkeit war die Gans wieder auf ihren kurzen Beinen, reckte den Hals in die Länge, ruckte mit dem Kopf und begann, wütend zu schnattern. Franca klatschte noch einmal. Da breitete das Federvieh die Flügel aus und stob auf sie zu, mit einem Zischen, als würde Luft aus einem prall gefüllten Reifen entweichen. Franca schaffte es gerade noch, wieder ins Auto zu steigen und die Tür hinter sich zuzuschlagen, schon tauchte der Gänsekopf vor der Seitenscheibe auf. Das Tier musterte sie aus kleinen Augen, mit einer Feindseligkeit, als wäre es die Reinkarnation sämtlicher Gänse-Verwandten, die in den letzten Jahren in Francas Backofen gelandet waren.
»Gehst du wohl weg!« Hinter dem erbosten Geschnatter erklang eine Frauenstimme. »Hau ab da! Weg da! Los!«
Der Kopf mit dem orangefarbenen Schnabel verschwand. Eilig watschelte der Feind davon. Dafür erschien ein Menschenkopf vor der Seitenscheibe. Grüne Augen, rotblonde lockige Haare, Sommersprossen auf der hellen Haut.
»Alles in Ordnung? Hat sie Sie erwischt?«
Franca ließ die Scheibe herunter. »Nein, aber das war knapp.«
Das Gesicht lachte. »Tut mir leid. Jemand muss das Tor aufgelassen haben. Antonia kann sehr sauer werden, wenn man sie aufscheucht. Vor allem, wenn es jemand Fremdes ist. Sie wollen sicher nach Lütenkamp? Die Straße ist gesperrt. Am besten fahren Sie zurück …«
»Nein, ich wollte hierhin. Ich suche die Nummer 27.«
»Ach …« Die grünen Augen musterten sie mit unverhohlenem Interesse. »Sie wollen zum Haus von Rosa Dissler?«
Eine Hand streckte sich in den Wagen.
»Ich bin Emely. Emely Mohlbrink. Dann sind Sie die Frau aus Heidelberg, die das Haus geerbt hat?«
Wie es schien, war Herr Rühlert kein Geheimniskrämer.
»Ja, genau, das bin ich. Franca Sallner.«
Franca nahm die Hand, die klein und zart war wie die eines Kindes. Und doch war diese Frau wahrscheinlich ähnlich alt wie sie, zumindest den feinen Linien nach zu urteilen, die um Augen und Mundwinkel lagen.
»Bleiben Sie über Nacht, oder sind Sie irgendwo im Hotel?«
»Ich dachte eigentlich, ich kann in dem Haus schlafen.«
»Dann komme ich kurz mit, wenn Sie wollen. Es ist gleich hier vorn. Ich kann Ihnen zeigen, wo das Holz für den Ofen liegt.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, lief ihre Beschützerin um das Auto herum und setzte sich auf den Beifahrersitz.
»Nenn mich einfach Emely«, bot sie an. »Wir sind hier in Neeskamp nicht so förmlich. Die 27 ist gleich da vorn.«
Das Haus von Rosa Dissler war in der Tat nur noch knappe fünfzig Meter entfernt. Es war etwas niedriger als die Häuser rechts und links. Neben der Haustür kletterte eine Rose am Spalier hoch und reckte ihre ersten Blüten der Sonne entgegen, die grünen Holzläden waren geschlossen. Ein hübsches Haus, es gefiel Franca auf Anhieb.
Sie folgte Emely durch das niedrige Holztor, den plattierten Weg entlang, der durch den Vorgarten führte. Herr Rühlert hatte sein Versprechen gehalten, der Schlüssel steckte. Emely öffnete die Haustür, ging hinein und tastete nach dem Lichtschalter, aber es blieb dunkel.
»Bestimmt ist der Strom mal wieder weg. Seitdem sie die Straße nach Lütenkamp machen, passiert das alle naselang. Die haben schon zweimal sämtliche Leitungen gekappt.«
In dem schmalen Flur, der hinter der Tür lag, war es kühl und dunkel. Der Geruch nach alten Äpfeln und feuchten Mauern hing in der Luft.
»Schon komisch herzukommen, ohne dass Rosa da ist«, sagte Emely.
Franca folgte ihr in einen Raum, in den durch die Ritzen zwischen den geschlossenen Läden ein heller Schimmer fiel. Emely machte das Fenster auf, löste den Haken, der die Läden miteinander verband, und klappte sie nach außen weg.
Das Tageslicht offenbarte einen Blick in vergangene Zeiten: Hinter der matten Glasscheibe des himmelblau gestrichenen Küchenschranks stapelten sich Teller und Kaffeegeschirr. Der dunkle Holzboden glänzte speckig, auf dem Herd stand ein blecherner Flötenkessel, und über der Spüle hing ein altertümlicher Wasserboiler mit Drehknopf, wie Franca ihn noch von ihren Großeltern kannte. Die Rüschenvolants der Gardinen waren zu den Seiten hin gerafft und ließen den Blick nach draußen frei. Franca konnte den weißen Fleck auf der Straße sehen. Die Gans hatte sich wieder in Position gebracht.
»Ich habe ab und zu für Rosa eingekauft. Hier in der Küche hat sie immer gesessen und auf die Straße geschaut.« Mit einer gedankenverlorenen Geste fegte Emely einen Krümel vom Wachstischtuch. »Komm, ich zeig dir den Rest.« Sie stieß die Tür auf der anderen Seite des Flurs auf und öffnete auch hier die Läden. »Das war ihr Wohnzimmer.«
Eine Ecke des Zimmers war ganz von einem grünen Kachelofen ausgefüllt. An der Wand stand ein verschlissenes Sofa, an der anderen eine Anrichte aus dunklem Holz, und gegenüber dem Fernseher bot ein Lehnsessel an, darin Platz zu nehmen und die Füße hochzulegen.
Emely ging zurück in den Flur. Sie deutete auf eine schmale Tür am Ende des Ganges.
»Da ist das Bad, und die Treppe hoch findest du das Schlafzimmer.«
Die Stufen der Holztreppe, die in die obere Etage führte, waren vom vielen Hoch- und Runterlaufen ganz ausgetreten. Eine Einladung, sich nachts den Hals zu brechen. Ob Rosa Dissler hier gestorben war? Franca kannte den Tod aus der Klinik besser als viele andere Menschen, trotzdem verursachte der Gedanke ihr Unbehagen.
»Ist Frau Dissler hier im Haus gestorben?«
»Ja, der Briefträger hat sie in der Küche auf dem Boden gefunden. Noch im Nachthemd. Normalerweise haben die beiden immer einen kleinen Plausch gehalten, wenn er vorbeikam. Als er Rosa an dem Tag nicht gesehen hat, ist er rein und hat nachgeschaut, was los ist. Rosas Tür war immer offen.«
»Hat sie lange da gelegen?«
»Bestimmt nicht. Am Abend vorher habe ich sie noch am Fenster sitzen sehen. Aber mach dir keine Sorgen, Rosa war eine Nette, die spukt nicht nachts durch die Gegend.« Emely drehte sich zu ihr. »Glaubst du an Geister?«
»Ich? An Geister? Wieso willst du das wissen?«
»Weil manche behaupten, es spukt in Neeskamp, seitdem die Sache passiert ist.«
»Was denn für eine Sache?«
Der steinerne Flurboden strahlte eine unangenehme Kälte ab. Als stünden sie in einem feuchten Keller. Dort, wo Franca als Kind nicht hatte hingehen wollen, weil sie fürchtete, etwas könnte in einem der dunklen Räume auf sie warten. Nein, sie glaubte nicht an Geister. Nicht mehr.
»Du weißt nichts davon, oder?«, fragte Emely.
»Wovon denn?«
Emely zögerte. So wie manchmal Patienten zögerten, bevor sie Franca etwas anvertrauten, das eigentlich nicht für fremde Ohren bestimmt war. Dann sagte sie leise: »Von dem Mord.«
»Ein Mord? Hier? In diesem Haus?«
»Nein, nicht hier. Aber im Dorf.«
»Was ist denn passiert?«
Abrupt wandte Emely sich wieder ab.
»Ach, das erzähle ich dir ein andermal.« Sie ging auf die Hintertür zu. »Ist eine alte Geschichte. Jetzt komm erst einmal an. Bleibst du länger?«
»Mal sehen.«
Emely zeigte ihr das Holz, das an der Rückwand des Hauses ordentlich aufgeschichtet lagerte. Hier schloss sich ein Garten mit einem großen Kirschbaum an, mit Blumen- und Gemüsebeeten und einem schmalen, von Buchsbaum gesäumten Weg, der zum hinteren Tor führte. Es war genau der Garten, den Franca sich an heißen, schwülen Sommertagen in der Stadt immer erträumt hatte.
»Falls du etwas einkaufen willst, musst du nach Lütenkamp fahren. Hier gibt’s nichts.« Emely sah auf ihre Uhr, als wäre ihr plötzlich eingefallen, dass gleich Besuch vor der Haustür stand. »Ich muss dann auch weg. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Wenn du Lust hast, ich bin morgen Abend im Jröne Stüffke, das ist unsere Kneipe. Du musst nur zweimal rechts. Kann man nicht verpassen. In Neeskamp kann man eh nichts verpassen.«
Ein letztes Lächeln, dann verschwand sie mit schnellen Schritten auf dem schmalen Pfad zum hinteren Gartentor hinaus.
Es dämmerte schon, und das Licht funktionierte immer noch nicht. Zum Glück war die Gans von der Straße verschwunden. Franca nutzte die Gelegenheit, ihren Koffer ins Haus zu holen.
Jetzt hätte sie zu gern Deniz angerufen, aber auf dem Handy zeigte sich kein einziger Balken. Genau wie Herr Rühlert angekündigt hatte: keine Verbindung. Immerhin konnte sie es als Taschenlampe benutzen, um das winzige Bad zu inspizieren. Doch schon bald gab das Handy den typischen Warnton von sich, der ankündigte, dass der Akku in Kürze leer sein würde. In der Schublade des Küchenschranks fand Franca noch zwei Teelichter. Sie stellte sie auf einen Teller, zündete sie an und stieg mit den flackernden Lichtern nach oben.
Die Tür zum Schlafzimmer stand weit offen, als wollte man sie hereinbitten. Franca leuchtete den kleinen Raum aus. Als sie sich wieder umdrehte, schaute sie in das bleiche Antlitz einer Frau. Vor Schreck hätte sie fast den Teller fallen lassen – dabei war es nur ihr eigenes Gesicht, das ihr aus dem Spiegel des Schranks entgegensah.
Die dicke Daunendecke, die auf dem Bett lag, war zurückgeschlagen, das Kopfkissen eingedrückt. Ganz so, als wäre Rosa Dissler gerade erst aufgestanden und das Bett noch warm.
Franca konnte sich nicht in dieses Bett legen. So nicht. Und nicht heute.
Draußen war es inzwischen stockfinster. Sie traute sich nicht mehr hinauszugehen, um Holz zu holen, trank in der Küche Wasser aus dem Kran und aß im Schein der flackernden Kerzen eines von den Broten, die Selma ihr für die Fahrt geschmiert hatte. Mit der Dunkelheit kroch auch die Kälte ins Haus. Franca zog den dicken Pullover über und legte sich auf die Couch im Wohnzimmer, dankbar für die Decke, die Selma ihr aufgedrängt hatte.
Ob Deniz auch wach im Bett lag und an sie dachte? Ganz unten in ihrem Koffer hatte sie eine Tafel Schokolade gefunden, Trauben-Nuss. Ihre Lieblingssorte, mit einem gelben Klebezettel daran, auf dem stand: »Für meine Liebste. Auf dass es dir beim Nachdenken hilft«. Er musste sie gestern hineingelegt haben, als er gekommen war, um sich zu verabschieden.
Manchmal fand sie eine kleine Tüte Gummibärchen in ihrer Manteltasche oder einige ihrer Lieblingsbonbons in der Schreibtischschublade. Deniz’ Art, ihr zu sagen, dass er an sie dachte. »Für meine Liebste.« Dass ein Zettel dabei war, war ungewöhnlich. Und schön. So gern hätte sie ihn in diesem Moment neben sich gespürt. Wenn Deniz sich nachts zu ihr drehte und seinen Arm um sie legte, war es so, als ob nichts auf der Welt ihr etwas anhaben könnte. Aber jetzt?
Franca starrte in die grauschwarze Nacht. Emely war so schnell verschwunden, als hätte sie etwas ausgeplaudert, über das es eigentlich zu schweigen galt. Wie eine der Geschichten von dunklen Mächten, die man heraufbeschwor, wenn man nur über sie redete. Eine alte Geschichte, hatte Emely gesagt. Wahrscheinlich war dieser Mord fünfzig Jahre her.
Doch das Unbehagen, das Emely mit ihren Andeutungen hervorgelockt hatte, ließ sich nicht mehr vertreiben. Es kroch zu Franca unter die Decke, schmiegte sich an sie und blieb bis zum Morgengrauen.
***
Tagebuch der Rosa Maria Dissler
Neeskamp, 12. September
Liebster Anton,
ich hätte nie gedacht, dass ein kleines Büchlein einmal so wichtig für mich werden würde. Aber meine Gedanken aufzuschreiben hilft mir, mich dir nahe zu fühlen. Dann ist es fast so, als säßen wir wieder zusammen neben dem Rosenbusch auf der Bank vor unserem Haus, und du würdest mir zuhören.
Im Moment denke ich oft ans Sterben. Ob man wohl spürt, wenn es näher kommt? Manchmal, wie jetzt in der Früh, wird mir ganz eng in der Brust. Dann bekomme ich Angst und muss aufstehen. Dabei fürchte ich den Tod nicht. Es wäre schön, wenn jemand bei mir wäre und meine Hand hielte, wenn es so weit ist. So wie ich deine Hand gehalten habe, als du gegangen bist. Aber das wäre schon ein Zufall. Obwohl, ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Schließlich kommt alle naselang einer von den Neeskampern vorbei, um in meiner Küche zu sitzen und mir den Kaffee wegzutrinken. Die Chancen, nicht allein zu sterben, stehen also nicht schlecht.
Auf jeden Fall wird es Zeit, meine Angelegenheiten zu regeln. Ich habe vor ein paar Tagen mit Emely über alles gesprochen. Emely meint, wenn wir tot sind, werden wir mit unseren Liebsten wieder zusammen sein. Sicher wollte sie mir etwas sagen, das mich tröstet. Wir beide wissen, dass es nicht mehr lange dauern wird mit mir.
Ich glaube nicht, dass es ein Jenseits gibt, wo wir andere wiedersehen. Wozu auch, du bist ja bei mir, ich trage dich in meinem Herzen, so wie ich unsere Merle in meinem Herzen trage. »Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück.« So steht es in der Bibel geschrieben, und so wird es sein. Es gibt dann keine Rosa Maria Dissler mehr. Ich werde mich auflösen, werde zerfallen und zu Staub werden. Irgendwann wird der Wind den Staub davontragen. Die Erde wird sich verändern und ich mich mit ihr. Ich verschwinde nicht, ich ändere nur die Art meines Seins, so wie du es schon getan hast.
Draußen vor dem Küchenfenster steht der Nebel wieder einmal wie eine Wand. Kein Wunder, dass sie es hier das »Nebelland« nennen. Ich glaube, nirgends auf der Welt gibt es so oft Nebel wie bei uns. Im Herbst, im Winter, sogar im Frühjahr legt er sich über den Ort. Im Moment kann ich nicht einmal mehr bis auf die andere Straßenseite sehen. Aber vielleicht ist es besser so. Man muss nicht immer alles mitbekommen.
4
Als Franca die Augen aufschlug, war es draußen schon hell. Vor dem Fenster schimpften ein paar Spatzen, irgendwo in der Ferne blökten Schafe. Kein Lärm von Autos, die sich durch enge Straßen quälten, keine Mitbewohner, die Türen zuschlugen oder im Treppenhaus lauthals telefonierten. Und im Flur war sogar Licht. Der Strom war wieder da. Dafür konnte Franca jeden einzelnen Knochen spüren. Noch eine Nacht auf diesem Sofa, und sie würde nie mehr aufrecht gehen können.
In der Küche fand sie einen altmodischen Filteraufsatz und in einer Büchse einen Rest Kaffeepulver. Auf der Bank draußen vor dem Haus aß sie Selmas letzte Stulle. Der heiße Kaffee vertrieb die Kälte der Nacht aus ihren Gliedern. Nun hatte ein Geheimnis ihrer Mutter sie an einen Ort katapultiert, dessen Namen sie vorher nicht einmal gekannt hatte. Neeskamp. Was mochte wohl die »große Not« gewesen sein, aus der ihre Mutter Rosa Dissler gerettet hatte?
Sie bekam mit ihrem Handy immer noch keine Verbindung, aber sie musste Deniz heute auf jeden Fall eine Nachricht schicken, dass sie gut angekommen war. Sie wusste, er würde sich Sorgen machen, wenn sie sich nicht bald meldete. Es gibt so viele Idioten hinter dem Steuer. Deniz’ Lieblingsspruch.
Und schon war er wieder da, der Ring um ihre Brust. Sie holte tief Luft. Nur nicht weiter dran denken. Der Tag war zu schön, um sich den Kopf zu zerbrechen. Dafür blieb noch genug Zeit.
Zwei große Raben mit glänzend schwarzem Gefieder hüpften auf dem Gartenweg umher und schienen sich nicht im Geringsten an Francas Gegenwart zu stören. Erst als sie sich bewegte, flatterten sie davon und setzten sich gegenüber auf den niedrigen Holzzaun. Das Haus dahinter sah aus, als wäre es nicht bewohnt. Die Läden waren geschlossen, der Jägerzaun leicht nach hinten gekippt. Mit dem verwilderten Garten davor erinnerte es Franca an ein Bild aus der Worpswede-Schule. Doch das wütende Kindergeschrei, das mit einem Mal zu hören war, passte so gar nicht zur Idylle.
Franca folgte dem Lärm und ging den schmalen Pfad entlang, der an Rosa Disslers Haus vorbei nach hinten führte. Schon von Weitem sah sie zwei Mädchen, vielleicht um die zehn, eins mit blonden Zöpfen, das andere mit dunklem Lockenkopf. Sie schlugen mit den Fäusten auf etwas ein, das am Boden lag.
»Lass los!« Die helle Stimme überschlug sich fast. »Lass endlich los! Paul, du sollst loslassen!«
»Hey! Was soll das?«, rief Franca.
Die beiden Mädchen hoben den Kopf und schauten zu ihr. Da entdeckte Franca den blonden Schopf am Boden.
»Schluss damit! Hört sofort auf!«
Franca rannte los, sprang über die kleine Buchsbaumhecke und rutschte aus. Unsanft fiel sie auf ihren Hintern, rappelte sich wieder hoch und lief weiter. Kurz bevor sie bei den Kindern war, ergriffen die Mädchen die Flucht und verschwanden durch das offene Gartentor. Der kleine Junge, der am Boden lag, hielt einen Arm schützend über den Kopf, den anderen streckte er von sich, die Hand zur Faust geballt. Seine Füße ragten fast in einen Tümpel hinein, der hier verborgen hinter kniehohem Gras lag.
»Hey, Kleiner, alles in Ordnung?«
Vorsichtig drehte sich der Kopf. Das war dann wohl Paul. Er musste viel jünger sein als die beiden Mädchen, vielleicht fünf. Eine Stupsnase, grüne Augen, strohblonde Haare, das Gesicht mit Dreck, Rotz und Tränen verschmiert.
»Komm, steh mal auf!«
Franca griff ihm unter die Arme und versuchte, ihn hochzuziehen. Der Junge aber machte sich steif wie ein Brett. Die Kordel, die er mit seiner Faust umklammerte, bemerkte Franca erst, als sie ihn auf die Beine stellte. Sie führte direkt in den Teich.
»Wolltest du hier angeln?«
Paul starrte wortlos auf den Tümpel, als stünde er am Loch Ness und das Ungeheuer könnte jeden Moment auftauchen.
»Jetzt wickeln wir deine Schnur mal auf. Dann sagst du mir, wo du wohnst, und ich bringe dich nach Hause.«
Sie wollte nach der Faust des Jungen greifen, aber der lief zur Seite, die Schnur weiter fest umklammert. Dabei spannte sie sich, und von dem, was am anderen Ende hing, tauchte eine Ecke aus dem Wasser auf. Weißes Gestänge. Das sah aus wie ein Vogelkäfig.
»Gib mir mal die Schnur!«
Der Kleine wich vor Franca zurück.
»Jetzt gib sie bitte her!«
Paul dachte gar nicht daran.
»Ich habe noch Schokolade im Haus. Wir tauschen einfach. Du gibst mir die Schnur und bekommst die Schokolade. Eine riesengroße Tafel.«
Doch der Junge kniff die Lippen zusammen. Die Knöchel der Hand, mit der er die Schnur umschloss, wurden weiß.
Franca war größer und stärker, aber Paul wehrte sich, wie man sich als Kind nur wehren kann. Er kratzte und biss, schlug mit dem freien Arm auf sie ein, während Franca die Finger der kleinen verschwitzten Faust aufbog.
»Nicht!«, schrie er und versuchte, ihr in die Hand zu beißen. »Nicht!«
Nach einem kurzen, aber erbitterten Kampf hielt Franca die Schnur in der Hand und zog den Käfig aus dem Tümpel, während der Kleine mit aller Wucht nach ihrem Schienbein trat. Das morastige Wasser strömte zwischen den Gitterstäben heraus. Sie kippte den Käfig, sodass auch das restliche Wasser rauslief. Auf seinem Boden lag das Opfer: ein Wellensittich. An einigen Stellen schimmerten noch die gelben Federn zwischen dem Morast und dem glitschigen Grünzeug hervor, das auf dem leblosen Körper klebte.
Paul sah interessiert auf die Leiche. »Was ist mit ihm?«
Die Wut stieg in Franca hoch. Da stand dieser Dreikäsehoch, völlig ungerührt, dabei hatte er gerade einen Vogel ertränkt. Und sie hatte auch noch die Mädchen vertrieben, die ihn daran hindern wollten.
»Er ist tot. Was denkst du denn?«