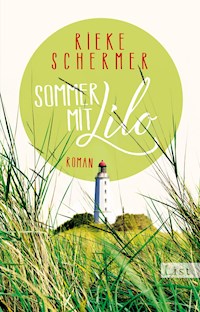
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Künstlerin Theresa Weiland ist fast dreißig, frisch getrennt und neu auf Hiddensee, als sie bei einem Spaziergang eine verträumte Fischerkate entdeckt. Kurzentschlossen kauft sie ihr Traumhäuschen für wenig Geld und macht sich an die Renovierung. Theresa ist überglücklich und voller Tatendrang - bis plötzlich ihre anstrengende Mutter Lilo vor der Tür steht. Lilo führt seit Jahren ein Hippieleben auf Mallorca, musste nun aber wegen Streitereien ihre Kommune verlassen. Das Verhältnis von Mutter und Tochter ist von jeher nicht das beste, und nun sollen die grundverschiedenen Frauen unter einem Dach leben? Theresa nimmt zunächst Reißaus, und Lilo überschreitet ihre Grenzen. Doch nach vielen Reibereien und einem großen Knall gibt es für die beiden einen echten Insel-Neuanfang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Die Künstlerin Theresa Weiland ist fast dreißig, frisch getrennt und neu auf Hiddensee, als sie bei einem Spaziergang eine verträumte Fischerkate entdeckt. Kurzentschlossen kauft sie ihr Traumhäuschen für wenig Geld und macht sich an die Renovierung. Theresa ist überglücklich und voller Tatendrang – bis plötzlich ihre Mutter Lilo vor der Tür steht. Lilo führt seit Jahren ein Hippieleben auf Mallorca, musste nun aber wegen Streitereien ihre Kommune verlassen. Das Verhältnis von Mutter und Tochter ist von jeher nicht das beste, und nun sollen die grundverschiedenen Frauen unter einem Dach leben? Beide wollen den Neuanfang, aber wollen sie auch denselben? Es sieht ganz so aus, als wäre es Zeit für eine Aussprache …
Die Autorin
Rieke Schermer ist das Pseudonym der erfolgreichen Autorin Susanne Lieder. Sie hat drei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Mann und fünf Katzen auf einem Resthof bei Bremen.
Von Rieke Schermer ist in unserem Hause bereits erschienen:
Liebe wie gedruckt
Unter ihrem echten Namen Susanne Lieder:
Ostseewind und SanddornküsseHerzmuscheln und BernsteinnächtePusteblumensommer
List
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1534-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: © plainpicture/ © Ralf Wilken
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für meine Mutter
Alle Personen in dieser Geschichte sind frei erfunden.Genau wie die Orte Selm auf Hiddensee und La Caleta auf Mallorca, die meiner Phantasie entsprungen sind.
Man muss warten können,das Glück kommt schon.
Paula Modersohn-Becker
GINSTERGELB
Hiddensee im Juli
Streitsüchtig hatte Cornelius sie genannt.
Sie und streitsüchtig! Lächerlich!
Sie hatte es einfach nur sattgehabt und ihn bei ihrem letzten Streit angebrüllt, dass sie ausziehen würde. Und zwar auf der Stelle. Wutschnaubend war sie aus der gemeinsamen Wohnung gestürmt und hatte dabei die Türen so geknallt, dass die Fensterscheiben geklirrt hatten.
Wie gut das getan hatte!
Cornelius und sie, das ging einfach nicht. Zwischen ihnen lagen nicht nur Welten, ein ganzes Universum befand sich dazwischen.
Zur Not würde sie vorübergehend in ihrem Atelier wohnen, wenn sich nichts anderes fand.
Sie hatte ihre Freundin Ella angerufen, die mit ihrer einjährigen Tochter in einer kleinen Dachgeschosswohnung lebte. »Ich brauche Asyl, Ella, dringend.«
»Ach herrje, das ist ganz blöd, Theresa, meine Schwester ist gerade für ein paar Tage bei mir. Und du kennst meine Wohnung. Natalie geht’s nicht gut. Aber sie wird bestimmt nicht lange bleiben.«
Theresa hatte geahnt, dass Ella mit »bestimmt« gleichzeitig auch »hoffentlich« meinte. »Kein Problem, ich finde schon was anderes.«
Das war leider nicht der Fall gewesen. Die Insel war um diese Zeit voller Touristen, es gab kein freies Zimmer weit und breit.
Aber zu Kreuze kriechen und Cornelius um Verzeihung bitten, nur damit sie wieder ein Dach über dem Kopf hätte?
Nein, ganz bestimmt nicht.
Und so wohnte sie nun seit drei Wochen in ihrem Atelier.
An diesem Morgen schien die Sonne durchs Fenster, und Theresa gönnte sich noch einen Moment und blieb faul liegen.
Sie verschränkte die Arme im Nacken und beobachtete die Sonnenstrahlen, die durchs Zimmer tanzten.
Als sie vor zwei Jahren auf die Insel gekommen war, war sie wie elektrisiert gewesen. Sie hatte sich gleich heimisch gefühlt, mehr noch, sie hatte sofort gewusst, dass dies ihr neues Zuhause sein würde. Ihr erstes richtiges Zuhause.
Als Kind war sie ständig mit ihrer Mutter umhergezogen, hatte dreimal die Schule wechseln müssen. In Berlin, wo sie Abitur gemacht und anschließend Kunst studiert hatte, war dann Cornelius in ihr Leben getreten. Er war fünfzehn Jahre älter als sie und hatte ihr das gegeben, wonach sie sich gesehnt hatte: Sicherheit und Beständigkeit.
Hier auf Hiddensee konnte sie endlich so arbeiten, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Die Umgebung, die Luft, das Rauschen des Meeres, der Wind, all das war eine einzige große Inspiration.
Und dann die Farben, an denen man sich kaum sattsehen konnte. Das helle Grün der Wiesen, das Gelb der Ginsterbüsche, der ockerfarbene Sand und das ganz besondere Blau des Himmels.
Im Frühling war es, als würde eine federleichte zartgrüne Decke über der Insel liegen, die stückchenweise heruntergezogen wurde. Tag für Tag wurde ein kleiner Zipfel freigelegt.
Sie musste lachen. Sie hatte ohne Zweifel eine lyrische Ader. Vielleicht hätte sie doch Schriftstellerin und nicht Malerin werden sollen.
Ihre Mutter hatte früher manchmal Gedichte oder Kurzgeschichten geschrieben, wahrscheinlich hatte das auf sie abgefärbt.
Theresa schwang die Beine von der Liege und streckte sich. Jeder einzelne Knochen im Leib tat ihr weh.
Noch drei Wochen auf dieser Liege, und sie hätte einen Bandscheibenvorfall.
Sie brauchte dringend eine eigene Wohnung, zur Not auch ein möbliertes Zimmer. Die meisten Möbel hatte sie sowieso bei Cornelius gelassen. Ein Fehler? Ja, wahrscheinlich.
Ihr Handy klingelte irgendwo, und sie machte sich auf die Suche danach.
Was nicht leicht war, denn in ihrem Atelier herrschte, seitdem sie hier wohnte, ein ziemliches Chaos.
Gestern hatte sie bis in die Nacht hinein gearbeitet. Im August hatte sie eine Ausstellung in Rostock, bis dahin mussten noch ein paar Bilder fertig werden.
Wie besessen, Kopfhörer mit lauter Rockmusik auf den Ohren, hatte sie an einem Bild gemalt, das den Strand in Vitte darstellte.
Ah, da war ja ihr Handy. »Ja?«, fragte sie atemlos.
»Ich bin’s.«
»Hallo, Bille.«
Bille war eine alte Schulfreundin aus Berlin. Die beiden hatten den Kontakt nie abbrechen lassen, auch wenn sie sich in den letzten Jahren nur selten gesehen hatten.
»Was machst du so?«, fragte ihre Freundin.
»Rufst du extra an, um mich das zu fragen, Bille? Für gewöhnlich schläfst du um diese Zeit doch noch.«
Bille gähnte herzzerreißend, als wolle sie demonstrieren, dass sie tatsächlich noch müde war. »Ich hab miserabel geschlafen, bin früh aufgewacht und dachte, ich rufe mal meine alte Freundin Theresa an und erkundige mich, wie’s ihr so geht.«
»Gut geht’s ihr.«
»Du klingst auch richtig gut. So aufgeräumt und fröhlich.«
Theresa lachte. »Wenn du wüsstest, Bille. Bei mir geht gerade alles drunter und drüber. Ich hab mich von Cornelius getrennt und hause seitdem mit Sack und Pack in meinem Atelier.«
»Und das erzählst du mir erst jetzt?«
»Entschuldige, aber du hast selbst genug um die Ohren.«
»Du wolltest mich schonen? Komm schon, Theresa, wozu sind Freunde da, wenn man sich nicht bei ihnen ausheulen kann?«
»Ich muss mich nicht ausheulen, Bille.« Das musste sie wirklich nicht. Nach ihrer Trennung hatte sie nicht ein Mal das Bedürfnis gehabt, sich auszuweinen.
»Okay, ich geb’s zu, ich bin beleidigt, dass du mir nichts gesagt hast.«
Theresa kannte ihre Freundin viel zu gut und wusste, dass das nicht ernst gemeint war. Sie lachte.
»Hat er dich rausgeworfen?«
»Nein, ich bin gegangen.«
Jetzt lachte Bille lauthals. »Gegangen? Wie lange kennen wir uns jetzt, Theresa?«
»Na schön, ich bin wie ein Berserker aus der Wohnung gestürmt.«
»Das klingt schon eher nach dir. Und es klingt nach jeder Menge Stress.«
»Nein, komischerweise überhaupt nicht. Seit drei Wochen habe ich endlich wieder das Gefühl, als gehöre mein Leben mir.«
»Verstehe.« Bille kannte Cornelius, wahrscheinlich verstand sie es wirklich. »Du hast einen Vaterkomplex, und Väter neigen nun mal dazu, einem Vorschriften zu machen und mit Argusaugen über einen zu wachen.«
»Ach ja?« Woher glaubte Bille das zu wissen? Sie war ohne Vater aufgewachsen, hatte ihn nicht mal kennengelernt.
»Komm schon, du weißt, dass du einen Vaterkomplex hast, Theresa.«
»Das meinte ich nicht. Es bezog sich auf deine Aussage, dass Väter Vorschriften machen und so.«
»Ich hab mal so was gehört.« Bille seufzte. »Darf ich ehrlich sein? Gut, dass du den alten Griesgram endlich los bist.«
Theresa verkniff sich eine Erwiderung.
»Und jetzt? Du kannst doch nicht ewig in deinem Atelier wohnen.«
»Drei Wochen reichen mir eigentlich schon völlig.«
»Warum suchst du dir keine Wohnung?«
»Weißt du, wieso ich mit dir befreundet bin, Bille?«
»Weil ich immer den Durchblick habe? Verständnisvoll und mitfühlend bin?«
Theresa musste wieder lachen. »In ungefähr der Reihenfolge, ja. Nein, im Ernst, im Moment sieht es mit freien Wohnungen sehr schlecht aus. Ganz abgesehen von den Mietpreisen. Wer kann sich das leisten? Arme, aufstrebende Künstlerinnen jedenfalls nicht.«
»Dann muss die aufstrebende Künstlerin eben mehr Bilder verkaufen«, schlug Bille vor.
»Deine Tipps und Ratschläge schätze ich übrigens auch.«
»Ich könnte schwören, dass das gerade sarkastisch gemeint war.«
»Ich hatte gedacht, ich könnte vorübergehend bei Ella unterschlüpfen. Fehlanzeige. Ihre Schwester braucht noch dringender Asyl als ich.«
»Wenn alle Stricke reißen, wohnst du halt eine Weile bei mir.«
»In Berlin? Nein, danke. Das ist wirklich lieb von dir, aber hier ist mein Lebensmittelpunkt. Ich liebe die Insel, ich glaube, ich möchte nie mehr woanders leben. Ich hab mein Atelier, was soll’s. Obdachlos bin ich ja nicht.«
»Ja, dann …« Ihre Freundin seufzte. »Mit mehr Tipps und guten Ratschlägen kann ich nicht dienen, tut mir leid. Du schaffst das, Theresa, du bist ein Stehaufmännchen.«
»Bin ich das? Doch, ja, du hast recht, Bille. Eine Eigenschaft, die ich von meiner Mutter geerbt habe.«
»Wie geht’s ihr eigentlich?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Theresa kurz angebunden. Sie hatte keine Lust, über Lilo zu reden und wollte eine aufkommende Diskussion gleich im Keim ersticken.
»Du könntest dich einfach mal erkundigen. Nein, schon gut. Du wolltest ja keine Tipps mehr.«
»Stimmt auffallend.« Theresa unterdrückte ein Seufzen. »Ich bin froh, dass so viele Kilometer zwischen mir und meiner Mutter liegen, Bille. Je mehr, desto besser.«
»Sie hat nur dich, Theresa.«
Theresa verdrehte die Augen. Gut, dass Bille es nicht sehen konnte. »Und die Leute aus ihrer WG und Jacques und Lionel und Peter, und wie die Kerle sonst noch heißen.«
»Du bist schon wieder sarkastisch.«
»Allerdings.«
»Ich hab mich schon viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich sage besser kein Wort mehr.«
Theresa war verstimmt, mochte das aber nicht zugeben. Bille konnte nichts dafür, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter so schwierig war. »Ich wollte dich nicht anfahren, Bille. Wir geraten immer aneinander, wenn’s um meine Mutter geht.«
Bille schwieg.
»Bist du noch dran?«
»Nein.«
Theresa lachte kopfschüttelnd. »Rufst du mich mal wieder an, um zu fragen, was ich so mache?«, fragte sie mit liebreizender Stimme.
»Na klar. Mach’s gut, Theresa.«
»Du auch.« Sie legte ihr Smartphone auf einen der kleinen Tische. Dort würde sie es hoffentlich jederzeit wiederfinden.
In ihrem Atelier standen zwei Tische, beide nicht sehr groß, und auf beiden herrschte für gewöhnlich ein heilloses Durcheinander. Gläser und Töpfe mit Pinseln türmten sich darauf, genau wie schmutzige und saubere Lappen, zwei Modellfiguren aus Holz, eine Farbmischpalette, zwei Tubenwringer, mehrere Skizzenblöcke und natürlich Tuben und Döschen mit Acryl- und Ölfarbe sowie ein großes Holzkästchen mit Pastellkreide.
Als Teenager war sie in eine Clique geraten, die nachts umhergezogen war und Graffiti an Mauern und Hauswände gesprüht hatte. Begeistert hatte sie sich ihnen angeschlossen und zum ersten Mal verliebt. In Paul. Er war siebzehn und wahnsinnig cool gewesen. Paul hatte vor nichts und niemandem Angst, pfiff auf Anstand und Moral und war irgendwann nach Amerika abgehauen. Ohne sie zu fragen, ob sie mitkommen wollte oder ihr auch nur Bescheid zu sagen.
Zwei Wochen hatte sie geheult und ihn verflucht. Dann hatte sie ihn vergessen, praktisch über Nacht, und sich in Boris verguckt, der so ganz anders als Paul gewesen war.
Jahre später hatte sie einen Zeitungsartikel über Paul gelesen. Er lebte als gefragter Künstler in Los Angeles und war steinreich geworden.
Sie gönnte es ihm von Herzen.
Im Baum vor dem Fenster sang eine Lerche, und unten vorm Haus spielten Kinder mit einem Hund.
Theresa blickte nach draußen.
Ob ich irgendwann wohl auch mal Kinder haben werde, fragte sie sich, eine richtige Familie?
Sie hatte nie eine klassische Familie gehabt. Vater, Mutter, Kind, das kannte sie nur von Freundinnen oder aus Filmen und Büchern. Ihre eigene Familie hatte nur aus ihr und ihrer Mutter bestanden, zwei Nomaden, die auf Sardinien und Rhodos gelebt hatten und von dort nach Marseille gezogen waren. Wegen Jacques, einem dunkelhäutigen Burschen mit langen Locken, der ihrer Mutter den Kopf verdreht hatte. Umgekehrt war es wohl nicht anders gewesen.
Theresa erinnerte sich noch allzu lebhaft daran, wie Lilo singend durch die Wohnung getanzt war, während Jacques am Küchentisch gesessen und filterlose Zigaretten geraucht hatte.
Als Theresa sechzehn war, waren sie und ihre Mutter nach Berlin gezogen. Nach dem Abitur hatte sie verkündet, dass sie jetzt ausziehen und für sich selbst sorgen würde.
Sie hatte genug vom Nomadenleben gehabt, aber auch von ihrer flippigen Mutter, die dauernd eine andere schrille Haarfarbe gehabt und selbstgefärbte Pluderhosen getragen hatte.
Den Kopf in den Wolken, die Fußspitzen gerade so am Boden, so hatte Theresa ihre Mutter früher bezeichnet. Wahrscheinlich hatte sich das bis heute nicht geändert.
Lilo war wenig später nach Ibiza und von dort nach Mallorca gezogen, wo sie erstaunlicherweise immer noch lebte.
Gesehen hatten sich die beiden eine ganze Weile nicht mehr.
Das einzig Gute an ihrem Nomadenleben war, dass Theresa fließend französisch und ziemlich gut italienisch sprach.
Wenn es mit der Kunst nichts geworden wäre, dann hätte sie sich wahrscheinlich als Dolmetscherin oder Fremdsprachensekretärin durchgeschlagen.
Sie schlüpfte in die Sachen, die sie gestern getragen hatte, putzte sich die Zähne in dem kleinen Handwaschbecken und band ihr blondes langes Haar zu einem Zopf.
Ich brauche dringend eine Wohnung …
Sie atmete die aufkommende Resignation weg und beschloss, einen langen Spaziergang zu machen.
INDISCHROT
La Caleta auf Mallorca
Kaum hatte Lilo die verschrammte Holztür hinter sich zugezogen, als zwei Arme sie von hinten umschlangen.
»Na, meine Schöne. Was haben wir denn heute noch vor?«
»Lass das, Gerard!«
Der hatte ihr gerade noch gefehlt. Konnte er sie nicht einfach mal in Ruhe lassen und Evelin befingern? Das machte er doch sonst auch ganz gern.
»Ach, komm schon, Lilo.«
»Verschwinde, Gerard, ich habe zu tun.«
Sie hatte sogar eine Menge zu tun, aber für Gerard, der seit ein paar Wochen bei ihnen wohnte, war das natürlich unvorstellbar. Beschäftigt sein, ein Fremdwort für ihn. Er lag den lieben langen Tag in der Hängematte, den Hut ins Gesicht gezogen, und ließ die Seele baumeln.
Dabei war sie selbst nun wirklich nicht der Typ für Stress. Im Gegenteil, warum sonst lebte sie wohl hier?
Evelin kam aus der Finca, halbnackt wie immer, und rannte kichernd über den Rasen. Ob sie was geraucht hatte?
Lilo wollte etwas wie »Dich schickt der Himmel, Evelin!« rufen, aber Gerard war schneller.
»Evelin!« Er lief zu ihr und umfasste ihre schlanke Taille. »Wie unglaublich du heute wieder aussiehst.«
Evelin kicherte erneut. Na klar hatte sie was geraucht.
Sie hüpfte über den Rasen, Gerard hinter ihr her.
Es gab Momente, da fragte Lilo sich, wie lange sie es hier wohl noch aushalten würde. Inmitten von Menschen, die es mit nichts, wirklich gar nichts allzu genau nahmen.
Die schon morgens bekifft waren – oder noch immer – und bis mittags im Bett lagen, die es nicht interessierte, dass sich in der Küche das dreckige Geschirr türmte, die die Zahnbürsten untereinander tauschten und bis drei Uhr nachts zusammensaßen und ironischerweise darüber diskutierten, warum das Leben kein Ponyhof war.
Was mache ich hier eigentlich?, fragte sie sich in diesen Momenten.
Sie selbst war ein entspannter, unerschütterlich optimistischer Mensch, aber sie brauchte eine gewisse Routine, einen halbwegs normalen Alltag. Sie stand immer sehr früh auf, machte ihre Yogaübungen, trank danach einen Tee und zog sich um. Anschließend ging sie in ihre Werkstatt und sorgte dafür, dass sie die nächste Zeit genug zu essen haben würde.
Dass sie die anderen häufig mit durchfütterte, ärgerte sie schon lange.
Evelin rannte sie beinahe um, Gerard war ihr noch immer auf den Fersen.
Lilo seufzte kopfschüttelnd, nahm die Holzkiste mit der frisch gebrannten Keramik und schleppte sie ins Haus. Mit der Hüfte stieß sie die Tür zu ihrem Zimmer auf und stellte die Kiste auf den verkratzten Holztisch. Mit einer fahrigen Geste schob sie sich ihre Brille auf den Kopf und setzte sich im Schneidersitz auf den Fußboden, die Füße unter ihrem roten langen Kleid.
Was mache ich hier zum Teufel? Ich sollte mir irgendwas suchen, wo ich allein für mich verantwortlich bin …
Das überraschte sie selbst. Früher hatte sie gern mit anderen Leuten zusammengewohnt. Es hatte ihr ein Gefühl von Familie und Zugehörigkeit vermittelt. Jetzt nervte es sie meistens.
Irgendwer hörte laut Pink Floyd, und sie schloss die Augen.
Ihr momentanes Mantra Ich bin die Ruhe selbst war sonstwohin.
Es half nichts, selbst wenn sie es zehnmal hintereinander im Geiste aufsagte. Sie war zurzeit nun mal nicht die Ruhe selbst. Sie war zerstreut, fahrig und spürte einen leisen Wutknoten im Bauch, der früher oder später aufspringen würde. Rasch stand sie wieder auf, wobei ihr schwindelig wurde. Sie sollte eine Kleinigkeit essen.
Sie schlüpfte aus der Tür und lief in die geräumige Küche, in der es wie immer chaotisch aussah. Schmutziges Geschirr stapelte sich in und neben der Spüle, dreckige Töpfe standen auf dem Herd, eine Pfanne mit Resten von Scampi mit Tomatensauce stand mitten auf dem Tisch, daneben ein überquellender Aschenbecher und eine angebrochene Flasche Manto Negro.
Gott, wie sie die Nase voll von alldem hatte! Mit einer wütenden Handbewegung schob sie Flasche, Pfanne und Aschenbecher zur Seite, so dass Platz für einen Teller war, und bestrich eine dicke Scheibe Brot mit selbstgemachter Knoblauchbutter. Das Brot hatte sie gestern Abend gebacken, während die anderen im Garten gesessen und Wein getrunken hatten.
Hab ich sie eigentlich noch alle?
Sie aß das Brot und wischte sich die Finger am Kleid ab, weil es kein sauberes Handtuch mehr gab.
Seit dem frühen Morgen hatte sie in der Werkstatt gestanden, getöpfert und anschließend gebrannt.
Und die anderen? Hatten es sich gemütlich gemacht.
Ich hab sie definitiv nicht mehr alle!
Sie war verschwitzt und müde. Sie würde früh schlafen und vorher noch eine Runde schwimmen gehen.
Und dieses Chaos hier sollte sonst wer beseitigen. Sie jedenfalls nicht!
Dass Gerard ihr gefolgt war, hatte sie nicht bemerkt.
Umso verblüffter war sie, als sie aus dem Wasser kam und ihn lang ausgestreckt auf ihrem Handtuch antraf.
Sie hätten ihn längst rausschmeißen sollen. Aber bis die anderen sich zu irgendetwas entscheiden konnten, verging mal eben ein Jahr.
Er streckte eine Hand nach ihr aus. »Setz dich doch. Du bist ganz nass.« Er grinste breit.
Und sein dämliches, süffisantes Grinsen konnte er sich sonstwo hinstecken!
»Ich war schwimmen, Gerard, da wird man nun mal nass.«
Sie hatte ihn von Anfang an nicht gemocht. Er war einer dieser Männer, die etwas Schmieriges an sich hatten. Und dann sein ständiges Grinsen. So als würde er alles und jeden belächeln.
»Hau ab, Gerard, ich will allein sein.«
Manchmal wünschte sie, sie wäre ein Mann und könnte Gerard einfach eins auf die Nase geben. Genau danach war ihr gerade.
Die Sonne ging bald unter, und sie wollte dann unbedingt allein hier sein. Den Sonnenuntergang an dieser Stelle erleben zu können war atemberaubend. Ohne Gerard wohlgemerkt.
Vielen Dank, Gerard, du verdammter Schmarotzer und Dauergrinser …
»Ich hab mir übrigens mit Absicht diesen Platz ausgesucht«, zischte sie.
»Na klar, damit wir zwei Hübschen ganz allein sind, oder?«
»Nein, damit ich ganz allein bin, Gerard.«
Noch bevor sie etwas tun oder sagen konnte, hatte er sie an sich gezogen und auf den Mund geküsst. Igitt, er schmeckte nach Tabak und Manto Negro. Und da war noch etwas. Ingwer?
Sie stieß ihn weg und boxte ihn in den Magen. »Lass das, du Blödmann!«
»Sei doch nicht so zickig. Ich dachte, wir machen es uns ein bisschen gemütlich.«
»Du machst es dir dauernd gemütlich, das ist nichts Neues.«
Er lachte.
»Okay, ich sag’s etwas deutlicher, Gerard: Verschwinde!«
Er lachte noch mehr.
Und Lilo wurde noch wütender. Am Ende würde sie ihm wirklich eine scheuern, verdient hätte er es dreimal.
»Ich. Will. Allein. Sein!«, brüllte sie und tippte sich an die Stirn. »Du hast’s nicht so mit dem Begreifen, oder?«
Er setzte sich träge auf und zündete sich eine Selbstgedrehte an.
»Mach die Zigarette aus!«
Er inhalierte tief und grinste sie unverschämt an.
»Mach sofort die verdammte Zigarette aus!«
»Hier ist Wildnis, freie Natur, Süße. Und ich werde nach Herzenslust rauchen. Apropos Lust …« Er streckte wieder die Hand aus.
Lilo sprang einen Schritt zurück und funkelte ihn an.
Es war verrückt, aber in diesem Moment ging ihr durch den Kopf, dass ihr niemand zu Hilfe kommen würde, selbst wenn Gerard gleich über sie herfiele. Sie könnte sich die Seele aus dem Leib schreien, und niemand würde reagieren.
Ganz einfach, weil es hier niemanden gab, der sie hören würde. Und von den anderen würde es keinen interessieren …
Diese Erkenntnis traf sie wie ein Faustschlag. Und es war verblüffend heilsam.
»Steh auf!«, fauchte sie ihn an.
»Was?«
»Beweg deinen Hintern, Gerard, du liegst auf meinem Handtuch!«
»Ist schön weich.«
Sie hatte eine ganze Menge äußerst kreative Schimpfwörter auf Lager, die ihr in diesem Augenblick einfielen. Aber sie biss sich auf die Zunge. Vergeudete Lebenszeit!
»Steh auf!«
Er klemmte sich die Zigarette in den Mundwinkel und stand in Zeitlupe auf.
Mit einer raschen Bewegung hatte sie sich das Badelaken geschnappt und mit einer weiteren darin eingewickelt. Sie hob ihre große Basttasche auf, schulterte sie und ging los.
»Wo willst du denn hin, Süße?«
»Irgendwohin, wo du nicht bist!«
Sie hörte ihn lachen. Und sie hörte, dass er hinter ihr herkam.
Sie lief schneller, was schwierig und verflucht anstrengend im Sand war.
»Warte doch, Lilo! Warum überzeugst du dich nicht von meinen Liebeskünsten?«
Sie musste lachen, sie konnte nicht anders. »Liebeskünste? Entschuldige, dass ich lache. Da hat mir Evelin aber was ganz anderes erzählt.«
Im nächsten Moment hatte er sie von hinten gepackt und zu Boden geworfen. Mit der Nase landete sie im warmen Sand und spürte gleich darauf ein Knirschen zwischen den Zähnen. »Spinnst du! Geh runter von mir!«
Er drehte sie auf den Rücken und setzte sich auf sie.
Lilo blieb nicht nur die Spucke weg, auch die Luft wurde knapp.
»Das ist nicht mehr witzig, hörst du?«, blaffte er.
»Nein«, keuchte sie, »das ist echt nicht mehr witzig. Ich schreie, Gerard!«
»Tu das.« Er wartete geduldig ab, doch es kam kein Laut aus ihrer Kehle. Wie auch, wenn sie noch nicht mal genug Luft zum Atmen hatte? Er grinste wieder und zerrte am Handtuch.
Das wagt er nicht! Er wird mich nicht …!
»Pfoten weg!«, schrie sie, und urplötzlich kehrte ihre Kraft zurück. Sie verpasste ihm einen heftigen Stoß, von dem er ganz offenbar so überrascht war, dass er das Gleichgewicht verlor und hintenüberkippte.
Lilo nutzte die Gelegenheit, kam auf die Füße und rannte los.
Das Laken löste sich, verhedderte sich kurzfristig um ihre Beine, rutschte dann aber Gott sei Dank herunter.
Lilo lief einfach weiter.
Splitternackt erreichte sie die Finca. Sie blieb stehen und lehnte sich an die Tür ihrer Werkstatt. Ihr Puls raste, und sie hatte Seitenstechen.
Das Maß war voll! Ihr ganz persönliches Fass war längst übergelaufen, sie hatte es nur ignoriert.
Henry kam aus dem Haus auf sie zu und blieb verdutzt stehen. »Was stehst du denn nackt hier rum?«
»Gerard ist … er wollte …«
»Er ist ein Schwachmat, sag ich ja immer. Aber du kennst ja die anderen, bis die sich dazu durchringen, ihn rauszuwerfen … Wir sollten abstimmen, was meinst du?« Er küsste sie auf die nackte Schulter. »Brigitte ist einkaufen. Wir könnten es uns ein bisschen auf deinem Futon gemütlich machen.« Er griff an ihre Brust.
Sie hatte genau dreimal mit ihm geschlafen. Einmal hatte er sie in der Werkstatt verführt, und der Tisch war unter ihnen zusammengebrochen. Sie hatten Tränen gelacht und sich woanders weitergeliebt. Henry hatte etwas Verführerisches an sich, dem sie nur schwer widerstehen konnte. Er konnte ungeheuer zärtlich und liebevoll sein, und er verstand es, sie zu umgarnen. Brigitte und er waren eigentlich ein Paar, doch das nahm hier niemand so genau, denn Brigitte ging auch manchmal mit Fred ins Bett. Immerhin war man untereinander so rücksichtsvoll, dass man nicht vor dem jeweils anderen herumturtelte.
»Lass mich, Henry!« Sie schob seine Hand weg. »Ich hab genug für heute.«
Nein, sie hatte genug für alle Zeiten.
Sie drängte sich an ihm vorbei und lief ins Haus.
In ihrem Zimmer begann sie ihre Klamotten aufs Bett zu werfen und achtlos in zwei große Taschen zu stopfen.
Henry erschien in der Tür und blieb stehen. »Was machst du da?«
»Ich packe.«
»Sieht echt danach aus, Lilo.«
Sie schlüpfte in ihr rotes Kleid.
»Willst du verreisen?«
»Nein, ich will weg, Henry.« Sie drehte sich zu ihm um. »Ich hab’s satt! Ich hab euch alle so was von satt!«
»Spinnst du?«, fragte er verwundert und sehr ruhig.
»Nein, ich spinne endlich mal nicht mehr. Ich hab endlich begriffen, was gut für mich ist.«
»Hey.« Er lächelte und ging nun auf sie zu. »Wir tun dir gut, wir alle hier tun dir gut, oder etwa nicht?«
»Nein, Henry.« Sie schluckte wütend. »Ihr tut mir überhaupt nicht gut.« Sie schnappte sich ihre Taschen und ging an ihm vorbei zur Tür.
Brigitte kam ihr entgegen und starrte sie an. »Ihr beide schon wieder? Das glaub ich ja jetzt nicht.«
»Lass mich durch, Brigitte«, erwiderte Lilo müde.
»Warst du wieder mit Henry in der Kiste?«
»Nein.«
»Und warum ist dein Kleid dann offen?«
»Hab vergessen, es zuzuknöpfen.«
»Wer’s glaubt.« Brigitte stieß ein Zischen aus. »Ich hab dir schon mal gesagt, lass die Finger von Henry. Ich mag’s nicht, wenn du mit ihm pimperst.«
»Er pimpert ja auch mit Line, und dagegen hast du nichts.«
Brigitte funkelte sie feindselig an. »Das ist was anderes, und das weißt du auch verdammt gut!«
»Warum ist das was anderes?« Mit einer Hand versuchte Lilo, ihr Kleid zuzuknöpfen.
Und warum stehe ich überhaupt hier und rechtfertige mich?
»Weil du attraktiv bist, Lilo! Line ist ganz niedlich, aber ein bisschen plemplem. Wenn Henry und du … das ist was anderes, verdammt!«
Musste sie das verstehen? Nein.
»Lass mich vorbei, Brigitte. Entspann dich, ich werde verschwinden.«
»Ach ja?« Diesen spöttischen Zug um den Mund hatte Brigitte manchmal. Er stand ihr nicht besonders.
»Wo willst du überhaupt hin?«, fragte Henry hinter ihnen.
»Mir fällt schon was ein.«
»Wir sollten das ausdiskutieren, Lilo.«
»Ich diskutiere mit euch gar nichts mehr aus.«
»Du kannst nicht einfach abhauen«, meinte er.
»Ich bin erwachsen, Henry, ich kann alles, was ich will.«
»Darüber wird erst mal abgestimmt«, sagte Brigitte nun sehr bestimmt.
»Du solltest doch froh sein, wenn ich nicht mehr hier bin«, meinte Lilo giftig zu ihr und schob sie einfach beiseite.
»Wir werden das ausdiskutieren!«, riefen Brigitte und Henry gleichzeitig.
Lilo lief zur Haustür, zog sie auf und knallte sie hinter sich zu.
Die beiden folgten ihr. Offenbar wollten sie sie wirklich nicht einfach so gehen lassen.
»Wir sind eine Gemeinschaft, Lilo.« Henry versuchte sie festzuhalten. »Du kannst nicht einfach abhauen, es gibt
Regeln …«
Jetzt musste sie lachen. »Regeln? Entschuldige, aber ich glaube, ich lache mich kaputt. Ihr sprecht von Regeln? Schon vergessen, dass ihr auf diese Regeln pfeift, wenn ihr sie gerade nicht gebrauchen könnt? Und seien wir doch mal ehrlich, Henry, ihr habt doch nur Schiss, dass ihr nun selber ranmüsst.«
»Wie meinst du das denn?«, wollte Brigitte wissen und baute sich vor ihr auf.
»Ihr müsst selbst dafür sorgen, dass der Kühlschrank aufgefüllt wird. Keine Lilo mehr, die arbeitet und einkaufen geht.«
Brigitte reckte das Kinn und verschränkte die Arme. »Das können wir selbst, liebe Lilo. Ich gehe auch arbeiten, und Henry …«
»Du gehst arbeiten? Interessant. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was machst du denn so?«
»Ich bin Fotomodell.«
Lilo musste so lachen, dass sie sich verschluckte.
»Was ist daran so witzig?«, fauchte Brigitte.
»Wer fotografiert dich denn, Brigitte?« Lilo suchte nach einem Taschentuch.
Warum ging sie nicht einfach? Warum stand sie sich hier die Beine in den Bauch, anstatt zu verschwinden?
Die Antwort wusste sie: weil sie leidenschaftlich gern diskutierte, deshalb. Und sie verfluchte sich in diesem Moment dafür.
Ich werd’s mir abgewöhnen. Ich schwöre es.
Brigitte war eingeschnappt. »Es gibt ganz tolle Fotos von mir. Sagt Henry auch, falls es dich interessiert. Und der Kalender in der Küche …«
»Nein, Brigitte, das interessiert mich nicht die Bohne. Und der Kalender ist von 1993. Ich werde von hier verschwinden, ihr seht mich nie wieder.«
»Und wo willst du hin?«, fragte Brigitte und verzog verächtlich das Gesicht.
»Mir fällt schon was ein.«
»Trotzdem finde ich, dass wir darüber abstimmen sollten«, beharrte Henry.
»Ihr könnt ja meinetwegen abstimmen, wenn ich weg bin«, gab Lilo zurück und verkniff sich ein Grinsen.
»Hier kann nicht jeder tun und lassen, was er will«, wiederholte er und warf Brigitte einen hilfesuchenden Blick zu.
»Doch, Henry.« Lilo strich ihm kurz über die unrasierte Wange. »Ich kann das.« Damit schulterte sie ihre beiden Taschen und ging über den Hof.
»Was ist mit deinen restlichen Klamotten, dem Geschirr?«, rief Henry ihr nach.
Sie hob eine Hand. »Lasse ich abholen.«
SCHLÜSSELBLUMENGELB
Theresa würde auf den kleinen, niedrigen alten Holztisch lindgrüne oder steingraue Kerzen stellen, da war sie sich noch nicht ganz schlüssig. Und sie würde sich vielleicht »Catherine« oder »Beatrice« kaufen, die Bilder einer Künstlerin aus Timmendorfer Strand, die sie vor ein paar Jahren in Hamburg kennengelernt hatte.
Cornelius hatte sie damals beinahe angefleht, keines der Bilder aufzuhängen, sie würden ihn verstören und um den Schlaf bringen.
Ich richte schon meine Wohnung ein, dabei hab ich noch nicht mal eine in Aussicht …
Sie schüttelte über sich selbst den Kopf, während sie barfuß den Sandweg entlanglief.
Die Sonne war leuchtend rot aufgegangen, und ein Kormoran dümpelte auf den Wellen.
Theresa blieb stehen und legte die Hand über die Augen.
Diesen Anblick würde sie lieben, bis sie alt und grau sein und vielleicht einen Rollator über die Insel schieben würde.
Die grau-blauen Wellen, die an Land schwappten, die weiße Gischt, die dabei aufspritzte, die leuchtende Sonne am Horizont, die Wolken, die wie gemalt aussahen, die blühenden Ginster- und Sanddornbüsche. Das hier war ihre Heimat, ihre kleine Oase.
Der Kormoran streckte seine glänzenden Flügel aus, um sie in den warmen Strahlen der Morgensonne trocknen zu lassen.
Theresas Magen knurrte, sie sollte eine Kleinigkeit frühstücken.
Die Konditorei war erfüllt von fröhlichem Kinderlachen.
Zwei Jungen, beide strohblond, liefen umher und spielten Fangen. Der Kleinere von beiden rannte Theresa fast über den Haufen, als sie hereinkam. »Hoppla, junger Mann.« Sie lächelte und strich ihm übers weiche Haar.
Hannah, die Konditorin, begrüßte sie mit einem »Na, schon wieder so früh unterwegs?«
Sie erwartete ihr zweites Kind, wie Theresa wusste.
»Ich hatte noch nicht mal einen Kaffee, Hannah.«
Hannah zeigte auf einen der kleinen Stehtische, die am Fenster standen. »Kaffee kommt sofort. Dazu vielleicht ein belegtes Brötchen mit selbstgemachter Marmelade?«
»Da sage ich nicht nein.«
Theresa stellte sich an den Tisch und sah den beiden Jungs zu, die kichernd und lärmend durch die Konditorei stürmten. Und sie bewunderte Hannah für deren Engelsgeduld.
Hannah brachte ihr einen großen Becher Kaffee, dazu einen Teller mit Marmeladenbrötchen. »Schwarz wie immer.«
»Ist das Erdbeermarmelade?« Als Hannah nickte, verdrehte sie die Augen. »Ich liebe Erdbeermarmelade. Danke, Hannah, Sie sind ein Schatz.«
»Gern geschehen. Dann haben Sie immer noch keine Wohnung?«
»Nein, leider.«
»Ich habe gehört, dass die kleine Wohnung über dem Schmuckladen bald frei werden soll.«
»Ich bin dankbar für jeden Hinweis.« Theresa biss in das Brötchen und verdrehte erneut die Augen. »Die ist göttlich.«
Als sie fertig gefrühstückt hatte und bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sie ihr Portemonnaie vergessen hatte.
»Ich bin so schusselig«, murmelte sie.
»Was ist passiert?«, fragte Hannah.
»Ich hab mein Geld zu Hause liegen lassen.« Sie schnaubte. »Zu Hause.«
Hannah holte einen kleinen Block und einen Stift aus dem Regal. »Kein Problem, ich schreib’s an.«
»Würden Sie das wirklich tun?«
»Natürlich. Sie bezahlen einfach beim nächsten Mal.«
Theresa hatte den kleinen Sandweg nach Selm eingeschlagen.
Eine Eidechse huschte über den Weg und verkroch sich dann in einem der Heidebüsche.
Sie blieb stehen und lauschte. Von hier aus konnte man das Meer rauschen hören. Diese Gegend mochte sie ganz besonders. Hier war es noch stiller, noch beschaulicher, noch idyllischer. Über allem lag ein Hauch Romantik. Verstreut standen, wie hingetupft, alte Fischerkaten mit Reetdächern. Und hinter jedem Busch oder Strauch vermutete man eine Fee, die all das geschaffen hatte, um einen zu verzaubern.
Am Ende schreibe ich wirklich noch Gedichte …
Sie lief weiter. Rechts von ihr lag das kleine, bezaubernde Haus, vor dem sie jedes Mal stehen blieb, wann immer sie hierherkam. Es hatte einen ganz besonderen Charme, etwas Verzaubertes an sich. Bestimmt hatte eine Fischerfamilie dort gelebt. Ein wortkarger Mann mit blauer Fischermütze und Vollbart, eine Frau mit langem Rock und Kittelschürze und eine Schar munterer, rotwangiger Kinder, die im Garten spielten und sich freuten, wenn das Boot ihres Vaters am Strand zu sehen war.
Sie war schon fast an dem Haus vorbei, als ihr ein kleines Schild ins Auge sprang: Zu verkaufen. Darunter ein Preis.
Ihr Hirn spielte ihr offenbar gerade einen Streich. Der Preis, der auf dem Schild stand, konnte unmöglich richtig sein. Niemand, der bei Verstand war, würde ein Haus mit Meerblick zu einem derart wahnwitzigen Preis verkaufen.
Sie wollte weitergehen, doch sie stand wie angewurzelt da und starrte auf das Schild. Ob der Preis ein Versehen war? Oder eins dieser Lockangebote?
Wie auch immer, ohne dass sie es wollte, hatte ihr Hirn ihr eine Botschaft geschickt: Du könntest zugreifen.
Sie hatte eine größere Summe von ihrem Großvater geerbt. Sie war seine einzige Enkelin, und er hatte bereits Jahre vor seinem Tod verkündet, dass er für ihre Zukunft gespart hatte.
Es wäre ihr lieber gewesen, wenn er sich selbst etwas gegönnt hätte, aber davon hatte er nichts hören wollen.
Noch immer starrte sie auf das Schild.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.





























