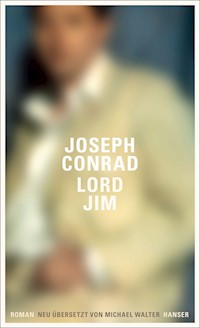9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Joseph Conrad, Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
Das unvollendete Hauptwerk von Joseph Conrad ist durchzogen von Geheimnissen und »Spannung« Auf seiner Europareise gerät der junge Engländer Cosmo Latahn nach Genua. Reise- und Lebensabenteuer zugleich wird die Europatour zur Lebens- und Ichsuche im Licht des Mittelmeers und der Geschichte. Denn über allem liegt der Schatten von Napoleon, dem Verbannten von Elba, dessen dramatische Rückkehr kurz bevorsteht. Als Hauptwerk angelegt blieb es Joseph Conrad verwehrt, seinen letzten Roman zu Ende zu bringen. So bleibt die Frage unbeantwortet, ob die Befreiung des gestürzten Kaisers der Höhepunkt dieser Geschichte hätte werden sollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Joseph Conrad
Spannung
Ein Roman aus Napoleonischer Zeit
Über dieses Buch
Auf seiner Europareise gerät der junge Engländer Cosmo Latahn nach Genua. Reise- und Lebensabenteuer zugleich wird die Europatour zur Lebens- und Ichsuche im Licht des Mittelmeers und der Geschichte. Denn über allem liegt der Schatten von Napoleon, dem Verbannten von Elba, dessen dramatische Rückkehr kurz bevorsteht.
Als Hauptwerk angelegt blieb es Joseph Conrad verwehrt, seinen letzten Roman zu Ende zu bringen. So bleibt die Frage unbeantwortet, ob die Befreiung des gestürzten Kaisers der Höhepunkt dieser Geschichte hätte werden sollen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Joseph Conrad, geboren 1857, wuchs als Waise bei seinem Onkel in Krakau auf. 1874 ging er zunächst nach Frankreich, wurde 1886 britischer Staatsbürger und machte als Seemann seine Leidenschaft zum Beruf. Als er 1890 die Seefahrt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, verarbeitete er seine Reiseerlebnisse in seinen Erzählungen. ›Lord Jim‹ (1900) und ›Das Herz der Finsternis‹ (1902) gehören zu seinen berühmtesten Werken. Joseph Conrad starb 1924 in England.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Teil I
I
II
III
IV
Teil II
I
II
III
IV
V
VI
VII
Teil III
I
II
III
Teil IV
I
Teil I
I
In tiefem Rot erglühten die Fassaden der marmornen Paläste, die sich am Hang eines reizlosen Berges drängten, dessen öder Kamm als geisterhafte, schimmernde Silhouette vor dem dämmernden Himmel stand. Über dem Golf von Genua sank die Wintersonne. Im Osten, hinter der mauerartigen Küstenlinie, war der Himmel wie dunkelndes Glas, und das offene Wasser glich einem purpurrot angelaufenen Spiegel, denn das letzte Tageslicht schien nicht weichen zu wollen. In der abnehmenden Helligkeit wirkten die Segel der wenigen, unbeweglich in der Flaute liegenden Feluken, die der prachtvollen Stadt den Bug zukehrten, rosig und heiter. Das Wasser des Hafens, eingefaßt von der langen Mole mit dem dicken runden Turm am Ende, war schon schwarz geworden. Ein größeres Schiff mit rechteckigen Segeln, das im Auslaufen begriffen war, wurde von der Flaute festgehalten und stand gegen die rote Scheibe der Sonne. Die Schiffsflagge hing schlaff herab, und ihre Farben waren nicht auszumachen. Der schlanke Mann, der zu einer abgewetzten Seemannsjacke eine fremdartige Mütze mit Troddel trug und beide Arme auf den Verschluß einer der mächtigen schwarzen Kanonen stützte, die zusammen mit dreien ihrer ungefügen Schwestern auf der Plattform des Turmes hockte, schien über den Heimathafen des Schiffes nicht im Zweifel zu sein, denn auf die Frage eines jungen Zivilisten in langem Überrock und Stulpenstiefeln, dessen frisches, freimütiges Gesicht aus den Falten eines weißen Halstuches hervorblickte, erwiderte er kurz, indem er die Pfeife aus dem Mund nahm, doch ohne sich umzuwenden:
»Das Schiff gehört nach Elba.«
Er schob die Pfeife wieder zwischen die Zähne und blickte ungesellig drein. Der elegante junge Mensch mit dem angenehmen Gesicht (es war Cosmo, der Sohn von Sir Charles Latham auf Latham Hall in Yorkshire) wiederholte leise für sich: »Nach Elba«, und blieb in stumme Betrachtung des von der Flaute gelähmten Schiffes mit der nicht zu erkennenden Flagge verloren. Erst als die Sonne im Wasser des Mittelmeeres versunken und an Bord des unbeweglichen Schiffes die nicht auszumachende Flagge eingeholt worden war, rührte er sich und wandte seine Blicke wieder nach dem Hafen. Ein imposantes englisches Kriegsschiff, das auf der Westseite, nicht weit von der Mole, festgemacht hatte, bot hier den bedeutendsten Anblick. Seine hohen Masten überragten die Dächer der Häuser. Soeben war die englische Flagge am Fahnenstock niedergeholt und durch eine Laterne ersetzt worden, deren Schein sich im klaren Dämmerlicht befremdlich ausnahm. Die Umrisse der im Hafeninnern zusammengedrängten Schiffe begannen miteinander zu verschmelzen. Cosmo ließ die Blicke über die kreisrunde Plattform des Turmes schweifen. Der Mann, der sich auf die Kanone stützte, fuhr fort, gleichmütig zu rauchen.
»Sind Sie der Wächter dieses Turmes?« fragte der junge Mann.
Der andere warf ihm einen Blick aus den Augenwinkeln zu, und als er antwortete, veränderte er seine Haltung so wenig, als spreche er mit sich selber:
»Der Turm wird nicht mehr bewacht. Die Kriege sind vorüber.«
»Wird der Eingang zu diesem Turm abends verschlossen?«
»Für jemanden wie Sie, der nachts ein weiches Bett hat, muß das eine besonders brennende Frage sein.«
Der junge Mann legte den Kopf auf die Seite und sah seinen Gesprächspartner lächelnd an.
»Ihnen scheint es jedenfalls einerlei zu sein«, sagte er. »Daraus schließe ich, daß auch ich mir darüber keine Sorgen zu machen brauche. Solange Sie hier verweilen habe ich nichts zu fürchten. Ich bin Ihnen übrigens hier herauf gefolgt.«
Der Mann mit der Pfeife richtete sich jäh auf. »Sie sind mir hierher gefolgt? Warum, im Namen der Heiligen, haben Sie das getan?«
Der junge Mann lachte, als habe er einen guten Witz gehört. »Weil Sie vor mir her gingen. Niemand sonst war in der Nähe der Mole zu sehen. Plötzlich waren Sie verschwunden. Dann entdeckte ich, daß die Tür am Fuße des Turmes geöffnet war und habe die Treppe bis zu dieser Plattform erstiegen. Und es hätte mich sehr überrascht, Sie nicht hier zu finden.«
Der Mann mit der seltsamen Troddelmütze hatte während des Zuhörens die Pfeife aus dem Mund genommen. »Aus keinem anderen Grund?«
»Nein. Aus keinem anderen Grund.«
»So etwas bringt bloß ein Engländer fertig«, sagte der andere vor sich hin und ein Schatten von Besorgnis ging über sein Gesicht. »Ihr Engländer seid ein sonderbares Völkchen.«
»Ich sehe in meiner Handlungsweise nichts Sonderbares. Ich hatte einfach Lust, aus der Stadt hinauszuspazieren. Die Mole eignete sich dazu vortrefflich. Es ist sehr hübsch hier.«
Eine sanfte Brise streifte die Männer, die einander schweigend betrachteten. »Ich bin nur ein Vergnügungsreisender«, sagte Cosmo unbefangen, »und heute morgen auf dem Landwege eingetroffen. Es war ein guter Einfall, hier heraufzukommen und Ihre Stadt im Glanze des Sonnenunterganges zu betrachten, dazu das Schiff, das nach Elba gehört. Viele solcher Schiffe dürfte es nicht geben. Sie aber, mein Freund …«
»Ich habe ebenso das Recht, mir hier oben die Zeit zu vertreiben, wie ein englischer Reisender«, fiel der Mann hastig ein. »Es ist hier sehr hübsch«, wiederholte der junge Reisende und starrte in die Dämmerung, die sich auf die Plattform des Turmes senkte.
»Hübsch?« wiederholte der andere. »Nun ja, vielleicht. Als ich das letzte Mal hier auf dieser Plattform war, zählte ich gerade zehn Jahre. Damals kreiselte eine Kanonenkugel wie besessen auf dem Steinfußboden. Ein höchst wunderlicher Anblick; man hätte sie für lebendig und von der Tollwut befallen halten können.«
»Eine Kanonenkugel!« rief Cosmo und betrachtete die glatten Fliesen, als erwarte er, Spuren jener Heimsuchung darauf zu finden. »Woher kam denn diese Kugel?«
»Sie stammte von einer englischen Brigg, die zum Geschwader von Lord Keith gehörte. Diese Brigg war recht nahe herangekommen und eröffnete das Feuer auf uns … der Himmel weiß, warum. Die Unverfrorenheit dieser Engländer! Eine einzige Kugel aus einem dieser Dinger hier«, fuhr er fort und klopfte dabei auf den Verschluß seiner Kanone, »hätte gereicht, den Kahn wegsacken zu lassen wie einen Stein.«
»Das kann ich mir gut vorstellen. Doch hat die Welt längst aufgehört, über die Furchtlosigkeit unserer Seeleute zu staunen«, murmelte der junge Reisende.
»Es gibt viele furchtlose Menschen auf der Welt, aber Glück ist besser als Mut. Die Brigg segelte ohne einen Kratzer davon. Jawohl, Glück ist besser als Mut. Es ist verläßlicher als die Klugheit und mächtiger als die Gerechtigkeit. Glück ist eine große Sache, der einzige Verbündete, den es sich wirklich verlohnt zu haben. Und ihr Engländer habt es stets gehabt. Jawohl, Signore, Sie gehören einer vom Glück begünstigten Nation an; wäre es anders, Sie stünden nicht hier auf dieser Plattform und spähten über das Wasser hinüber nach jenem Inselchen, auf dem Ihr berühmter Gegner eine letzte Zuflucht gefunden hat.«
Cosmo lehnte sich nahe der Schießscharte über die steinerne Brüstung; auf der anderen Seite der Kanone vollführte der Mann mit der Hand, die die kurze Pfeife hielt, eine unbestimmte Geste. »Ich frage mich, woran Sie denken mögen«, fuhr er gleichmütig fort. »Vielleicht sind Sie noch zu jung, um sich schon Gedanken zu machen. Verzeihen Sie meine Offenheit, doch habe ich stets sagen hören, man dürfe mit Engländern ganz ungeniert reden. Und Ihre Aussprache läßt mich nicht daran zweifeln, daß Sie Engländer sind.«
»Ich versichere Ihnen, daß ich keine vom Haß eingegebenen Gedanken hege … sehen Sie doch, das Schiff aus Elba wird immer undeutlicher. Fährt es, oder sieht das in der Dunkelheit nur so aus?«
»Die Nachtluft ist schwer. Auf dem Wasser geht mehr Wind als hier oben, wo wir stehen, doch glaube ich nicht, daß das Schiff Fahrt macht. Sie interessieren sich offenbar für das Schiff aus Elba, Signore.«
»Alles, was mit dieser Insel zusammenhängt, hat heutzutage etwas Faszinierendes«, gestand der junge Reisende. »Sie haben eben gemutmaßt, ich sei zu jung, um mir Gedanken zu machen. Sie selbst sehen nicht viel älter aus als ich. Ich frage mich, was Sie wohl denken mögen?«
»Die Gedanken eines einfachen Mannes, Gedanken, die für einen englischen Lord nicht von Interesse sein können«, erwiderte der andere in festem, abweisendem Ton.
»Glauben Sie denn, alle Engländer seien Lords?« fragte Cosmo lachend.
»Ich habe nicht darüber nachgedacht, sondern nach Ihrem Aussehen geurteilt. Ich habe einst einen alten Mann sagen hören, die Engländer seien eine großspurige Nation.«
»Ach nein!« rief der junge Mann und lachte wieder sein leises, angenehmes Lachen. »Ich wiederum habe einst einen alten Mann sagen hören, wir seien eine Nation von Händlern.«
»Nazione di mercante«, wiederholte der Mann langsam, »nun, auch das mag zutreffen. Jeder Greis hat seine eigenen Wahrsprüche.«
»Der Gedanke ist mir noch nie gekommen«, sagte Cosmo und schwang sich lässig auf die steinerne Brüstung des Turmes. Er stützte einen Fuß auf die schwere Lafette der Kanone und heftete die klaren Augen auf den dunkelroten Streifen, den die scheidende Sonne am westlichen Horizont hinterließ wie eine klaffende Schnittwunde im gequälten Körper des Weltalls. »Jeder Greis hat seine eigenen Wahrprüche«, wiederholte er nachdenklich. »Das stimmt wohl. Das Leben der Menschen ist so unterschiedlich … und von welcher Art war die Weisheit Ihres Greises?«
»Es war die Wahrheit einer endlosen Prärie, die fast so eben ist wie das Meer«, sagte der andere ernst. »Ich vernahm seine Stimme geradeso unerwartet wie die Ihre, Signore. Die Schatten des Abends senkten sich auf mich, und kurz zuvor hatte ich im Westen, sozusagen am Rande der Welt, einen Löwen beobachtet, der ein Wild im Sprung verfehlte. Beide liefen in die Glut des Sonnenunterganges hinein und verschwanden darin. Es war, als hätte ich geträumt. Als ich mich umwandte, stand der Greis hinter mir, wenige Schritte entfernt. Meiner überraschten Miene begegnete er mit einem Lächeln. Die Brise spielte mit seinen langen, silbernen Locken. Es stellte sich heraus, daß er mich, verborgen hinter Bodenwellen und im Schilf, einen halben Tag lang beobachtet hatte, weil er nicht ahnte, was ich beabsichtigte. Ich war an Land gegangen, um in der Ebene zu wandern. Ich bin zuweilen gern allein. Mein Schiff lag in einer Bucht dieser verlassenen Küste vor Anker, etliche Meilen entfernt, zu weit jedenfalls, um von einem Landfremden, wie ich es war, zu Fuß in der Dunkelheit erreicht werden zu können. Ich verbrachte darum die Nacht in der Hütte des alten Mannes, die aus Gras und Schilf gefertigt war und sich nahe einem Teich befand, wo unzählige Vögel wohnten. Der Alte behandelte mich, als sei ich sein Sohn. Wir sprachen miteinander bis zum Morgengrauen, und als die Sonne aufging, kehrte ich nicht zu meinem Schiff zurück. Was ich an Bord besaß, war ohne Wert, ganz gewiß ließ ich niemanden zurück, der in diesem ganz besonderen Ton ›mein Sohn‹ zu mir sagte – Sie verstehen mich wohl, Signore.«
»Ich weiß es nicht genau, doch kann ich es vermuten«, lautete die Antwort, deren unbeschwerte, zugleich aber ernste Offenheit besonders knabenhaft klang und den Älteren zu einem Lächeln veranlaßte. Wenn er schwieg, wirkte seine Miene streng. Sein englischer Gesprächspartner nahm nach einem Weilchen die Unterhaltung wieder auf: »Sie desertierten also von Ihrem Schiff und taten sich mit einem Einsiedler in der Wildnis zusammen, bloß weil dessen Stimme Ihnen gefiel – das meinten Sie doch, wie?«
»Ganz recht, Signore. Vielleicht war mehr dabei als nur das. Doch zweifellos bin ich von meinem Schiff desertiert.«
»Und wo ereignete sich das?«
»An der Küste Südamerikas«, erwiderte der Mann von der anderen Seite der Kanone her, plötzlich sehr schroff. »Und jetzt ist es Zeit, daß wir uns trennen.«
Doch rührte sich keiner von beiden, und ein Weilchen standen sie stumm, wurden einer für den anderen immer schattenhafter auf dem festen Turm, der selber bei einfallender Nacht nur ein grauer Schatten über der schwarzen, reglosen See war.
»Wie lange blieben Sie bei dem Eremiten in der Wüste?« fragte Cosmo. »Und wie kam es, daß Sie ihn verließen?«
»Er war es, der mich verließ, Signore. Nachdem ich seinen Leichnam begraben, blieb mir dort nichts mehr zu tun. Während jenes Jahres hatte ich viel gelernt.«
»Was ist es, das Sie gelernt haben, mein Freund? Das möchte ich gerne wissen.«
»Signore, seine Weisheit glich nicht der Weisheit anderer Menschen, und es würde zu lange dauern, sie Ihnen zu dieser späten Stunde hier auf dem Turm auseinanderzusetzen. Ich lernte alles mögliche … zum Beispiel lernte ich, Geduld üben … Glauben Sie übrigens nicht, Signore, daß Ihre Freunde oder das Personal der Herberge Ihrer langen Abwesenheit wegen in Sorge sein könnten?«
»Ich sage Ihnen doch: ich bin erst seit gut zwei Stunden in der Stadt, und, abgesehen von den Leuten im Gasthaus, sind Sie der erste Einwohner, mit dem ich spreche.«
»Man wird nach Ihnen Ausschau halten.«
»Warum sollte man sich die Mühe machen? Es ist noch nicht spät. Warum sollte meine Abwesenheit überhaupt auffallen?«
»Warum? … nun vielleicht einfach darum, weil man um diese Stunde das Abendbrot für Sie gerichtet hat«, entgegnete der Mann ungeduldig.
»Das mag ja sein, doch verspüre ich noch keinen Hunger«, erwiderte der junge Mann lässig. »Wenn es den Leuten Spaß macht, mögen sie meinethalben die ganze Stadt nach mir absuchen.« Und gleich darauf fragte er lebhafter: »Glauben Sie, daß man hier nach mir suchen würde?«
»Nein, daran würde man wohl zu allerletzt denken«, murmelte der andere wie im Selbstgespräch. Dann hob er nachdrücklich die Stimme: »Wir müssen uns jetzt wirklich trennen. Gute Nacht, Signore.«
»Gute Nacht.«
Der Mann in der Seemannsjacke stierte den anderen ein Weilchen an und setzte sich dann die Troddelmütze mit einer entschiedenen Bewegung aufs Ohr: »Ich gehe hier nicht weg«, verkündete er.
»Ach, ich dachte Sie wollten gehen? Warum haben Sie mir denn gute Nacht gewünscht?«
»Weil wir uns trennen müssen.«
»Tja, Irgendwann einmal wird es wohl sein müssen«, stimmte Cosmo liebenswürdig zu. »Ich würde Sie gerne wiedersehen.«
»Wir müssen uns trennen, und zwar sofort.«
»Warum?«
»Weil ich allein gelassen zu werden wünsche«, sagte der andere nach einem kaum merklichen Zögern.
»Aber nicht doch! Wozu, um alles in der Welt, wollen Sie unbedingt allein gelassen werden? Was können Sie hier schon unternehmen?« widersprach Cosmo mit unerschütterlichem Wohlwollen. Dann tat er, als sei ihm ein lustiger Einfall gekommen: »Es sei denn, Sie hätten die Absicht«, fuhr er vergnügt fort, »sich hier als Teufelsbeschwörer zu betätigen.« Er verstummte und setzte dann spöttelnd hinzu: »Es gibt Leute, die glauben, daß man den Teufel herbeirufen kann.«
»So unrecht haben die nicht«, lautete die unheilträchtige Antwort. »Jeder von uns hat irgendwo einen Teufel ganz in der Nähe. Widersprechen Sie nicht, Signore, kitzeln Sie nicht den Teufel in mir wach! Sie täten gut daran, kein Wort mehr zu sagen und sich ganz friedlich davonzumachen.«
Der junge Reisende änderte seine lässige Haltung nicht im geringsten, und der Mann mit der Troddelmütze hörte ihn ganz gelassen und wie im Selbstgespräch sagen: »Ich ziehe es vor, ganz friedlich hier zu bleiben.«
Wirklich herrschte ein ganz wunderbarer Friede, der auch durch die Stimmen der beiden Männer nicht beeinträchtigt wurde. Der Friede war machtvoll und überwältigend und ergriff, wie es dem Mützenmann vorkam, rund heraus Partei für den still verstockten Engländer und gegen seine eigene, wachsende Wut. Es gelang ihm nicht mehr, eine jähe, drohende Gebärde gegen den unwillkommenen Gefährten zu unterdrücken, doch der dahinter stehende Zorn hatte sich bereits in Ratlosigkeit verwandelt. Er schob die Mütze noch mehr auf die Seite und kratzte sich den Schädel.
»Sie gehören zu den Leuten, die immer ihren Kopf durchsetzen, doch diesmal wird nichts daraus. Ich habe Sie rund heraus und in aller Ruhe aufgefordert, mich auf diesem Turm allein zu lassen. Falls Sie auf die Stimme der Vernunft nicht hören wollen …«
Cosmo drückte sich mit den Handflächen vom Rande der Brüstung ab, sprang leichtfüßig bis zur Mitte der Plattform und landete hier sicher, ohne zu schwanken. Auch seine Stimme klang ganz unbewegt.
»Eben die Vernunft ist es, von der allein ich mich leiten lasse«, versetzte er. »Ihr Verlangen kommt mir jedoch vor wie eine Schrulle. Denn was könnten Sie hier schon anstellen? Die Seevögel sind zur Ruhe gegangen, und ich habe ebenso das Recht, hier oben Luft zu schnappen, wie Sie. Also …« Da schien ihm ein Gedanke zu kommen. »Sie können sich hier doch unmöglich zu einem Stelldichein verabredet haben«, bemerkte er in ganz anderem Ton, der nicht frei war von Anteilnahme. Dieser Einfall wurde durch ein sehr schroffes, verächtliches Lachen des anderen für unzutreffend erklärt, und Cosmo murmelte ernüchtert: »Nein, das ist wohl abwegig … zwischen diesen grimmigen alten Kanonen …« Dann sagte er entschlossen: »Ich will Ihnen gern den gesamten vorhandenen Platz überlassen.« Er zog sich von der Mitte der Plattform zurück auf das Verschlußstück eines Sechzigpfünders. »Nun fangen Sie schon an mit Ihren Beschwörungen«, forderte er die schlanke, undeutliche Gestalt auf, deren Unbeweglichkeit für diesen Augenblick wie Hilflosigkeit wirkte. Die Gestalt sagte nach einem Weilchen mit großem Nachdruck:
»Es ist Ihnen gewiß nicht entgangen, daß ich Sie in jedem beliebigen Stadium unserer Unterhaltung unversehens von der Brüstung hätte stoßen können, auf der Sie da saßen.« Und nach sekundenlangem Schweigen fragte er gedämpft: »Das wollen Sie doch nicht leugnen, wie?«
»Nein, das will ich nicht«, kam die sorglose Antwort. »Es war mir gar nicht eingefallen, mich vor Ihnen in acht zu nehmen. Übrigens kann ich schwimmen.«
»Sie wissen wohl nicht, daß da Felsblöcke im Wasser liegen. Es wäre ein fürchterlicher Tod … und will der Signore nun vielleicht tun, worum ich bitte, und in seine Herberge zurückkehren, die weniger gefährdet ist als diese Plattform?«
»Sicherheit lockt mich nicht sehr. Ich glaube auch keinen Augenblick, daß Sie erwogen haben, mich hinterrücks zu überfallen.«
»Nun ja …« Die schlanke, undeutlich sichtbare, von der Troddelmütze gekrönte Gestalt gestand dies nur ungern ein: »Tja … wenn Sie es so ausdrücken … das hatte ich tatsächlich nicht vor.«
»Da haben wir’s. Ich halte Sie für einen anständigen Kerl. Immerhin bin ich nicht verpflichtet, mich Ihren Anweisungen zu fügen.«
»Sie sind ein rechter Pfiffikus«, stieß der andere erbittert hervor. »Das liegt im Blut. Wie soll man mit Leuten Ihres Schlages fertig werden?«
»Sie können versuchen mich wegzujagen«, schlug Cosmo vor. Darauf erfolgte anfänglich keine Antwort, dann verfiel sein Gegenüber in ein gemurmeltes Selbstgespräch. »Schließlich ist er Engländer.«
»Darum halte ich mich noch nicht für unbesiegbar«, bemerkte Cosmo gleichmütig.
»Ich weiß. Ich habe nämlich in Buenos Aires gegen englische Soldaten gefochten. Ich überlegte eben nur: man soll auch dem Teufel Gerechtigkeit widerfahren lassen, und Männer Ihrer Nation verkehren im allgemeinen weder mit Spitzeln, noch haben sie eine Vorliebe für Tyrannen … stimmt es übrigens, daß Sie erst seit zwei Stunden in der Stadt sind?«
»So ist es.«
»Und doch«, setzte der nur mehr als Umriß sichtbare Mann seine Überlegungen halblaut fort, »und doch seid ihr mit allen Tyrannen verbündet.«
Der ebenfalls nur noch als Umriß sichtbare Reisende sagte ruhig in die sinkende Dunkelheit:
»Sie wissen nicht, wer meine Freunde sind.«
»Nein, das weiß ich nicht, doch werden Sie vermutlich weder mit den Sbirri von Piemont gemeinsame Sache machen noch mit irgendwelchen Geschichten zu den österreichischen Spitzeln rennen. Und was nun die Pfaffen angeht, die überall ihre langen Nasen reinstecken …«
»Ich kenne keinen Menschen in Italien«, unterbrach der andere.
»Das wird sich bald ändern. Menschen wie Sie machen überall Bekanntschaften. Doch nicht das ist es, was ich fürchte, sondern müßiges Geschwätz mit Fremden. Darf ich von Ihnen, dem Engländer, erwarten, daß er nichts von dem erzählt, was er vielleicht zu sehen bekommen wird?«
»Sie dürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, welche gesetzwidrige Handlung Sie hier vornehmen können. Ich sterbe förmlich vor Neugier. Sind Sie vielleicht wirklich eine Art Zauberer? Na, fangen Sie schon an! Ziehen Sie Ihren Zauberkreis, oder was Sie da schon machen, und beschwören Sie die Geister der Toten.«
Die Antwort auf diese in einem Ton zwischen Scherz und Ernst gehaltene Anrede war ein gedämpftes Knurren. Cosmo beobachtete vom Verschlußstück der Kanone aufmerksam die Bewegungen jenes Mannes, der so heftig gegen seine Anwesenheit protestiert und der ihm nun nicht mehr die geringste Beachtung zu schenken schien. Es waren nicht die Bewegungen eines Zauberers, wenigstens wurden keine magischen Ringe beschrieben. Die Gestalt war nach der dem Meer zugewandten Seite des Turmes hinübergetreten und zog dort unaufhörlich etwas aus der Innentasche ihrer Jacke. Der junge Engländer glitt von seiner Kanone herab, ohne den gespannten Blick abzuwenden, trat Schritt für Schritt näher und blieb endlich stehen, wobei er erstaunt ausrief: »Beim Himmel, der Bursche will angeln!« Die Überraschung verschlug Cosmo sekundenlang die Sprache, doch dann platzte er heraus: »Und darum diese Geheimniskrämerei? Das ist doch wirklich der dümmste Schwindel …«
»Kommen Sie näher, Signore, doch vermeiden Sie es, mit den Füßen in die Angelschnur zu geraten … sehen Sie diese Dose?«
Die Köpfe der beiden Männer waren einander vertraulich nahe gerückt, und der junge Reisende erblickte einen zylindrisch geformten Gegenstand, eine runde Blechdose wie sich herausstellte. Sein Gefährte drückte Cosmo die Dose in die Hand mit der Aufforderung: »Halten Sie das, bitte, Signore«, was Cosmo Gelegenheit gab festzustellen, daß der Deckel der Dose luftdicht verschlossen war. Der Mann mit der seltsamen Mütze grub in seiner Hosentasche nach Feuerstein und Stahl. Der Engländer sah überrascht, wie sein kürzlich noch so abweisender Genosse sich zwischen das dicke Rohr der Kanone und die steinerne Mauer zwängte, und sich dann so weit in die tiefe Schießscharte schob, daß außer seinen schwarzen Strümpfen und den Sohlen seiner schweren Schuhe nichts mehr von ihm zu sehen war. Nach einem Weilchen wurde seine durch die dicke Mauer gedämpfte Stimme vernehmlich:
»Wollen Sie mir jetzt die Dose geben, Signore?«
Cosmo, der nun eine Rolle bei diesem geheimnisvollen Vorgang hatte, dessen wahre Natur ihm allmählich verständlich wurde, gehorchte sogleich; er trat an die Schießscharte und schob die Dose soweit vor, bis sie die erwartungsvoll ausgestreckte Hand des Mannes berührte, der da auf dem Bauch lag und dessen Kopf über die Mauer des Turmes hinausragte.
Die tastende Hand spürte die Dose und riß sie an sich. Sogleich wurde die Angelschnur daran befestigt, deren auf der Plattform ausgelegte Schlingen abliefen, bis auch das Ende verschwunden war. Darauf drückte sich der Mann eng in die Schießscharte und verhielt sich reglos wie der Tod, während der junge Reisende bei nunmehr eingetretener Stille die Ohren nach Kräften spitzte, um auch das geringste Geräusch am Fuß des Turmes zu vernehmen. Er hörte aber nur das Schlagen einer fernen Turmuhr, irgendwo in der Stadt. Er wartete noch ein Weilchen, fragte dann aber im flüsternden Ton des willigen Spießgesellen:
»Hat schon was angebissen?«
Die kaum vernehmbare Antwort lautete:
»Nein. Aber jetzt muß der Fisch beißen.«
Cosmo fühlte seine Anteilnahme wachsen. Der Vorgang als solcher war gewiß nicht besonders aufregend, doch besaß er Reiz und Charakter eines unerwarteten Abenteuers, welches durch das geheimnisvolle Drum und Dran noch spannender wurde und überdies vor der Kulisse der alten Stadt ablief, die wie ein aus Stein gehauener Berg aufragte, geschmückt mit Lichtern, die in rascher Folge überall an der düsteren, gewaltigen Masse des Gestades aufblitzten. Im Westen war der letzte Sonnenstrahl verloschen. Der Hafen lag lichtlos, ausgenommen die Laterne am Heck des englischen Linienschiffes. Der Mann in der Schießscharte machte eine geringfügige Bewegung. Cosmos Aufmerksamkeit nahm noch zu, doch augenscheinlich geschah gar nichts. Weder hörte man Flüstern, noch war die allergeringste Bewegung am Fuße des Turmes wahrzunehmen. Plötzlich begann der Mann rückwärts aus der Schießscharte herauszukriechen und stand bald in voller Größe vor seinem ungebetenen Helfer.
»Es war da und ist wieder fort«, sagte er. »Haben Sie was gehört, Signore?«
»Keinen Laut. Es war wohl das Gespenst eines Bootes – denn Sie reden doch wohl von einem Boot, wie?«
»Si. Und ich hoffe, man hat es auch an Land für ein Gespenst gehalten, falls man es gesehen hat. Das englische Schiff schickt des nachts selbstverständlich ein Wachboot aus, doch das soll ja nicht nach Gespenstern Ausschau halten.«
»Das will ich meinen. Gespenster sind ohne Belang. Und kann man sich was überflüssigeres denken, als das Gespenst eines Bootes?«
»Sie gehören zu den nüchternen Denkern, Signore. Geister sind was für die Dummen – und doch, wer weiß? Immerhin klingt es merkwürdig, von dem Gespenst eines Bootes zu reden, das doch eine seelenlose Sache ist. Ein Gespenst müßte doch was Spirituelles sein, die Seele eines Menschen etwa, die keine Ruhe findet vor Liebe oder Kummer, vor Reue oder Wut. Jedenfalls heißt es immer so. Der alte Einsiedler aus der großen Ebene, von dem ich Ihnen sprach, hat mir versichert, die Toten seien viel zu glücklich, endlich das Leben hinter sich zu haben, um etwa noch auf Erden zu spuken.«
»Sie und Ihr Einsiedler!« rief Cosmo mit knabenhaft verwunderter Stimme. »Es hat wohl keinen Zweck Sie zu fragen, in welcher Angelegenheit ich Ihnen eben behilflich war?«
»Bei einer kleinen Schmuggelei, Signore. In England gibt es doch gewiß ebenfalls Zollhäuser, Signore, und also auch Schmuggler.«
»Selbstverständlich habe ich davon gehört, doch würde ich jede Wette halten, daß es darunter keinen gibt, der Ihnen ähnelt. Ich nehme auch nicht an, daß es dabei um Paketchen geht, die so klein sind wie jenes, das Sie da in Ihr Gespensterboot hinuntergelassen haben. Es war doch wirklich eines da? Sie haben tatsächlich eines gesehen?«
»Wie Sie sich überzeugen können, war jemand da, der die Schnur abgeschnitten hat. Hier, schauen Sie, die Angelschnur.«
»Alles bis auf ein ganz kurzes Ende. Vielleicht war es ein Mensch, der im dunklen Wasser schwamm. Ein Mensch mit einer Seele, die sich dazu eignet, zum Gespenst zu werden … nennen wir ihn also ein Gespenst, Signore.«
»Ja, das wollen wir«, sagte der andere leichthin. »Ganz gewiß wird mir dies morgen früh, wenn ich aufwache, vorkommen wie ein Traum. Selbst jetzt verspüre ich Lust, mich in den Arm zu kneifen.«
»Warum denn das um des Himmels willen?«
»Das ist eine heimatliche Redensart. Jawohl: Sie, Ihr Eremit, Ihr Gerede und auch dieser Turm hier, all das wird mir vorkommen wie ein Traum.«
»Ich würde sagen: Besser kann es gar nicht sein, wären nicht die meisten Leute nur allzugern bereit, über ihre Träume zu schwatzen. Nein, Signore, beachten Sie dies alles so wenig, als wäre es eine Gespenstergeschichte, eine Geschichte von bloßen Gespenstern, an die Sie ja nicht glauben. Sie haben sich mir aufgedrängt, als wären Sie der Besitzer dieses Turmes, und doch bin ich Ihnen freundschaftlich gesonnen.«
»Ich habe nicht um Ihre Freundschaft ersucht«, erwiderte der junge Reisende mit klarer Stimme, der aber alles Kränkende mangelte, so daß der andere nichts als die Feststellung eines Sachverhaltes heraushörte.
»Gewiß nicht. Ich sprach von meinen eigenen Gefühlen. Wenn ich auch in meiner Heimatstadt zur Zeit so etwas wie ein Neuling und ein Fremder bin, dürfen Sie mir doch glauben, daß es besser ist, mich zum Freunde als zum Feind zu haben. Am zuträglichsten wäre es, mich zu vergessen. Das wäre übrigens auch das liebenswürdigste.«
»So?« fragte Cosmo teilnahmsvoll. »Wie können Sie von mir erwarten, daß ich das aufregendste Ereignis meines Lebens einfach vergesse?«
»Ihres Lebens! Sie haben noch viele Jahre vor sich, Signorino.«
»Mag sein, doch ist dies immerhin ein Abenteuer.«
»Das meine ich ja. Es stehen Ihnen so viele herrliche Abenteuer bevor, daß Sie dieses hier sehr bald vergessen werden, Signorino. Warum es also nicht gleich vergessen?«
»Nein, mein Freund. Sie sind irgendwie nicht der Mann, den man leicht vergißt.«
»Ich … Gott behüte … Gute Nacht, Signore.«
Kaum waren diese Worte über seine Lippen gekommen, rannte der Mann mit der Mütze auch schon über die Plattform, warf sich in die rechteckige, schwarze Öffnung an der Landseite des Turmes und flitzte so leichtfüßig die Treppen hinunter, daß auch nicht das leiseste Geräusch an Cosmos Ohren drang. Dieser tastete sich in der Dunkelheit behutsam die Wendeltreppe hinab. Die Tür stand offen, und er trat hinaus auf die menschenleere Mole. Er gewahrte dort nicht einmal die Spur eines flüchtenden Schattens.
Unmittelbar am Wasser stand ein niederes Gebäude mit drei Bogengängen, durch dessen geöffnete Tür matter Lichtschein drang. Es mochte sich da um eine Art Wachlokal handeln, denn davor stand ein Posten in weißem Mantel, offensichtlich ein österreichischer Soldat. Seine Wachsamkeit schien sich indessen auf die Wassertreppe vor dem Wachlokal zu beschränken, denn er ließ den jungen Reisenden so ungehindert passieren, als habe er ihn gar nicht gesehen. Tiefe Nacht hatte sich auf die langen Kais gesenkt. Vereinzelte trübe Laternen warfen mattes Licht auf das Pflaster aus grob zugehauenen Steinen, das die Füße des federnd ausschreitenden Reisenden kaum zu berühren schienen. Das erhebende Gefühl, etwas Ungewöhnliches erlebt zu haben, beschleunigte seine Schritte. Auch verspürte er Hunger und eilte seiner Herberge zu, um vorerst zu speisen und danach in Ruhe das Abenteuer zu überdenken; denn er war ganz davon überzeugt, ein Abenteuer erlebt zu haben, das erregend und zugleich unverständlich war.
II
Cosmo Latham besaß die angeborene Fähigkeit, sich auch in fremder Umgebung mühelos zurechtzufinden, eine Fähigkeit, die für einen Kavallerieoffizier höchst schätzenswert ist, die er jedoch kaum je erprobt hatte, nicht einmal während jener Monate, da er als Fähnrich in der Armee des Herzogs von Wellington im letzten Jahr des iberischen Feldzuges diente. Einem frischgebackenen Fähnrich hatte sich dazu kaum einmal Gelegenheit geboten. Sie kam ihm, diese Fähigkeit, jedoch in jener Nacht sehr zustatten, als er die ihm völlig unbekannte Stadt auf dem Weg zu seiner Herberge durcheilte, denn sie erlaubte ihm, an seine Heimat zu denken, ohne viel auf den Weg zu achten – an diese Heimat, die ihm so teuer war, darin er jeden Stein liebte und jeden Baum, und auch an die Menschen, die er dort zurückgelassen, und die er ebenfalls, jeden auf andere Weise, liebte: seinen Vater, Sir Charles, und seine Schwester Henrietta.
Latham Hall, eine große, weitläufige Anlage, die Spuren unterschiedlicher Baustile aufwies, von einem romantischen Park eingefaßt wurde und einen beherrschenden Ausblick auf die Berge von Yorkshire bot, war bereits seit den Zeiten vor der Großen Revolution Stammsitz der Lathams. Daß er dazumal der Konfiskation entging, mag seinen Grund in der Weltklugheit des damaligen Latham gehabt haben. Vermutlich vermied er es, einflußreiche und hochgestellte Persönlichkeiten vor den Kopf zu stoßen. Solche Behutsamkeit war für die späteren Lathams, Sir Charles, Cosmos Vater eingeschlossen, nicht bezeichnend.
Seine ländlichen Nachbarn hatten Sir Charles’ eigenwilliger Wesensart keinerlei Verständnis entgegengebracht. Er, dem große Intelligenz, lebhafte Phantasie und gesellschaftliche Gewandtheit gleichsam in die Wiege gelegt worden waren, sah sich der Schrullenhaftigkeit seines Vaters wegen dazu verurteilt, seine frühe Jugend tief in Yorkshire, in einer Umgebung zu verbringen, die seinem Geschmack ganz und gar nicht entsprach. Später diente er dann in der Garde, quittierte indessen bald den Dienst und unternahm ausgedehnte Reisen in Frankreich und Italien. In den Tagen vor der Revolution erwarb sich le chevalier Latham großes gesellschaftliches Ansehen in den vornehmsten Kreisen von Paris und Versailles, und zwar weniger seiner Brillanz als seiner Charakterstärke und seiner großzügigen Denkungsart wegen. Allein, er entsagte hier überraschend den Annehmlichkeiten der Freundschaft und dem Glanz des Erfolges, und reiste nach Italien weiter. In der englischen Kolonie von Florenz lernte er die beiden Fräulein Aston kennen und wurde von deren verwitweter Mutter auffallend bevorzugt. Nach etlichen Monaten beschloß er, heimzufahren. Im Verlaufe einer langen, schlaflosen Nacht, die er, in schwerem inneren Konflikt von einem der prächtigen Räume seiner florentinischen Wohnung in den nächsten wandernd hinbrachte, entschied er sich für den Seeweg. Auf diese Weise ließ es sich am leichtesten vermeiden, Paris zu berühren. Er hatte unlängst erfahren, daß der Marquise und dem Marquis d’Armand, seinen liebsten Freunden aus der glänzenden französischen Gesellschaft, in der er sich bewegt hatte, eine Tochter geboren worden war, Noch am Abend vor der Einschiffung in Leghorn galt es, neuerlich einen schweren inneren Kampf zu bestehen – doch es blieb bei der Schiffsreise. Als er nach langewährender Überfahrt den Fuß auf heimatlichen Boden setzte, hatte er bereits den Plan verworfen, sogleich nach dem Norden zu eilen und sich in seinem
Landhaus zu vergraben. Stattdessen verweilte er müßig und teilnahmslos in London und begann nur widerstrebend, die Gewohnheiten eines Lebemannes anzunehmen. Ein Bekannter, der gerade aus Italien kam, ließ ihn wissen, die ältere Miß Aston beabsichtige, einen bejahrten toskanischen Edelmann zu heiraten; im übrigen gehe in Florenz das seltsame Gerücht, Miß Molly Aston, die jüngere der Schwestern, habe kurz nacheinander zwei Freier zurückgewiesen, da sie sich als mit ihm, Charles Latham, verlobt betrachte.
Ob ihn nun der Stachel des Gewissens oder aber die Empörung trieb, Sir Charles jedenfalls machte sich stehenden Fußes nach Italien auf; seine Route kreuzte Südfrankreich. Das war ein, weiter Weg. Anfangs war er verblüfft gewesen, bestürzt, ja wütend, doch ehe er an das Ende seiner Reise gelangte, hatte er Zeit gehabt, sich mit einer Lage vertraut zu machen, die leicht lächerlich oder widerwärtig hätte werden können. Er sagte sich, daß er durch eine Heirat mit Molly Aston allen erdenklichen Scherereien ausweichen könne. So geschah es denn auch, zum Wohlgefallen der ehrbaren Gesellschaft, und nach zwei weiteren im Auslande verbrachten Jahren kehrte er mit seiner Frau zurück, in der Absicht, sich endgültig im Schlosse seiner Ahnen niederzulassen, welches den beherrschenden Ausblick auf eine weitläufige, romantische Szenerie gewährte, die er für eine der prächtigsten dieser Erde hielt.
Molly Aston war zu ihrer Zeit schön genug gewesen, um fahrende Sänger und mindestens einen italienischen Bildhauer zu inspirieren; doch als Cosmo älter wurde, begriff er allmählich, daß seine Mutter innerhalb des Familienkreises ein Nichts gewesen war. Das bedeutendste Ergebnis ihrer Initiative war sein Name. Sie hatte darauf bestanden, ihn Cosmo zu nennen, weil die Astons in grauer Vorzeit über einen florentinischen Ahnherrn angeblich mit den Medici verwandt gewesen waren. Cosmo war blond, und der Name alles, was seine Mutter ihm vermacht hatte. Seine Schwester Henrietta hingegen war eher der Typ der dunklen Schönheit. Lady Latham starb, als beide Kinder noch klein waren. Zu Lebzeiten hatte sie Latham Hall in gleicher Weise zur Zierde gereicht wie ein Standbild das getan hätte. Die Ausübung ihrer Schlüsselgewalt beschränkte sie auf die Anordnung der Mahlzeiten. In ihr verbanden sich ausgeprägte Pedanterie und eine schon ans Wunderbare grenzende intellektuelle Bedeutungslosigkeit mit einem Temperament, das sie gewiß veranlaßt hätte, sich der Geselligkeit, den Zerstreuungen, ja der Ausschweifung zu ergeben, hätte sie sich nicht mit achtzehn Jahren heftig in jenen Mann verliebt, der sie dann auch heiratete. Nunmehr bestanden Zerstreuung und Ausschweifung einzig darin, daß sie lange Briefe an unzählige Freunde und Verwandte in der ganzen Welt schrieb, von denen sie nach ihrer Heirat kaum noch einen zu Gesicht bekam. Sie beklagte sich nie. Ihre geheime Furcht vor allem selbständigen Handeln und die verborgene Glut ihres Temperaments bestimmten sie, sich bedingungslos dem Willen von Sir Charles zu unterwerfen. Es wäre ihr nicht im Traume eingefallen, Pferd und Wagen für einen Besuch in der Nachbarschaft zu verlangen, doch wenn ihr Gatte bemerkte: »Ich halte es für ratsam, my Lady, da und da Visite zu machen«, strahlte sie, erwiderte eifrig: »Gewiß, Sir Charles«, und eilte, sich ungemein prächtig (vielleicht wegen des Tropfens Medici-Blutes in ihren Adern), aber auch sehr geschmackvoll herauszuputzen.
Wie nun die Jahre dahingingen, alterte Sir Charles schneller, als in der Ordnung gewesen wäre, ja er wurde gar ein wenig feist, doch konnte sich niemand darüber täuschen, daß er zu seiner Zeit ein schöner Mann und die Vernarrtheit seiner jungen Braut irgendwie gerechtfertigt gewesen war. Was Politik anlangte, so war er weniger ein waschechter Tory, als vielmehr ein Anhänger von Pitt. Er liebte sein Vaterland und glaubte an seine Größe, seinen überlegenen Wert, seine unbezwingliche Macht. Nichts vermochte ihn in seinem Festhalten an allen möglichen nationalen Vorurteilen zu erschüttern. Für Edelleute und den Landadel hatte er nichts übrig, die elegante Welt verachtete er, und mit »Emporkömmlingen« jeder Spielart wollte er nichts zu tun haben. Ohne geradezu ein edles Herz zu besitzen, war er doch liebenswürdig und gastfrei. Er war für seine angeborene Großzügigkeit so bekannt, daß sich niemand wunderte, als er einer französischen Flüchtlingsfamilie, dem Marquis und der Marquise d’Armand samt ihrer kleinen Tochter Adèle, Zuflucht in seinem Haus in Yorkshire bot. Die d’Armands waren praktisch mittellos in England eingetroffen, wenn auch begleitet von zwei Dienstboten, welche Gefahr und Elend der Flucht vor den Ausschreitungen der Revolution mit ihnen geteilt hatten. Die Anwesenheit all dieser Personen in Latham Hall – ein Zustand der anfänglich als Improvisation galt, sich aber durch etliche Jahre fortsetzte – beeinträchtigte das seelische Gleichgewicht der elegant gekleideten, müßigen Lady Latham nicht im geringsten. Denn waren die d’Armands nicht vor Jahren in Frankreich aufs engste mit Sir Charles befreundet gewesen? Weiterreichende Neugier verspürte sie nicht. Der Umstand, daß die Marquise die Königin von Neapel zur Taufpatin hatte, machte ihr einigen Eindruck. Im übrigen waren das für sie nur etliche Personen mehr in den Dienstbotenquartieren, am Eßtisch und im Salon, wo man die Abende verbrachte.
An einer der Wände dieses Salons befand sich unweit der Decke ein abgeschirmtes Licht, das den gelbseidenen Leibrock eines porträtierten Latham beschien, dessen rötliches Gesicht über dem feinen Weißzeug auch das seines eigenen Kutschers hätte sein können, wäre nicht der sensible Mund gewesen. Abgesehen von diesem schönen Farbfleck war der große Raum mit den auf die Terrasse blickenden Fenstern düster (es waren eben diese Fenster, durch welche Sir Charles gewohnheitsmäßig den Sonnenuntergang betrachtete) und wirkte so ungemein weitläufig, daß seine Benutzer einschließlich Sir Charles zu substanzlosen Schatten wurden, deren Reden große, fast unerleuchtete Entfernungen zu überwinden hatten.
Auf der einen Seite des Kamins aus italienischem Marmor (einer Neuerung, von Sir Charles eigenhändig entworfen) glitzerten in verschwenderischer Fülle die Juwelen der prächtig gekleideten und lässig auf ein Sofa hingestreckten Lady Latham, und gegenüber ruhte die Marquise auf einer niedrigen Couch, die Füße von einem Schal der Lady Latham bedeckt. Auf ihrer Flucht vor dem Schrecken hatten die d’Armands nicht viel mehr als das nackte Leben retten können, und das Leben der Marquise war mittlerweile ein recht ungewisser Besitz geworden.
Sir Charles spürte das vielleicht deutlicher als ihr Gatte, der Marquis. Sir Charles wußte noch sehr wohl, wie liebenswert selbst bei wechselnder Stimmung, beim Übergang von Scherz zu Ernst, wie reizvoll und bezaubernd, wie voller Charme und Unternehmungslust die Marquise gewesen, entschieden die klügste wie auch die schönste Frau am französischen Hofe. Ihre Stimme, wie sie ihn klar, aber matt über die Entfernungen im Salon hinweg erreichte, ergriff ihn tief, und die Erinnerung an eine bedeutende Neigung und die Ehrfurcht angesichts eines bitteren Mißgeschickes färbte den Ton seiner Antwort. Gelegentlich ließ sich Lady Latham mit einer in alltäglichem Tonfall gemachten Bemerkung vernehmen; das veranlaßte Sir Charles, seinen ausgesucht höflichen Antworten eine Prise Barschheit beizumengen und bei sich zu vermerken, daß aus dem Munde dieser Frau selbst das Vaterunser banal klinge. Und in den langen Gesprächspausen hing jeder den eigenen Gedanken nach, so ratlos und rastlos wie die Welt mit ihren Meeren und Kontinenten, die da, verschönt von dem prachtvollen Sonnenuntergang, am Ende der Terrasse begann: die weite Welt, die, erfüllt vom Streit der Ideen und dem Kampf der Nationen, durch die vielleicht stürmischste Epoche ihrer Geschichte ging.
Die im italienischen Kamin flammenden englischen Scheite beschienen Adèle d’Armand, die still auf einem niedrigen Schemel nahe dem Lager der Mutter saß. Ihr blondes Haar, die weiße Haut und die dunkelblauen Augen unterschieden sich stark von den dunkleren Farben der Henrietta Latham, deren Locken von sattem Kastanienbraun waren und deren Augen weniger die Sanftmut, als vielmehr die Klugheit schwärzliche Glut verlieh. Ab und an wandte die kleine Französin den Kopf zu Sir Charles hin, zu dem sie in diesem ereignislosen Dasein eine töchterliche Neigung entwickelt hatte.
In jenen Tagen bekam Adèle d’Armand ihren eigenen Vater nur selten zu Gesicht. Der Marquis war meistens abwesend. Jede solche Abwesenheit stellte einen Akt der Ergebenheit gegenüber seinen im Exil lebenden Fürsten dar, die das zweifellos zu schätzen wußten, Ergebenheit bei einem Sproß dieser Familie jedoch für selbstverständlich hielten. Ihre Wertschätzung für den Marquis äußerte sich hauptsächlich darin, daß sie ihn auf weite, gefährliche Reisen an norddeutsche und oberitalienische Höfe entsandten. Bei der allgemeinen Zerrüttung überkommener Ordnungen erwiesen sich alle diese Unternehmungen als nutzlos, wie denn niemand je eine herabstürzende Lawine durch Intrigen und Verhandlungen aufgehalten hat. In der Person des Marquis verband sich indessen die ungetrübte Erkenntnis dieser tiefen Wahrheit mit jenem Enthusiasmus, der gerade die Hoffnungen hervorbringt, von denen er sich nährt. Der Marquis nahm die Weisungen für seine verzweifelten Missionen mit größter Gemessenheit entgegen und machte sich auf den Weg, sobald er seine kränkliche Frau und sein stilles Kind in Latham Hall umarmt und eine ernste Unterredung mit seinem würdevollen englischen Freund geführt hatte, vor dem er nicht einen seiner Gedanken und keine seiner Hoffnungen verborgen hielt. Und Sir Charles billigte beides: denn die Gedanken waren nüchtern und bar der lächerlichen Illusionen, die alle Verbannten hegen, was Sir Charles’ Vernunft und seiner geheimen Verachtung aller großen Aristokraten zusagte, und die Hoffnungen teilte Sir Charles unbedenklich, gründeten sie doch auf des Marquis Glauben an Englands ungebrochene Macht und Beharrlichkeit.
So spazierten sie etwa eine Stunde lang auf einem von Lorbeerbüschen gesäumten Weg: Sir Charles schwerfällig und würdevoll wie ein kränkliches Kind Jupiters, der Marquis mit verhaltenem Schritt, vorgebeugt, mit zerfurchter Stirn, gemessen und leidenschaftslos sprechend. Sir Charles’ Weisheit äußerte sich in knappen Sätzen, welche Verachtung für die täppische Tätigkeit und die kurzsichtigen Meinungen der Menschen mit gefestigter Zuversicht verbanden.
Nach dem Friedensschluß von Amiens vertauschten die Marquise und Adèle den Aufenthalt in Latham Hall mit dem entbehrungsreichen, ungewissen Dasein fast mittelloser Emigranten in London, weil der Graf von Artois, das Haupt der Dynastie im Exil, den Wunsch geäußert hatte, den Marquis stets um sich zu haben. Einen stärkeren Beweis seiner Anhänglichkeit an die Sache des Königs konnte dieser kaum geben. Man bewohnte nun vier Zimmer in einem schmutzigen Haus aus gelben Ziegelsteinen, wohin man über eine enge, steile Stiege gelangte. An Personal verfügte man über eine dunkelhäutige Mulattin, die schon vor der Revolution, noch im Kindesalter, von einer Tante der Marquise von den Westindischen Inseln mitgebracht worden war; ferner über einen Menschen von unbestimmbarer Nationalität namens Bernard, der sich irgendwann einmal im Landhaus der d’Armands eingefunden und später, während der Irrfahrten, welche die Familie unternommen, ehe sie in England Zuflucht gefunden, große Fähigkeiten als Faktotum bewiesen hatte. Ihm war das Leben in Latham Hall unsagbar langweilig geworden, denn die dort herrschende Atmosphäre der Sicherheit war seinem Temperament ganz unzuträglich. Die Regelmäßigkeit des Tagesablaufes und die Gewißheit, stets reichliche Mahlzeiten vorgesetzt zu bekommen, wirkten geradezu niederdrückend auf ihn. Die Übersiedlung nach London belebte ihn außerordentlich, fand er hier doch täglich Gelegenheit, seine reichen Gaben zu bewähren. Am frühen Morgen ging er einkaufen, dann wischte er Staub in dem Zimmer, das er den Salon nannte, danach bereitete er die Mahlzeiten, und bei alledem befeuerte und beglückte ihn das strahlende, weiße Lächeln der Negerin Miß Aglae, in die er sehr verliebt war. Gegen zwölf Uhr machte er sich ein wenig zurecht und trat dann, behutsam auf den Spitzen seiner viereckigen Schuhe gehend, bei der Marquise ein, um sie mit umständlicher Kraftentfaltung und gehöriger Respektbezeigung aus ihrem Zimmer in den Salon zu tragen, gefolgt von Aglae, die, Kissen, Schal und Riechfläschchen in der Hand, nur mühsam eine ernste Miene wahren konnte. Bernard empfand ihre Gegenwart immer sehr stark und durfte darauf rechnen – sobald die Marquise auf ihr Sofa gebettet war –, ein blitzend weißes Lächeln ganz für sich allein zu bekommen. Später im Laufe des Tages pflegte dann die weißhäutige, blonde Mlle. Adèle auszugehen, um Besuche zu machen, von Aglae so dicht gefolgt wie die Nacht dem Tage folgt; und Bernard sah ihnen die Treppe hinunter nach, denn er hoffte, noch einen Blick auf ein rasch zurückgewandtes braunes Gesicht mit schönen rollenden Augen darin tun zu können. Das stimmte ihn dann für den Rest des Nachmittages glücklich. Des Abends oblag es ihm, die Besucher zu melden, welche sich die Stiege hinaufgemüht hatten, darunter einige der ersten Namen Frankreichs, welche zu Fuß durch den Schlamm oder den Staub der schmutzigen Straßen geschloffen waren, um jenes trüb erhellte Zimmer zu füllen, welches den Salon der Marquise d’Armand vorstellte.
In Ausübung dieses Amtes legte Bernard ein Paar weißer Strümpfe an, die ihm Miß Aglae einen um den anderen Abend wusch, und zwängte seine breiten Schultern in einen stramm sitzenden, schäbigen grünen Rock mit großen Metallknöpfen. Miß Aglae fand stets Zeit, ihn prüfend zu mustern oder noch rasch abzubürsten. Das waren köstliche Momente. Er hielt den Atem an, geriet in einen Zustand regloser Verzückung und drehte sich nach den schelmisch geflüsterten Anweisungen seiner exotischen Angebeteten einmal nach links, einmal nach rechts. Später dann pflegte er auf einem Schemel vor der geschlossenen Tür des Salons zu sitzen und dem wohlerzogenen, gedämpften Stimmengewirr drinnen zu lauschen. Brachen die Gäste auf, so leuchtete er ihnen auf der Treppe, indem er einen mit Kerzenresten bestückten Leuchter über das Geländer hielt. Waren seine Tagespflichten solcherart erfüllt, machte er sich auf dem Boden eines engen Korridors, der die Wohnzimmer von einer Art geräumiger Besenkammer trennte, in welcher Miß Aglae nach des Tages Arbeit ruhte, ein Lager zurecht. War Bernard unter seine beiden zerschlissenen Wolldecken gekrochen, ließ er die Kerze noch brennen und hielt den Schlaf solange fern, bis Miß Aglae ihren mit einem alten, rotseidenen Tuch umwundenen Kopf durch den Türspalt steckte – es war stets nur ihr Kopf, der im Türspalt erschien –, um im Flüsterton noch eine Unterhaltung zu führen. Das war der Augenblick, da die Bediensteten ihre Ansichten austauschen und einander Beobachtungen und Einfälle mitteilen konnten. Diejenigen der schwarzen Magd waren gescheiter als die des weißen Faktotums. Da sie den beiden Damen persönliche Dienste leistete, hatte sie Gelegenheit, mehr zu hören als ihr Anbeter. Man erwähnte den sichtlichen Verfall der Gesundheit der Marquise, und das nicht etwa klagend, sondern sachlich registrierend. Ferner war die Rede von der veränderten Lebensweise des Marquis, der häuslich und geradezu untätig geworden war.