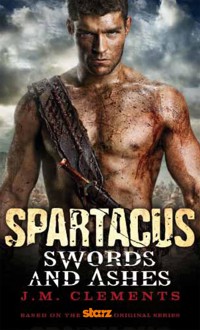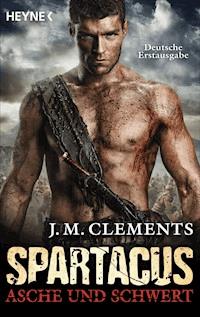
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman zur Kultserie
Die amerikanische TV-Serie
Spartacus ist mittlerweile ein internationales Phänomen. Selten sind martialisches Schlachtgetümmel und nackte Haut so explizit gewürdigt worden. Die Geschichte um den Gladiator Spartacus und seine Kampfgenossen, die sich gegen das Joch Roms erheben, ist Kult und wird weiter fortgesetzt. Alle Fans können ihren Hunger jetzt auch mit der Buchserie stillen, die neue, exklusive Geschichten mit den aus dem Spartacus-Universum bekannten Figuren erzählt. Die Spiele mögen beginnen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
ZUM BUCH
Sizilien, einige Jahrzehnte vor dem Ende der Römischen Republik:
In Capua, der Hochburg der Gladiatorenkämpfe, strebt der skrupellose Gladiatorenmeister Quintus Batiatus nach höheren gesellschaftlichen Weihen und politischer Macht. Sein bester Kämpfer ist Spartacus, ein ehemaliger thrakischer Herresführer, der sich gegen Rom aufgelehnt hat und dafür als Gladiator in der Arena den Tod finden sollte. Doch Spartacus hat sich mit seinem unerschütterlichen Willen und seiner überlegenen Kampfkraft zum ersten Gladiator des Hauses Batiatus aufgeschwungen.
Capua ist erschüttert, als eine blutige Sklavenrevolte das Haus des mächtigen Pelorus zerstört. Spartacus freundet sich mit der Sklavin Medea an, die den Aufstand angezettelt und Pelorus getötet hat. Bei den grausamen Trauerspielen zu Ehren von Perolus sollen Medea und die anderen beteiligten Gladiatoren in der Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Doch Medea überlebt das blutige Gemetzel und erhält die Ehre, ad gladium – durch das Schwert – zu sterben. Bevor das Urteil vollstreckt werden kann, geraten Spartacus und Medea in ein infames Intrigenspiel um den Besitz von Pelorus, in welches auch das Haus Batiatus verwickelt ist. Es wird noch viel Blut fließen, bis der Sieger feststeht …
Die Spartacus-Bücher erzählen neue Geschichten aus dem Universum um die Figuren der erfolgreichen TV-Kultserie. Weitere Bände sind in Vorbereitung: Die Spiele mögen beginnen …
ZUM AUTOR
J. M. Clements schreibt Romane und historische Sachbücher, zudem Drehbücher für Audiobooks und Radiohörspiele. In diesem Umfeld verfasste er Adaptionen aus dem Robin-Hood- und Dr.-Who-Universum sowie eine Geschichte der Wikinger.
J. M. CLEMENTS
SPARTACUS
ASCHE UND SCHWERT
ROMAN
Aus dem Englischen
von Martin Ruf
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die OriginalausgabeSPARTACUS: SWORDS AND ASHES
erschien 2012 bei Titan Books, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2013
Copyright © 2012 by J.M. CLEMENTS
Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
This translation of Spartacus: Swords and Ashes, first published
in 2013, is published by arrangement with Titan Publishing Group Ltd.
Redaktion: Kristof Kurz
Umschlagmotiv: Nele Schütz Design unter Verwendung
des Original-Artworks © SPARTACUS TM & © Starz Entertainment, LLC
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN: 978-3-641-12818-0
www.heyne.de
Für Andy Whitfield
1972–2011
I DIE IDEN DES SEPTEMBER
I
DIE IDEN DES SEPTEMBER
Er nahm ein Obstmesser und klopfte damit vorsichtig gegen einen Weinkelch. Das Geräusch vermochte kaum, sich in all dem Lärm um ihn herum zu behaupten. Dröhnendes Gelächter übertönte die kichernden jungen Frauen, die Trommeln und Flöten der Musiker und den Klang der Fingerzimbeln, die eine der wenigen Tänzerinnen trug, die sich noch immer auf den Beinen halten konnte.
Pelorus erhob sich mühsam, indem er sich auf dem Tisch abstützte, wodurch er seinen Gästen die Sicht auf das mit doppelten Hörnern verzierte Wappenschild seines Hauses nahm, das hinter ihm an der Wand hing. Seine Finger packten das von Weinflecken übersäte Tischtuch. Mehrere Teller rutschten in Richtung seiner Hand. Eine Lampe fiel klirrend zu Boden und rollte in das flache Becken in der Mitte des Atriums, in dem bereits mehrere Schüsseln, Äpfel, Tierknochen und eine teilweise versunkene, zur Hälfte aufgegessene Portion Trauben dahintrieben. Die Lampe flackerte und erlosch; zurück blieben ein aufsteigender Rauchfaden und eine immer weiter anwachsende Öllache auf dem Wasser.
»Freunde! Römer! Ich beschwöre euch! Schenkt mir einen Augenblick Ruhe!«, rief Pelorus halb lachend. Jemand im Schatten sagte, er solle seine beschissene Klappe halten, was die fröhliche Ausgelassenheit nur noch mehr anfeuerte.
Pelorus’ Finger umschlossen den Fuß des Weinkelchs, wodurch er wie ein grober Hammer wirkte, mit dem man auf den Tisch schlagen konnte. Dreimal ließ Pelorus mit der erfahrenen Zielsicherheit eines Mannes, der wusste, wie man Dinge zerstört, den Kelch nach unten krachen. Ein Schwall Rotwein schoss über den Tisch und fügte den schon vorhandenen Flecken einige neue hinzu.
»Haltet eure Zungen im Zaum! Das gilt für jeden von euch!«, schrie er.
Und dann herrschte fast so etwas wie Stille.
»Ich danke euch dafür«, begann er, »dass ihr hier und heute dem Haus Pelorus mit eurer Anwesenheit die Ehre erwiesen habt, bevor jeder von uns dem Wein so ungehemmt zugesprochen hat, dass nicht allzu viel Sinnvolles mehr zu hören war!«
Das halbe Dutzend Gäste brach in Hochrufe aus, und die anwesenden Frauen applaudierten höflich, sofern ihre Hände nicht anderweitig beschäftigt waren.
»Doch obwohl auch weiterhin an Wein kein Mangel herrschen soll« – erneute Hochrufe –, »solltet ihr nicht versäumen, euch dem zu widmen, was euch an Diensten aus dem Haus des Geflügelten Priapus angeboten wird, denn diese sind noch köstlicher als alle Aromen, die euren Trinkkelchen entsteigen.«
Besonders einen der Gäste versetzte diese Neuigkeit in größte Begeisterung. Er erhob sich halb von seinem Sofa, stolperte und landete mit den Knien im flachen Becken. Wasser spritzte über die kleine Mauer auf der gegenüberliegenden Seite, während die anderen lachten und ihn mit Trauben bewarfen.
»Valgus!« Pelorus lachte. »Caius Quinticus Valgus! Wir müssen dich von deinen nassen Kleidern befreien!« Unter allgemeinem Jubel zog Valgus’ Begleiterin an seiner vor Nässe triefenden Toga und entkleidete ihn mit den sicheren und geschickten Bewegungen einer Frau, die in diesen Dingen große Erfahrung hat.
»Willkommen, Valgus, du alter Narr«, sagte Pelorus. »Willkommen, Marcus Porcius, willkommen all ihr anderen guten Freunde aus Pompeij. Ein herzliches Willkommen auch meinen Gästen aus Baiae und Puteoli. Willkommen, mein guter Timarchides, du alter Gauner. Deine Anwesenheit hier am Tisch ist wohlverdient und schon lange überfällig! Ich bin davon überzeugt, dass du das Haus des Marcus Pelorus höchst gastfreundlich finden wirst.«
Pelorus hielt inne und genoss wohlig die Zustimmung, die ihm entgegenbrandete, während seine Gäste ihm im Licht der flackernden Lampen ihren Dank zuriefen. Eine Weile sonnte er sich in ihrer Zuneigung, doch schließlich hob er die Hände, um noch einmal um Ruhe zu bitten.
»Wir haben uns heute versammelt, um einen Tag zu feiern, der unserer Gesellschaft von Investoren aus Campanien eine überaus glückliche Entwicklung beschert hat. Der Edelste von uns, Gaius Verres, wird schon in wenigen Tagen aus Neapel abreisen, um seinen wohlverdienten Posten als Statthalter anzutreten. Ja, als Statthalter! Von ganz Sizilien!«
Wieder erklangen Hochrufe.
»Möge das Glück niemals enden und der Strom klingender Münzen nie versiegen!«
Pelorus hob seinen Kelch, der unterdessen unauffällig gefüllt worden war, und goss Wein in das Becken im Atrium. Die Gäste sahen in respektvollem Schweigen zu, wie er die Manen beschwor und den unsichtbaren Göttern den ihnen zustehenden Respekt zollte.
»Ich bringe dieses Trankopfer dar in der innigen Hoffnung darauf, dass unser guter Freund Verres eine sichere Reise haben wird, wenn er von Neapel aus in See sticht. Möge sein Amt reiche Früchte tragen für sein Haus und die guten Menschen von Sizilien diese armen, armen Bastarde!«
Wilder Jubel ließ die Wände vibrieren und stieg auf in den nächtlichen Himmel über Neapel.
»Edle Herren, begrüßen wir Gaius Verres, unseren würdigen Vertreter in Sizilien!«
Rufe nach »VERR-ES! VERR-ES!« erfüllten den Garten, doch schon kurz darauf verklangen sie wieder, während sich die Gäste ratlos umsahen.
»Scheiße, wo mag er nur sein?«, fragte Pelorus kichernd. Er hob das Tischtuch, als hielte er darunter Ausschau nach dem Gesuchten.
»Das ist mir egal!«, schrie Caius Valgus. »Angelegenheiten von weitaus größerer Bedeutung verlangen unsere Aufmerksamkeit.« Vergnügt deutete er auf die junge Frau, die vor ihm im Becken des Atriums kniete und deren Kopf hingebungsvoll zwischen seinen Beinen auf und ab wippte.
Gaius Verres hörte, wie die anderen Gäste seinen Namen riefen und die Musiker ihr Spiel wieder aufnahmen. Das Fest würde ohne ihn weitergehen müssen, denn er wollte die entlegeneren Teile von Pelorus’ Haus erkunden.
Die Zimmer, die nicht für die Feierlichkeiten vorgesehen waren, wurden nur spärlich von einzelnen Öllämpchen erleuchtet, von denen viele nach und nach flackernd erloschen. Die Sklaven des Hauses hatten andere Pflichten, und das Fest dauerte inzwischen schon viel länger, als die übliche Lampenfüllung vorhielt.
Er hörte, wie sich eine Frau leise von hinten auf ihn zuschlich – wenn man ihre Bewegungen »leise« nennen konnte angesichts der winzigen Glocken an ihren Fußkettchen.
»Verres«, rief sie ihm mit einem Bühnenflüstern aus einem der Flure des Hauses nach. »Verres? Versteckst du dich vor mir?«
Er ignorierte sie und hob seine Lampe. Das Zimmer war bis auf einen kleinen Schrein für die Manen und ein Holzschwert, das an der Wand hing, völlig leer. Verres schüttelte den Kopf und seufzte.
»Wo ist denn nun das Abenteuer, Pelorus, du alter Stecher?«, murmelte er. Schnell kamen die Schritte näher, und die Knöchelglöckchen erklangen lauter. Plötzlich fühlte sich Verres von einem hauchdünnen Tuch aus syrischer Seide umhüllt.
»Wer sucht hier etwas zum Stechen?«, fragte die junge Frau.
»Ich habe nicht mit dir geredet«, erwiderte Verres ungeduldig.
»Vielleicht bist du ja einer von denen, die keinen Wert auf viele Worte legen«, sagte sie. Ihr singender Tonfall verriet ihren pompeijanischen Akzent.
»Ich habe kein Interesse an deiner Gesellschaft …«
»Successa. Ich heiße Successa.«
»Wie du meinst.« Verres wischte das Tuch beiseite und ging in das nächste Zimmer. Er bewegte sich so schnell, dass der entstehende Luftzug beinahe seine Lampe erlöschen ließ.
»Successa, das ist mein Name.« Fast sang sie die Worte. »Successa, das ist meine Natur.«
»Ich bin sicher, dass das viele Männer bestätigen können.«
»Warum kommst du nicht ein bisschen näher und verschaffst dir selbst Gewissheit darüber – Statthalter Verres?«
»Ich bin eher an anderen Leistungen interessiert.«
»Aber es wäre ganz im Sinne des guten Pelorus.«
»Dann lass mich in Frieden und mach’s doch mit ihm.«
Mit erstaunlicher Kraft packte Successa den designierten Statthalter und schob ihn gegen die Wand. Völlig überrascht ließ Verres die Lampe fallen, deren Inhalt sich über den Mosaikboden ergoss, wo er in einem Gitterwerk kleiner Flammen aufleuchtete. Successa drückte ihren heißen Mund auf Verres’ Lippen, ihre Zunge schob sich tastend vor, und ihre Arme zogen seinen Kopf näher zu sich heran. Sie presste ihre Brüste gegen ihn und schlang ein Bein um seine Waden.
Verres drehte seinen Kopf weg.
»Koste nur einmal von dem, was ich dir zu bieten habe, Verres«, sagte sie in drängendem Ton. »Dann wird dein Schwanz niemals mehr an einem anderen Ort ruhen wollen.«
»Lass mich.«
Verres schob sie von sich weg. Plötzlich wurden seine Augen größer, als er sah, wonach er gesucht hatte: eine Treppe, die ein halbes Stockwerk tiefer in den Keller des Hauses führte.
»Pelorus’ Börse ist schwer von all seinen klingenden Münzen, und ich habe den Auftrag, sowohl seine Börse als auch deinen Schwanz zu erleichtern«, fuhr Successa unnachgiebig fort.
Verblüfft beobachtete sie, wie Verres vorsichtig die Treppe hinunterstieg. Die leuchtenden Flammen, die die zerbrochene Lampe umgeben hatten, waren fast erloschen. Nur noch ein mattes, blaues Schimmern schwebte über dem brennenden Öl auf dem Fußboden, sodass die in die Tiefe führende Treppe in fast völliger Dunkelheit lag.
»Dieser Durchgang führt zu den Zellen der Sklaven«, sagte Successa voller Verachtung. »Dort wirst du nichts von Wert entdecken.«
Verres ignorierte sie und hob den Riegel. Die Tür öffnete sich auf einen Korridor mit Wänden aus grobem Backstein. Alle zehn Schritte brannten hier Fackeln, keine Lampen. Er griff nach einer unbenutzten, neuen Fackel und entzündete sie an einem flackernden Stumpf, der in einem Wandhalter steckte. Geduldig wartete er, bis sich die Flammen über die teergetränkten Stofffasern ausgebreitet hatten und zischend zu feurigem Leben erwachten.
Successa streifte die Knöchelglöckchen von den Füßen und folgte ihm.
»Gladiatoren und Sklaven«, flüsterte sie. »Abfälle und Lagerräume. Ist das nach deinem Geschmack, Verres?«
Stumm lächelte Verres im Halbdunkel vor sich hin.
»Suchst du überhaupt die Nähe von Frauen?«, fragte Successa in grübelndem Ton.
Verres schnaubte.
»Successa, du solltest endlich akzeptieren, dass ich an dir kein Interesse habe. Was übrigens keine Beleidigung sein soll.«
»Bin ich zu alt? Zu direkt?«
Die beiden kamen an mehreren vergitterten Alkoven vorbei, in denen jeweils ein bis zwei Dutzend dösende Männer lagen. Müde hoben sich einige Köpfe, die sich jedoch gleich wieder senkten, sobald Verres weitergegangen war. Überall in den Zellen waren Weinkrüge verstreut, die verrieten, dass hier eine einfachere Version der Feierlichkeiten, die oben noch in vollem Gange waren, stattgefunden hatte.
»Ich habe viele Dinge gelernt«, fuhr Successa fort. »In Zypern, dem Geburtsort der Liebesgöttin. In Ägypten, wo viele dunkle Schlafzimmerkünste ihren Ursprung haben.« Sie runzelte die Stirn angesichts der Tatsache, dass sie anscheinend keinerlei Eindruck auf Verres machte. »Und sogar in Rom, wo kein echter Mann diesen Schenkeln widerstehen konnte«, fügte sie schmollend hinzu.
»Ich suche einfach nur etwas anderes«, murmelte er.
»Ich kann anders sein.«
Verres war vor einer der Zellen stehen geblieben.
»Das hier«, sagte er anerkennend. »Das hier ist wirklich anders.«
Die Zelle war völlig kahl. Sie enthielt weder einen Weinkrug noch die Reste einer Mahlzeit. Nichts als eine grobe Decke aus Sackleinen, die über eine auf dem Bauch liegende, wohlgeformte Gestalt gebreitet war. Die Frau war wach. Ihre dunklen Augen funkelten im Licht der Fackel.
»Ist sie eine Gladiatorin?«, fragte Successa.
»Frag nicht so dumm«, erwiderte Verres. »Pelorus handelt nicht nur mit Gladiatoren, und sein Geld ist auch nicht nur dazu da, um mit vollen Händen ausgegeben zu werden. Das hier hat er wie einen wahren Schatz weggeschlossen.«
Die Frau in der Zelle musterte ihn ausdruckslos und ohne Angst. Verres hob die am Gitter angebrachte Tafel und las den Namen, den die fünf dort eingeritzten Buchstaben bildeten.
»Medea?«, sagte er. »Welch Unglück verheißender Name für so eine kleine Maus.«
Die Frau drückte den groben Leinenstoff gegen ihren Oberkörper, doch sie konnte nicht verhindern, dass eine ihrer schönen Brüste und eine hoch aufgerichtete Brustwarze sichtbar wurden. Sie zog die Beine zu sich heran, als wiche sie vor dem Licht zurück.
»Du kannst nirgendwohin, kleine Maus«, hauchte Verres.
Die Frau in der Zelle schüttelte trotzig den Kopf, als könne sie Verres mit ihrer bloßen Willenskraft zum Verschwinden bringen, was ihr natürlich nicht gelang. Ihr Gesicht war von etwas bedeckt, das wie die Ranken einer Pflanze oder verfilztes Haar aussah. Im Halbdunkel konnte man das nur schwer erkennen.
»Plötzlich ist sie schüchtern«, sagte Successa und rümpfte die Nase.
»Dazu hat sie auch allen Grund«, erwiderte Verres mit einem höhnischen Lächeln und reichte Successa die Fackel.
»Sie ist nichts«, sagte Successa voller Verachtung. »Warum machst du dir die Mühe mit etwas so Irdischem, wenn himmlische Schenkel dich umschließen könnten?«
Langsam, fast feierlich hakte Verres das Schloss auf, das in einem Metallring hing, und griff nach dem Bolzen, der die Zellentür verriegelte. Vorsichtig zog er den Bolzen aus dem Ring. Das alte, trockene Metall knirschte.
»Das wäre für die meisten Männer wohl Versuchung genug«, sagte er zu Successa, die an seinem Gürtel zerrte. »Doch dem Himmel kommt man dann am nächsten, wenn man sich einfach nimmt, was man will.«
Er ließ seine Tunika zu Boden sinken und sah fast ein wenig lächerlich aus, wie er so, nur mit Sandalen bekleidet, dastand. Er schob die linke Hand zwischen seine Beine und begann, sein immer härter werdendes Organ sanft zu reiben. Seine rechte Hand zog an der schweren Zellentür, die sich in ihren protestierenden Angeln drehte und sich quietschend öffnete.
»Ich bin eine Frau, die man weitaus mehr schätzt als sie«, beschwerte sich Successa.
»Ich habe kein Verlangen nach zwei Frauen«, kicherte Verres. »Jedenfalls nicht heute Nacht.«
»Warum machst du dir das Leben nur so schwer?«, knurrte Successa. »Sie wird sich wehren.«
»Genau das hoffe ich«, flüsterte Verres, während er langsam und jeden Schritt auskostend auf die zitternde Gestalt zuging.
Die Frau, die Medea genannt wurde, zog sich noch tiefer in ihre Ecke zurück, und als sie mit dem Rücken gegen die unnachgiebigen Backsteine stieß, stand Furcht in ihren Augen.
»Du kannst mir nicht entkommen, kleine Maus«, sagte Verres. Er beugte sich vor und packte ihre Haare mit seiner Faust. »Also zeig mir, was du zu bieten hast.«
Er zog sie hoch, und die grobe Leinendecke rutschte von ihrem nackten Körper. Überrascht schnappte Successa nach Luft, als sie das Netz regelmäßig angeordneter Ziernarben, die Tätowierungen und die wirbelförmigen Hauteinritzungen sah, in die farbige Erde gerieben worden war. Die linke Körperseite der Gefangenen war vollständig mit der Kunst der wilden Skythen bedeckt, bei der unzählige Messer tausende sorgfältig angeordnete Schnitte angebracht und ebenso zahlreiche, in Farbe getauchte Nadeln ihre Stiche hinterlassen hatten. Die Frau hob den Kopf ins Licht, wodurch eine ähnliche Zeichnung auf einer Gesichtshälfte erkennbar wurde – ein wie aus Fangzähnen gebildetes Muster, das sich im Zickzack über ihre Wange zog, sowie Ranken aus rotem Ocker, die ihr über das Gesicht und über die Stirn reichten.
»Welch ein Kunstwerk du bist!«, hauchte Verres voller Bewunderung. »Wahrscheinlich eine Priesterin. Eine Seherin? Eine Frau, die von ihrem Stamm geschätzt wird, da bin ich mir sicher. Hoch geschätzt. Überaus geachtet. Und jetzt … bist du hier. Nackt vor mir.«
Staunend starrte Successa die Muster auf dem Körper der Frau an, die Welten entfernt von dem sparsam aufgetragenen Rouge oder einem gelegentlichen Kneifen waren, das die Damen Roms bevorzugten, um ihre Wangen zu röten. Hier hatte sie einen ganzen Kosmos aus Symbolen und magischen Zeichen in den barbarischen Formen und Farben der primitiven Völker des Schwarzen Meeres vor sich. Doch Verres widmete Medeas geschmückter Haut kaum einen Blick. Seine Hände sahen keine Tinte. Vielmehr umschlossen und streichelten sie den straffen Körper der nervösen Frau wie jeden anderen.
»Vergewaltigung ist römische Tradition«, flüsterte Verres Medea ins Ohr. »Weißt du, kleine Medea, wir haben unsere Frauen schon so genommen, bevor Rom zur Stadt wurde.«
Medeas dunkle Augen starrten in die seinen; ihr Blick war unergründlich. Verres spürte ihren Atem auf seinem Mund. Sein harter Schwanz stieß gegen das weiche Fleisch ihres Bauchs und hinterließ dort wie eine Schnecke eine schimmernde Spur. Mit seiner freien Hand strich er über Medeas Hüfte und fuhr hinauf zur Wölbung ihrer Brust. Seine Finger umkreisten eine ihrer harten Brustwarzen.
»Wie ich sehe, bist du erregt, kleine Medea«, sagte Verres einigermaßen überrascht. »Ich frage mich, was genau es an mir ist, das dich erregt.«
Medeas Blick huschte zum Eingang der Zelle, wo die Kurtisane Successa ungeduldig wartete.
Unwillkürlich stieß Successa ein entnervtes Seufzen aus.
»Wenn du dafür bezahlt wirst, mir Gesellschaft zu leisten, Successa, dann solltest du jetzt hier bleiben und zusehen!«, sagte Verres. »Es amüsiert mich, Publikum zu haben.«
»Ich stehe ganz zu deiner Verfügung, Verres«, sagte Successa. Es gelang ihr nicht, ihre Enttäuschung zu verbergen.
»Dann befehle ich dir, alles genau zu beobachten«, sagte Verres lächelnd. »Sieh dir an, wie ein wahrer Römer die Angehörige einer minderen Rasse seine Männlichkeit spüren lässt. Schau hin und ler –«
Verres verstummte mitten im Wort, als Medea ihm ihr Knie zwischen die Beine rammte.
Während er vor Schmerz und Überraschung nach Luft schnappte, lockerte sich sein Griff um ihre Haare. Er beugte sich nach vorn und tastete nach seinen gestauchten Hoden, doch schon stieß Medea ihm ihr Knie ins Gesicht, wobei sie gleichzeitig seinen Kopf nach unten drückte. Unwillkürlich stieß Verres einen Schrei aus und ging auf dem Zellenboden in die Knie, doch Medea kümmerte sich schon nicht mehr um ihn. Nackt stürmte sie auf den Eingang der Zelle zu, von wo aus Successa sie anstarrte, unfähig, sich zu rühren.
Mit einer Hand packte Medea Successa am Hals, während ihre andere zu einer Klaue gekrümmt auf die Augen der jungen Frau zuschoss. Beide drehten sich halb um die eigene Achse, bis Medea Successa mit einem Tritt in die Zelle schleuderte, während sie selbst durch den Zelleneingang hinaus in den Korridor stürmte.
Verres erhob sich gerade unter großen Mühen, als Successa auf ihm landete, wodurch beide Römer in einem wirren Durcheinander von Armen und Beinen stöhnend zu Boden sanken. Die Fackel entglitt Successas Hand und landete auf ihrem teuren, ihren Körper schmeichelhaft umhüllenden Kleid und beschmierte es mit hartnäckig klebrigem Pech, das bereits in vielfarbigen Flammen brannte.
Medea rannte durch den Korridor. Im Licht der Flammen, die neue Nahrung gefunden hatten, huschte ihr riesiger Schatten über die Wände. Die Schreie der brennenden jungen Frau übertönten jedes andere Geräusch in den engen Räumen, doch Medea blieb konzentriert. Einen kurzen Augenblick hielt sie inne, denn fast hätte sie sich verirrt. Doch dann sah sie im Sand die Spuren des Mannes und der Frau, die in ihre Zelle eingedrungen waren, um sie zu quälen.
Medea stürmte in die Richtung, aus der die beiden gekommen waren, kam jedoch gleich darauf schlitternd vor einer anderen Zelle zum Stehen.
Ein Mann redete sie in einer Sprache an, die sie nicht kannte.
Sie wandte sich zu ihm um, und er rüttelte an den Gitterstäben seiner Zelle, um auf sich aufmerksam zu machen.
Er sprach weiter, doch sie hörte nur raue, abgehackte Worte auf Aramäisch an ihr Ohr dringen.
Schließlich versuchte er es auf Griechisch – auf gebrochenem Griechisch, in das einige Brocken Latein wie schmutzige Erdklumpen geworfen waren.
»Nicht Sklave! Nicht Sklave!Frei Medea frei?«
Medea lächelte nur halbherzig. Dann packte sie den Riegel, der die Zellentür verschloss, und löste ihn. Sie blieb nicht stehen, um die Tür zu öffnen, sondern stürmte stattdessen zur nächsten Zelle und dann zur übernächsten, wobei sie die geöffneten Schlösser aus den Halterungen riss und die Bolzen, die die Türen sicherten, beiseiteschleuderte.
Vergnügt schob der Gefangene aus der ersten Zelle die Tür zu seinem Gefängnis auf und stolperte hinaus in den Korridor. Das höllische Licht aus Medeas eigener Zelle war schon nach kurzer Zeit schwächer geworden, und die Schreie der jungen Frau hatten sich in ein von Schluchzern unterbrochenes Wimmern verwandelt. Der stechende Geruch verbrannter Haare trieb wie auf Wogen unsichtbaren Rauchs durch den unterirdischen Gang.
»Verflucht sollst du sein, du bemalte Hure!«, dröhnte die donnernde Stimme des Römers irgendwo in der Ferne.
Medea starrte den Mann an, den sie gerade befreit hatte. Er musterte sie erwartungsvoll.
»Was?«, fragte er vorsichtig. Sein Latein klang noch immer verwaschen und unsicher. »Was jetzt?«
Hinter ihm traten mehrere andere befreite Gladiatoren in den düsteren Korridor, einige mit noch immer verquollenen Augen, andere bereits wach und bereit zum Kampf.
Medea deutete auf die Treppe, die hinauf zum Atrium führte.
Sie wählte ihre Worte sorgfältig und sprach so klar und deutlich, wie sie konnte.
»Tötet sie«, sagte sie. »Tötet sie alle.«
Die Musiker gaben ihr Letztes. Der Trommler hatte einen Rhythmus angestimmt, als triebe er die Sklaven auf einer Galeere an. Valgus thronte über einer Frau im flachen Becken des Atriums und rammte ihr im Takt der Musik seine Männlichkeit in den Leib. Timarchides lehnte sich auf seinem Sofa zurück und umfasste mit beiden Händen den Kopf einer jungen Frau, die mit ihren Lippen sein Organ bearbeitete. Marcus Porcius nahm seine junge Begleiterin von hinten, wobei er sich grunzend und mit pfeifendem Atem an ihren Schenkeln festkrallte.
Pelorus fläzte sich bequem auf seinem Sofa und sah mit zufriedenem Lächeln zu, wie eine gallische Hure ihr Becken an ihm rieb. Er griff nach ihrem geflochtenen roten Haar und musste ein wenig enttäuscht feststellen, dass es in seiner Hand hängen blieb. Er warf die Perücke mit einem Murren beiseite und konzentrierte sich stattdessen darauf, die kleinen Brüste der jungen Frau zu kneten.
Medea erschien mitten zwischen den Musikern, schleuderte die Flötenspieler in das Impluvium und versetzte dem Trommler einen Tritt, sodass er kopfüber in seinem Instrument landete. Schlagartig verstummte die Musik. Nur die Zimbeln erklangen noch drei Mal, indem sie zuerst gegen die Wand, dann gegeneinander und schließlich zu Boden krachten. Eine kreiselte einen Augenblick lang um sich selbst wie eine Metallschale, die jemand hatte fallen lassen, doch gleich darauf verklang sie abrupt.
Die Musiker beschwerten sich lauthals, während die Gäste die wilde nackte Frau in ihrer Mitte zunächst nur sprachlos anstarrten. Die flackernden Flammen der Öllampen tanzten über ihre Haut und schienen die fremdartigen Pigmente in geschmeidige Wirbel zu versetzen. Die Verzierungen in ihrem Gesicht verschwanden in den Schatten ihrer Locken, sodass man unmöglich erkennen konnte, wo das Haar endete und die Haut begann. Dunkle Flecken huschten wie Schlangen über ihren Schädel.
»Bist du zu unserer Unterhaltung gekommen?«, fragte Marcus Porcius und schlug ihr auf die Hinterbacken. Medea versetzte ihm einen Hieb aufs Auge.
Mehrere Gäste brachen in Gelächter aus, als sie das sahen, doch Pelorus gehörte nicht dazu. Er stieß seine von ihrer Perücke befreite Begleiterin zu Boden und erhob sich schwankend.
»Wer hat ihr erlaubt, sich frei zu bewegen?«, schrie er, als sich die befreiten Sklaven durch die Tür drängten, durch die auch Medea gekommen war.
»Wachen! Wachen!«, rief Pelorus, doch da sprang Medea schon auf ihn zu und schleuderte ihn zu Boden. Sie packte sein Obstmesser und rammte es ihm in den Hals, bis es auf Widerstand stieß. Als Medea es wieder herauszog, schoss ein Schwall Blut aus der Wunde. Pelorus drückte seine Hände an seine Kehle und versuchte verzweifelt, das ausströmende Blut zu stoppen, während Medea blutbeschmiert den in der Nähe stehenden Speisetisch in das Becken im Atrium kippte.
Hinter ihr erschien eine kleine Gruppe von Männern in Lendenschurzen, die die behelfsmäßigen Waffen hin und her schwenkten, die sie sich im Haus hatten verschaffen können. Einer hielt einen Weinkelch in jeder Hand. Er schlug mit den Metallgefäßen zu und hinterließ tiefe rote Striemen am Kopf von Marcus Porcius. Die anderen Sklaven prügelten mit Zaunpfosten und kleinen Statuen um sich und verwandelten das Gelage in ein beängstigendes Chaos.
Schließlich sahen sich die Sklaven Timarchides gegenüber, einem riesigen, muskulösen Griechen, dessen Haut kreuz und quer mit den dünnen weißen Narben alter Schlachten übersät war. Schockiert und überrascht starrte er die Sklaven an. Er wirkte verletzt, als hätten sie ihm eine noch tiefere Wunde geschlagen als diejenige, mit der Pelorus zu kämpfen hatte.
Für einen winzigen Augenblick sahen Timarchides und die ausgebrochenen Sklaven einander in die Augen, getrennt durch den unüberwindlichen Abgrund, der zwischen Freien und Unfreien liegt. Doch dann war dieser Augenblick vorüber und mündete in einem wilden Durcheinander aus wirbelnden Armen und Beinen, Rufen und Schreien, als sich alle Sklaven zugleich in das Kampfgetümmel stürzten.
Timarchides duckte sich unter dem Hieb eines Mannes weg, der auf Ägyptisch fluchte, während er eine Statuette durch die Luft schwang. Die steinerne Gottheit zischte kaum eine Handbreit an Timarchides’ Kopf vorbei. Timarchides sprang nach vorn, packte den Mann mit beiden Armen und riss ihn in das Wasserbecken im Atrium. Mit einem lauten Knacken schlug der Kopf des Mannes gegen die marmorne Beckenwand, und Timarchides spürte, wie die Arme des Angreifers unter seinen Händen erschlafften.
Mehrere Bewaffnete in dunkler Kleidung stürmten herbei – eine Patrouille aus dem Außenbereich der Villa, der durch die nächtlichen Stadtwachen noch ergänzt wurde. Mit Schwertern und Knüppeln sorgten sie rasch dafür, dass die übrigen Sklaven von ihren Gegnern abließen, und drängten sie in einer entfernten Ecke des Gartens zusammen: drei blutende, ziemlich mitgenommen aussehende Männer und eine trotzige Frau. Ein Wächter schleuderte ihnen den fünften, bewusstlosen Sklaven vor die Füße.
Timarchides zwang sich, das Pochen in seinem Kopf zu ignorieren. Er bedeckte eines seiner Augen mit der Hand, um nicht alles doppelt zu sehen. Pelorus aber lag tot auf dem Boden, umgeben von den zerstörten Überresten seines letzten Gelages. Seine aufgeschlitzte Kehle sah aus wie ein zweiter Mund, und sein Blut strömte über das ölige Wasser im Becken auf den Abfluss am gegenüberliegenden Ende zu.
»In den Zellen da unten sind Dutzende Sklaven«, sagte Timarchides, indem er sich an den Mann aus dem Osten wandte, als sei er der Anführer. »Und doch werdet nur ihr fünf den Tod über alle bringen.«
Der Mann aus dem Osten starrte Timarchides verständnislos an.
»Was?«, sagte er. »Nein.«
»Was – allerdings!«, erwiderte Timarchides. »Du wieherst wie ein verdammtes Pferd. Begreifst du nicht, was du getan hast?«
Der Sklave starrte ihn einfach nur an.
»Für die Freundlichkeit deines Herrn wirst du den höchsten Preis bezahlen. Mit deinem Leben und dem Leben aller anderen Sklaven in seinem Haus.«
»Befehlt, Herr, und mein Schwert wird den Schlag ausführen«, erklärte der Anführer der Wachen.
»Nein«, sagte Timarchides. »Pelorus’ Tod verlangt ebenso eine Antwort in aller Öffentlichkeit, wie er öffentlich betrauert werden muss.«
»Wir könnten sie jetzt töten«, sagte der Anführer der Wachen mit einem besorgten Blick auf seine Männer.
»Sperrt sie ein«, befahl Timarchides knapp. »Sie werden den Sklaventod sterben. Und alle sollen es sehen.«
II JUPITER PLUVIUS
II
JUPITER PLUVIUS
»Es sieht nach Regen aus«, sagte der goldhaarige Varro grimmig.
Spartacus warf ihm einen Blick zu und lächelte. Vorsichtig schob er seine Füße in den Sand des Trainingsgeländes, der von einem Schauer am Tag zuvor noch feucht war.
»Das wäre ja mal ganz was Neues«, sagte er.
»Rein mit dir, du Regenmacher«, sagte Varro. »Ich habe keine Lust, in einer rostigen Rüstung zu kämpfen.«
Doch Spartacus rührte sich nicht von der Stelle, das hölzerne Übungsschwert und den zerbeulten Schild zum Kampf bereit in den Händen. Der Übungsbereich, der von allen einfach nur »der Platz« genannt wurde, hallte wider vom dumpfen Pochen und scharfen Knacken aufeinanderprallender Schwerter und Schilde aus Holz.
»Sieh dir den Himmel an«, fuhr Varro fort. »Nicht mehr lange, dann öffnen sich seine Schleusen.«
»Genau wie sich dein Kopf öffnen wird«, erwiderte Spartacus. »Noch bevor er auch nur eine Chance hat, nass zu werden.«
Varro wandte sich mit beschwörendem Blick an Drago, den riesigen afrikanischen Ausbilder, der ihn stirnrunzelnd musterte wie ein verärgerter Gott.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!