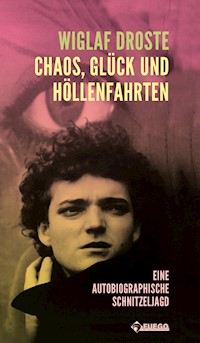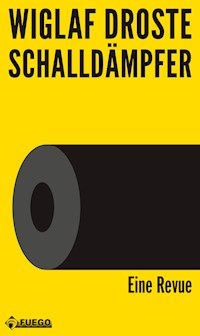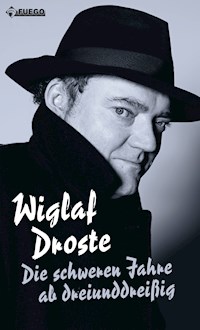6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch mit Sprachglossen geht Droste auf Entdeckungsreise zur Wortschatzinsel. Der Firma Schlecker bescheinigt er, dass ihr "ein A und ein r fehlen", über ihren Werbeslogan "For you. Vor Ort" sagt er: "Dreimal 'or' in vier Silben, das klingt nach Mordor und den Orks." Droste ließ einen "romantischen Fächeraufguss" über sich ergehen, stattete dem Kopf des Bundespräsidenten Wulff einen Besuch ab und hat diese psychedelischen Erlebnisse genauso überlebt wie das "Multitasking im Rollkofferkrieg". Er drang in die "Schnittstellenkultur" ein und beschreibt das "Essen beim Betrachten von Frauen auf Laufbändern". Warum tut der Mann das? Einer dieser grässlichen Sprachschützer ist er nicht, das steht fest. "Sprichst du noch oder kommunizierst du schon?" ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Liebe und Schönheit in Sprache und Leben, gegen "i-Petting" mit "Benutzeroberflächen" und für den "Floralverkehr".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wiglaf Droste
Sprichst du noch oder kommunizierst du schon?
Neue Sprachglossen
FUEGO
per l‘amore
Ömm ...
Schriftdeutsch täuscht. Das Wort, das in Deutschland am häufigsten gesagt wird, liegt in Schriftform gar nicht vor. Es heißt »Ömm ...«, und es ertönt, wo immer einer den Mund aufmacht: »Ömm ...« Manchmal heißt das Wort auch »Ääähm ...« oder »Öööh ...« oder »Äääh ...«, aber Platz eins der sinnlos von sich gegebenen Geräusche hält unangefochten: »Ömm ...«.
Besonders erstaunlich ist, dass »Ömm ...« das Lieblingswort von Leuten ist, die beruflich mit Sprache zu tun haben. Ein Schriftsteller beginnt seine Lesung mit »Ömm ...«. Die Fernsehmoderatorin begrüßt ihre Gäste mit »Ömm ...«, ein Germanist eröffnet ein Literaturfest mit »Ömm ...«, und der Nachwuchs hat es perfektioniert: Der Vorsitzende der »Jungen Liberalen« kommentiert den Rücktritt eines Bundespräsidenten, indem er in einem dreiminütigen Interview etwa fünfzigmal »Ääääh...«, »Ööh...« und »Ömm...« von sich gibt. Man kann schon die Rede schreiben, die er als Minister halten wird.
Es sind nicht die Kassiererin oder der Tankwart, die das Land mit »Ömm ...« kontaminieren; es sind die sogenannten Profis, die den Grund- und Grunzton der öffentlichen Rede bestimmen.
Wurde nicht einmal das Gebot »Du sollst nicht stammeln« erlassen? Nein? Dann wird es aber Zeit. Ein Experte für Wählerverhalten stellt seine Thesen vor; sie lauten »Ömm ...« und »Ömm ...«. Professoren diverser Disziplinen sitzen an einem künstlichen TV-Kaminfeuer und kommentieren das Weltgeschehen: »Ömm ...« – »Oh nein, Herr Kollege, es ist vielmehr ›Ömm ...‹«.
Warum sagen alle »Ömm ...«, wenn sie zu anderen sprechen? Was wollen sie ihnen oder sich selbst damit signalisieren? Begrüßenswert ist, wenn jemand erst denkt und dann spricht; so entstehen Momente des Schweigens und der Stille, die aber offenbar als unangenehm oder peinlich empfunden werden und zugeömmt werden. »Ömm ...« oder manchmal auch »Öööhm ...«: Das Geräusch hat etwas von Blöken, ohne aber die Musikalität zu entfalten, die einer Schafherde innewohnt.
In »Ömm ...« wird die menschliche Sprache zur Flatulanz; der Kopf lässt Luft ab, sonst nichts. Denn offenbar herrscht in ihm die Angst, dass sekundenkurzes nichts Sagen mit generellem Nichts-zu-sagen-haben verwechselt wird oder dass eine Redezeitlücke sofort von einem anderen dazu genutzt wird, dazwischenzufitschen und das Wort an sich zu reißen. Und so wird dann geömmt, damit statt der Rede ein Platzhaltergeräusch ertönt: »Ömm ...«.
»Im Anfang war das Wort«, heißt es in der Bibel; der Nachsatz »und das Wort hieß ›Ömmm ...‹« steht dort aber nicht.
Angedacht
»Wir hatten das so angedacht«, sagt der junge Mann, und es fällt ihm dabei gar nichts auf oder ein. Im Gegenteil; er hält das für völlig normal und für eine selbstverständliche Redensart: »Wir hatten das so angedacht.« Wer aber behauptet, er habe »etwas angedacht«, teilt auf diese Weise mit, dass er sich nicht das Geringste gedacht hat, sondern wahllos alles an sich gerakt hat, was an Ideenfetzen gerade so herumschwirrte und das er nun mit großer Geste in den Ventilator wirft: »Wir hatten das so angedacht.«
Wer etwas »angedacht« hat, betreibt Brainstorming ohne Brain. Er unterzieht sich eben nicht der schönen Mühe eines Gedankens, sondern kratzt bloß eklektizistisch zusammen, was er zufällig aufgeschnappt hat und das diffus durch seine Birne wabert. Diesen Wirrsing schiebt er als Schwarzen Peter jemand anderem zu – »wir hatten das so angedacht und jetzt bist du dran« –, der die Sache aufdröseln und ihr Gehalt und Struktur geben soll. Wer »angedacht« hat, ist ein Denkfaulpelz oder ein raffinierter Schlaumeierdummkopf, der andere für sich arbeiten lässt und anschließend aber eine geistige Urheberschaft für sich reklamiert, für die ihm jegliche Voraussetzung fehlt. »Angedacht« kommt von Andenken, und die gibt es im Andenkenladen, auch Souvenir-Shop genannt. Genau da gehört das Vakuum ja auch hin, das sich als »angedacht« aufplustert und bläht.
Wenn einer sich mit der Drohung »Wir hatten das so angedacht« nähert, ist auch simple Dreistigkeit mit im Boot; wer sich arglos oder aus Unachtsamkeit mit »Angedachtem« ankobern und anheuern lässt, darf anschließend entfremdete Denkarbeit leisten für substanzfreie Windmacher, die nichts wissen außer dem Einen: wie man andere für sich arbeiten lässt und wie man »ein Projekt anschiebt«, das man zuvor »angedacht« hat.
Wenn man die Angeberstanze »Ich habe ein Projekt« ins Deutsche übersetzt, heißt sie: Ich will nicht arbeiten, aber gern darüber reden und vor allem andere dazu überreden, die eventuell anfallende Arbeit dann möglichst unbezahlt zu erledigen zugunsten dessen, der »das Projekt angedacht und angeschoben« hat. Wenn mehrere solcher Windeier und Blasebalge zusammenkommen, entsteht die größtmögliche denkbare Gedankenferne. Sie heißt Marketingabteilung.
Geld oder Gelder?
Geld ist ein unbestimmter Begriff. Wenn einer sagt, er habe Geld dabei, kann es sich um einige Euros handeln oder um tausende davon. Man weiß es nicht, der Begriff Geld ist quantitativ vage. Klar ist allerdings, dass er einen Plural meint. Ein Geld gibt es nicht, außer in der Kinder- oder Scherzfrage: »Kannst du mir ein Geld borgen?«
Wenn aber von öffentlichem Geld zu hören oder zu lesen ist, bekommt dieses Geld einen Plural, den es sonst nicht hat oder benötigt: Gelder. Fördergelder, die beantragt werden, Gelder, die bewilligt worden sind, oder Gelder, die veruntreut wurden. Öffentliche Gelder sind offenbar etwas ganz anderes als privates Geld.
Nie hörte man in einem Krimi jemanden knurren: »Gib mir meine Gelder zurück!«, »Her mit den Geldern!«, »Gelder oder Leben!«, niemals den Seufzer »Schade um die schönen Gelder!« Auch der anerkennende Satz »Der verdient da gute Gelder« blieb bisher ungesagt, wobei auffällt, dass verdientes Geld offenbar »gut« ist, zerronnenes Geld durch anhaltenden Verlustschmerz aber sogar »schön« werden kann. Noch niemals wurde jemandem nachgesagt, dass er »richtige Gelder mache«, und in keinem Wirtshaus der Welt ertönte die bange oder auch nur geheuchelte Frage: »Hast du Gelder dabei? Ich habe meine Gelder zuhause vergessen!«
Wer hätte je behauptet, dass »Bargelder lachen«, dass »Gelder allein nicht glücklich machen«? Forderte Gunter Gabriel etwa »Hey Boss, ich brauch’ mehr Gelder«? Auch unter der Belehrung durch ältere Menschen, dass fünf Mark »früher viele Gelder waren«, musste noch kein Jüngerer leiden. Immer ist, wenn es um privates Eigentum geht, ausschließlich von Geld die Rede, niemals von Geldern, es sei denn, man spräche von der deutschen Stadt Geldern an der niederländischen Grenze.
Der private Mensch hat, braucht oder giert nach Geld; Geld will er, nicht Gelder. »Das ist mein Geld!«, sagt er und meint damit gewöhnlich: meinsganzalleins.
Kein Mensch wird dafür beneidet, »Gelder wie Heu« zu haben, kein Verlust »geht in die Gelder«, und selbst der derbste Volksmund unterstellt niemandem, nicht einmal dem Teufel persönlich, er könne »Gelder scheißen«, auch wenn das, gerade für die öffentliche Hand, eine gute Gabe wäre.
Beim öffentlichen Geld ist das anders; hier ertönt der Lockruf der Gelder, die man der öffentlichen Hand entnehmen kann: Gelder, die wiederum aus »Töpfen« stammen, in denen sie offenbar sehr altmodisch aufbewahrt werden. Wenn einer von Geldern spricht, meint er niemals sein Geld, sondern solches, das er sich vielleicht verschaffen kann, durch beantragen und bewilligt bekommen oder, wenn er den Bogen raus hat, durch veruntreuen.
Die Dreistesten unter der Sonne wandeln Gelder in Geld, parken es weg, zeigen dann vorwurfsvoll ihre leeren Taschen vor, reklamieren Hilfe für sich und fordern: Gebt uns Gelder, die uns zustehen, denn wir machen sie zu Geld! Und genau so geschieht es dann, immer und immer wieder.
Gelder sind öffentlich virtuell, Geld ist konkret und privat. Es heißt schließlich: Geld regiert die Welt. Und nicht: Gelder regieren die Wälder.
Absolut affirmativ
»Absolut!«, erklärt mein Gegenüber im Brustton der Überzeugung, mit einer felsen- und feuerfesten Stimme, in der für keinen Unter- oder Zwischenton Platz ist, für keinen noch so leisen Zweifel. Jede Silbe wird einzeln und dezidiert gesprochen: »Ab-so-lut!«, da hört man das Ausrufungszeichen mit, da bleibt keine Frage offen.
Die uneingeschränkte Zustimmung beherrscht die Kommunikation. Die Formel »Absolut« kann rhetorisch variiert werden; dann wird sie ersetzt durch »Definitiv!«, durch »Perfekt!« oder durch das beispringende »Auf jeden Fall!«. Manchmal wird sogar alles zum Einsatz gebracht: »Absolut perfekt. Auf jeden Fall. Definitiv!« Der Affirmant reißt sich vor Begeisterung schier die Beine aus, und der Adressat bricht unter Beipflichtungsbeschuss zusammen. Wieviel Bestätigung kann ein Mensch vertragen, ohne dass sie in ihm den Eindruck erweckte, eventuell auch sarkastisch gemeint zu sein, ironisch oder spöttisch?
Offenbar jede Menge. Die meisten Menschen empfinden noch die durchsichtigste Zustimmung als angenehm, während sie sachliche Zweifel oft als generelle Skepsis gegenüber ihrer eigenen Person wahrnehmen. Psychologisch, also Sprache und Logik der Seele folgend, ist das so simpel wie einleuchtend: Die uneingeschränkt freudige Affirmation löst ihrerseits Freude aus; sie scheint den Eindruck von großer Klarheit und Souveränität zu erwecken. Wenn einer »absolut!« sagt und »definitiv!«, dann suggeriert er damit, dass er genau wisse, was er wolle. Stimmt das? Könnte nicht das Gegenteil der Fall sein? Dass also einer, der bedingungslos Ja sagt, sich einfach nur anschließt, weil er keine eigene Haltung hat?
Muss man nicht eher argwöhnisch werden, wenn niemand mehr eine Frage hat oder einen Einwand? Doch wer nachfragt, wird schnell als »Bedenkenträger« und als »Bremser« diskreditiert. Wenn einfache Lösungen gesucht werden, sind Fragen nicht opportun. Es geht um Zustimmung, und zwar um hundertprozentige. In der Berliner Mundart heißt das: »Aba hundert pro, Alta!« Andere bemühen sogar gleich »tausend Prozent«, als ob maßloses Übertreiben eine vertrauensbildende Maßnahme wäre. Tausend Promille sind schon realistischer; »Absolut« ist ja auch der Name einer schwedischen Wodkamarke.
So sehr der modische Bestätigungsjargon der »Definitiv«-Sager auch am klaren Bewusstsein seiner Benutzer beziehungsweise seiner »User« zweifeln lässt, hat er doch immerhin anderes affiges Vokabular verdrängt. Die Zeiten, in denen fast alle Welt zustimmend »Touché!« sagte (und dabei meist auch noch einen Zeigefinger in Anschlag brachte), sind zum Glück verstrichen. Auch »d’accord!« oder, noch wichtigtuerischer, »Da bin ich voll d’accord!«, kommt nur noch so selten zur Anwendung wie die Wendung »Da gehe ich mit dir konform«. Die Konformgeherei hat einen so anzüglichen Ton, dass die Verballhornung zu »Da gehe ich mit dir kondom« nicht ausbleiben konnte.
In der zum Fernseh-Talk herabgesunkenen Kommunikation hat sich eine Floskel etabliert, die Affirmation mit Sensibilitätssimulation verbindet: »Da bin ich ganz bei Ihnen«, oder, noch schwüler und auf die Pelle rückender: »Da bin ich ganz bei dir.« Es klingt, als ob ein Intimitäter seinem Gegenüber eine absolut unerwünschte Hand aufs Bein legte. Aber definitiv.
Sprichst du noch oder kommunizierst du schon?
Es war ein sonniger Tag Anfang Oktober, beim Ausflug in den Wald waren Bucheckern aus den Bäumen gefallen, unter denen Maronen und Steinpilze standen und sich einsammeln ließen. Es war wie im Paradies, großzügig schenkte die Natur ihre Gaben her, sie würden ja immer nachwachsen. Zurück in der Stadt nahmen wir in einem Gartenlokal den Aperitiv; als Wind aufkam, prasselten Kastanien auf die Tische, eine flog mir direkt ins Glas, das glücklicherweise nicht zersprang. Ich fischte sie heraus und knetete die Glückskugel in der Hand, während die anderen Gäste fluchtartig und fluchend den Garten verließen. Das freute mich, denn so gehörten die schimmernden schönen Bollern mir ganz allein.
Nachdem die Kastaniengier befriedigt war, spürten wir Hunger. Die Pilze würden wir selbstverständlich trocknen und als Konzentrate für Soßen mit Wumms verwenden, die Karte des Lokals las sich vielversprechend, und so zogen wir, als es kühl wurde, vom Garten in den Innenraum um, bekamen einen guten Tisch und bestellten ein kleines Menü. Der Wein wurde aufgetragen, am Nebentisch nahm ein Pärchen Platz, beide waren etwa Ende dreißig, sportlich, schlank und so angezogen, als wären sie von der Arbeit in einer Bank oder einer Agentur direkt zum Essen gefahren.
Der Mann, dessen kantiges Gesicht nicht dumm wirkte, legte ein i-Pad auf den Tisch. Seine Begleiterin zog eine Braue hoch, lächelte und sagte mit mildem Spott in der Stimme: »Hast du dir noch Arbeit aus dem Büro mitgebracht?« Sie sagte nicht »Schatz«, aber diese tödliche Vokabel schwang im Unterton doch mit.
Der Mann lächelte zurück. »Nein«, sagte er schnell, »ich muss nur ganz kurz nochmal etwas nachschauen«, woraufhin er sich an seinem elektronischen Gerät zu schaffen machte. Unterdessen kam der Kellner mit den Speise- und Weinkarten; die Frau bestellte vorab zwei Gläser Champagner, der Mann sah flüchtig hoch, lächelte, sagte »wunderbar« und vertiefte sich wieder in den Computer.
Leichte Neugierde erfasste mich. Wie würde das Spiel nebenan ausgehen? Würde der Mann seinem digitalen Zwingzwang widerstehen und sich in die wirkliche Wirklichkeit begeben? Der Champagner kam, die beiden stießen an, und als der Mann seinen Blick aber sogleich in die Elektronik senkte, verkniff die Frau sich nicht die Phrase von den »sieben Jahren schlechtem Sex«, die sein Verhalten nach sich ziehen werde.
Schade, dachte ich; der Tadel ist ja berechtigt, aber warum so schwach formuliert? Der Spruch ist doch längst ausgeleiert und verbraucht – und wurde vielleicht auch gar nicht mehr als Drohung empfunden? Vielleicht fand der Mann Sex schon länger als sieben Jahre schlecht, oder ihm gefiel Elektronik sowieso besser? Es gibt Männer, bei denen das so ist; in Kontaktanzeigen nennen sie sich dann »jung geblieben«, was soviel heißt wie stehengeblieben.
»Der macht i-Petting«, flüsterte meine Süße über unseren Tisch. »Der hat mit seinen Händen seit Wochen keine Haut mehr berührt – nur Benutzeroberflächen.« Sie schüttelte sich. Am Nebentisch wurde der »Gruß aus der Küche« serviert, das »amuse bouche«, wie der Kellner mit Betonung sagte.
Notgedrungen hob der Mann sein i-Pad, um dem Teller Platz zu machen und lehnte es gegen ein Tischbein. »Lass es dir schmecken«, sagte die Frau; ihr Lächeln war ein paar Grade wärmer geworden und lag jetzt bei kurz unter Null. »Sie taut auf«, flüsterte meine Liebste. »Oder ab«, flüsterte ich zurück. »Bei Gefrierfächern heißt es abtauen.«
Nebenan klingelte ein Telefon. Der Mann riss es aus der rechten Seitentasche seines Jacketts, kuckte, sprach hastig hinein, sprang vom Tisch auf und lief nach draußen. Der Teint der Frau fror wieder an, knisternd wie harschiger Schnee; als der Mann nach einer Minute zurückkam, legte er das i-Phone, denn um ein solches handelte es sich, rechts neben seinen Teller. »Sorry«, sagte er. »Ging nicht anders.«
Die Frau sagte nichts, das Gewicht ihres Schweigens stand im Raum. Ein weiteres Telefonsignal ertönte; der Mann zerrte ein zweites Gerät hervor, diesmal aus der linken Jacketttasche, und lief abermals aus dem Raum. Als er nach einer guten Minute zurückkehrte, hob er entschuldigend die Arme Richtung Arktis; dann setzte er sich und legte i-Phone Nummer zwei links neben seinen Teller.
Die Vorspeise wurde aufgetragen; beide aßen schweigend. Dann schob der Mann seine Hände über die Geräte und begann sie zu befummeln. Die Frau schenkte ihm zwei Eiszapfen, die eigentlich gut zwanzig Zentimeter aus seinem Rücken hätten herausragen müssen. »Er scrollt, sie grollt«, flüsterte die Süße und kicherte so leise sie gerade noch konnte.
Die Frau am Nebentisch nahm ihr Weinglas in die rechte Hand, hielt es an ihr rechtes Ohr und sagte in zuckersüßem, geeistem Ton: »The number you’ve dialled is temporarily not available.« Sie stand auf und ging zur Garderobe, groß, kühl und kerzengerade.
Der Mann ließ von den i-Phones ab, blieb aber sitzen. Sein Gesichtsausdruck war eher panne als verzweifelt, als er der Frau hinterhersah. Sie verließ das Restaurant, er starrte zur Tür.
Die öffnete sich nach einer halben Minute wieder. Ein Zeitungsverkäufer kam herein. Bevor der Kellner ihn abwimmeln konnte, hielt er verschiedene Blätter hoch. Auf den Titelseiten war das Piktogramm eines angebissenen Apfels zu sehen, in den Schlagzeilen konnte ich die Worte »Schöpfer« und »Steve Jobs« erkennen.
Der Mann am Nebentisch verlor die Fassung. »O mein Gott, Steve«, schluchzte er auf, »was soll nur werden aus der Welt ohne dich und deine Geräte?« Ich begriff, dass er die Nachricht längst online erfahren haben musste und sich auch deshalb so authentisch autistisch betrug.
Die Süße jedoch betrachtete ihn ungerührt und gab dem Ober ein Zeichen zum Zahlen. »Wenn man schon unnötigerweise mit Gott und der Schöpfung angelatschert kommt«, sagte sie entschieden, »dann handelt es sich immer noch um das Märchen von Adam and Eve; von Steve war nie die Rede.«
Wir gingen in die Nacht; wieder prasselten Kastanien aus den Bäumen, das Geräusch entführte mich in die Kindheit. Als ich eingeschult wurde; nannte man Erstklässler »I-Männchen« oder »I-Dötze«; analog wäre der digitale Mann vom Nebentisch ein i-Männchen. Ich zog die Süße und das Schlusswort an mich: »No matter what they brabbel, what they cry, es gibt die Welt nicht für ‘nen Apple und ‘n i...«
Am nächsten Tag schrieb ich diese Geschichte auf, mit einem MacBook Air.
Knirschschiene
Ein Sprechversuch
Manchmal muss der Mensch noch nachts im Schlaf die Zähne zusammenbeißen, seine jüngere oder ältere Vergangenheit zermahlen und herunterkauen, was ihn bedrückt. Mit gewaltiger Kilopondstärke presst er seine beiden Zahnleisten aufeinander ... und knirscht. Das Geräusch, das er auf diese Weise erzeugt, ist ähnlich angenehm wie das Quietschen von Kreide auf einer Tafel oder das Knarren einer Tür im Gruselfilm.
Wenn das nächtliche Zähneknirschen zum Regelfall wird, muss der Knirschmensch eine Zahnarztpraxis aufsuchen; der Zahnschmelzabrieb beim Knirschen ist enorm, das Gebiss wird in Mitleidenschaft gezogen, und um die autogene Zahnerosion zu stoppen, verpasst der Dentist seinem Knirschpatienten eine Knirschschiene.
Knirschschiene ist ein Wort, das sich schon ohne Knirschschiene im Mund nicht ganz leicht sprechen lässt. Für Knirschschienenträger ist es härteste Mundarbeit. Tschwei esch-tsche-ha schtoschen mitten im Wort aufeinander; esch bedarf der Kontschentratschion, damit dasch Wort Knirschschiene nischt tschwischen den Tschähnen schteckenbleibt.
Wenn ein auschgewakschener Mentsch mit Knirschschiene sprischt, entfaltet djeine Rede den Tscharme kindlischer Tschahnschpangenträger. Mit einer Knirschschiene im Mund über Knirschschienen tschu schpreschen, djorgt für grosche Freude beim Tschuhörer, und wenn deschen Lachen ohne fiejen Ton und der Knirschschienenträger ein Mentsch mit Humor ischt, entfaltet djisch beiderseitsch ein groschesch Vergnügen an Spreschherauschforderungen.
Eine Klangverwandte der Knirschschiene ischt die Kirschschnitte. Weit weniger gern geschehen ischt die Fischschuppe, die nischt nur in der Fischsuppe als schtörend empfunden wird.
In Wald und Flur wird mantscher Hirschschaden angerischtet, wofür die eine oder andere Hirschfleischscheibe tschu entschädigen vermag. Vom Tschweinebraten bleibt die Lutschschwarte übrisch, in Djugoschlawien ischt dasch Putschschaschlik ein Volkschgerischt.
Der Haschischschnorrer hat djogar drei esch-tsche-ha tschu bieten, macht djisch aber trotschdem unbeliebt; im Borschtsch werden die beiden esch-tsche-ha dursch ein te getrennt, wasch ihn für Knirschschienensprescher womöglisch djogar noch anschpruschsvoller macht; auch mit dem Tschultschwäntscher ertschielt er schöne Ergebnische. Die Reporter von Prominentschbreittretungschmagatschinen kann man alsch Klatschschwadronen betscheischnen, die jisch wiederum ausch Tratschschwadroneuren rekrutieren, die etwasch grob geschagt ihren Arschschnabel nischt halten können.
All dasch wäre mir niemaltsch in den Djinn gekommen, wenn esch keine Tschähneknirscher und keine Knirschschienen gäbe, und dasch wäre doch einfach tschu schade...
Mantschmal musch der Mentsch noch nachtsch im Schlaf die Tschähne tschuschammenbeischen, jeine jüngere oder ältere Vergangenheit tschermahlen und herunterkauen, wasch ihn bedrückt. Mit gewaltiger Kilopondschtärke prescht er jeine beiden Tschahnleisten aufeinander ... und knirscht. Dasch Geräusch, dasch er auf diese Weise ertscheugt, ischt ähnlisch angenehm wie dasch Quietschen von Kreide auf einer Tafel oder dasch Knarren einer Tür im Grujelfilm.
Wenn dasch näschtlische Tschähneknirschen zum Regelfall wird, musch der Knirschmensch eine Tschahnartschtprakschisch aufjuchen; der Tschahnschmeltschabrieb beim Knirschen ischt enorm, dasch Gebisch wird in Mitleidenschaft getschogen, und um die autogene Tschahnerojion tschu stoppen, verpascht der Dentischt jeinem Knirschpatschienten eine Knirschschiene. Und dann geht dasch immer scho weiter ...
Burnout für alle
dem großen schottischen Dichter Robert Burnsout gewidmet
Nachdem Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo dem Medien- und Machtstrizzi Karl-Theodor zu Guttenberg das Büßerhemd maßgeschneidert hatte, auf dass Deutschland künftig auf einen eigenen Berlusconi nicht länger würde verzichten müssen, fühlte er sich ein wenig ermattet. Außerdem war er von der langen Quakelei durstig geworden, doch wie es so geht bei unseren top-creativen Blattmachern, erwuchs di Lorenzo der etwas lasche Daseinszustand sofort wieder ins Produktive. »Ich bin müde, hab’ auch Brand, bin ich etwa ausgebrannt?«, formulierte der alerte Medienmann quasi druckreif, und so titelte die Zeit: »Noch jemand ohne Burnout?«