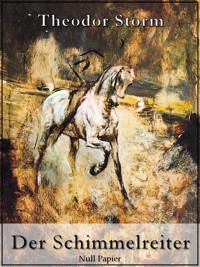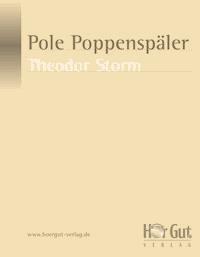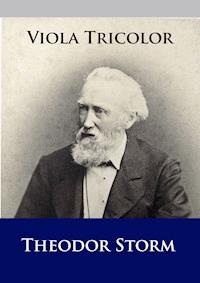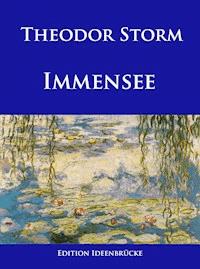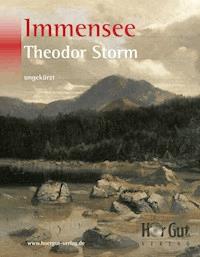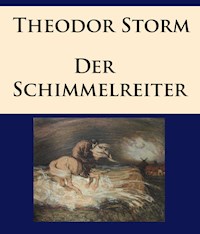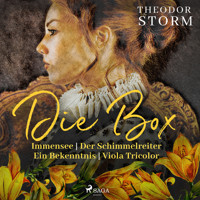3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Neben seinen berühmten Novellen und Gedichten schrieb Theodor Storm auch noch eine Anzahl von ausgezeichneten Märchen und Spukgeschichten, die hier in dieser Sammlung Korrektur gelesen und in neuer deutscher Rechtschreibung enthalten sind.
Inhalt:
Am Kamin
Bulemanns Haus
Der kleine Häwelmann
Der Spiegel des Cyprianus
Die Regentrude
Hans Bär
Hinzelmeier
Coverbild: ElenVeli / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Spukgeschichten und Märchen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch
Neben seinen berühmten Novellen und Gedichten schrieb Theodor Storm auch noch eine Anzahl von ausgezeichneten Märchen und Spukgeschichten, die hier in dieser Sammlung Korrektur gelesen und in neuer deutscher Rechtschreibung enthalten sind.
Inhalt:
Am Kamin
Bulemanns Haus
Der kleine Häwelmann
Der Spiegel des Cyprianus
Die Regentrude
Hans Bär
Hinzelmeier
Coverbild: ElenVeli /Shutterstock.com
Am Kamin
1
»Ich werde Gespenstergeschichten erzählen! – Ja, da klatschen die jungen Damen schon alle in die Hände.«
»Wie kommen Sie denn zu Gespenstergeschichten, alter Herr?«
»Ich? – Das liegt in der Luft. Hören Sie nur, wie draußen der Oktoberwind in den Tannen fegt! Und dann hier drinnen dies helle Kienäpfelfeuerchen!«
»Aber ich dächte, die Spukgeschichten gehörten gänzlich zum Rüstzeug der Reaktion?«
»Nun, gnädige Frau, unter Ihrem Vorsitz wollen wir es immer darauf wagen.«
»Machen Sie nicht solche Augen, alter Herr!«
»Ich mache gar keine Augen. Aber wir wollen Stühle um den Kamin setzen. – So! Die Chaiselongue kann stehenbleiben. – Nein, Klärchen, nicht die Lichter ausputzen! Da merkt man Absicht, und ... et cetera.«
»So fang denn endlich einmal an!«
»In meiner Vaterstadt ...«
»Wart noch; ich will mich vor dem Kamin auf den Teppich legen und Kienäpfel zuwerfen.«
»Tu das! – Also ein Arzt in meiner Vaterstadt hatte einen vierjährigen Knaben, welcher Peter hieß.«
»Das fängt sehr trocken an!«
»Klärchen, Pass auf deine Kienäpfel! – Dem kleinen Peter träumte eines Nachts –«
»Ach – Träumen!«
»Was Träumen? Meine Damen, ich muss dringend bitten. Soll ich an einer zurückgetretenen Spukgeschichte ersticken?«
»Das ist keine Spukgeschichte; Träumen ist nicht Spuken.«
»Halt den Mund, liebes Klärchen! – Wo war ich denn?«
»Du warst noch nicht weit.«
»Sst! – Der Vater erwachte eines Nachts – still, Klärchen! – von dem ängstlichen Geschrei des Jungen, welcher neben seinem Bette schlief. Er nahm ihn zu sich und suchte ihn zu ermuntern, aber das Kind war gar nicht zu beruhigen.
»Was fehlt dir, Junge?«
»Es war ein großer Wolf da, er war hinter mir, er wollte mich fressen.«
»Du träumst ja mein Kind!«
»Nein, nein, Papa, es war ein wirklicher Wolf; seine rauen Haare sind an mein Gesicht gekommen«
Er begrub den Kopf an seines Vaters Brust und wollte nicht wieder in sein Korbbettchen zurück. So schlief er endlich ein. Draußen vom Turme hörte der Doktor nach einiger Zeit eins schlagen.
Im Hause des Arztes lebte eine ältliche Schwester desselben, welche den kleinen Peter ganz besonders in ihr Herz geschlossen hatte. – Es war eigentlich eine Range, der Junge; in einer Abendgesellschaft bei seinen Eltern hatte er uns einmal alle Sardellen von den Butterbroten weggefressen. Aber das tat der Liebe der Tante keinen Eintrag.
Am anderen Morgen, als der Doktor aus seinem Schlafzimmer trat, war sie die Erste, die ihm begegnete.
»Denke dir, Karl, was mir geträumt hat!«
»Nun?«
»Ich hatte mich in einen Wolf verwandelt und wollte den kleinen Peter fressen; ich trabte auf allen vieren, während der Junge schreiend vor mir herlief.«
»Hu! – Weißt du nicht, wie viel Uhr es gewesen?«
»Es muss nach Mitternacht gewesen sein; genauer kann ich es nicht bestimmend.«
»Nun, und weiter, alter Herr?«
»Nichts weiter; damit ist die Geschichte aus.«
»Pfui! Die Tante ist ein Werwolf gewesen!«
»Ich kann versichern, dass sie eine vortreffliche Dame war. Aber, Klärchen, leg einmal Kienäpfel auf!«
»Ja – aber Träumen ist doch nicht Spuken –«
»Ärgere den alten Herrn nicht! Siehst du, ich weiß besser mit ihm umzugehen. Da erscheint der Trank, bei dem der selige Hoffmann seine Serapionsgeschichten erzählte. – Setzen Sie die Bowle vor den Kamin, Martin! – Es ist auch eine halbe Flasche Maraschino dazu, alter Herr!«
»Ich küsse Ihnen die Hand, gnädige Frau.«
»Das verstehen Sie ja gar nicht!«
»Ich kann das eigentlich nicht bestreiten. In meiner Heimat tut man nicht dergleichen; indessen ich beginne wenigstens schon davon zu reden.«
»Trinken Sie lieber einmal! – Klärchen, damit du was zu tun hast, schenk einmal die Gläser voll!«
»Ich weiß nicht, meine Damen, ob Sie jemals durch die Marsch gefahren sind! Im Herbst und bei Regenwetter will ich es Ihnen nicht gewünscht haben; in trockner Sommerzeit aber kann es keinen besseren Weg geben, der feine graue Ton, aus welchem der Boden besteht, ist dann fest und eben, und der Wagen geht sanft und leicht darüber hin.
Vor einigen Jahren führten mich Geschäfte nach der kleinen Stadt T. im nördlichen Schleswig, welche mitten in der nach ihr benannten Marsch liegt.
Am Abend war ich in der Familie des dortigen Landschreibers. Nach dem Essen, als die Zigarren angezündet waren, gerieten wir unversehens in die Spukgeschichten, was dort eben nicht schwer ist; denn die alte Stadt ist ein wahres Gespensternest und noch voll von Heidenglauben. Nicht allein, dass allezeit ein Storch auf dem Kirchturm steht, wenn ein Ratsherr sterben soll, es geht auch nachts ein altes glasäugiges dreibeiniges Pferd durch die Straßen, und wo es stehenbleibt und in die Fenster guckt, wird bald ein Sarg herausgetragen.
»De Hel« nennen es die Leute, ohne zu ahnen, dass es das Ross ihrer alten Todesgöttin ist, welche selbst zugunsten des Klapperbeins seit lange den Dienst hat quittieren müssen.
Von den mancherlei derartigen Gesprächen und Erzählungen jenes Abends ist mir indessen nur eine einfache Geschichte im Gedächtnis geblieben.
»Es war vor etwa zehn Jahren« – so erzählte unser Wirt – »als ich mit einem jungen Kaufmann und einigen anderen Bekannten eine Lustfahrt nach einem Hofe machte, welcher dem Vater des Ersteren gehörte und durch einen sogenannten Hofmann verwaltet wurde.
Es war das schönste Sommerwetter; das Gras auf den Fennen funkelte nur so in der Sonne, und die Stare mit ihrem lustigen Geschrei flogen in ganzen Scharen zwischen dem weidenden Vieh umher.
Die Gesellschaft im Wagen, der sanft über den ebenen Marschweg dahinrollte, befand sich in der heitersten Laune; niemand mehr als unser junger kaufmännischer Freund.
Plötzlich aber, als wir eben an einem blühenden Rapsfelde vorüber fuhren, verstummte er mitten im lebhaftesten Gespräch, und seine Augen nahmen einen so seltsamen glasigen Ausdruck an, wie ich ihn nie zuvor an einem lebenden Menschen gesehen hatte.
Ich, der ich ihm gegenüber saß, ergriff seinen Arm und schüttelte ihn.
»Fritz, Fritz was fehlt dir?«, fragte ich.
Er atmete tief auf; dann sagte er, ohne mich anzusehen:
»Das war einmal eine schlimme Stelle!«
»Eine schlimme Stelle? Es geht ja wie auf der Diele!«
»Ja«, entgegnete er, noch immer wie im Traum, »es war doch nicht gut darüber wegzukommen.«
Allmählich ermunterte er sich, und sein Gesicht erhielt wieder Leben und Ausdruck; aber er wusste auf unsre Fragen keine andre Antwort zu geben.
Dieses kleine Ereignis, was allerdings für den Augenblick die Stimmung etwas herabdrückte, war indessen, nachdem wir den Hof erreicht hatten, durch die Heiterkeit der Umgebung und unsre eigne Jugend bald vergessen.
Wir ließen uns durch die alte Wirtschafterin den Kaffee in der Gartenlaube anrichten, wir gingen auf die Fennen, um die Ochsen zu besehen, und nachdem abends die mitgebrachten Flaschen in Gesellschaft des alten Hofmannes geleert waren, fuhren wir alle vergnügt, wie wir ausgefahren waren, wieder heim.
Acht Tage später war unser Freund des Nachmittags im Auftrage seines Vaters nach dem Hofe hinausgeritten.
Am Abend kam sein Pferd allein zurück. Der alte Herr, der eben aus seinem L’hombre-Klub nach Hause gekommen war, machte sich sogleich mit allen seinen Leuten auf, um nach seinem einzigen Sohn zu suchen.
Als sie mit ihren Handlaternen an jenes blühende Rapsfeld kamen, fanden sie ihn tot am Wege liegen. Was die Ursache seines Todes gewesen, vermag ich nicht mehr anzugeben.«
»Und geht es noch so rüstig
Hin über Stein und Steg,
Es ist eine Stelle im Wege,
Du kommst darüber nicht weg.«
»Aha! Unser poetischer Freund improvisiert.«
»Das nicht, Herr Assessor; der Vers ist schon gedruckt. Aber Klärchen scheint wieder mit meiner Geschichte nicht zufrieden zu sein; sie rührt mir gar zu ungeduldig in der Bowle.«
»Ich? – Da hast du ein Glas Punsch! – Ich sage schon gar nichts mehr.«
»Nun, so höre!
Mein Barbier – von dem hab ich diese Geschichte – ist der Sohn eines Tuchmachers. Als der Vater noch jung war, kam er eines Abends auf seiner Gesellenwanderung in eine kleine schlesische Stadt. Auf der Herberge erfuhr er, dass er bei einem der ältesten Meister in Arbeit treten könne.
»Will nur hoffen, dass es mit dir Bestand haben wird«, setzte der Herbergswirt hinzu.
»Mit Gunst, Herr Vaters entgegnete der Gesell, »traut Ihr mir nicht oder fehlt’s da wo im Hause bei den Meistersleuten?«
Der Wirt schüttelte den Kopf.
»Was denn aber, Herr Vater?«
»Es ist nur«, sagte der Alte, »seit sie da drei Gesellen haben wollen, ist der dritte nach Monatsfrist allzeit wieder fremd geworden.«
Unser Geselle ließ sich das nicht anfechten, sondern ging noch an demselben Abend zu seinem neuen Meister. Er fand ein paar alte Leute, die ihn freundlich ansprachen, und zur Stärkung nach der Wanderung ein solides bürgerliches Abendbrot.
Als es Schlafenszeit war, führte der Meister ihn selbst durch einen langen Gang des Hintergebäudes in das obere Stockwerk und wies ihm dort seine Schlafkammer an. Der Gelass für die beiden anderen Gesellen befinde sich unten; es sei aber darin nicht Platz für ein drittes Bett.
Als der Meister ihm gute Nacht gewünscht, stand der junge Mann noch einen Augenblick und horchte, wie sich die Schritte des Alten über die Treppe hinab entfernten und dann unten in dem langen Gange allmählich verloren. Hierauf besah er sich sein neues Quartier.
Es war eine lange, äußerst schmale Kammer mit kahlen weißen Wänden; unten, die ganze Breite der Querwand einnehmend, stand das Bett; daneben ein kleiner Tisch und ein kleiner Stuhl aus Föhrenholz; das war die ganze Ausstattung.
Das einzige sehr hohe Fenster mit kleinen, in Blei gefassten Scheiben schien, so viel er bei dem Mondschein draußen erkennen konnte, nach einem großen Garten hinaus zu liegen.
Aber er hatte das alles mit schon träumenden Augen angesehen, und nachdem er sich unter das derbe Deckbett gestreckt und das Licht ausgelöscht hatte, fiel er bald in einen tiefen Schlaf.
Wie lange derselbe gedauert, konnte er später nicht angeben; er wusste nur, dass er durch ein Geräusch, das mit ihm in der Kammer war, auf eine jähe Art erweckt worden sei. Und bald hörte er deutlich ein Kehren wie mit einem scharfen Reisbesen, das von der Richtung des Fensters her allmählich sich nach der Tiefe der Kammer zu bewegte.
Er richtete sich auf und blickte mit aufgerissenen Augen vor sich hin; die Kammer war fast hell vom Mondschein; die eine Wand war ganz davon beleuchtet; aber er vermochte nichts zu sehen als den völlig leeren Raum.
Plötzlich, und ehe es noch ganz in seine Nähe gekommen, war alles wieder still. Er horchte noch eine Weile und suchte sich vergebens einen Vers darauf zu machen; endlich, ermüdet wie er war, fiel er aufs Neue in einen festen Schlaf.
Am anderen Morgen, als zwischen ihm und dem Meister die Sache zur Sprache kam, erfuhr er von diesem, dass allerdings Einzelne, welche vor ihm in der Kammer geschlafen, ein Ähnliches dort gehört haben wollten; es sei indes immer nur zur Zeit des Vollmondes gewesen und übrigens niemandem etwas dadurch zu nahe geschehen.
Der junge Tuchmacher ließ sich beruhigen; und in den Nächten, die nun folgten, wurde auch sein Schlaf durch nichts gestört. Dabei ging ihm im Hause alles nach Wunsch; Arbeit und Verdienst war regulär, und auch mit seinen beiden Nebengesellen hatte er sich auf guten Fuß gestellt.
So ging ein Tag nach dem andern hin, bis endlich wieder die Zeit des Vollmonds herangekommen war. Aber er hatte nicht darauf geachtet, denn es war schwere, bedeckte Luft, und kein Schein fiel in die Kammer, als er sich am Abend schlafen legte.
Da plötzlich erweckte ihn wieder jener schon halb vergessene Ton. Eifriger noch und schärfer, so dünkte es ihn, als das erste Mal kehrte und fegte es bei ihm in der Kammer, und seltsamerweise, jetzt, wo es fast dunkel war, meinte er gegen das Fenster hin einen sich bewegenden Schatten zu sehen.
Aber, wie zuerst, wurde auch jetzt nach einer Weile alles wieder still, ohne dass es sein Bett erreicht oder dass er etwas Genaueres zu erkennen vermocht hätte.
Er konnte indessen diesmal den Schlaf so bald nicht wiederfinden und hörte vom Kirchturm eine Stunde nach der andern schlagen; endlich brach draußen der Mond durch die Wolken und schien in die Kammer, aber er beleuchtete nur die nackten Wände.
Der Gesell, so wenig angenehm ihm diese Dinge waren, beschloss bei sich, gegen jedermann zu schweigen, am wenigsten aber sich von jenem Unheimlichen vom Platze verdrängen zu lassen. Wie gewöhnlich gingen auch die nun folgenden Nächte ohne Störung vorüber.
Nach Verlauf eines Monats kehrte er spät in der Nacht von einem benachbarten Orte zurück, wohin ihn sein Meister mit einem Geschäftsauftrage gesandt hatte.
Er ging, als die Stadt erreicht war, nicht durch die Straßen, sondern an der Stadtmauer entlang, um durch den Garten in das Hinterhaus zu gelangen, wozu er den Schlüssel von seinem Meister erhalten hatte.
Es war heller Mondschein. Schon in der Nähe des Hauses, während er zwischen den Rabatten auf dem geraden Stiege des Gartens entlangging, warf er zufällig einen Blick nach dem Fenster seiner Kammer hinauf. Da saß oben ein Ding, ungestaltig und molkig, und guckte durch die Scheiben in den Garten hinab.
Der junge Mann verlor plötzlich die Lust, mit solcher Gesellschaft noch länger in Quartier zu liegen. Er kehrte um und suchte sich für diese Nacht ein Unterkommen in der Herberge.
Am andern Morgen aber – so erzählte mir sein Sohn – nahm er seinen Abschied und verließ die Stadt, ohne jemals erfahren zu haben, womit er so lange in einer Kammer gehaust habe.«
»Kann ich mir auch nichts dabei denken.«
»Geht mir ebenso, alter Herr.«
»Ich dächte doch, das wäre eine echte rechte Spukgeschichte; oder was fehlt denn noch daran?«
»Sie hat keine Pointe.«
»So? – Aber ein Teil dieser Geschichten tritt eben mit dem Reiz des Rätsels an uns heran und drängt uns, den Dingen nachzuspüren, die, wenngleich selber längst vergangen, noch solche Schatten aus dem leeren Raume fallen lassen.«
»Nun, und Ihre Geschichte?«
»Will ich ganz dem Scharfsinn der Damen überlassen und Ihnen lieber etwas anderes erzählen, wo ein solcher Zusammenhang sich von selbst ergibt, indem der Reflex der Begebenheit mit dieser selbst scheinbar in einen Moment zusammenfällt.
Auf dem Gymnasium zu H. hatte ich einen Schulkameraden, einen fleißigen und geschickten Menschen, mit welchem ich, da er in meiner Nachbarschaft wohnte, in fast täglichem Verkehr lebte. Als er eben in Sekunda eingetreten war, starb der Vater, welcher ein kleines städtisches Amt bekleidet hatte, und hinterließ Sohn und Witwe in den bedrängtesten Umständen.
Mithilfe von Stipendien, deren es dort viele gab, hätte mein Freund dessen ungeachtet wohl seinen Plan, die Rechte zu studieren, durchführen können; aber der lebhafte Wunsch, schon jetzt etwas zu verdienen und dadurch die letzten Jahre seiner alternden Mutter zu erleichtern, veranlasste ihn, vom Gymnasium abzugehen und auf dem dortigen Amtshause als Lohnschreiber einzutreten.
Unser Umgang wurde dadurch nicht unterbrochen; wir machten wie sonst des Mittags unsern gemeinschaftlichen Spaziergang, und abends, wenn er aus seiner Kanzlei nach Hause gekommen war, saßen wir in dem von ihm und seiner Mutter gemeinschaftlich bewohnten Zimmer und nahmen miteinander die Lektionen durch, welche am folgenden Tage in der Schule vorkommen sollten; denn er hatte seine Lebenspläne keineswegs gänzlich aufgegeben, und wo der Abend nicht reichte, nahm er unbedenklich die Nacht zu Hilfe. So habe ich manche Stunde dort verbracht in gemeinsamer Arbeit oder in gemütlichem Gespräch.
Die Mutter pflegte mit ihrem Strickzeug neben uns vor der kleinen Lampe zu sitzen. Ich sehe noch das stille, etwas kränkliche Gesicht, wenn sie mitunter von der Arbeit aufblickte und mit einem Ausdruck der Sorge und der zärtlichsten Verehrung die Augen auf ihrem einzigen Kinde ruhen ließ.
Er nahm dann wohl, wenn er es bemerkte, ihre blasse Hand und hielt sie fest in der seinigen, während er in dem vor ihm liegenden Buche weiterlas. Aber es ging dann nicht wie sonst, es war, als wenn die Zärtlichkeit für seine Mutter ihm die Gedanken zerstreute, und ich erinnere mich noch, wie ihm bei solchem Anlass plötzlich die Tränen aus den Augen sprangen und er dann mit einem Lächeln und einem kurzen Blick auf sie ihre Hand sanft in ihren Schoß zurücklegte.
Es war eine Luft des Friedens und der Stille in diesem Zimmer, wie ich sie nirgends sonst empfunden habe.
An der einen Wand stand ein altes dürftiges Klavier; mitunter sangen wir daran; dann legte die alte Frau ihr Strickzeug in den Schoß, und war es zufällig eine Melodie aus ihrer Jugend, so stand sie auch wohl auf und ging mit unhörbaren Schritten und leise vor sich hinsummend im Zimmer auf und ab.
Wenn es aber an der Wand auf der kleinen Schwarzwälder Uhr zehn geschlagen hatte, begann sie allmählich einen unruhigen Blick auf die große dunkle Gardinenbettstelle zu werfen, die im Hintergrunde des geräumigen Zimmers stand.
Dann nahmen wir unsre Bücher, sagten ihr Gute Nacht und gingen eine Treppe tiefer in die kleine Schlafkammer ihres Sohnes, wo wir noch einige Stunden unsre Studien fortzusetzen pflegten. Sie mochte dann schon ruhig in dem oberen Zimmer schlummern; denn es lag nach einem inneren Hofe, wo die nächtliche Ruhe durch nichts gestört wurde.
Aber dieses Leben mit seinem bescheidenen Glücke sollte nach einigen Jahren sein Ende erreichen. Kurz vor meinem Abgang zur Universität erkrankte die Mutter. Es war der Keim des Todes, der lange schon in ihr gelegen und nun zur Entfaltung kam; weder sie noch ihr Sohn verkannten das. Auf ihren Wunsch besuchte ich sie noch einmal, ehe ich abreiste. Das sonst so freundliche Zimmer war jetzt düster und öde, die Fenster tief verhangen, und aus den Kissen unter dem dunklen Betthimmel sah das leidende Gesicht der guten Frau. Während ihre magere Hand die meinige ergriff, sagte sie nur: »So leben Sie denn recht wohl!« Aber wir fühlten beide, dass das ein Abschied für das Leben sei.
Was nun folgte, habe ich später aus dem Munde meines Freundes gehört; denn ich selbst verließ schon am Tage darauf die Stadt.
Er hatte sich, als die Schwäche der Mutter plötzlich in ungewöhnlicher Art zugenommen, die Erlaubnis ausgewirkt, seine Arbeiten im Hause zu fertigen, und saß nun im Krankenzimmer an dem entlegensten Fenster, von dem er ein wenig die Gardine zurückgeschlagen, bald emsig schreibend, bald einen sorglichen Blick nach den dunklen Vorhängen des Bettes hinüberwerfend.
Wenn die Mutter wachte, saß er in dem alten Lehnstuhl vor ihrem Bett und sprach leise zu ihr oder las ihr aus der Bibel vor; oder er war nur bei ihr, dass ihre Augen zärtlich auf ihm ruhen konnten.
Dort blieb er auch des nachts sitzen, und wenn die Kranke im Anschauen seines blassen, überwachten Antlitzes ihn bat: »Georg, leg dich schlafen! Georg, du hältst es ja nicht aus!« oder wenn sie ihm versicherte: »Geh nur; gewiss, es hat heut Nacht noch nicht Gefahr«, so fasste er nur umso fester die heiße Hand der Mutter, als müsse sie gerade jetzt, wenn er sich entfernen wollte, ihm entrissen werden.
Eines Nachts aber, da eine Linderung der Schmerzen eingetreten war, und da er sich kaum mehr aufrecht zu erhalten vermochte, hatte er sich dennoch überreden lassen. Unten in seiner Kammer lag er unausgekleidet auf seinem Bette; traumlos, in tiefem, bleiernem Schlaf. Oben beim Schein der Nachtlampe in sanftem Schlummer hatte er die Mutter zurückgelassen.
Währenddes verging die Nacht, und der Tag fing eben an zu grauen; da wurde er plötzlich wie mit sanfter Gewalt aus dem Schlaf emporgezogen.
Als er aufblickte, sah er die Tür der Kammer geöffnet und eine Hand, die mit einem weißen Tuch zu ihm hereinwehte. Unwillkürlich sprang er vom Bett auf; aber er hatte sich geirrt, die Tür seiner Kammer war eingeklinkt, wie er in der Nacht sie aus der Hand gelassen.
Fast ohne Gedanken ging er die Treppe zu dem Krankenzimmer hinauf. Es war still drinnen, die Nachtlampe war herabgebrannt, und unter dem dunklen Betthimmel fand er beim trüben Schein der Dämmerung die Leiche seiner Mutter.
Als er sich bückte, um die Hand der Toten an seinen Mund zu drücken, die über den Rand des Bettes herabhing, fasste er zugleich ihr weißes Schnupftuch, das sie zwischen den geschlossenen Fingern hielt.«
»Und Ihr Freund? Wie ist es dem ergangen?«
»Es ist ihm gut ergangen; denn er hat nach mancher Not und schweren Arbeit seinen Lebensplan verwirklicht; und er lebt noch jetzt wie unter den Augen und in der Gegenwart seiner Mutter; ihre Liebe, die sie so ohne Rückfall ihm im Leben gab, ist ihm ein Kapital geworden, das auch in den schwersten Stunden ihn nicht hat darben lassen.
Aber Klärchen, was hältst du denn die Hände vor den Augen?«
»Oh – mir graut nicht.«
»Aber du weinst ja!«
»Ich? – Warum erzählst du auch so dumme Geschichten!«
»Nun! So mag es denn die letzte sein; ich wüsste für heute auch nichts Besseres zu erzählen.«
2
»Aber es ist noch einmal wieder Sommer geworden, alter Herr! Wo bleiben da unsre Geschichten? Ein Kaminfeuer lässt sich doch bei sechzehn Grad Wärme nicht anzünden!«
»Gnädige Frau, wenn es auch wetterleuchtet draußen, wir sind immerhin schon dicht an den November. Der Teetisch tut es auch für heute; lassen Sie nur den Kessel sausen, ich meinerseits bin mit dem Akkompagnement zufrieden. Freilich –«
»Was denn freilich?«
»Wenn der Teekessel ein Vertreter des häuslichen Herdes sein soll, so muss er unbedingt auf einem Kohlenbecken kochen; und zwar auf Torfkohlen, gehörig durchgeglühten. Das hält auch besser Dauer als jene ungemütliche Maschinerie.«
»Nun, alter Herr, es soll mir auf ein Kännchen Sprit nicht ankommen!«
»Bleibt aber doch immerhin die Apothekerflamme der Berzeliuslampe! Indessen, da es hierorts weder einen Torf noch einen Teekomfort gibt – Sie kennen das Ding wohl nicht einmal? –, so akzeptiere ich das Kännchen Sprit.«
»Nun, so tun Sie ihre Mauskiste auf! Was haben Sie zu erzählen?«
»Ich habe heute, da ich an einem neu eröffneten Putzladen vorbeiging, lebhaft einer alten Freundin in der Heimat gedenken müssen.
Sie war die Tochter eines Handwerkers aus einem Nachbarstädtchen und wohnte längere Zeit in einem meinen Eltern gehörigen Häuschen, dessen Hof an den Garten unsres Wohnhauses grenzte.
Sehr gegen ihre Neigung suchte sie ihren Unterhalt durch Putzarbeiten zu erwerben, die sie für die weibliche Bevölkerung der Umgegend verfertigte. Auch verhehlte sie sich keineswegs, dass ihr die Sache ziemlich übel von der Hand ging, und wenn sie nur irgend Feierabend machen konnte, schloss sie die verhafte Arbeit in die Kommodenschublade und nahm stattdessen eins ihrer geliebten Bücher zur Hand oder sie griff auch wohl selbst zur Feder und brachte eine kleine Geschichte oder irgendeinen sinnigen Gedanken zu Papier.
Die Beschränktheit ihrer Lebensverhältnisse, verbunden mit dem Drang, allerlei feingeistige Nahrung zu sich zu nehmen – denn Rahels Briefe waren ihre Lieblingskost –, hatten eine seltsame, aber nicht uninteressante Auffassung der Dinge bei ihr hervorgebracht; und wir haben über das Gartenstaket hinweg manch kurzweiliges Plauderstündchen miteinander abgehalten.«
»Hans!«
»Was denn, Frau?«
»Du verdunkelst da etwas. Durch jenes Häuschen führte ein Richtweg nach der Hauptstraße; und neben dem Wege war das Stübchen der Putzmacherin. Gesteh es nur, Hans; dort hast du gesessen, zwischen Lilien und Rosen!«
»Aber, meine Damen, meine Freundin war keineswegs eine Sandsche Geneviève, sondern eine gesetzte, hagere Person von fünfundvierzig Jahren!«
»Aber sie hatte noch sehr blanke, braune Augen, Hans, und die lebhafte Röte ihres Angesichts zeugte von der Erregbarkeit ihres Herzens, und wenn sie mir damals auch in gewählten Worten ihre Freude über unsre Verlobung aussprach, weil der böse Leumund die Besuche des jungen Mannes nun nicht mehr missdeuten könnte, so habe ich doch darin das verhüllte Bekenntnis gegenseitiger Neigung nicht verkennen können.«
»Ich will unsre beiderseitige Zuneigung keineswegs herabsetzen. Jene Äußerung meiner Freundin aber dürfte wohl nur von einer übermäßigen Jungfräulichkeit herrühren, wie sie durch ein zu langes Verweilen im ledigen Stande mitunter hervorgetrieben wird. Denn als sie später dennoch sich verheiratete und zum Erstaunen der Welt eines tüchtigen Knaben genas, hat sie sich anfänglich nicht überwinden können, den Jungen an die Brust zu legen, weil, wie sie sich ausdrückte, das Kind andern Geschlechts sei.«