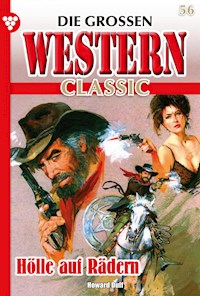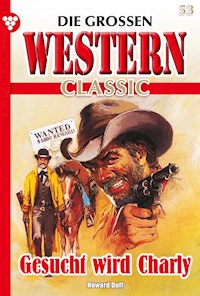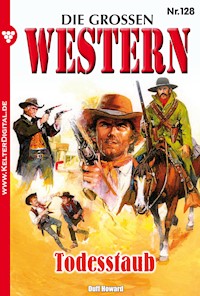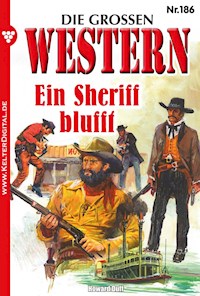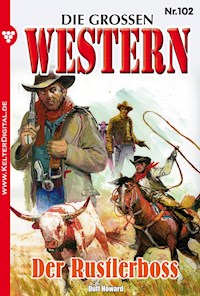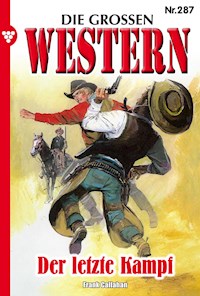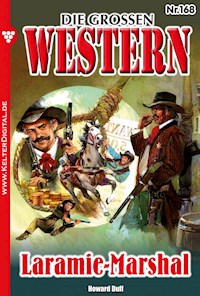Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. »Die Hände hoch, nimm die Hände hoch, Gringo.« Es ist Tony Ornell, als wenn ihm jemand einen klatschnassen, eiskalten Lappen in den Nacken schlägt. Die Stimme ist schräg über ihm und so scharf, dass Tonys Hand zurückzuckt. Die Hand ist vom Revolverkolben fort. Tony wendet nur kurz den Kopf und sieht nun den Mann oben auf dem Felsen stehen, einen schweren, breiten Mann, der sein Gewehr, auf dem das Mondlicht sich bricht, auf ihn gerichtet hält. »Sitz still«, sagt nun auch der Mann, der vor ihm ist, und hat sein Gewehr angeschlagen, während der andere, der dritte Mann, hastig hinter ihm heranreitet. »Keine Bewegung, wir schießen.« Sie haben nicht einmal die Halstücher vorgezogen, denkt Tony Ornell bestürzt, sie sehen aus wie Banditen. Eine Falle, denkt Tony und nimmt langsam die Arme empor. Der Revolver sieht ihn an, düster das Mündungsloch, drohend der Stahl. Die Patronen in den Kammern des Zylinders sind deutlich zu erkennen. Mein Geld, denkt Tony, sie werden mich durchsuchen und mein Geld nehmen. Dieser hagere Bursche da hat eine Visage, die einem das Fürchten lehren kann. »Komm herunter«, sagt der Mann vor ihm in seinem harten rollenden Englisch. »Sonst wirst du liegen, sehr lange liegen. Und die Geier werden dich holen.« »Du wirst nie mehr aufstehen«, sagt nun der Zweite mit dem Revolver drohend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 48 –
Spur im Sand
Ornell nahm die Verfolgung auf
Howard Duff
»Die Hände hoch, nimm die Hände hoch, Gringo.«
Es ist Tony Ornell, als wenn ihm jemand einen klatschnassen, eiskalten Lappen in den Nacken schlägt. Die Stimme ist schräg über ihm und so scharf, dass Tonys Hand zurückzuckt.
Die Hand ist vom Revolverkolben fort.
Tony wendet nur kurz den Kopf und sieht nun den Mann oben auf dem Felsen stehen, einen schweren, breiten Mann, der sein Gewehr, auf dem das Mondlicht sich bricht, auf ihn gerichtet hält.
»Sitz still«, sagt nun auch der Mann, der vor ihm ist, und hat sein Gewehr angeschlagen, während der andere, der dritte Mann, hastig hinter ihm heranreitet. »Keine Bewegung, wir schießen.«
Sie haben nicht einmal die Halstücher vorgezogen, denkt Tony Ornell bestürzt, sie sehen aus wie Banditen.
Eine Falle, denkt Tony und nimmt langsam die Arme empor.
Der Revolver sieht ihn an, düster das Mündungsloch, drohend der Stahl. Die Patronen in den Kammern des Zylinders sind deutlich zu erkennen.
Mein Geld, denkt Tony, sie werden mich durchsuchen und mein Geld nehmen. Dieser hagere Bursche da hat eine Visage, die einem das Fürchten lehren kann.
»Komm herunter«, sagt der Mann vor ihm in seinem harten rollenden Englisch. »Sonst wirst du liegen, sehr lange liegen. Und die Geier werden dich holen.«
»Du wirst nie mehr aufstehen«, sagt nun der Zweite mit dem Revolver drohend. »Eine Bewegung, dann bist du tot.«
Tony ahnt plötzlich, dass sie nicht bluffen.
Sie werden schießen, sobald er etwas versucht. Er steigt ab.
Tony sitzt am Boden und sieht sie vor sich stehen.
Dem Gewehrkolben kann er nicht ausweichen.
In der nächsten Sekunde sieht Ornell den Mond am Himmel immer größer und größer werden.
Er denkt noch, dass der Mond auf die Erde stürzt. Dann sinkt er zur Seite und wird ohnmächtig.
Als Tony zu sich kommt, friert er entsetzlich. Die drei Banditen sind weg, mit ihnen seine Jacke, die Stiefel, seine Uhr und das Pferd. Auch seine Waffen sind verschwunden.
»Diese verflixten Halunken«, sagt Tony wütend.
Er hat nur Socken an. Es sind prächtige Wollsocken, überhaupt hat Tony stets nur die besten Kleidungsstücke für sich gekauft, das ist in seinem Beruf als Spieler so üblich.
Tony Ornell geht los. Er orientiert sich nach dem Stand des Mondes. Der harte, manchmal so grobkörnige Boden beginnt bald, seinen Füßen Schwierigkeiten zu machen. Die Fußsohlen brennen. Er seufzt bitter, streift dann seine Hosen ab, zieht die Unterhose aus und zerreißt sie. Zwar hat er nun keine Unterhose mehr, aber seine Füße kann er mit den Streifen umwickeln und so weiterkommen.
Er muss Wasser finden. Es wird schon irgendwo ein Haus geben.
Mehr als drei Stunden mag er unterwegs sein, als er im Osten den grauen Streifen entdeckt.
Der Morgen kommt. Ornell sinkt oben an einem Hang auf einen kleinen Vorsprung und blickt in das Tal zu seinen Füßen.
In diesem Augenblick – er hat den Kopf in die Hände gestützt und atmet mühsam – hört er den Knall.
Durch die Berge kommt scharf und dröhnend das Echo eines Gewehrschusses.
Der Schuss muss mindestens drei Meilen voraus fallen, wenn es nicht noch weiter ist. Das Echo ist nur scharf, aber es hat das typische Dröhnen und Grollen eines Gewehrschusses.
Gleich darauf, kaum eine Sekunde später, bellt es einmal trocken und peitschend, aber leiser auf.
»Ein Gewehr, dann ein Revolver«, sagt Tony erstaunt. »Es ist in der Richtung des Tales hier, genau nach Osten. Wo jemand schießt, da sind auch Menschen, da wird auch Wasser sein, ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen.«
Es kracht noch einmal, dann ist alles totenstill.
Für Ornell aber, der sich steil aufgerichtet hat, sind die Schüsse ein Zeichen von Zivilisation. Wo geschossen wird, da sind auch Menschen, also muss er hin, ganz gleich, wer und warum man dort geschossen hat.
Tony hastet wieder los, kommt in das Tal und läuft nun beinahe. Einmal geht seine Umwicklung am linken Fuß auf. Er schimpft, muss anhalten und sich den Stoff erneut um den Fuß binden. Dann geht es weiter.
Tony Ornell hat nichts als die Hoffnung, vielleicht ein Haus, vielleicht sogar ein Essen, in jedem Fall aber Menschen zu finden.
*
Ornell torkelt auf den Zaun zu und hält sich an ihm fest. Er sieht vor sich den langen Hang, das Salzgras und die Büschel des Fettholzes. Neben dem Haus ist ein Brunnen, dessen Wringe von der Sonne ausgeblichen ist. Das Seil hängt von der Wringe herab in den Brunnen. Rechts vom Brunnen, also dem Haus gegenüber, ist ein Stall.
Und der Stall ruft denselben Eindruck hervor den Ornell schon vom Haus gewonnen hat.
Es sind keine zweihundert Schritte mehr, aber für Ornell sind zweihundert Schritte wie tausend, so ermattet fühlt er sich.
Die Lehmwände des Hauses zeigen Risse und keine Farbe, das Dach ist an einigen Stellen verfallen. Die Fenster sind heil. Nur das eine Fenster des Stalles, das Ornell sehen kann, ist zerborsten.
Und alles ist still.
Kein Vieh hier zu sehen, keine Spur von einem Menschen. Im ersten Augenblick bezweifelt Tony, dass dies das Haus sein soll, der Punkt, an dem die Schüsse gefallen sind. Es ist heller Tag, Ornell ist am Rande der Erschöpfung. Obwohl die Sonne noch nicht hoch steht, ist es schon warm.
Tony Ornell stemmt sich gegen die Latte des Zaunes und blickt den Zaun entlang auf Haus und Stall. Es sieht alles verwahrlost, völlig verlassen aus. Wenn es jemals hier Bewohner gegeben hat, so sind sie mit Sicherheit schon vor Jahren fortgegangen.
»Ich habe mich geirrt«, sagt Ornell heiser. »Oh, mein Gott, keine Seele zu sehen, niemand hier. Der Brunnen, hoffentlich führt er Wasser. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lieber Himmel, in einem dieser Täler hier muss es sein, aber niemals hier. Ich habe mich sicher geirrt.«
Er hat nicht die Kraft, sich über den Zaun zu ziehen, dazu reicht es nicht mehr. So schleppt er sich am Zaun weiter, der nach zwanzig Schritten ohnehin zusammengebrochen ist und steigt über die am Boden liegende Latte hinweg. Dann torkelt er auf den Brunnen zu, erreicht ihn, wirft einen Blick nach links und rechts, blickt auf das Seitenfenster des nur eingeschossigen Hauses und fragt, buchstäblich krächzend:
»Hallo, ist da jemand?«
Nichts, keine Stimme gibt Antwort, kein Geräusch kommt auf. Er fasst nun an das Seil, zieht und spürt das Gewicht des Eimers, der am Seil hängt. Hastig betätigt er die Winde. Ein quietschendes, abscheuliches Geräusch kommt von den beiden Bolzen her, die die Winde in den Lagern halten, aber selbst jetzt zeigt sich nichts.
Der Eimer kommt nun nach oben.
Ornell zieht ihn zu sich heran auf den Brunnenrand und kippt ihn dann.
Tony trinkt, schüttet sich dann einfach das Wasser über den Kopf und lässt schnaufend den Eimer auf dem Rand des Brunnens stehen.
In diesem Moment poltert es hohl und hart rechts von ihm. Er fährt herum, blickt auf den Stall. Aber es ist nun still. Auf den Stall blickend, geht er zum Haus.
»He«, sagt er noch einmal, nun schon bedeutend frischer. »Ist hier jemand? Man hat mich beraubt, ich brauche Hilfe. Ich habe keine Waffe. He, ist da jemand?«
Ein schneller Blick nach rechts, keiner kommt um die Ecke. Und das Fenster?
Tony dreht sich blitzschnell um, steht nun neben dem Fenster und kann in den Raum blicken.
Das Zimmer ist vielleicht drei Schritte breit und vier lang. In ihm ist niemand, die Tür steht offen, durch die man auf einen Flur blicken kann.
»Hallo«, brummt Tony laut. »Wenn hier jemand ist, ich habe keine schlechten Absichten. Hallo.«
Es bleibt still. Seine umwickelten Füße verursachen auch kein Geräusch, als er zur Ecke des Hauses geht und dann um die Ecke blickt.
Tony Ornell sieht einen toten Mann vor der Tür am Boden. Die Hand des Mannes ist anderthalb Zoll vom Kolben eines Revolvers entfernt.
Es ist Tony, als wolle die Stille ihn erdrücken. Es ist ihm, als könne dieser Mann jeden Augenblick aufspringen. Er braucht fast eine Minute, ehe er sich bewegt und den ersten Schritt um die Ecke macht.
Die Taschen des Mannes sind nach außen gekehrt, sein Hut liegt nahe der Türschwelle, das Lederfutter ist umgekrempelt worden. Dem Mann fehlt auch der Revolvergurt, der Gurt liegt zwei Schritt weiter und ist aufgetrennt worden.
Ornell bleibt stehen und blickt auf die Stiefel. Die Stiefel, denkt er, er hat sie ausziehen müssen wie ich.
Er sieht die Spuren im Sand vor der Tür, Stiefelabdrücke auf der Türschwelle.
»Mein Gott«, sagt Tony Ornell gepresst. »Was ist hier geschehen?«
Er geht langsam weiter, er wagt kaum, den Mann anzublicken.
Er ist bärtig und vielleicht fünfunddreißig Jahre alt. Er ist schwarzhaarig, er hat einen wilden, trotzigen Zug im Gesicht.
»Zweimal getroffen«, sagt Tony stockheiser. »Der Gewehrschuss ist vor dem Revolverschuss gekommen.
Sollte er wirklich noch die Kraft gehabt haben, den Revolver zu ziehen und zu schießen? Wer hat das getan?«
Ornell hebt mit zwei spitzen Fingern den Revolver an und riecht an der Mündung. Von Schusswaffen versteht Ornell fast genauso viel wie von den Spielkarten. Es ist seltsam, aber er hat immer eine Vorliebe für Schusswaffen besessen, für Gewehre, Revolver und Derringer. Niemand braucht ihm zu sagen, dass aus diesem Revolver vor wenigen Stunden gefeuert worden ist. Es besteht kein Zweifel mehr, der Mann hat trotz der ersten Kugel noch schießen können.
Erst nach diesem Gedanken wiegt Ornell den Revolver in der Hand und greift dann fest zu. Es ist dieser Augenblick, der ihn zum dritten Mal zusammenzucken lässt.
Es ist Tony, als würde dieser Ort unheimlich, immer bedrückender wird ihm zumute.
Es sieht fast wie Furcht aus, als sich Ornell bückt und den Revolver aufnimmt, um ihn mit Patronen zu füllen.
Die Waffe, denkt er, eine Waffe muss ich haben.
Er fühlt sich plötzlich sicherer und betritt dann die Küche. Der Herd steht dort, ein alter, verbeulter und durchgebrannter Topf liegt vor dem Herd.
»Der Packen«, sagt Ornell verstört und blickt entsetzt auf das Durcheinander von Sachen am Boden. Hosen, Hemden, zwei Jacken, alle aus schwarzem Tuch gefertigt. Dazu eine Lederweste, auch schwarz. Ein Gewehr liegt an der Wand, Patronen daneben. Man hat den vorderen Schraubverschluss des Winchesterröhrenmagazins herausgedreht, die Feder liegt dort.
Was hat man gesucht, fragt sich Ornell verständnislos. Alles zerwühlt, überall die Taschen nach außen gedreht, jedes Behältnis geöffnet, die Wasserflasche offen. Man hat etwas gesucht, aber ob man es gefunden hat?
Er geht zum Herd, selbst dort hat man gesucht, den Rost entfernt. Im Staub, der überall fast fingerdick liegt, die Stiefelabdrücke.
Und dann weiß er es. Zwei Männer sind hier gewesen. Es sind drei verschiedene Stiefelspuren. Eine muss dem Mann draußen gehören, er hat Stiefel mit einem breiten Absatz, das weiß Ornell nach jenem Blick draußen genau.
Der Mann ist keine drei Schritte in diesen Raum gegangen, der neben der Küche liegt und in den Ornell geblickt hat, dann ist er wieder umgekehrt. Anscheinend hat er nur nachsehen wollen, ob auch wirklich niemand im Haus gewesen ist. Es muss ja noch fast stockdunkel im Haus gewesen sein, als er gekommen ist. Kein Lager, also hat er hier nicht geschlafen. Vielleicht im Stall?
Rechter Hand ist noch ein Raum. Auch in ihn hat der Mann geblickt, auch hier ist er nur zwei Schritte gegangen und wieder umgekehrt.
Wieder die beiden Spuren rechts und links seiner Spur.
Ornell geht langsam nach draußen, denkt dann an das Gewehr und weiß plötzlich, dass der Mann einen Fehler gemacht haben muss. Er hat sein Gewehr nicht mit vor die Tür genommen.
Aus Fehlern anderer kann man auch lernen, also setzt sich Ornell hin, setzt die Feder wieder ein und lädt dann das Gewehr auf. Er repetiert, die Patronen fliegen ihm entgegen, die Waffe funktioniert. Erst danach geht er hinaus und sieht sich um.
Kein Mensch kommt, die Gegend ist wie tot. In der Stille, das Gewehr im Arm, geht er zum Stall und tritt an die Wand. Die Tür geht knarrend auf und das Prusten kommt.
Im ersten Moment zuckt er zurück, dann muss er über sich selbst lächeln und macht einen Schritt in den Stall hinein.
Ein Pferd steht da und sieht ihn an, es prustet wieder und schnaubt scharf. Ein großes dunkelbraunes Pferd.
Am Boden liegt der Sattel und der Gurt. Man hat die beiden Satteltaschen genauso behandelt wie den Packen, aber seltsamerweise nicht den Sattel aufgeschnitten.
Warum das nicht, fragt sich Tony und blickt das Pferd an. So ein Pferd lässt man nicht hier stehen, man nimmt es mit.
Ornell steht nachdenklich neben dem Pferd, dreht dann um, geht zum Brunnen und lässt den Eimer hinab. Er holt ihn wieder herauf, muss dem Pferd zweimal den Eimer bringen und bekommt ein anscheinend dankbares Schnauben zu hören.
»Ich verstehe das nicht«, sagt er und hockt sich auf den umgedrehten Eimer. »Wenn das Buschräuber gewesen sind, würden die doch nie seine Sachen und sein Pferd hier gelassen haben. Die Burschen können alles gebrauchen, vor allen Dingen die Waffen und ein gutes Pferd. Das begreife wer will, ich begreife es nie. Oder ist man hinter ihm her gewesen?«
Er sieht sich im Stall um, findet eine alte rostige Hacke ohne Stiel und bricht von der Decke einen der Äste ab, der ungefähr in das Loch der Hacke passen muss. Er muss ein Messer holen, spitzt den Stiel etwas an und setzt dann die Hacke auf.
»Also gut«, sagt er bitter. »Ich muss es tun, ich kann ihn zur nächsten Stadt mitnehmen. Hier ist kein Mensch, hier ist nur der Tote. Und wenn sie nun denken, dass ich ihn umgebracht habe? Die Welt ist schlecht, wer weiß das besser als ich. Ich möchte wetten, dass sie schon mehr als einen Unschuldigen gehängt haben. Erst mal begraben, dann kann ich mich immer noch nach ihm erkundigen, und dann reden, aber mit ihm ankommen, seine Stiefel an den Füßen, sein Pferd? Sie werden sagen, dass ich ihn umgebracht habe. Die Leute glauben oft die verrücktesten Dinge. Logisch denken können die wenigsten. Vielleicht hat der Mann noch Freunde? Oder die Burschen, die ihn erwischt haben, die verbreiten das Gerücht …«
Ornell fasst sich unwillkürlich an den Hals und lehnt sich an die Wand des Stalles.
Natürlich, denkt er, natürlich kann man es so machen. Sie haben ihn umgebracht und sagen, dass ich es getan habe. Sie brauchen es nur irgendwo zu erzählen. Im Leben sind alle Dinge möglich, genau wie beim Kartenspiel. Dass mich dieser und jener beißen soll, ich bin doch nicht verrückt und reite mit ihm in die nächste Stadt. Gerüchte entstehen schnell, vor allen Dingen, wenn jemand nur ein Spieler ist und ohnehin auf Grund seines Berufes einen schlechten Ruf besitzt. Einem Spieler traut man auch einen Mord zu, warum nicht mir?
Tony denkt nach, seufzt dann bitter und geht nach draußen. Hinter dem Stall findet er einige Schritt entfernt lockeren Boden und macht sich an die Arbeit. Er schwitzt bald, seine Handflächen schmerzen, und der Durst meldet sich wieder.
So geht er zum Stall, nimmt den Eimer und holt sich Wasser. Dann macht er weiter und ist nach zwei Stunden mit seiner Arbeit fertig.
»Also gut«, sagt er heiser. »Begraben habe ich ihn. Ich werde mal nach den Spuren sehen. Mein Gott, in was für eine Geschichte bin ich da gestolpert?«
Im Stall sind noch einige Bretter, mit denen er die Grube notdürftig ausfüllen kann.
Zaudernd sieht er sich um, blickt auf seine Füße und dann zu den Stiefeln.
»Ich kann doch nicht in Socken auf einem Pferd reiten«, sagt er bitter. »Himmel, ich komme mir ziemlich trostlos vor, aber was soll ich sonst tun?«
Er packt alles zusammen, nimmt dann die Decke und verwischt mit ihr alle Spuren im Haus.
Wenig später zieht er das Pferd aus dem Stall, bindet es jedoch an der Tür fest und steigt dann erst auf. Das Pferd scheut nicht, obwohl er es beinahe erwartet hat. Es ist ein bedrückendes, unheimliches Gefühl, als er die Zügel löst und noch einmal zum Haus zurückblickt.
Der scharfe Wind, der jetzt zum Mittag von Westen in das Tal weht, treibt eine Sandwolke auf ihn zu, die ihm für Augenblicke die Sicht nimmt. Darum der Sand, den er unter den Fenstern und auf den Fenstersimsen im Haus gefunden hat. Der Wind weht hier scharf, aber er ist heiß und trocken, er bringt keine Kühle mit.
Die Spuren, denkt Tony Ornell, der Wind wird die Spuren verwehen, fürchte ich. Also, sehen wir nach, wo die beiden Schurken gewesen sind. Seltsam, kein Stück Papier zu finden. Er muss doch irgendein Stück Papier besessen haben, einen Geldbeutel, aber nichts ist da. Mal sehen, wie es dort am Arroyo aussieht.
Er reitet langsam an, hat das Gewehr nun gezogen und die Hand am Abzug. So kommt er zum Arroyo, reitet auf den Spuren von drei Pferden und sieht etwas blinken, kaum dass er über den Rand des Arroyos kommt. Eine Patronenhülse liegt hier im Sand, die er aufhebt, um dann – denn hier gabelt sich die Spur – den zwei Pferdespuren zu folgen. Der eine Mann muss hier gelegen haben. Der andere hat weiter links gekauert, die Spuren beweisen es. Und die eine Patronenhülse auch. Dieser Mann, der nichts als seine Spuren und die Patronenhülse hinterlassen hat, hat schräg von der Seite geschossen. Sie haben ihn beide umgebracht, denn beide Schüsse sind tödlich gewesen.
»Und er?«, fragt sich Ornell bedrückt. »Woher ist er gekommen? Ich weiß nicht, an wen erinnert mich der Mann nur? Er erinnert mich an jemanden, aber ich komme nicht drauf. Sehen wir mal nach, woher er gekommen ist.«