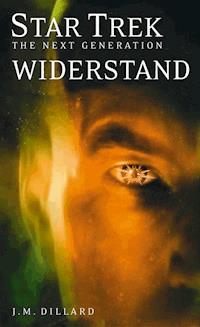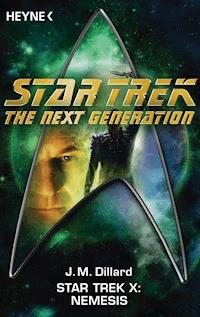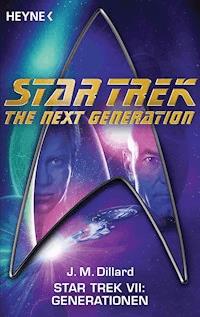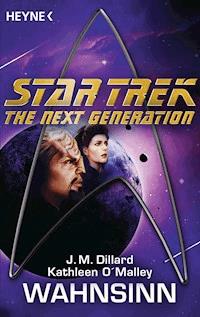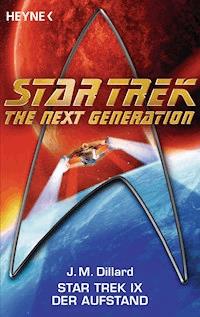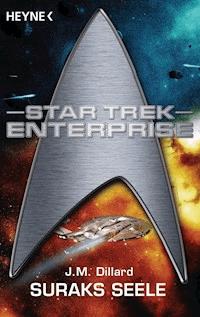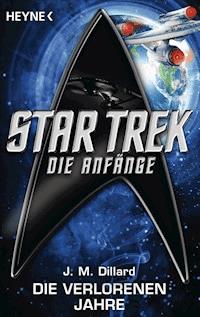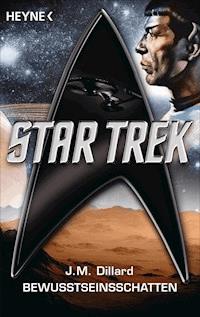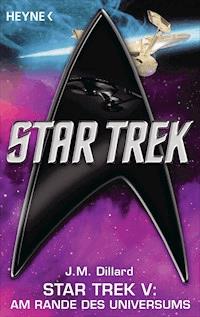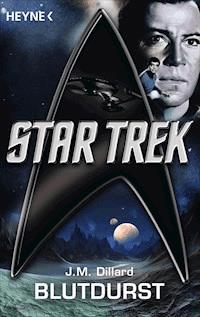
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kann Kirk die Verschwörung aufdecken?
Der Planet Tanis ist in den Sternkarten als unbewohnte Welt verzeichnet. Doch in einem unterirdischen Laboratorium werden geheime Forschungen von Wissenschaftlern der Sternenflotte durchgeführt. Als die Enterprise einen Notruf von Tanis erhält, kommt jede Hilfe zu spät: Zwei der drei Wissenschaftler sind tot, der Mikrobiologe Dr. Adams ist von einer lebensbedrohlichen Infektion gezeichnet. Auch wenn das Sternenflotten-Kommando jede Beteiligung leugnet - Captain Kirk und seine Offiziere sind sich sicher: Auf Tanis wurden verbotene biologische Waffen entwickelt. Das für militärische Zwecke gezüchtete Virus ist außer Kontrolle und bedroht nun auch die Enterprise-Crew. Kirk will, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen sind. Ist er einer Verschwörung in den höchsten Kreisen auf der Spur?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Der Planet Tanis ist in den Sternkarten als unbewohnte Welt verzeichnet. Doch in einem unterirdischen Laboratorium werden geheime Forschungen von Starfleet-Wissenschaftlern durchgeführt. Als die Enterprise auf einen Notruf hin Tanis erreicht, kommt jede Hilfe zu spät: Zwei der drei Wissenschaftler sind tot; der Mikrobiologe Dr. Adams ist von einer lebensbedrohlichen Infektion gezeichnet und dem Wahnsinn nahe.
Auch wenn Starfleet Command jede Beteiligung leugnet – Captain Kirk und seine Offiziere sind sich bald sicher: Auf Tanis wurden verbotene biologische Waffen entwickelt. Das für militärische Zwecke gezüchtete Virus ist jedoch außer Kontrolle geraten. Und nun bedroht dieses Virus auch die Enterprise-Crew.
J. M. DILLARD
BLUTDURST
Star Trek™
Classic
Prolog
Yoshi erwachte und wusste, dass er irgendwann im Schlaf entschieden hatte, Leben auszulöschen.
Er hob die Lider, sah den flackernden gelben Schein einer halb heruntergebrannten Kerze in der Sturmlaterne. Sekunden der Verwirrung folgten, und er befürchtete, im falschen Jahrhundert zu sein. Dann erinnerte er sich: Dies war Laras Unterkunft. Dumpfer Schmerz prickelte im Unterkiefer. Er saß, und die eine Seite des Gesichts ruhte auf dem harten Rollschreibtisch.
Er hatte es nicht fertiggebracht, sich auf ihrem Bett auszustrecken.
Yoshis Zunge schien aus trockener Wolle zu bestehen. Sie klebte am Gaumen, und er zuckte zusammen, als er sie davon löste. Kleine Hautfetzen blieben haften.
Der Schmerz stimulierte Zorn. Einige Traumbilder verharrten in ihm, und mit ihnen Bitterkeit: Ärger darüber, dass Reiko ihn verlassen hatte, dass sie gerade jetzt nicht bei ihm war, obwohl er sie dringend brauchte. Allein zu sterben – konnte einem etwas Schrecklicheres zustoßen? Yoshi wünschte sich Reikos Präsenz so sehr, dass er sie vor sich sah, hier in Laras Quartier: Sie lachte; Augen und Haar glänzten im Kerzenschein. Ihre Augen … So klar wie bernsteinfarbenes Glas. Und sie verbargen nichts, gewährten Einblick in den innersten Kern ihres Selbst. Er verglich sie mit dem warmen, kristallklaren Wasser von HoVanKai, damals, während der Flitterwochen, als er beim Schwimmen die Fische unter sich beobachtet hatte. Reikos Augen zeigten ihm ebenfalls alles. Freude an jedem Tag, wenn sie ihn begrüßte, Kummer und Verzweiflung nach dem Tod der kleinen Tochter. Yoshi ertrug sein eigenes Leid, aber nicht das Elend in Reikos Augen. Doch selbst damals hatte sie den Eindruck erweckt, ihn noch zu lieben.
Das Phantombild lachte nicht mehr. Eine andere Erinnerung gewann Konturen in Yoshi, und sie war noch schmerzhafter für ihn als der Gedanke an den Tod des Kindes. Reiko blickte ihn aus jenen wundervollen Augen an, und er sah nur … Kühle in ihnen, eine Leere, die ihn bestürzte. Warum?, dachte er. Bist du enttäuscht von mir? Was habe ich getan oder unterlassen?
Nichts, flüsterte die Gestalt, und die hinreißenden kristallenen Augen erzeugten eine so intensive Kälte, dass Yoshi der Atem stockte. Er begriff sofort: Es gab jemand anders. Dich trifft keine Schuld.
Auf diese Weise erfolgten alle Schicksalsschläge in seinem Leben. Nie lud er Schuld auf sich, doch das Unglück verfolgte ihn ständig. Er war ein vorbildlicher Sohn gewesen, ein guter Schüler und Student, ein Mustergatte. Er hatte sich immer bemüht, allen in ihn gesetzten Erwartungen zu genügen und niemandem ein Leid zuzufügen. Doch der Kummer begleitete ihn auf Schritt und Tritt. Zuerst der Tod seiner Mutter, dann der Verlust von Reiko. Und jetzt zwangen ihn die Umstände, zu töten und zu sterben, ohne dass er irgendeine Art von Verantwortung trug.
Yoshis Finger schlossen sich so fest um das Skalpell, dass die Knöchel unter der Haut weiß hervortraten. Er merkte kaum, dass er es noch immer in der Hand hielt, während der ganzen langen Nacht in der Hand gehalten hatte. In ihm brodelte das Verlangen nach Rache, für seine Mutter, für sich selbst. Nun, was ihn betraf, durfte er sich vermutlich keine Vergeltung erhoffen. Für die Mutter … Ja, vielleicht, wenn er still starb. Um ihretwillen zog er diese Möglichkeit in Erwägung.
In seinem Büro stand ein Holobild der Eltern, vor langer Zeit aufgenommen, als die Mutter noch lebte. Der sehnsüchtige Wunsch, es noch einmal zu betrachten, gewann ein solches Ausmaß, dass er dadurch körperlichen Schmerz empfand. Doch er musste unerfüllt bleiben. Yoshi beschwor mit geschlossenen Augen das Bild aus dem Gedächtnis. Vater erschien zuerst: stolz, dunkle Haut, damals noch dichtes schwarzes Haar. Neben ihm seine japanische Frau. Sie zart und schlank, er untersetzt und stämmig – ein auffallender Kontrast. Yoshis Vater veränderte sich nach dem Tod seiner Lebensgefährtin, wurde grüblerisch und verdrießlich. Dadurch fühlte sich der Sohn ständig an das Fehlen der Mutter erinnert. Sein Vater verzieh sich selbst und Yoshi nicht, dass sie noch lebten.
Er berührte das aufgeschlagene Buch, in dem er gelesen hatte. Lara sammelte Antiquitäten, darunter auch Bücher aus Papier. Dutzende davon standen in ihren Regalen. Am vergangenen Abend hatte Yoshi eins ausgewählt, weil ihm der Titel bekannt vorkam, aber die Lektüre zog unangenehme Konsequenzen nach sich, belastete ihn mit Albträumen. Er senkte nun den Kopf und las zwei Sätze:
Ich befand mich tatsächlich in den Karpaten. Jetzt blieb mir nichts anderes übrig, als geduldig zu sein und auf den nächsten Morgen zu warten.
Yoshi schloss das Buch und schob es fort. Er hatte sich in Geduld gefasst, doch für ihn gab es keinen nächsten Morgen. Er atmete tief durch, um sich von der Benommenheit zu befreien, füllte seine Lungen mit muffiger Luft, die nur noch wenig Sauerstoff erhielt. Er hatte die Klimaanlage in Laras Quartier deaktiviert. Jeder Raum konnte isoliert werden, wenn das Sicherheitssystem vor einer bakteriologischen Verseuchung warnte, aber man ging davon aus, dass die Dekontamination nur wenige Stunden in Anspruch nahm. Nicht lange genug, um eine Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und frischer Luft erforderlich zu machen.
Niemand war auf die Katastrophe vorbereitet gewesen. Yoshi schloss die Augen und sah das Unmögliche: Zusammen mit Lara stand er in der Stasiskammer, vor der geschlossenen Leichenkapsel – und entsetzt beobachtete er, wie sich der Deckel langsam hob. Jemand drückte ihn von innen her auf …
Er stöhnte leise. Denk nicht daran.
Yoshi schluckte, verdrängte die Furcht und lenkte sich ab, indem er seinem knurrenden Magen lauschte. Der Hunger war eigentlich nicht so schlimm; nach den ersten beiden Tagen reduziert er sich auf ein mahlendes Pochen hinter der Stirn. Der Durst hingegen wurde allmählich unerträglich.
Er brachte es schneller hinter sich, wenn er das Zimmer verließ. Die Frage des Überlebens stellte sich gar nicht mehr. Es ging jetzt nur noch darum, wie er starb.
Yoshi stand zu schnell auf und musste sich am Schreibtisch festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Auswirkungen des Wassermangels auf sein Bewusstsein hielt er für besonders schlimm: Dadurch lief er Gefahr, den eigenen Gedanken zum Opfer zu fallen, anstatt sie zu kontrollieren. Mit klarem Verstand wäre es ihm nicht so schwergefallen, dem Tod entgegenzutreten und zu töten.
Behutsam stieß er sich vom Schreibtisch ab und wankte durchs Halbdunkel. Die Lampen funktionierten schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Blind und voller Furcht hatte er sich durch die Finsternis getastet, bis er Laterne, Kerze und Feuerzeug fand – weitere Antiquitäten. Jetzt hielt er die Laterne in der einen und das Skalpell in der anderen Hand, taumelte an langen Regalen mit staubigen Büchern vorbei, passierte die Vitrine mit den alten medizinischen Instrumenten und erreichte schließlich die dicke Stahltür, die ihn von der Außenwelt trennte.
Einige Minuten lang sah Yoshi auf das Schott. Kleine Schweißtropfen berührten seine rissigen Lippen, und er leckte sie gierig ab, während er daran dachte, was ihn draußen erwartete: ein Mord, gefolgt vom eigenen Tod.
Ein Kloß entstand in seinem Hals, und die Nackenmuskeln spannten sich. Nein, er durfte jetzt nicht den Mut verlieren. Er musste auch weiterhin entschlossen bleiben. Es war schlimmer, langsam zu verdursten oder nichts gegen das Unheil zu unternehmen. Das Töten gewann die Bedeutung eines Gnadenakts. Yoshi lehnte sich erschöpft ans kühle Metall und betätigte eine Taste. Das Siegel gab mit einem leisen Zischen nach, und die Tür öffnete sich.
Die Korridore trugen ein Gewand aus Dunkelheit. Der Mann hob die Laterne, wagte sich vorsichtig über die Schwelle. Das Kerzenlicht flackerte, entlockte der Schwärze vage Umrisse. Das Herz pochte Yoshi bis zum Hals empor, als er einen Fuß vor den anderen setzte und zur Krankenstation wanderte. Dort spürte er eine nahe Präsenz und zögerte, bevor er sich durch die offene Tür beugte, das Skalpell wie einen Dolch in der Hand.
»Lara?« Nur ein leises Flüstern, doch in der Stille klang es wie ein lauter Ruf.
Im Licht der Laterne sah Yoshi direkt in die Pupillen des Todes: in die trüben Augen seiner Mutter, die tot auf dem Boden des Shuttles lag, in Reikos Augen, die von Verrat kündeten. In die weit aufgerissenen, blicklosen Augen einer Frau namens Lara Krowozadni.
Die scharfe Klinge des Skalpells blitzte, als Yoshi damit zustieß.
Kapitel 1
Leonard McCoy verabscheute moderne Technik und war davon überzeugt, dass sie ihn eines Tages umbringen würde. Als ihn der Transporterstrahl fast einen Kilometer unter der Oberfläche des Planeten rematerialisieren ließ, in völliger Dunkelheit, erstarrte er und glaubte seine Befürchtungen auf schreckliche Weise bestätigt.
»Allmächtiger Gott!« McCoy streckte den Arm aus und sah nur mattes energetisches Schimmern an den Händen. Er bewegte sie, ohne etwas anzurühren. »Sind Sie noch da, Stanger?«
»Ja, Doktor.« Der sanfte Tenor ertönte einige Meter weiter rechts. »Keine Sorge, das haben wir gleich …« Einen Sekundenbruchteil später schnitt ein Lichtstrahl durch die Finsternis, und dahinter bemerkte McCoy das braune Gesicht des Sicherheitswächters. Stanger trug ebenfalls einen Individualschild.
Leonard tastete nach seinem Kommunikator und klappte ihn verärgert auf. »McCoy an Enterprise.« Er musste lauter sprechen, um sicher zu sein, dass man ihn verstand. Das Kraftfeld dämpfte die Stimme, verlieh ihr einen nasalen Klang. »Zum Teufel auch, Jim, wie sollen wir hier unten im Dunkeln zurechtkommen?«
Eine kurze Pause schloss sich an, und der Arzt stellte sich vor, wie es in Kirks Mundwinkeln zuckte. Doch die Stimme des Captains brachte nur neutralen Ernst zum Ausdruck. »Soll das heißen, niemand von euch hat daran gedacht, eine Lampe mitzunehmen?«
»Ich habe eine dabei, Sir«, antwortete Stanger etwas zu eifrig, fand McCoy. Er runzelte die Stirn, bevor er erneut in den Kommunikator sprach.
»Darum geht's gar nicht, Jim. Ich wollte nur darauf hinweisen …«
»Ich weiß«, sagte Kirk. Diesmal offenbarte sich das Lächeln auch in der Stimme. »Und ich nehme deine Beschwerde zur Kenntnis. Beim nächsten Mal geben wir dir rechtzeitig Bescheid.«
»Danke«, brummte McCoy sarkastisch.
»Ist sonst alles in Ordnung?«
»Woher soll ich das wissen?«, entgegnete McCoy. »Wir sind gerade erst eingetroffen. Ich melde mich, wenn wir etwas entdecken.«
Stanger war bereits an die nächste Wand herangetreten und prüfte die Beleuchtungskontrollen. Dünne Falten bildeten sich in seiner Stirn. »Keine Energie. Seltsam. Die anderen Systeme scheinen zu funktionieren.«
McCoy nickte. »Wo sind wir hier eigentlich?«
Stanger drehte sich um, hielt den kleinen Scheinwerfer in Hüfthöhe. »Scheint eine Art Laboratorium zu sein …«
Der Lichtkegel glitt über Arbeitsplatten aus Onyx und komplexe Anordnungen aus Petrischalen und Phiolen alles befand sich in einem großen fünfeckigen Kristall. Am Zugang dieses Pentagons glitzerte ein Kraftfeld, vergleichbar mit den Individualschilden, die McCoy und Stanger trugen. Als sich die beiden Männer näherten, reflektierte der Kristall das Licht. »Sieht nach einem medizinischen Labor aus«, meinte der Sicherheitswächter.
»Eine ›heiße‹ Kammer«, murmelte McCoy mehr zu sich selbst.
Stanger musterte ihn verwirrt. »Eine was?«
»Die Abschirmungen deuten auf ein pathologisches Laboratorium hin. Ein isolierter Raum für die Behandlung gefährlicher Infektionskrankheiten. Erinnert mich an die Anlage in Atlanta. Sonderbar, dass es so etwas ausgerechnet hier gibt, mitten im Nichts.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!