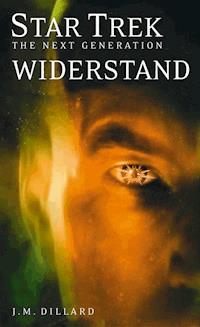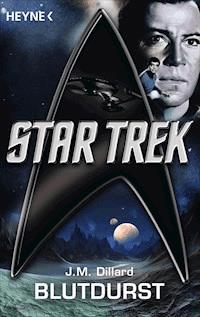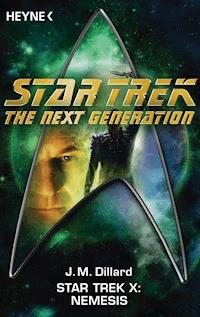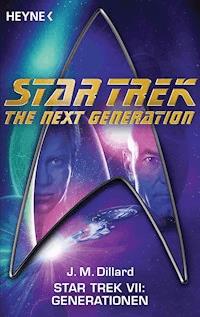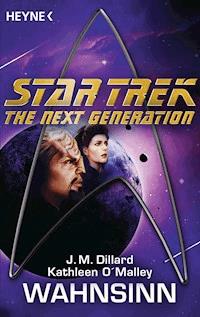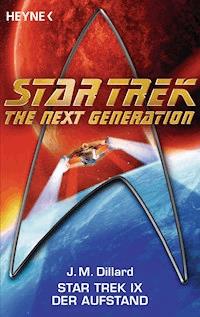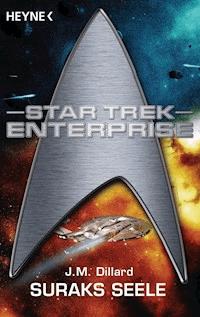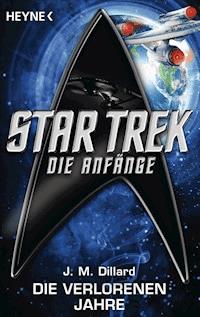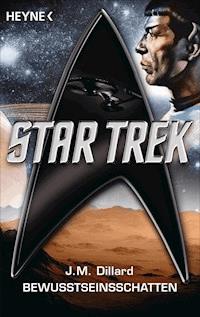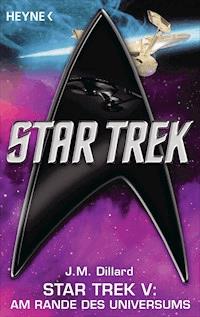
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Ein Rebell bedroht den Frieden in der Galaxis
Der Planet Nimbus III ist Schauplatz einmes einzigartigen Experiments: Die drei Mächte der Galaxis, die Klingonen, Vulkanier und Menschen, besiedeln den Planeten gemeinsam. Doch eine Klimakatastrophe droht, das friedliche Experiment zum Scheitern zu verurteilen. Der vulkanische Renegat Sybok schart eine Armee von Aufständischen um sich und nimmt drei Diplomaten als Geiseln. Captain Kirk erhält den Befehl, mit seinem neuen, noch nicht ausgereiften Raumschiff die Geiseln zu befreien. Niemand auf der
Enterprise ahnt, welche Beziehung zwischen Spock und Sybok besteht. Außerdem betrachten die Klingonen die Geiselnahme als willkommenen Anlass, endlich ihren Erzfeind zu erledigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Ähnliche
Der Planet Nimbus III ist Schauplatz eines einzigartigen Experiments: Die drei Mächte der Galaxis – die Föderation, das klingonische Imperium und das romulanische Reich – haben sich zusammengetan, um den Planeten im Interesse des galaktischen Friedens gemeinsam zu besiedeln. Doch eine Klimakatastrophe droht das Experiment zum Scheitern zu verurteilen.
Die Siedler sind verzweifelt. So fällt es dem vulkanischen Renegaten Sybok leicht, eine Armee von Aufständischen um sich zu scharen und drei Diplomaten als Geiseln zu nehmen. Der geheimnisvolle Prophet hat jedoch weit ehrgeizigere Pläne, als nur den Planeten unter seine Kontrolle zu bringen: Er folgt einer Vision, die ihn bis ins Zentrum der Galaxis führt.
Captain Kirk erhält den Befehl, mit seinem neuen, noch nicht ausgereiften Raumschiff die Geiseln zu befreien. Niemand auf der Enterprise ahnt, welch verhängnisvolle Beziehung zwischen Spock und Sybok besteht. Überdies betrachten die Klingonen die Geiselnahme als willkommenen Anlass, den Erzfeind ihres Volkes endgültig zu erledigen.
J. M. DILLARD
STAR TREK V –
AM RANDE DES UNIVERSUMS
Star Trek™
Classic
Für George, Dave Stern, Kathy
und insbesondere Irwin und Geraldine
Besonderen Dank schulde ich
Dr. Carol Williams, einer Astronomin an der
University of South Florida,
Prolog
Leise sprach der Beobachter an der Tür des steinernen Gemachs vor.
T'Rea erhob sich von ihrer Ruhestätte – nicht mehr als eine doppelte Lage handgewobenen Stoffes, den man auf dem harten Boden ausgebreitet hatte. Seit einiger Zeit hatte sie schon wach dagelegen, den Ruf erwartet. Auf dem Boden neben ihr schlief ihr junger Sohn. Als T'Rea aufstand und ihren säuberlich gefalteten Umhang von dem nahegelegenen Sims holte, regte er sich kurz, wachte jedoch nicht auf.
Durch die Öffnung, die man in den schwarzen Fels gehauen hatte, drang hell das Sternenlicht. T'Rea legte sich den Umhang über die Schultern, bewegte sich um die schattenhafte, reglose Gestalt ihres Sohnes herum und ging mit lautlosen Schritten auf die Türe zu. Diese war nur angelehnt, und T'Rea stieß sie weiter auf, bis sie sich in die höhlengleiche Vorhalle öffnete.
Der Beobachter wartete im flackernden Licht der Fackel, hager und dunkelhaarig. Neben ihm stand T'Sai, die Adeptin, jene Frau, in der T'Rea schon seit langem ihre Nachfolgerin vermutete. Die Kapuze von T'Sais Robe war hochgezogen und verhüllte ihr Gesicht, doch T'Rea erkannte ihre Körperhaltung wieder.
T'Rea wusste, was als nächstes kommen würde. Sie fühlte einen stechenden, beinahe körperlichen Schmerz über ihren Verrat, doch ihre Unterweisung als Adeptin des Kolinahr war vollkommen gewesen. Nicht einmal der Schatten eines Gefühls huschte über ihr Gesicht. Sie konnte die Worte beinahe hören, noch bevor der Beobachter sie ausgesprochen hatte; doch nun gab es nichts mehr zu tun, als ihnen zuzuhören und sie zu erdulden.
»Die Kolinahru sind zu einer Übereinstimmung gekommen«, sagte der Beobachter. Seine Augen waren matt, so kalt wie der Nachtwind in der Wüste. »Eine Entscheidung ist getroffen worden.«
Ohne mich, beendete T'Rea stumm den Satz. Die Gesichter von T'Sai und des Beobachters, Storel, sagten ihr, dass die Entscheidung nicht zu ihren Gunsten ausgefallen war. Ihres Titels und ihrer Macht hatte man sie bereits beraubt, und deshalb empfand sie Schmerz. Was ihr Herz ergriff, war jedoch die Furcht, dass man ihr das Kind wegnehmen würde. Erstaunlicherweise blieb ihr Gesichtsausdruck jedoch gelassen.
T'Sai nahm ihre Kapuze ab und enthüllte ihr bleiches, von silberschwarzem Haar eingerahmtes Gesicht. »Ich bin jetzt Hochmeisterin der Kolinahru«, verkündete T'Sai mit einer Stimme, die stark und frei war von der Schande T'Reas. »Du bist nicht länger Hochmeisterin. Aber wir werden dir folgendes zugestehen: Nach deinem Tod wird dein Geist in der großen Halle des Alten Denkens eingeschlossen werden.« Ihre Stimme senkte sich, als sie in die vertraute Form der Anrede überwechselte. »Es genügt, dass Ihr im Leben entehrt seid. Wir werden Euch nicht auch im Tode noch entehren.«
»Was noch?«, fragte T'Rea. T'Sai würde verstehen, was sie meinte. Immerhin gab es noch die Frage der Verbannung aus ihrem Zufluchtsort in den Wüstenbergen von Gol.
Die neue Hochmeisterin kehrte zu der formelleren Anrede zurück, jener, die die Kolinahru für Fremde, Außenweltler und Ketzer vorbehalten hatten. »Falls du es wünschst, darfst du in Gol bleiben. Doch du kannst nicht als eine von uns leben, du musst dich von uns fernhalten.«
»Und mein Sohn?« T'Rea kämpfte darum, die Angst in ihrer Stimme zu verbergen.
»Er darf bei dir bleiben.«
T'Rea schloss die Augen.
»Unter einer Bedingung. Der Junge ist außerordentlich begabt in den mentalen Künsten. Derart ungeschulte Macht ist … gefährlich. Er muss von den Kolinahru in der angemessenen Anwendung seiner Macht geschult werden … und in der angemessenen Philosophie Vulkans.«
Auf gewisse Art war dies ein Schlag ins Gesicht T'Reas, eine Andeutung, dass ihre Art der Ausbildung suspekt, ihre Philosophie unschicklich war. Und doch: Wäre sie in diesem Moment allein gewesen, hätte sie gelächelt. Sollten die Kolinahru doch tun, was sie für richtig hielten, um dem Jungen die ›angemessene‹ Philosophie einzuimpfen. Dazu war er schon zu sehr ihr Sohn. Er war kaum elf Jahreszeiten alt – nicht ganz fünf Jahre nach terranischer Zeitrechnung –, und doch beherrschte er bereits die grundlegenden Geistesregeln, die man normalerweise erst jenen Kindern beibrachte, die dreimal so alt waren wie er. Der Junge war ein Wunderkind, intellektuell so begabt wie sein Vater, telepathisch so geschickt wie seine Mutter, und T'Rea hatte seine Begabungen voll ausgenutzt, ihr Wissen so bereitwillig mit ihm geteilt, als handle es sich bei ihm um einen erwachsenen Eingeweihten.
Denn der Junge würde der Retter seines Volkes werden.
Er war das einzige Kind seiner Mutter – und von ihr sehr geliebt. T'Rea hatte ihn in aller Heimlichkeit geboren und die Existenz des Kindes vor seinem Vater geheim gehalten. Sie hatte den Jungen Sybok getauft, ein altertümliches Wort, das sich zwar an den Mustern männlicher Vornamen orientierte, aber nurmehr selten gebraucht wurde. Es bedeutete ›Seher‹, ›Prophet‹. Privat nannte sie in oft shiav, ein Begriff aus einer längst vergessenen Religion, der keine Entsprechung im modernen Vulkanisch hatte: ›Messias‹.
Er war gerade drei Jahreszeiten alt, als T'Rea, die Hochmeisterin und Adeptin des höchsten Grades, die Erleuchtung überkam und sie sich gegen das Ungleichgewicht in Suraks Lehre der Nichtbewegung zu wenden begann. In ihrer Aufgabe als Hochmeisterin hatte T'Rea des Öfteren die Hallen des Alten Denkens betreten und sich mit den katras, den Geistern der bewahrten Meister beraten. So war die Erleuchtung über sie gekommen, und mit ihr die Erkenntnis, dass man zum Erreichen spirituellen Wissens die Logik hinter sich lassen musste. Um wirklich frei zu sein, musste der Adept ein Gleichgewicht zwischen Vernunft und Gefühl finden.
Von den ältesten der Meister hatte sie zudem von der Existenz Sha Ka Rees erfahren.
Die Gelehrten hatten sie in Geschichte unterwiesen, insbesondere der Vorgeschichte mit besonderem Augenmerk auf die frühesten vulkanischen Religionen. Der Junge war brillant, und sie teilte soviel ihres Wissen mit ihm wie nur irgend möglich. Sie erzählte ihm vom alten Glauben, von den vulkanischen Kriegsgöttern, die, ganz ihren Launen gehorchend, grimmig oder liebevoll sein konnten, und mit nichts geringerem als einem Blutopfer zu besänftigen waren. Sie erzählte ihm von der alten Legende des Sha Ka Ree, dem Ursprung allen Seins, dem Paradies, wo alle Götter und Göttinnen des vulkanischen und nichtvulkanischen Pantheons zu dem Einen verschmolzen.
Und sie erzählte ihm vom shiav, der kommen, alle Religionen und Rassen vereinen und sie zum Ursprung, zu Sha Ka Ree führen würde.
Sha Ka Ree ist keine Legende, hatte T'Rea ihm gesagt. Sie hatte einen akademischen Text zum Thema verfasst und ihn aufgehoben, damit Sybok ihn lesen konnte, wenn er etwas älter war. Der Artikel hatte sie zur Zielscheibe zahlreicher Spötter gemacht; auch war er einer der Hauptgründe für ihren Niedergang als Hochmeisterin. Ich sage dir, Kind, dass es ihn gibt, hatte sie gesagt. Und du bist der shiav, der Erwählte. Eines Tages wirst du andere zu Sha Ka Ree führen, doch jetzt ist es noch zu früh, um diese Gedanken mit anderen zu teilen.
Wo ist er?, hatte das Kind geweint, völlig verzaubert. Sag es mir, und ich werde dich mit mir nehmen.
T'Rea hatte nur geheimnisvoll gelächelt. Wenn die Zeit gekommen ist, mein shiav. Wenn die Zeit gekommen ist.
Nach ihrer Erleuchtung hatte sich T'Rea bei ihren Beratungen auf jene Meister beschränkt, die gelebt hatten, bevor der Pazifismus Suraks den Planeten Vulkan ergriffen und verwandelt hatte. Kurz nach der Veröffentlichung ihres Artikels über Sha Ka Ree war unter den Adepten das Gerücht umgegangen, dass T'Rea alle Ethik vergessen hätte und nun aktiv dem Studium der Gedankenkontrolle nachhinge – nicht der eigenen Gedanken, sondern der der anderen.
Sie glaubte, sie sei vorsichtig gewesen. Weder sie noch der Junge hatten in der Öffentlichkeit ein Gefühl zur Schau gestellt. Und doch war diese Konfrontation im Rückblick nur eine Frage der Zeit gewesen.
In der düsteren, schattendurchwirkten Vorhalle gab T'Rea T'Sai ihre Antwort.
»Ich nehme an«, sagte sie. Die neue Hochmeisterin nickte und zog sich zusammen mit dem Beobachter in die Schatten zurück.
T'Rea trat zurück in ihr Gemach und schloss leise die Tür. Sie hatte gewusst, dass es unvermeidlich war, und doch vermochte dieses Wissen ihren Schmerz nicht zu vermindern. Sie ließ es geschehen, dass er ihre Seele füllte, legte dann ihre Stirn gegen den warmen Stein der Tür und weinte stumm und bitterlich.
Als sie sich umwandte, sah sie ihren Sohn, der sich aufgerichtet hatte und sie eulengleich im Licht der Sterne anstarrte.
»Was ist los, Mutter?«
Sie seufzte. Er war zu brillant, zu mitfühlend, zu telepathisch begabt, um sich von der bloßen Behauptung, dass nichts geschehen sei, irreführen zu lassen. Besser war es wohl, jetzt die Wahrheit zu sagen.
»Man hat mich für meine Ketzerei zum Schweigen gebracht, shiav. Ich bin nicht länger Hochmeisterin.«
»Das können sie nicht machen!«, rief der Junge.
»Sie haben es bereits getan.« T'Rea ging zu ihm hinüber und setzte sich. »Shiav, sie wollen dich zu einem Kolinahru ausbilden.«
»Ich werde mich weigern!« Die Augen des Jungen schienen vor Hass zu glitzern.
»Nein, das wirst du nicht. Aber du wirst ihnen nicht erlauben, das zu verändern, was tief in deiner Seele verborgen ist. Und du darfst niemals deine Bestimmung vergessen.«
»Niemals!«, schwor das Kind leidenschaftlich … und dann fing seine Stimme an zu zittern – auf eine Art, die ihr Herz zerriss. »Werden sie dich zum Gehen zwingen, Mutter?«
»Nein.« Der Gedanke brachte T'Rea eine finstere, wenn auch nicht lange währende Befriedigung. Sie hatte die Kolinahru in Verlegenheit gebracht. Anstatt sie in die Welt hinaus zu schicken, wo sie nur ihre Ketzerei predigen würde, hatten sie es vorgezogen, zu schweigen und sie unter sich zu lassen. »Ich bleibe hier bei dir.«
Im Licht der Sterne sah sie den Umriss von Syboks schmalen Schultern vor der dunklen Wand, wie sie sich in einem Seufzer der Erleichterung hoben und wieder herabsanken.
T'Rea zögerte, bedrückt vom Gewicht dessen, was sie nun zu sagen hatte. »Kind, es gibt etwas, das ich mit dir teilen muss. Ich hatte eine Vision der Meister. Es ist der einzige Weg, dein Herz zu gewinnen, sicherzugehen, dass die Kolinahru dich niemals verderben können.«
Mit der Verzweiflung des Kindes griff er nach ihr und bekam den enggewebten weißen Stoff ihrer Robe zu fassen. »Teile die Vision … aber verlass mich nicht. Ich schwöre dir, Mutter …« Seine Kinderstimme hob sich. »Ich schwöre dir bei den Meistern, dass ich dich mit mir nehmen werde, zu Sha Ka Ree, wo wir beide glücklich sein können.«
Sie strich ihm übers Haar und lachte sanft; ihr Herz war nicht in ihrem Lachen, doch sie wollte das Kind beruhigen. Dann nahm sie seine Hand die ihre. »Ich werde nicht gehen, Sybok. Ich werde niemals gehen. Und ich bete, dass wir eines Tages Sha Ka Ree begegnen werden, nicht in einer Vision, sondern wie er wirklich existiert.«
»Ich werde dich dorthin führen, das schwöre ich auf mein Leben!«, rief das Kind.
Diesmal lächelte T'Rea ein ehrliches Lächeln, berührt von seiner Treue. »Lieber shiav, das ist ein Versprechen, von dem ich nur hoffen kann, dass du es einlöst. Und nun muss ich etwas tun, das mir sehr schwerfällt, etwas, das ich von den alten Meistern gelernt habe. Es wird mich auf ewig deiner Treue versichern. Erst dann kann ich meine Vision mit dir teilen.«
»Ich bin bereit«, sagte der Junge.
Sie ließ seine Hände los und legte ihre Finger an das warme Fleisch seiner Schläfen. »Teile deinen Schmerz, Sybok …«
Kapitel 1
Am Wüstenhorizont braute sich ein Sturm zusammen.
J'Onn hielt kurz in seiner Arbeit inne und starrte über das schwarze Hitzeflimmern hinweg auf die anwachsende Staubwolke. Normalerweise hätte er sich in einem solchen Moment auf den Rückweg zu dem baufälligen Unterschlupf gemacht, der ihm als Heim diente, und den Sturm dort abgewartet. Heute war es ihm egal, ob ihn der Sturm mit Haut und Haar verschlang.
Er sah hinab auf seine Arbeit, auf den kleinen Bohrer, der im ausgedörrten Boden steckte; ein kläglicher Versuch, Wasser aufzuspüren. Wie alle anderen Löcher zuvor, war auch dieses Loch trocken; der Erde mangelte es entschieden an Feuchtigkeit. Ohnehin dachte J'Onn schon längst nicht mehr in diesen Begriffen. Erde, so jedenfalls war seine Ansicht, half dem Leben. Dieser trostlose, versengte Sand dagegen half niemandem, weder ihm noch Zaara.
Nach Zaaras Tod in der vergangenen Nacht war er auf das Feld gewandert – einst so fruchtbar, nun nicht mehr als eine Verlängerung der Wüste – und hatte zu graben angefangen. Inzwischen stand die Sonne im Zenit, und das Feld um ihn herum war übersät mit Hunderten von Löchern, manche davon schon einige Jahre alt, gegraben in glücklicheren Zeiten, als das Wasser noch nicht eine derart kostbare Seltenheit war. Die meisten waren jedoch während des sanften Wahnsinns entstanden, der J'Onn die ganze Nacht und einen Teil des Tages über aufrechterhalten hatte.
Nun war es Nachmittag, und die Sonne brannte mit unversöhnlicher Wildheit. Der Boden war heiß genug, um die Haut unter J'Onns zerlumpten Kleidern in Blasen aufbrechen zu lassen, während er sich neben dem Bohrer niederkniete, und doch fühlte er keinen Schmerz. Es war Wahnsinn, in der schlimmsten Hitze zu arbeiten, Wahnsinn, keine Zuflucht vor dem aufkommenden Staubsturm zu suchen … und er war wahnsinnig, wahnsinnig vor Trauer und Wut.
Schon vor Zaaras Tod hatte ihn die Enttäuschung halb wahnsinnig gemacht. Vor der großen Dürre war das Land … nein, nicht freigiebig, um ehrlich zu sein, aber doch ein Ort karger Schönheit gewesen. Er und Zaara hatten sich ihr Leben aufgebaut – ein beschwerliches zwar, ohne den geringsten Komfort, aber immerhin ein Leben. Für sie hatte es keine Alternative gegeben. Auf ihrem Heimatplaneten Regulus, im Romulanischen Imperium, hatte J'Onn die Gelder seines Vorgesetzten unterschlagen und war dabei ertappt worden. Seine Wahl war einfach: Hinrichtung oder ein Exil auf Nimbus III.
Wie tausend andere Kleinverbrecher wurde J'Onn ein Farmer. Nimbus III, ein einstmals fruchtbarer Planet nahe der Neutralen Zone, hatte den zweifelhaften Ruf errungen, gleichzeitig von drei einander feindlich gesinnten Regierungen in Anspruch genommen zu werden: von dem Romulanischen und Klingonischen Imperium und von der Vereinten Föderation der Planeten.
Damals hatte Nimbus noch genügend Rohstoffe besessen, dass sich ein solcher Streit lohnte: Bauholz, einige fossile Brennstoffe und eine Reihe nützlicher Mineralien, darunter Dilithium, welches in aller Windeseile abgebaut worden war. Ein Föderationsdiplomat von Altair regelte den Disput schließlich: Warum nicht allen drei Regierungen erlauben, den Planeten zu erschließen? Das erforderte natürlich eine Rechtsprechung, die – zumindest theoretisch – den Frieden zwischen den Siedlern aufrechterhielt: Wie auch immer geartete Waffen waren auf dem Planeten verboten. Folgerichtig erhielt Nimbus bald den etwas großspurigen Beinamen ›Planet des Galaktischen Friedens‹.
Einige Jahre lang funktionierte das Konzept beinahe. Und dann, während die drei Regierungen noch über die Details stritten, hatten die Siedler – ›Freiwillige‹ wie J'Onn, die der Hinrichtung oder dem Gefängnis zu entkommen suchten – die Wälder dezimiert, die Minen erschöpft und das Ökosystem mit Hilfe chemischer Toxine, die überall sonst in der Galaxis längst verboten waren, völlig zerstört. Weniger als zwanzig Jahre nach Unterzeichnung des Vertrags war Nimbus III eine Wüste. Die hungernden Farmer bauten eigene Waffen und fingen damit an, sich gegenseitig zu bekämpfen.
In erstaunlich kurzer Zeit gab es kein Wasser mehr. Das Getreide ging ein, und mit ihm schien auch Zaara zu verdorren. Für eine medizinische Behandlung fehlte das Geld. Und wegen J'Onns Verbrechen konnte sie nicht zu ihrer Familie heimkehren, solange sie sich nicht scheiden ließ und ihm völlig abschwor. Dazu war sie nicht bereit, obwohl sie J'Onn mit Tränen in den Augen darum bat.
In der Nacht zuvor war sie gestorben, wenige Stunden vor der Dämmerung. J'Onn war nach draußen getaumelt, benommen vor Trauer, weder sich selbst noch seiner Umgebung gewahr, allein seinen Verlust empfindend. Es war später Vormittag, als er wieder zu sich kam und die Dutzende von frischen Löchern bemerkte, die er auf seiner fieberhaften Suche nach Wasser in der Nacht zuvor gegraben hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihn die Besessenheit gepackt, und er konnte nicht mehr aufhören. Er hatte Zaara und das Land verloren, nichts war mehr geblieben. Verschwommen merkte er, dass er solange weitergraben würde, bis er entweder auf Wasser gestoßen war oder an einem Hitzschlag starb. In Anbetracht der grellen Nachmittagssonne, überlegte er, standen die Chancen, dass ihm zumindest letzteres gelingen würde, gar nicht schlecht. Er hatte bereits aufgehört zu schwitzen. J'Onn wischte mit der Hand über die Stirn; sie fühlte sich kühl und trocken an. Seine Gedanken fingen an zu treiben. Bald würden Schwindel und Krämpfe folgen, dann der Tod.
J'Onn ließ den Bohrer aus den Händen gleiten und schloss die Augen. Die Wahnvorstellungen hatten bereits angefangen, er bildete sich ein, in weiter Ferne ein Geräusch zu hören. Es kam aus der Richtung des aufziehenden Sturms, ein tiefes Poltern, wie Donner vor dem Regen.
Donner hatte er schon sehr lange nicht mehr gehört.
Seltsamerweise weigerte sich der Donner jedoch, ein Crescendo zu erreichen und langsam wieder abzuklingen. Statt dessen wurde das Poltern immer lauter, unüberhörbar lauter, als ob es näher käme. Mit gelinder Neugier öffnete J'Onn die Augen.
Ein Reiter tauchte aus dem Sturm auf.
Er ritt auf einem Geschöpf, das die Siedler aus der Föderation scherzhaft als ›Pferd‹ bezeichnet hatten. Aus irgendeinem Grund hat sich der Begriff durchgesetzt, obwohl J'Onn bislang kein irdisches Tier gesehen hatte, das diesem Wesen auch nur annähernd glich. Zugegeben, es war ein Vierbeiner. Andererseits war es größer und zottiger als ein Pferd, mit einem gewundenen Horn auf seiner Schnauze.
J'Onn hatte keine Angst vor diesen Pferden. So hässlich die Geschöpfe aussahen, wusste er doch, dass sie recht zahm waren. Erst der Anblick des Reiters trieb ihn wieder auf die Beine. Er schnappte nach Luft.
Der Fremde ritt wie ein Besessener. Er trieb sein Ross mit den Sporen voran, und hatte sein Gesicht gegen den Sandsturm geschützt. Hinter ihm bauschte sich sein weißer Umhang im Wind wie die Flügel eines Engels.
Oder eines Dämons.
Der Reiter donnerte näher. Offensichtlich bestand sein Ziel in genau jenem Flecken Erde, auf dem J'Onn sich gerade aufhielt.
Eine Spur Ehrfurcht und Scheu drang durch J'Onns Trauer. Aus diesem Grunde – oder vielleicht auch wegen seiner Erfahrung, die ihn lange zuvor gelehrt hatte, von Fremden nichts als Böses zu erwarten – stürzte er sich auf die Waffe neben sich, eine selbstgefertigte, Steine verschießende Rohrpistole. Auf ihre tödliche Wirkung konnte man sich nicht verlassen, und doch war sie der einzige Schutz, der ihm zur Verfügung stand.
Im selben Augenblick, als er einen Warnschuss in Richtung des Eindringlings abfeuerte, fragte sich J'Onn: Warum verteidige ich mich eigentlich? Ich will nichts weiter als den Tod.
Und doch war da die starke Macht der Gewohnheit. Schützend umklammerte J'Onn die Waffe, als der Reiter sein Tier nur wenige Fuß vor ihm mit den Zügeln zu einem abrupten Stillstand brachte. Hinter ihm näherte sich der Sturm langsam, aber unaufhaltsam.
Das Tier stampfte mit den Füßen, während sein Reiter den Gesichtsschutz abnahm und sein Atemgerät entfernte. Er und J'Onn musterten einander vorsichtig. Das Gesicht des Fremden, halb verborgen in der Kapuze seines weißen Umhangs, war unverkennbar humanoid, männlich und erwachsen. Die Augen lagen im Schatten, und doch fühlte J'Onn, dass sie außerordentlich intelligent waren, voll eines seltsamen, beunruhigenden Scharfsinns.
Ohne die Rohrpistole loszulassen, starrte J'Onn die Erscheinung vor ihm an, bis der Reiter schließlich anhob. Er sprach Standard, eine Sprache, die J'Onn vor seiner Ankunft auf Nimbus erlernt hatte.
»Ich dachte, Waffen seien auf diesem Planeten verboten«, sagte der Reiter. Es klang ungezwungen, eher humorvoll als anklagend. Dann schwang er sich aus seinem Sattel und stand direkt vor J'Onn: hochgewachsen und muskulös. J'Onn hätte ihn in diesem Moment erschießen können, doch irgend etwas hielt ihn davon ab.
Mit einem kräftigen Arm wies der Fremde auf die trostlose Umgebung. Seine Stimme wurde weich, voll des wissenden Mitgefühls. »Abgesehen davon glaube ich nicht, dass du mich wegen eines Feldes voll leerer Löcher umbringen willst.«
J'Onn starrte auf sein Land. Der Fremde hatte recht, nichts war von seiner Farm geblieben außer einem vertrockneten Feld ausgetrockneter Quellen. Und an den meisten Stellen war die Erde inzwischen sogar zu locker geworden, um als angemessene Grabstätte für Zaara dienen zu können. »Es ist alles, was ich habe«, antwortete er schwach.
Er hatte stark und trotzig klingen wollen, doch die Güte des Fremden stahl ihm die letzten Reserven seiner Stärke. J'Onn brach unter der Last seiner Trauer, seiner Erschöpfung, seiner Furcht zusammen. Verschwommen sah er, wie der Fremde auf ihn zuging und ihm die Rohrpistole aus den Händen nahm. Wie in weiter Ferne hörte er sein eigenes Schluchzen.
»Dein Schmerz reicht tief«, sagte der Fremde.
»Was weißt du schon von meinem Schmerz?«, rief J'Onn. Es war Anklage und Eingeständnis zugleich.
Der Fremde bewegte sich nicht, und doch fühlte J'Onn, wie kühle Finger über seine Wangen strichen und sich auf seinen Schläfen niederließen. »Erforschen wir ihn gemeinsam!«
Scheinbar ohne die geringste Bewegung kam der Fremde näher, bis er hoch in J'Onns Blickfeld aufragte. Das sonnenverbrannte Land mit seinen kläglichen Löchern, der ominöse Sturm am Horizont, selbst die Erinnerung an Zaaras Tod – alles wurde ausgelöscht, verschluckt von der Glut in den Augen des Fremden.
J'Onn schien hypnotisiert von diesen Augen, und doch lauerte tief in seinem Geist das Misstrauen. Seine Kultur kannte zahlreiche Legenden von Zauberern, die unaussprechliche Macht über schwächere Seelen ausüben konnten, und der Fremde vor ihm war ohne Zweifel einer dieser Zauberer.
So sehr er es versuchte, konnte er dennoch keine Furcht vor dem Fremden empfinden. Das Leuchten verbarg nichts weiter als grenzenlose Liebe und Güte.
Dann sprach der Fremde wieder; seine Stimme war zart wie eine Liebkosung. »Jeder von uns verbirgt einen geheimen Schmerz. Es gilt, ihn zu enthüllen und sich ihm zu stellen, ihn aus der Dunkelheit ans Licht zu bringen.«
»Nein!«, schrie J'Onn mit plötzlich erwachter Furcht. Während der Fremde noch sprach, überfiel ihn das Bild von Zaara mit voller Wucht. Zaara, wie sie tot auf der harten engen Pritsche lag, die ihr als Bett gedient hatte. Wieder sah er die letzten Augenblicke ihres Lebens, hörte sie nach Luft schnappen, unfähig, seinen Namen auszusprechen, die Augen voll des Elends und der Sorge um ihn. Um ihn! Sie hatte sich entschieden, ihrem Mann treu zu bleiben, und diese Entscheidung hatte sie vernichtet. J'Onn erzitterte unter der Wucht von Zaaras stummer Qual, unter der Wucht seiner eigenen Schuld.
Das Gefühl einer kühlen Berührung auf seiner Stirn.
»Teile deinen Schmerz mit mir«, sagte der Fremde mit solcher Güte, dass J'Onn zu weinen begann. »Teile deinen Schmerz und gewinne Kraft aus ihm.«
J'Onn gab jede Gegenwehr auf. Das Grauen dessen, was Zaara zugestoßen war – der Blick auf ihrem Gesicht, als sie gezwungen war, ihre Familie zu verlassen, der Ausdruck in ihren Augen, als sie starb, die Dürre, die das Land unfruchtbar gemacht hatte, die Schande seiner Verbannung von Regulus, kurz gesagt, all die Trümmer, die sein Leben ausmachten – all der Jammer brandete über ihn herein, hüllte ihn ein, tauchte ihn in Reue, bis er es nicht mehr ertragen konnte. Er schrie auf und sank im heißen Sand auf seine Knie.
Und als er bereits glaubte, er könne es nicht mehr ertragen, ließ der Schmerz nach, als ob sanfte, unsichtbare Hände ihn ergriffen und über seinen Schmerz gehoben hätten. Zwar verschwanden die Ereignisse nicht, die seinen Kummer ausgelöst hatten, doch nun sah er sie mit den Augen eines anderen, aus einem objektiven und doch mitfühlenden Blickwinkel. Mit neugewonnener Stärke konnte sich J'Onn nun all diesen Ereignissen stellen, einer Stärke, die er nicht als die seine, sondern als jene des Fremden erkannte. Selbst die Erinnerung an Zaaras Tod war nun erträglich geworden, als ob er vor zwanzig Jahren und nicht vor wenigen Stunden stattgefunden hätte. J'Onn erkannte die Rolle, die er in ihrem Unglück gespielt hatte … und wusste nun mit unerschütterlicher Sicherheit, dass es Zaaras Entscheidung gewesen war, bei ihm zu bleiben.
Ein seltsamer Friede überkam ihn, ein Friede, geboren aus der Weisheit des Fremden. Auf einmal bemerkte J'Onn, dass seine Augen noch immer fest geschlossen waren. Er öffnete sie und blickte voll Dankbarkeit und Staunen auf seinen Wohltäter. Euphorie ersetzte Schmerz.
Der Fremde hatte die ganze Zeit einige Fuß entfernt gestanden. Nun streckte er die Hand nach J'Onn aus, um diesem wieder auf die Füße zu helfen. Sein Griff verriet enorme Kraft.
»Woher hast du diese Macht?«, flüsterte J'Onn, als er endlich seine Stimme wiederfand. »Ich fühle mich wie neugeboren.«
Der Fremde löste seinen Griff um J'Onns Hand, hielt sein Gesicht aber nach wie vor im Schatten seiner Kapuze verborgen. »Die Macht war stets in dir, J'Onn.«
Der Fremde kannte seinen Namen, eine Tatsache, die J'Onn zwar beeindruckte, aber sicher kaum phantastischer war als das Wunder, das der Mann soeben vollbracht hatte. Wenn der Fremde schon kein Engel oder Gott war, so doch mindestens ein heiliger Prophet. Von Dankbarkeit überwältigt, suchte J'Onn nach den richtigen Worten. »Ich fühle mich, als ob mir eine große Last vom Herzen genommen wurde. Wie kann ich dir dieses Wunder entgelten?«
»Schließ dich meiner Suche an«, sagte der Fremde.
»Was ist es, das du suchst?«
»Wonach auch du suchst«, entgegnete der Fremde voller Ernst. Neben ihm schnaubte und stampfte das Pferd ungeduldig, und J'Onn, der so unter dem Bann des Fremden stand, dass er das Tier vollkommen vergessen hatte, zuckte zusammen. »Was wir alle seit Anbeginn der Zeit gesucht haben – den Sinn des Lebens, das höchste Wissen. Um es zu finden, benötigen wir jedoch ein Raumschiff.«
J'Onn lächelte, noch immer berauscht ob der Erleichterung seines Schmerzes. Selbst wenn der Fremde sich als rasender Mörder zu erkennen gegeben hätte, J'Onn hätte sich ihm ohne Zögern angeschlossen. So aber füllte sich sein Herz mit beinahe unerträglicher Freude über die Worte des Fremden. Endlich den Sinn seines tristen, unglücklichen Lebens zu entdecken … und dann auch noch ein Raumschiff zu finden! Es würde die Freiheit von dieser verfluchten Wüste bedeuten. Aber Nimbus war isoliert, weitab aller Handelsrouten. Und nach der großen Dürre hatten alle Exporte aufgehört; die Farmer konnten sich die teuren Importwaren nicht mehr leisten. Kein geistig gesunder Mensch kam nach Nimbus – wenigstens nicht freiwillig. Nicht einmal die Handelsfrachter legten sonderlichen Wert auf eine solche Reise, geschweige denn ein echtes Raumschiff.
»Ein Raumschiff?«, fragte J'Onn zögernd. »Es gibt keine Raumschiffe auf Nimbus III.«
Obwohl er das Gesicht des Fremden nicht sehen konnte, hatte er doch den Eindruck, als reagiere dieser mit Belustigung auf seine Frage. »Hab Vertrauen, Freund«, antwortete der Fremde. »Es gibt mehr von uns, als du ahnst.«
Der Reiter warf die Kapuze zurück. Er sah asketisch aus: hohle Wangen, unrasiert, unfrisiert, und doch lag eine gewisse Stattlichkeit in seinen wilden, ebenen Gesichtszügen. Den Schatten entronnen, verblüfften seine Augen um so mehr, voll einer stechenden Helle, die J'Onn Ehrfurcht und ein wenig Angst abnötigten.
Dann sah J'Onn die Ohren. Da Regulus von Romulanern beherrscht wurde, konnte J'Onn die feinen Unterschiede zwischen ihnen und anderen Vulkanoiden erkennen. Er schnappte nach Luft. »Du … du bist ein Vulkanier.«
Der Fremde nickte einmal, langsam und bedeutungsschwer. Dann tat er etwas, das J'Onn noch nie zuvor bei einem Vulkanier erlebt hatte.
Er lächelte, warf seinen Kopf zurück und lachte.
Kapitel 2
Kahl und abschreckend erhob sich der Monolith des El Capitan aus den Wäldern in die Wolken. Im Zeltlager nahe des Merced River, im Schatten hoher Pinien und Zedern, spähte Dr. Leonard McCoy durch ein Fernglas auf die Bergwand. Der El Capitan ragte in rechtem Winkel zum Waldboden auf, im Grunde war er nichts weiter als eine massive Felswand. Von McCoys Position wirkten seine Seiten völlig glatt, ohne den geringsten Halt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!