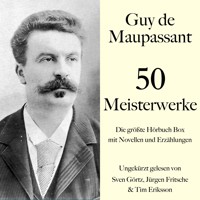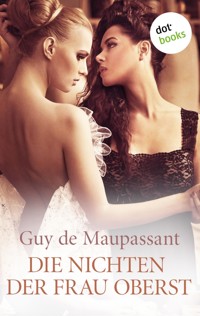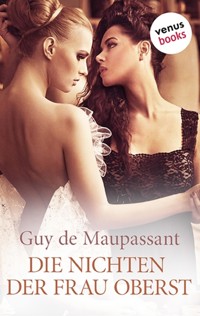Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein alternder Pariser Maler unterhält eine Liebesbeziehung zu einer verheirateten Frau. Da soll die Tochter, die genau so schön ist wie ihre Mutter, in die Gesellschaft eingeführt werden....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stark wie der Tod
Guy de Maupassant
Inhalt:
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Stark wie der Tod
Erster Teil
I
II
III
IV
Zweiter Teil
I
II
III
IV
V
VI
Stark wie der Tod, G. de Maupassant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624187
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 5. Aug. 1850 auf Schloß Miromesnil in der Normandie, gest. 7. Juli 1893 in Paris, begann seine Laufbahn als Ministerialbeamter. Für den angehenden Schriftsteller war Gustave Flaubert, ein Vetter seiner Mutter, gebornen Le Pottevin, ein treuer, unnachsichtiger Berater, der sogleich erkannte, daß in der Novellistik seine Stärke lag. Bekannt wurde M. nicht durch die Gedichte »Des Vers« (1880), sondern erst durch die 1870 in Rouen spielende musterhafte Novelle »Boule de Suif«, das Glanzstück der von Zola und seinen Schülern vereinigten »Soirées de Médan« (1880). Durch Objektivität und scharfe Hervorhebung des charakteristischen Merkmals zeichnete sich M. vor den übrigen Naturalisten, auch vor Zola selbst, aus. Seine Novellen sind im ganzen seinen Romanen überlegen, weil die hastige Produktion von 27 Bänden innerhalb 10 Jahren die planmäßige Arbeit erschwerte. Hervorragend sind immerhin die beklemmend traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1887), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die einen unheilvollen Einfluß Bourgets verratenden sentimentalen Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890). Unter den 20 Novellenbänden ragen besonders hervor: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). Die Novelle »Musotte« dramatisierte M. mit J. Normand 1891 mit großem Erfolg. Der direkt für die Bühne geschriebene Zweiakter »La Paix du Ménage« (1893) gelang weniger. M. verfiel, wie sein älterer Bruder und mehrere andre Verwandte, in Wahnsinn, machte in Cannes einen Selbstmordversuch und starb in der Privatanstalt Blanche zu Paris. Eine illustrierte Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 27 Bänden 1900–04. Von den zahlreichen Übersetzungen nennen wir die von H. v. Ompteda (»Gesammelte Werke«, Berl. 1898–1903, 20 Bde.). Ein Denkmal wurde ihm 1897 im Parc Monceaux zu Paris gesetzt.Vgl. A. Lumbroso, Souvenirs sur M., sa dernière maladie, sa mort (Par. 1905).
Stark wie der Tod
Erster Teil
I
Durch das Oberlicht an der Decke fiel der Tag in das geräumige Atelier. Es war ein großes Viereck voll strahlenden, bläulichen Lichtes, eine helle Öffnung, in die das unendliche Himmelsblau hineinschaute, durch das blitzschnell die Vögel dahinschossen.
Aber kaum war das fröhliche Himmelslicht in den hohen, ernsten, drapierten Raum gefallen, so ward es sanft, fing sich in den Stoffen und wurde von den Vorhängen verschluckt, sodaß es kaum noch die dunklen Ecken erhellte, wo bloß die Goldrahmen wie Feuer aufleuchteten. Hier schienen Friede und Ruhe hergebannt, in die Stille des Künstlerheims, wo die Menschenseele arbeitet. Innerhalb dieser Wände, die der Gedanke bewohnt, in denen er kämpft und ringt ohne Unterlaß, erscheint alles matt und müde, sobald der Schöpfer ruht. Nach seinen gewaltigen Anstrengungen ist alles wie tot, alles schlummert, Möbel, Stoffe, die noch nicht beendigten Porträts auf der Leinewand, als ob der ganze Raum unter der Müdigkeit des Meisters gelitten, mit ihm gerungen und täglich teilgenommen hätte an diesem immer wieder sich erneuernden Schaffenskampf.
Ein unbestimmter Geruch von Malerei, Terpentin und Tabak lag über dem Raum, festgehalten von Teppichen und Möbeln. Kein andrer Laut unterbrach die tiefe Stille, als der kurze, helle Schrei der Schwalben, die über dem geöffneten Oberlicht hinschossen, und das unbestimmte Geräusch der Stadt, das kaum bis über die Dächer drang. Nichts bewegte sich, als stoßweise eine kleine, blaue Dampfwolke, die der auf dem Divan ausgestreckte Olivier Bertin langsam aus der Cigarette durch die Lippen blies.
Den Blick zum fernen Himmel gerichtet, suchte er nach einem Vorwurf für ein neues Bild. Was sollte er machen? Er wußte es noch nicht. Er war kein entschlossener, selbstsicherer Künstler, sondern ein Tastender, dessen nicht deutlich ausgesprochene Begabung zwischen allen Kunststilen umherschwankte. Er war reich, berühmt, war aller Ehren teilhaftig, geworden und wußte dennoch, nun wo sich die Sonne seines Lebens dem Untergange näherte, noch nicht bestimmt, was er künstlerisch eigentlich vertreten und erstrebt. Er hatte das Romstipendium erhalten, hatte das Althergebrachte verteidigt und wie tausend andre auch Historienbilder gemalt; dann war er moderner geworden und hatte Zeitgenossen mit dem Pinsel festgehalten, aber mit Anlehnung an klassische Vorbilder. Klug, voll Begeisterung, ein energischer Arbeiter, mit immer wechselnder Idee, in heiliger Liebe entbrannt für seine Kunst, die er aus dem Grunde verstand, hatte er dank seines seinen Verstandes sich ein außerordentliches Können erworben, dazu eine große Schmiegsamkeit des Talentes, die zum Teil grade von seinem Hin- und Herschwanken und seinen Versuchen in allen Stilarten kam. Vielleicht hatte auch der jähe Beifall, den seine eleganten, vornehmen und tadellosen Bilder in der Gesellschaft gefunden, ihn beeinflußt und daran gehindert, sich so zu entwickeln, wie er es sonst wohl gethan hätte. Seit dem ersten Erfolge lenkte ihn eigentlich fortwährend, ohne daß er es selbst wußte, der Gedanke zu gefallen, führte ihn sachte auf andere Wege und beugte seine künstlerischen Überzeugungen. Übrigens machte sich dieser Wunsch, es allen recht zu thun, bei ihm in allen möglichen Dingen breit und hatte viel zu seinem Ruhme beigetragen.
Seine guten Manieren, die ganze Art sich zu geben, sein gewählter Anzug, der frühere Ruf seiner Kraft und seiner Geschicklichkeit im Sattel und mit der Waffe, alles hatte dazu beigetragen, seine Berühmtheit zu erhöhen. Nach der Cleopatra, dem ersten Bilde, das ihm seiner Zeit einen Namen gemacht, war ganz Paris Feuer und Flamme für ihn gewesen. Man hatte ihn bewundert, gefeiert, und er war plötzlich einer jener gesellschaftlich glänzenden Künstler geworden, die man im Bois de Boulogne trifft, um die man sich in den Salons reißt und die schon in jungen Jahren zu Mitgliedern der Akademie der Künste ernannt werden. Er war unter dem Beifall der ganzen Stadt in dieselbe aufgenommen worden.
So hatte ihn das Glück hätschelnd und liebkosend bis an die Schwelle des Alters geführt.
Nun suchte er in der Stimmung, die das schöne Wetter draußen, das er gleichsam um sich fühlte, in ihm erregt, einen poetischen Vorwurf zu einem Bilde. Etwas müde geworden durch sein Frühstück und die Cigarette träumte er, den Blick in die Höhe gerichtet, indem er in der blauen Luft flüchtig ein paar Figuren skizzierte: graziöse Frauen in einer Allee des Bois oder auf dem Trottoir einer Straße, ein Liebespärchen am Flußrand, galante Bilder, in denen sich seine Phantasie gefiel. Die wechselnden Erscheinungen zeichneten sich vom Himmel ab, unbestimmt und in einander fließend, wie sie in Farben sein Auge sah, und die Schwalben, die unausgesetzt pfeilgleich durch die Luft schossen, schienen sie fortlöschen zu wollen, indem sie sie wie mit einem Federzuge durchstrichen.
Er fand nichts, alle Gestalten, die er vor seiner Phantasie sah, ähnelten irgend einem Bilde, das er schon gemacht, alle Frauen, die ihm erschienen, waren Töchter oder Schwestern derer, die seine Künstlerlaune schon einmal in die Welt gesetzt, und die noch unbestimmte Angst, die ihn seit einem Jahre quälte, er möchte sich ausgegeben, alle seine Themata erschöpft haben, die Furcht, daß seine Phantasie verdorrt, nahm bei seiner Unfähigkeit, neue Gedanken zu finden, etwas noch nicht Gemaltes zu entdecken, schärfere Gestalt an, wie an seinem geistigen Auge so vorbeiglitt, was er alles geschaffen.
Er stand langsam auf, um seine Studien durchzusehen, ob er unter den Entwürfen nicht irgend etwas fände, was ihn auf neue Ideen brächte.
Er blies den Rauch von sich und durchblätterte die Skizzen, Zeichnungen, die er in einem hohen, alten Schranke aufhob. Aber schnell ekelte ihn das vergebliche Suchen, es quälte ihn, er warf die Cigarette fort, pfiff einen Gassenhauer und holte unter einem Stuhl eine schwere Hantel hervor die dort lag.
Mit der anderen Hand hatte er einen Vorhang zur Seite geschlagen, der den Spiegel verbarg, welcher dazu diente, die Richtigkeit der Stellungen zu prüfen, die Perspektive zu korrigieren. Er stellte sich grade vor das Glas und begann Übungen zu machen, indem er sich im Spiegel beobachtete.
In den Ateliers war er berühmt wegen seiner Kraft gewesen, dann in der Gesellschaft wegen seiner Schönheit, aber jetzt lastete das nahende Alter auf ihm, machte ihn plump und schwer. Er war groß und breitschultrig, besaß einen starken Brustkasten, aber jetzt hatte er Fett angesetzt, wie ein alter Ringer, obgleich er täglich focht und beharrlich ritt. Sein Kopf hatte etwas Besonderes behalten, er war noch so schön wie früher, obgleich er sich doch auch verändert. Durch sein weißes, kurzgeschnittenes Haar glänzte sein schwarzes Auge lebhafter unter grauen Augenbrauen. Sein kräftiger Schnurrbart, der etwas Militärisches hatte war fast braun geblieben und verlieh seinem Gesicht einen seltenen Ausdruck von Energie und Stolz.
Er stand vor dem Spiegel mit geschlossenen Absätzen kerzengerade und ließ die beiden gußeisernen Kugeln am Ende seines muskulösen Armes allerlei Übungen machen, indem er wohlgefällig sich dabei betrachtete.
Aber plötzlich gewahrte er im Spiegel, in dem man das ganze Atelier übersah, wie sich ein Vorhang bewegte und ein Frauenkopf, nur der Kopf, erschien und nach ihm spähte. Hinter ihm fragte eine Stimme!
– Ist man zu Hause?
Er antwortete:
– Jawohl – und drehte sich herum. Dann warf er die Hantel auf den Teppich und sprang mit etwas gemachter Elastizität zur Thür.
Eine Dame in hellem Kleid trat ein. Sie gaben sich die Hand, und sie sagte:
– Du machst Deine Übungen?
– Ja, antwortete er, ich schlug ein Rad und Du hast mich dabei überrascht.
Sie lachte und fuhr fort:
– In der Portierloge war niemand, und da ich weiß, daß Du um diese Zeit immer allein bist, habe ich mich nicht anmelden lassen.
Er betrachtete sie:
– Donnerwetter! Bist Du schön! So chic!
– Ja, ein neues Kleid! Gefällt es Dir?
– Reizend, die Farben stimmen wundervoll zu einander, man kann wohl sagen, daß man heutzutage Verständnis dafür hat.
Er ging um sie herum, befühlte den Stoff, zupfte mit den Fingerspitzen die Falten zurecht wie einer, der sich auf die Toilette gleich einem Damenschneider versteht. Hatte er doch sein ganzes Leben hindurch sein künstlerisches Gefühl und seinen Athletenkörper benutzt, um mit der feinen Spitze seiner Pinsel die Schönheiten der wechselnden Mode und den weiblichen Liebreiz zu schildern, der sich unter schwerem Sammet, unter Seide und schneeigen Spitzen verbirgt.
Endlich sagte er:
– Das Kleid ist sehr gelungen, es steht Dir ausgezeichnet.
Sie ließ sich von ihm bewundern, erfreut, hübsch zu sein und ihm zu gefallen.
Sie war nicht mehr ganz jung, aber noch schön, nicht sehr groß, ein wenig stark, doch frisch in jenem Reiz, der den Vierzigjährigen eine gewisse köstliche Reife verleiht. So glich sie einer jener Rosen, die ohne Ende blühen, bis ihre Blätter schließlich, wenn sie zu sehr aufgeblüht, in einer einzigen Stunde abfallen.
Mit ihrem Blondhaar behielt sie den jungen, frischen Liebreiz der Pariserin, die nicht altert. Jener Pariserin, die eine erstaunliche Lebenskraft besitzt, einen unerschöpflichen Vorrat an Widerstand gegen die Zeit, die sich Jahre hindurch gleich bleibt, unzerstörbar, immer Siegerin, indem sie vor allem ihren Körper pflegt und ihre Gesundheit vorsichtig conserviert.
Sie schlug den Schleier in die Höhe und flüsterte:
– Nun, bekomme ich keinen Kuß?
– Ich habe geraucht, sagte er.
Sie meinte: – Ach was, – dann hielt sie ihm den Mund hin: – Das schadet nichts.
Und ihre Lippen begegneten einander.
Er nahm den Sonnenschirm aus ihrer Hand, zog ihr das Frühjahrsjäckchen aus mit schneller sicherer Bewegung. Man merkte, er verstand sich darauf. Als sie sich dann auf's Sofa setzte, fragte er eifrig:
– Wie geht es Deinem Mann?
– Ausgezeichnet, er muß sogar gerade jetzt in der Kammer eine Rede halten. – Ach! Worüber denn?
– Wie immer, wahrscheinlich über Zuckerrüben oder Rapsöl.
Ihr Mann, Graf von Guilleron, Abgeordneter für das Departement Eure, war Specialist für alle landwirtschaftlichen Fragen.
Aber sie hatte in einer Ecke eine Studie erblickt, die sie noch nicht kannte, ging nun quer durch das Atelier und fragte:
– Was ist denn das?
– Ein Pastell, das ich angefangen habe. Das Porträt der Prinzessin von Pontève.
– Hör mal, sagte sie ernst, Du weißt, daß wenn Du wieder anfängst, Damen zu malen, ich einfach Dein Atelier zuschließe. Ich weiß zu genau, wohin das führt.
– Oh! meinte er, ein Porträt wie Anys malt man nur einmal.
– Das hoffe ich sehr.
Sie betrachtete das begonnene Pastell als Kennerin, trat zurück, näherte sich wieder, legte die Hände als Schirm an die Augen, suchte den günstigsten Standpunkt und erklärte sich endlich befriedigt:
– Das Bild ist gut. Die Pastelle glückt Dir immer famos.
Er meinte geschmeichelt:
– Findest Du?
– Ja, es ist eine feine Kunst, dazu braucht man Vornehmheit. Für die groben Patzer paßt es nicht.
Seit zwölf Jahren bestärkte sie ihn in seiner Neigung zu vornehmer Malerei. Sie bekämpfte jede Rückkehr zur einfachen Wahrheit, und durch die Forderungen ihrer Modepuppen-Eleganz trieb sie ihn ganz sachte zu einem etwas gezierten, gemachten, süßlichen Stil.
Sie fragte:
– Wie ist denn diese Prinzessin eigentlich?
Er mußte ihr tausend Einzelheiten erzählen, alle jene winzigen Details, in denen sich eifersüchtige kleinliche Frauenneugier gefällt, und von der Toilettenfrage kam er auf die geistige Seite.
Plötzlich fragte sie:
– Ist sie kokett?
Er lachte und schwor, sie wäre es nicht. Da legte sie beide Hände dem Maler auf die Schultern, blickte ihn durchdringend an, und die Glut ihrer Frage machte die runden Pupillen zittern mitten in der blauen Iris wie zwei, undurchdringlichen Tintenklecksen ähnliche, schwarze Punkte.
Sie flüsterte wieder:
– Ist sie wirklich nicht kokett?
– Wirklich nicht.
Sie fügte hinzu:
– Übrigens bin ich ganz ruhig, denn jetzt liebst Du nur noch mich! Mit anderen ist es aus. Zu spät armer Freund!
Jener leichte Schauer überlief ihn, der das Herz eines reifen Mannes trifft, wenn man von seinem Alter spricht, und er flüsterte:
– Heute, morgen wie gestern gab es in meinem Leben und wird es geben nur dich, Any!
Da nahm sie ihn beim Arm, führte ihn zum Sofa zurück, und zog ihn an ihre Seite.
– Woran dachtest Du?
– Ich suche den Stoff für ein Bild.
– Was denn für ein Bild?
– Das weiß ich eben nicht, ich suche es ja.
– Was hast Du die Tage getrieben?
Er mußte ihr alle Besuche aufzählen, die er empfangen, Diners und Gesellschaften, die er besucht, Gespräche und Klatsch. Beide fanden sie Gefallen an all den flüchtigen intimen Dingen der Gesellschaft. Die kleinen Eifersüchteleien, die Verhältnisse, von denen man wußte oder doch ahnte, die fertigen Urteile, die tausend Mal wiederholt wurden, die man tausend Mal hörte über dieselben Menschen, dieselben Ereignisse, dieselben Ansichten zogen ihren Geist davon auf jenem, Pariser Leben genannten, wellenbewegten Fluß. Da sie beide alle Welt in den verschiedensten Kreisen kannten, er als Künstler, dem sich alle Thüren öffneten, sie als die elegante Frau eines konservativen Abgeordneten, so waren sie mit dem Sport der französischen Unterhaltung vertraut, die fein ist, banal, liebenswürdig boshaft, unnütz geistreich, im allgemeinen vornehm, und die einen besonderen viel beneideten Ruf allen verleiht, deren Sprechweise sich an diese Art lästerndes Geschwätz gewöhnt hat.
– Wann kommst Du zu Tisch? fragte sie plötzlich.
– Wann Du willst. Wann paßt es denn?
– Freitag, da kommt die Herzogin von Mortemain, dann Corbelle und Musadieu, es soll nämlich die Rückkehr meines Töchterchens gefeiert werden, die heut abend zurückkommt, aber sage es niemandem, es ist Geheimnis.
– Schön, ich komme, ich freue mich, Annchen wieder zu sehen, ich habe sie ja drei Jahre nicht gesehen.
– Ja wahrhaftig drei Jahre.
Annchen, zuerst in Paris im väterlichen Hause erzogen, war die letzte leidenschaftliche Liebe ihrer Großmutter, Frau Paradin, geworden; diese war fast erblindet und lebte das ganze Jahr hindurch auf der Besitzung ihres Schwiegersohnes, dem Schloß Roncières im Departement Eure. Allmählich hatte die alte Dame das Kind immer länger bei sich behalten, und da die Guilleroy beinahe die Hälfte ihres Lebens auf ihrem Gute zubrachten, wohin sie immer die verschiedensten Interessen riefen, sei es Landwirtschaft, seien es Wahlen, so nahm man das junge Mädchen schließlich nur noch ab und zu nach Paris mit.
Annchen zog auch das freie, ungebundne Landleben dem eingeschlossenen Dasein in der Stadt vor.
Seit drei Jahren war sie überhaupt nicht mehr nach Paris gekommen. Die Gräfin wollte Annchen ganz von der Stadt fern halten, um nicht, ehe sie offiziell in die Welt eingeführt wurde, den Geschmack daran in ihr zu erwecken. Gräfin Guilleroy hatte ihr zwei ausgezeichnete Erzieherinnen aufs Land mitgegeben, und sie selbst fuhr häufig auf Besuch zu ihrer Mutter und ihrer Tochter. Übrigens war der Aufenthalt Annchens auf dem Schlosse beinahe zur Notwendigkeit geworden, weil sich die alte Dame dort befand.
Früher brachte Olivier Bertin alljährlich sechs bis acht Wochen in Roncières zu, aber seit drei Jahren zwang ihn ein rheumatisches Leiden entfernt gelegene Bäder aufzusuchen, die seine Vorliebe für Paris in solchem Grade weckten, daß er, wenn er einmal aus dem Badeort zurückgekehrt war, die Hauptstadt nicht mehr verlassen mochte.
Eigentlich sollte das junge Mädchen erst zum Herbst wiederkommen, aber der Vater hatte plötzlich ein Heirats-Projekt für Annchen in Aussicht genommen und rief sie zurück, damit sie sofort die Bekanntschaft des Marquis Farandal machen sollte, den er ihr bestimmt. Der Plan wurde ganz geheim gehalten, und Olivier Bertin war der einzige, der darin durch die Gräfin eingeweiht worden war.
So fragte er denn:
– Die Absicht Deines Mannes steht also fest?
– Ja, ich glaube sogar, es ist eine sehr gute Idee.
Dann sprachen sie von anderen Dingen.
Sie kam auf die Kunst zurück und wollte ihn bereden, ein Christusbild zu malen. Er widerstrebte, denn er fand, es gäbe deren schon genug, aber sie blieb beharrlich dabei und ward ungeduldig:
– Ach! Wenn ich zeichnen könnte, würde ich Dir zeigen, was ich will. Etwas ganz Neues, sehr gewagt: man nimmt Christus vom Kreuze ab, und dem Manne, der die Hände losgemacht hat, entgleitet der Körper. Er fällt und sinkt auf die Menge herab, welche die Arme hebt, ihn aufzufangen. Verstehst Du, was ich meine?
Ja, er verstand es, er fand sogar die Erfindung ganz eigenartig, aber er war gerade in ganz modernem Fahrwasser, und wie seine Freundin so auf dem Divan lag, den einen Fuß herabhängend in zierlichen kleinen Schuhen, daß man meinte durch den dünnen fast durchsichtigen Strumpf das Fleisch zu sehen, rief er:
– Da, da, das müßte man malen, das heißt Leben, ein Frauenfüßchen, das aus einem Kleide lugt. Da hinein läßt sich alles legen, Wirklichkeit, Begierde und Poesie, es giebt nichts Reizenderes, Hübscheres als einen Frauenfuß und dann welch' feiner Reiz: das Bein, das unter dem Stoff verborgen ist und das man nur ahnt und errät.
Er hatte sich mit gekreuzten Beinen auf den Fußboden gesetzt, nahm ihren einen Schuh, zog ihn aus, und der seiner Lederumhüllung entschlüpfte Fuß bewegte sich wie ein kleines zappelndes Tier, das höchlichst überrascht ist, freigelassen zu sein.
Bertin sagte:
– Nichts ist doch so zierlich und vornehm und dabei voll, voller als die Hand; zeige mal Deine Hand her, Any.
Sie trug lange Handschuhe, die bis zum Ellenbogen gingen. Sie zog den einen aus, faßte ihn dazu oben am Rand an und streifte ihn schnell ab, indem sie ihn umkrempelte, wie eine Schlangenhaut, die man abzieht. Der Arm ward sichtbar, weiß, dick und rund, so schnell entblößt, daß er den Gedanken erweckte, als sei sie vollständig nackt.
Da streckte sie ihm die Hand entgegen, und er nahm sie am Gelenk; auf ihren weißen Fingern blitzten die Ringe, und die rosigen scharfen Nägel machten den Eindruck verliebter Krallen, an der Spitze dieses niedlichen Frauenpfötchens gewachsen.
Olivier Bertin betrachtete ihre Hand, er bewegte die Finger hin und her, wie ein Spielzeug aus Fleisch, und sagte dabei:
– Was für ein eigentümliches Ding das doch ist, ein reizendes kleines Glied, klug und geschickt und macht alles, was man will: Bücher, Spitzen, Häuser, Pyramiden, Lokomotiven, Kuchen oder Liebkosungen, das ist das beste, was es kann.
Er zog einen Ring nach dem anderen ab und wie nun auch der Trauring herabfiel, flüsterte er lächelnd:
– Achtung vor dem Gesetz!
– Dummheiten, sagte sie etwas gekränkt. Er hatte immer etwas Höhnisches, jene Sucht der Franzosen, auch den ernstesten Gefühlen den Schein der Ironie zu geben, und oft betrübte er sie damit, daß er nicht verstand den feinen Regungen der Frauenliebe zu folgen und die Grenzen des Heiligtums, wie sie es nannte, zu achten. Vor allem ärgerte sie sich jedesmal, wenn er ihre Beziehungen zu einander bespöttelte, die so lange schon dauerten, daß sie das beste Beispiel für treue Liebe im neunzehnten Jahrhundert gewesen wären. Nach einer Pause sagte sie:
– Nicht wahr, Du begleitest uns, Annchen und mich zur Eröffnung der Bilder-Ausstellung?
– Selbstverständlich!
Da fragte sie ihn, welches die besten Bilder des nächsten Salons, der in vierzehn Tagen eröffnet werden sollte, sein würden.
Aber plötzlich sagte sie, vielleicht weil ihr einfiel, daß sie eine Besorgung vergessen:
– Schnell, schnell, gieb mir meinen Schuh.
Er spielte träumend mit der leichten Fußbekleidung, drehte und wandte sie zerstreut in den Händen.
Er beugte sich nieder und küßte den Fuß, der zwischen Kleid und Teppich zu schweben schien, sich nicht mehr bewegte und durch die Luft kühl geworden war.
Dann zog er ihr den Schuh an. Gräfin Guilleroy erhob sich und trat an den Tisch, auf dem allerlei Papiere, offene Briefe, alte und neue, neben einem echten Maler-Tintenfaß, in dem die Tinte eingetrocknet war, herumlagen. Sie blickte alles neugierig an und hob die Blätter auf, um darunter zu sehen.
Er näherte sich ihr:
– Du wirst meine Unordnung in Unordnung bringen.
Ohne zu antworten fragte sie:
– Wer ist dieser Herr, der »die Badenden« kaufen will?
– Ein Amerikaner, den ich nicht kenne.
– Hast Du die »Straßen-Sängerin« verkauft?
– Ja. Zehntausend.
– Das ist sehr vernünftig, die war nett, aber nichts Besonderes. Adieu Liebster!
Sie hielt ihm die Wange hin, die er mit einem ruhigen Kuß streifte, und sie verschwand hinter der Portière, nachdem sie noch halblaut gesagt:
– Freitag um acht. Du sollst mich nicht zur Thür begleiten. Du weißt, ich mag es nicht.
Als sie fort war, steckte er sich zuerst eine Cigarette an, dann durchmaß er das Atelier langsam mit großen Schritten, und die ganze Geschichte dieses Verhältnisses tauchte vor ihm auf. Allerlei Einzelheiten, die er längst vergessen, fielen ihm wieder ein, und er suchte sie zusammen, um sie eine an die andere zu reihen. Die Jagd nach Erinnerungen unterhielt ihn in seiner Einsamkeit.
Damals war es, als er wie eine neue Sonne am Kunsthimmel von Paris aufstieg, damals, als die Maler die ganze Gunst des Publikums gewonnen und ein ganzes Stadtviertel prächtigster Häuser bezogen, die sie sich mit ein paar Pinselstrichen verdient.
Bertin hatte nach seiner Rückkehr von Rom 1864 zuerst ein paar Jahre hindurch keinen Erfolg und keinen Ruf gehabt; da ward er plötzlich 1868, als er seine Cleopatra ausstellte, von der Kritik wie vom Publikum in den Himmel erhoben.
1872, nach dem Kriege und nachdem der Tod Henri Regnaults all seinen Kollegen sozusagen ein Piedestal des Ruhmes verschafft, ward Bertin durch eine »Jokaste«, ein etwas gewagtes Bild, zu den Modernen gezählt, obwohl seine klug berechnete Technik ihn auch für die Akademiker annehmbar machte.
1873 brachte ihm seine »Algerische Jüdin« die große goldene Medaille ein, sodaß er außer Wettbewerb erklärt ward, – ein Bild, das er nach seiner Rückkehr von einer afrikanischen Reise gemalt. Und seit einem Porträt der Prinzessin von Salia, 1874, galt er in der großen Welt für den ersten Portratisten seiner Zeit. Von diesem Tage ab wurde er der Lieblingsmaler der Pariserin und der Pariserinnen, der geschickteste und genialste Schilderer ihrer Grazie, ihrer Art, ihres ganzen Seins. Nach ein paar Monaten hatten sämtliche bekannten Damen von Paris um die Gunst gebeten, von ihm gemalt zu werden. Er war sehr wählerisch und machte hohe Preise.
Als er nun in Mode war und gleich jedem anderen Herrn der Gesellschaft Besuche machte, traf er eines Tages bei der Herzogin von Mortemain eine junge Frau in tiefer Trauer, die eben ging, als er eintrat. Die Begegnung mit ihr in der Thür gab ihm einen packenden Eindruck von Grazie und Eleganz.
Er fragte nach ihrem Namen und erfuhr, daß es die Gräfin Guilleroy sei, die Frau eines normannischen Landjunkers, Landwirtes und Abgeordneten, daß sie um ihren Schwiegervater trauerte, daß sie geistreich, sehr bewundert und sehr beliebt sei.
Er sagte sofort, noch ganz hingerissen von der Erscheinung, die seinem Künstlerauge wohl gethan:
– Die würde ich gern malen!
Am nächsten Tage war es der jungen Frau hinterbracht worden, und noch am selben Abend erhielt er ein kleines bläuliches Briefchen, das einen unbestimmten Duft ausströmte und in seiner, regelmäßiger Handschrift, ein wenig von links nach rechts ansteigend, die Worte enthielt:
»Verehrter Herr Bertin!
Die Herzogin von Mortemain, die eben bei mir war, versichert, Sie würden geneigt sein, mit Hilfe meiner armen Züge eines Ihrer Meisterwerke zu machen. Ich würde sie Ihnen gern zur Verfügung stellen, wenn ich bestimmt wüßte, daß Sie nicht bloß eine Liebenswürdigkeit gesagt haben, sondern wirklich in mir ein Modell sehen, wert Ihrer Kunst.
Ich bin Ihre sehr ergebene Anna Gräfin Guilleroy.«
Er antwortete und fragte an, wann er der Gräfin seine Aufwartung machen dürfe. Ohne weitere Förmlichkeiten wurde er für den folgenden Montag zum Frühstück eingeladen.
Die Wohnung lag auf dem Boulevard Malesherbes in einem prachtvollen, modernen Hause.
Er durchschritt einen großen Salon, der mit blauer Seide tapeziert war, in Holzrahmen, Weiß mit Gold, und trat in eine Art Boudoir mit hellen, koketten Tapeten aus dem vergangenen Jahrhundert. Diese im Stil Watteau's gehalten, zeigten in zarten Farben graziöse Bilder, als hätten, die sie entworfen und ausgeführt, dabei von Liebe geträumt.
Er hatte sich eben gesetzt, als die Gräfin erschien. Sie schritt so leise, daß er nicht gehört, wie sie durch das anstoßende Zimmer gekommen, und ganz erstaunt war, als sie vor ihm stand.
Ungezwungen gab sie ihm die Hand und fragte:
– Sie wollen mich also wirklich malen?
– Es würde mir eine sehr große Freude sein, Frau Gräfin.
Ihr schwarzes, eng anliegendes Kleid machte sie sehr schlank, sodaß sie ganz jung aussah, obwohl sie eine ernste Miene aufsetzte, die ihr lächelnder Kopf im hellen Blond der Haare jedoch Lügen strafte.
Der Graf trat ein, ein kleines Mädchen von sechs Jahren an der Hand.
Die Gräfin stellte vor:
– Mein Mann.
Er war klein, glattrasiert, mit eingefallenen Wangen, die durch den abrasierten Bart bläulich schimmerten. Er hatte etwas von einem Geistlichen oder Schauspieler mit seinem nach hinten gebürsteten Haar. Er war sehr zuvorkommend, und an seinem Mund hatten sich zwei tiefe, halbmondförmige Falten eingegraben, die von den Wangen zum Kinn herabliefen und den Eindruck machten, als hätte sie die Gewohnheit, öffentlich zu sprechen, gezogen.
Mit einem Wortschwall, der auch den Redner verriet, dankte er dem Maler. Seit langem schon habe er seine Frau malen lassen wollen und hätte unbedingt Herrn Olivier Bertin darum gebeten, wenn er nicht eine Ablehnung befürchtet, denn er wußte, wie überlaufen der Maler war.
Sie kamen also nach vielen Komplimenten überein, daß er gleich vom nächsten Tage ab seine Frau ins Atelier bringen sollte. Aber er fragte, ob es nicht besser sei noch damit zu warten, wegen der tiefen Trauer, in der sie sich befanden; doch der Maler erklärte, es sei ihm gerade darum zu thun, den ernsten Eindruck festzuhalten, gerade den packenden Gegensatz ihres lebhaften, feinen, leuchtenden Kopfes mit dem Goldhaar zum ernsten Schwarz des Kleides.
So erschien sie am nächsten Tage mit ihrem Mann, und die folgenden mit dem Töchterchen, das man an einen Tisch setzte mit einem Haufen Bilderbücher darauf.
Olivier Bertin war wie gewöhnlich sehr zurückhaltend. Den Damen der Gesellschaft gegenüber war er verlegen: er kannte sie zu wenig. Er glaubte, sie wären gerissen und albern, scheinheilig und gefährlich, unbedeutend und unbequem zugleich. Bei den Damen der Halbwelt hatte er dank seiner Berühmtheit, seiner Unterhaltungsgabe sowie kräftigen, eleganten Gestalt, seinem energischen, männlichen Gesicht leichte Siege gehabt.
So zog er sie vor. Und da er an den leichten, lustigen Ton der Ateliers und der Theaterwelt, in der er verkehrte, gewöhnt war, so mochte er die ungegezwungene Art und Unterhaltung mit ihnen gern. In Gesellschaft ging er seines Renommees wegen, aber nicht etwa, weil es ihm Spaß gemacht hätte; dort verkehrte er aus Eitelkeit, man schmeichelte ihm, er bekam Bestellungen und spielte sich vor den schönen Damen auf, die ihm Liebenswürdigkeiten sagten, machte ihnen jedoch nicht den Hof. Da er sich aber im Gespräch mit ihnen niemals Zweideutigkeiten und Gewagtheiten erlaubte, so hielt er sie für dumm, und man fand, er habe sehr gute Manieren. Jedesmal, wenn sich eine bei ihm malen ließ, hatte er trotz aller Liebenswürdigkeit, die sie aufgewendet, ihm zu gefallen, immer das Gefühl, verschiedener Race, das Künstler und Gesellschaftsmenschen verhindert, einander nahe zu kommen, wenn sie auch miteinander verkehren. Hinter dem Lächeln und der Bewunderung, die bei den Damen immer etwas gemacht ist, erriet er eine unbestimmte Zurückhaltung, wie sie ein Mensch zeigt, der sich mehr dünkt als ein andrer. Das hatte bei ihm eine Art Stolz zur Folge, ein respektvolleres Vernehmen, beinahe von oben herab, neben der versteckten Eitelkeit des Emporkömmlings, der von Prinzen und Prinzessinnen als ihresgleichen behandelt wird, der Stolz des Mannes, der seinem Können die Stellung verdankt, welche andere nur durch die Geburt erlangt haben. Man sagte von ihm, fast wie erstaunt: »Er hat famose Manieren.« Dieses Erstaunen, das ihm schmeichelte, verletzte ihn zu gleicher Zeit, denn es zeigte ihm eine Scheidewand zwischen ihnen.
Der förmliche und beabsichtigte Ernst des Malers störte Gräfin Guilleroy ein wenig, die nicht wußte, was sie mit diesem zurückhaltenden Manne sprechen sollte, der doch für geistreich galt.
Nachdem sie ihre kleine Tochter untergebracht, nahm sie selbst auf einem Stuhle Platz neben der begonnenen Studie und gab sich Mühe, nach dem Wunsche des Künstlers ihren Zügen Leben zu verleihen.
Als sie mitten in der vierten Sitzung waren, hörte er plötzlich auf zu malen und fragte:
– Was macht Ihnen am meisten Spaß?
Sie war verlegen:
– Ja, ich weiß nicht, warum fragen Sie das?
– Ich brauche einen glücklichen Ausdruck in Ihren Augen, und den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
– Nun, bringen Sie mich zum sprechen, ich schwatze gern.
– Sind Sie heiter?
– Sehr heiter.
– Gut, so wollen wir uns unterhalten, Frau Gräfin.
Dieses »unterhalten, Frau Gräfin,« hatte er in ganz ernstem Tone gesagt, dann ging er wieder an die Arbeit, begann einige Themata und suchte einen Berührungspunkt zwischen ihnen. Sie fingen an, ihre Beobachtungen über gemeinsame Bekannte auszutauschen, dann sprachen sie von sich selbst, was doch immer der angenehmste und anziehendste Stoff ist.
Am nächsten Tage fühlten sie sich ungezwungener, und da Bertin sah, daß er der Gräfin gefiel[*,] fing er an, Geschichten aus seiner Künstlerlaufbahn zu erzählen und tischte Erinnerungen auf in jener phantastischen Art, die er liebte.
Sie, an die gezierte Sprache der Salon-Schriftsteller gewöhnt, war erstaunt über diese etwas verrückte Manier, mit der er offen herausredete und die Dinge beleuchtete.
Sofort antwortete sie im selben Tone mit feiner, kecker Grazie.
Nach acht Tagen hatte sie ihn gewonnen und verführt durch ihre gute Laune, ihre Offenheit und Einfachheit, hatte er sein Vorurteil gegen die Damen der Gesellschaft ganz vergessen und war bereit zu behaupten, nur sie hätten Reiz und Mumm. Während er malend vor der Leinwand stand und wie ein Fechter avancierte und zurückwich, schwatzte er ungezwungen, als ob er diese hübsche, blonde Frau in Schwarz da vor ihm, – halb Sonne, halb Trauer, – die ihm lachend zuhörte und so fröhlich und lebhaft antwortete, daß sie alle Augenblicke aus ihrer Stellung kam, schon lange gekannt hätte. Ab und zu entfernte er sich von ihr, kniff ein Auge zu, beugte sich vor, um sein Modell im ganzen zu erfassen, ab und zu wieder trat er ganz nahe heran, um die kleinsten Züge festzuhalten, den flüchtigsten Ausdruck, und alles auf die Leinwand zu bannen, was mehr in einem Frauenantlitz steckt, als man auf den ersten Blick gewahrt: dieser Ausfluß idealer Schönheit, dieser Widerschein von etwas, das man nicht kennt, der intime, gefährliche Reiz, der einer jeden inne wohnt und bewirkt, daß man sich bis zum Wahnsinn verliebt gerade in diese eine und gerade dieser eine in keine andere.
Eines Nachmiitags stellte sich das kleine Mädchen mit ganzem Kinderernst vor die Leinwand und sagte:
– Das ist doch Mama.
Er nahm sie auf den Arm und küßte sie, da ihm diese naive Bestätigung der Ähnlichkeit seines Werkes schmeichelte.
Als sie an einem anderen Tage sehr still war, erklärte sie plötzlich traurig mit leiser Stimme:
– Mama, ich langweile mich!
Und den Maler rührte diese erste Klage dermaßen, daß er folgenden Tages einen ganzen Spielwarenladen in das Atelier bringen ließ.
Das kleine Annchen war sehr erstaunt und zufrieden, und bedachtsam, wie sie immer war, ordnete sie das Spielzeug mit großer Sorgfalt, um eines nach dem anderen, je nachdem sie gerade Lust hatte, vorzunehmen. Von dem Tage ab, wo sie das geschenkt bekommen, liebte sie den Maler auf kindliche Art mit jener tierischen, schmeichelnden Zärtlichkeit, die den Kindern so gut steht und ihnen die Herzen gewinnt.
Die Gräfin fand Geschmack an den Sitzungen, sie hatte diesen Winter nichts vor wegen der Trauer, es fehlten ihr Gesellschaften und Feste, so wurde das Atelier ihre ganze Unterhaltung.
Als Tochter eines sehr reichen und gastfreien Großhändlers, der vor ein paar Jahren gestorben war und einer immer kranken Mutter, die gesundheitshalber sechs Monate im Jahre das Bett hütete, war sie schon frühzeitig eine vorzügliche Wirtin geworden. Sie verstand zu empfangen, zu lächeln, zu schwatzen, die Leute zu unterhalten, sie wußte was man jedem zu sagen hatte, und klug und schmiegsam fand sie sich im Leben zurecht. Als man ihr Graf Guilleroy als Bräutigam vorstellte, begriff sie gleich, welchen Vorteil diese Ehe für sie haben würde, fand sich sofort darein als vernünftiges Mädchen, das genau weiß, daß man nicht alles haben kann und in jeder Lebenslage die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen muß.
Als sie in die Gesellschaft trat, wurde sie sehr gut aufgenommen, weil sie hübsch war und geistreich. Ihr wurde sehr der Hof gemacht, aber sie verlor niemals ihr Herz, das kühl blieb wie ihr Kopf.
Und doch war sie kokett, aber von einer gewissen herausfordernden, gleichzeitig vorsichtigen Koketterie, die nie zu weit ging. Die Artigkeiten, die man ihr sagte, machten ihr Spaß, die Wünsche, die sie erweckte schmeichelten ihr, so lange sie sie ignorieren konnte, und wenn sie einen ganzen Abend durch in Gesellschaft umschmeichelt gewesen, schlief sie still und ruhig, als eine Frau, die ihren Zweck auf Erden erfüllt hat.
Aber dieses Leben, das nun schon sieben Jahre so dauerte, ohne sie zu ermüden oder zu langweilen, denn sie liebte das Hin und Her der Gesellschaft, ließ sie dennoch manchmal anderes wünschen.
Die Herren ihrer Umgebung, politisierende Advokaten, Finanz- oder beschäftigungslose Klubmänner machten ihr Spaß wie Schauspieler. Sie nahm sie nicht recht ernst, wenn sie auch bei ihnen Stellung, Amt und Titel schätzte.
Zuerst gefiel ihr der Maler durch all das Neue, das er ihr zuführte. Sie unterhielt sich ausgezeichnet im Atelier, lachte nach Herzenslust, fand sich geistreich und war ihm dankbar für das Amüsement, das die Sitzungen ihr brachten. Er gefiel ihr auch, weil er schön, stark und berühmt war. Was die Frauen auch sagen mögen, keine ist für körperliche Schönheit und Berühmtheit unzugänglich. Es schmeichelte ihr, von diesem Kenner bemerkt worden zu sein, und sie war sehr geneigt, ihn auch ihrerseits nach ihrem Geschmack zu finden. Sie hatte bei ihm einen regen gebildeten Geist gefunden, Zartgefühl, Phantasie und eine bilderreiche Sprache, die sofort klar machte, was er sagen wollte.
Schnell kam es zwischen ihnen zu Intimität, und in den Händedruck, jedesmal wenn sie das Atelier besuchte, ging täglich etwas mehr von ihrem Herzen über.
So fühlte sie in sich ohne Berechnung, ohne bestimmte Absicht, den Wunsch, ihn zu gewinnen, und dem gab sie auch nach. Sie hatte keinen Plan, sie ging nicht bewußt vor, sie war nur kokett und liebenswürdig gegen ihn, wie unwillkürlich gegen einen Mann, der einem mehr als andere gefällt. In ihr ganzes Benehmen gegen ihn, ihre Blicke, ihr Lächeln legte sie jene Verführungskunst, welche jede entwickelt, in der der Wunsch erwacht, geliebt zu werden.
Sie sagte ihm Artigkeiten, die so viel bedeuteten wie: »Sie gefallen mir,« und ließ ihn lange sprechen, um ihm durch ihr aufmerksames Zuhören zu beweisen, wie sehr er sie interessierte; er hörte auf zu malen, setzte sich neben sie, und in jener erhöhten Stimmung, die der Wunsch zu gefallen hervorzaubert, war er manchmal poetisch, humoristisch oder philosophisch, je nach dem Tage.
Es machte ihr Spaß, wenn er heiter war; wenn er ernstere Gespräche führte, versuchte sie, seinen Gedankengängen zu folgen, ohne daß es ihr immer gelang; und wenn sie dann an andere Dinge dachte, schien sie ihm doch zuzuhören, und sie that so, als verstehe sie ihn vollkommen und habe einen großen Genuß an seinen Worten, sodaß es ihn glücklich machte, sie so lauschen zu sehen, und er ganz gerührt war, eine zarte, mitfühlende, gelehrige Seele gefunden zu haben, in die seine Gedanken fielen wie ein Samenkorn.
Das Bild machte Fortschritte. Es schien sehr gut zu werden, denn der Maler war in der nötigen Erregung, alle Vorzüge seines Modells herauszufinden und sie nun mit jener feurigen Überzeugung wiederzugeben, die den wahren Künstler kennzeichnet.
Er neigte sich zu ihr, bespähte jeden wechselnden Zug ihres Antlitzes, jeden Farbenton ihres Fleisches, den Schatten auf ihrer Haut, den Ausdruck, die Durchsichtigkeit der Augen, alle Geheimnisse ihrer Erscheinung, und so hatte er sich vollgesogen mit ihr, wie ein Schwamm mit Wasser; und indem er den ganzen sinnverwirrenden Reiz, den seine Blicke einsogen, auf die Leinwand übertrug, der sich wie ein Strom von seinem Kopf in den Pinsel ergoß, war er wie berauscht, als habe er Frauenliebreiz getrunken.
Sie fühlte, wie er verliebt ward, und das Spiel, der immer sicherer werdende Sieg machte ihr Spaß, sodaß sie selbst dabei Feuer fing.
Ein Neues war in ihr erwacht, gab ihrem Dasein neuen Reiz und machte sie seltsam froh. Wenn man von ihm sprach, schlug ihr Herz schneller, und sie hatte den Wunsch – einen Wunsch, den sie aber niemals äußerte – ganz laut zu rufen: »Er liebt mich!« Sie war glücklich, wenn man sein Talent lobte, und vielleicht noch glücklicher, wenn man ihn schön fand. Wenn sie an ihn dachte, ganz heimlich im stillen Kämmerlein, meinte sie, an ihm einen wahren guten Freund gewonnen zu haben, der sich stets mit einem freundschaftlichen Händedruck begnügen würde.
Er aber legte oft plötzlich mitten während der Sitzung die Palette auf ein Tischchen, schloß das kleine Annchen in die Arme, küßte sie auf Augen und Haar, während er dabei die Mutter ansah, als wollte er sagen: »Dich küsse ich ja, Dich, nicht das Kind!«
Ab und zu kam die Gräfin ohne ihre Tochter, allein. An solchen Tagen wurde dann kaum gearbeitet, aber desto mehr geschwatzt.
Eines Nachmittags kam sie zu spät. Es war ein kalter Tag, gegen Ende Februar. Olivier war zeitig nach Hause zurückgekehrt, wie jetzt immer, wenn sie ihm sitzen sollte, denn er hoffte immer, sie würde zu früh kommen. Er wartete auf sie und schritt rauchend auf und nieder, indem er sich fragte – selbst ganz erstaunt, daß sich ihm seit acht Tagen die Frage zum hundertsten Male aufdrängte: »Liebe ich sie?« Er wußte es nicht, denn er hatte noch nie ernstlich geliebt. Er war wohl einmal, sogar lange Zeit hindurch, heftig verschossen gewesen, hatte das aber nie für Liebe angesehen. Heute wunderte er sich über das, was er empfand.
Liebte er sie? Jedenfalls begehrte er sie kaum, da er an die Möglichkeit sie zu besitzen noch nie gedacht. Bisher hatte ihn jedesmal, wenn ihm eine Frau gefallen, die Begierde sofort übermannt, daß er die Hand nach ihr ausstreckte, wie man eine Frucht pflückt, ohne daß seine Seele durch ihre Ab- oder Anwesenheit jemals aus dem Gleichgewicht gebracht worden war.
Der Wunsch, diese zu besitzen, hatte ihn kaum gestreift und schien sich hinter einem anderen, stärkeren, dunkleren, kaum erwachten Gefühl zu verbergen.
Olivier hatte gedacht, daß die Liebe beginnen müsse mit Träumen und poetischer Begeisterung, das was er aber empfand, schien ihm im Gegenteil einem undeutbaren, mehr körperlichen, als seelischen Zustand zu entspringen. Er war nervös, fiebernd, unruhig, wie vor dem Ausbruch einer Krankheit, und doch mischte sich mit diesem fiebrigen Blut, das sich wie durch Ansteckung auch auf seine Gedanken übertrug, nichts Schmerzhaftes. Er wußte wohl, daß diese Erregung durch Gräfin Guilleroy verursacht ward, durch das Denken an sie und das Warten auf ihr Kommen.
Er fühlte sich nicht durch alle Pulse zu ihr hingetrieben, aber er empfand immer ihre Gegenwart, als ob sie nie von ihm gegangen wäre. Wenn sie fortging, ließ sie ihm etwas von sich zurück, etwas Zartes, Unaussprechliches. Wie? War das Liebe? Nun stieg er in sein eigenes Herz hinab, zu sehen und zu begreifen, was es sei. Er fand sie reizend, aber sie entsprach nicht dem idealen Bilde, das seine Sehnsucht erträumt. Jeder, der die Liebe ersehnt, malt sich die geistigen Gaben und körperlichen Reize der Frau aus, die ihn in Fesseln schlagen soll, und wenn Gräfin Guilleroy ihm auch unendlich gefiel, so schien sie ihm doch dieses Geschöpf seiner Phantasie nicht zu sein.
Aber warum beschäftigte er sich mehr mit ihr, als mit andern, ganz anders und unablässig?
Hatte er sich einfach in den Fallstricken ihrer Koketterie gefangen, die er schon längst gefühlt und geahnt hatte? Und erlag er etwa dem faszinierenden Einfluß, den der Wunsch, einer Frau zu gefallen, ausübt?
Er ging hin und her, setzte sich, stand wieder auf, zündete sich Cigaretten an, warf sie wieder fort, und alle Augenblicke sah er nach dem Zeiger der Wanduhr, der langsam fast unbeweglich sich der bestimmten Stunde näherte.
Ein paar Mal schon war er daran gewesen, das runde Deckglas aufzuknipsen über den beiden goldenen Zeigern, und mit der Fingerspitze den großen bis an die Stunde vorzuschieben, der er sich so träge näherte.