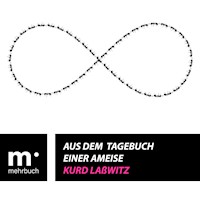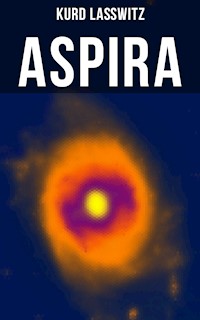Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein im wahrsten Sinne des Wortes fantastischer Roman. Auf einem Spaziergang entdeckt die junge Harda eine unbekannte Pflanze, die nicht von der Erde stammt. Sie reproduziert Elfen, deren Fähigkeiten bis zum Gedankenlesen reichen. Aber sind diese Elfen gut oder böse ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sternentau – Die Pflanze vom Neptunsmond
Kurd Laßwitz
Inhalt:
Kurd Laßwitz – Biografie und Bibliografie
Sternentau – Die Pflanze vom Neptunsmond
Harda
Am Riesengrab
Ebah, der Efeu
Das weise Moos
Die Hastenden
Gespenster
Der Vater
Gestörte Nacht
Der Botaniker
Sternentau
Unsichtbare Früchte
Pflanzenseele
Die Elfen kommen
Auf dem Neptunsmond
Zur Erde
Studien
Pläne
Pflanzenrede
Sorgen
Der Überfall
Geo
Bedauernswerte Erde!
Schlechtes Wetter
Erfolge
Elfen-Erbe
Sternentau, K. Laßwitz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849624637
www.jazzybee-verlag.de
Kurd Laßwitz – Biografie und Bibliografie
Philosophischer und belletristischer Schriftsteller, geb. 20. April 1848 in Breslau, verstorben am 17. Oktober 1910 in Gotha. Studierte in Breslau und in Berlin Mathematik, Physik und Philosophie, war 1875 Lehrer am Gymnasium in Ratibor und bekleidete ab 1876 eine Lehrerstelle am Gymnasium in Gotha; 1884 wurde er zum Professor ernannt. In seinen philosophischen Arbeiten hat er sich von dem früher eingenommenen subjektivistischen Standpunkt mehr entfernt und erstrebt eine erkenntnis-kritische Grundlegung der Wissenschaften im Sinne des Kantschen Idealismus. Er schrieb: »Atomistik und Kritizismus« (Braunschw. 1878); »Die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit allgemeinverständlich dargestellt« (Berl. 1883); »Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton« (Hamb. 1890, 2 Bde.); »G. Th. Fechner« (in »Frommanns Klassikern der Philosophie«, Stuttg. 1896, 2. Aufl. 1902); »Wirklichkeiten. Beiträge zum Weltverständnis« (Berl. 1900, 2. Aufl. 1903). Auf belletristischem Gebiet veröffentlichte er: »Bilder aus der Zukunft«, Erzählungen (3. Aufl., Bresl. 1879); »Seifenblasen«, moderne Märchen (3. Aufl., Weim. 1901); »Auf zwei Planeten«, Roman (2. Aufl., das. 1898, 2 Bde.); »Nie und Immer«, neue Märchen (Leipz. 1902).
Sternentau – Die Pflanze vom Neptunsmond
Harda
Auf dem breiten Gartenwege vor der Villa Kern hielt das Automobil zur Abfahrt bereit. Der Fahrer stand daneben, seinen Auftrag erwartend.
Hermann Kern streckte seine zierliche Figur nach Möglichkeit in die Höhe. Er blickte suchend hinüber, wo ein Fußweg im Gebüsche verschwand.
»Wo bleiben denn die Mädel?« sagte er ungeduldig vor sich hin. Und dann zum Diener gewendet, der mit dem Staubmantel im Arm hinter ihm stand:
»Sie haben doch den Damen melden lassen, daß ich reise?«
»Gewiß, Herr Direktor, vor zehn Minuten.«
Kern zuckte mit den Schultern und wandte sich dem Wagen zu. In diesem Augenblick erschien ein helles Kleid zwischen den Büschen. Ein junges Mädchen im Tennisanzuge, den Schläger in der Hand, trat auf den Weg. Als sie das Auto vor der Tür stehen sah, begann sie zu laufen. Mit leichten, behenden Sprüngen näherte sie sich dem Vater, aus dessen Gesicht der unzufriedene Zug schon verschwunden war. Sie schlang die Arme um seinen Hals und küßte ihn.
»Du willst fort, Vater?« rief sie. »Beim Kaffee sagtest du doch noch nichts. Wo willst du denn hin?«
»Ich mußte mich ganz plötzlich entschließen. Es geht nur nach Berlin. Morgen in der Nacht komme ich zurück.«
»Aber jetzt ist doch gar keine Abfahrtszeit. Und im Auto –«
»Ich will den Blitzzug in Liebenau erreichen.«
»Da hättest du auch noch eine Stunde Zeit.«
»Will ich auch haben, aber in Liebenau. Ich muß dort noch mit Krakauer konferieren.«
»Wohl wegen des Patents?«
»Jetzt habe ich keine Zeit mehr, Kind. Wo bleibt denn Sigi?«
Kern lüftete seine Mütze und strich das Haar von der Seite nach vorn über die kahle Stirn. Da rief Harda:
»Ich glaube, jetzt kommt sie. Ich höre sie schon da hinten singen.«
»So leb wohl, Harda, mein Herzel! Kurbeln Sie an, Pätzold.« Er küßte Harda. Sie hielt ihn fest.
»Vater,« sagte sie, »nimm mich mit!«
»Es wird zu spät. Ich kann dich diesmal wirklich nicht brauchen.«
Ihre braunen Augen ruhten mit einem langen, forschenden Blicke in denen des Vaters. Er wandte sich ab, als sähe er nach Sigi aus.
»Vater!« sagte Harda wie warnend.
Über die kleinen Fältchen in dem energischen feinen Gesicht zuckte ein nervöses Lächeln, als er es Harda wieder zuwendete.
»Sei unbesorgt, Dummköppel! Grüße Sigi! Wenn sie so langsam daherstolziert, kann sie das Nachsehen haben.«
»Aber Vater, ich habe deinen Koffer seit vorgestern nicht revidiert. Du hast inzwischen doch nichts herausgenommen?«
»Ich hab' ihn gar nicht geöffnet.«
»Willst mich nicht mitnehmen?«
Kern schüttelte den Kopf.
»Aber ein Stückchen fahr' ich mit,« rief Harda.
»Kind, du hast ja keine Zeit! Frickhoff hat sich zum Abend angesagt.«
»Sigi ist doch da und Anna und Tante Minna.«
»Minna wollte sich zu Bett legen. Sie bekam Kopfschmerzen.«
Harda blickte wieder fragend zum Vater hin. Er war eifrig damit beschäftigt, den Staubmantel anzuziehen. Leise summte der Motor.
Soeben setzte Kern einen Fuß auf den Wagentritt; doch zwei jugendliche kräftige Arme zogen ihn zurück. Sigi war herangekommen.
»Reist man so ab, Vater?« sagte sie entschieden. »Hast mich aus meinem besten Spiel herausgerufen.«
»Und du hast mich mindestens fünf Minuten warten lassen.«
»Hier bin ich doch. Da hast du zwei Abschiedsküsse. Aber ich will auch was.«
»Einen Sonnenschirm oder eine Reitpeitsche?«
»Tielen und Randsberg –«
»Gleich alle beide?«
Der Vater und Harda lachten fröhlich.
Sigi machte eine Handbewegung gegen Harda und sagte mit unerschütterlichem Ernste:
»Wir sind ja auch zwei. Ich habe sie eingeladen, zu abend zu bleiben. Bist du böse?«
»Schöpsel! Ist mir ganz recht. Frickhoff will nämlich kommen. Da hole dir nur auch noch einen Herren dazu, Harda? Wie wär' es mit dem langen Doktor? Dem bin ich's eigentlich schuldig. Zwei sind immer besser als einer.«
»Vater, reis' ab,« lachte Sigi. »Du bist unausstehlich.«
»Amüsiert euch gut, Kinder.«
»Adieu, ich muß zum Tennis.«
Sigi warf dem Vater noch eine Kußhand zu und ging gravitätisch von dannen.
»Los!« rief Kern.
»Ich fahre doch mit,« erklärte Harda. Sie sprang in den Wagen, der eben in Bewegung kam, indem sie über des Vaters Füße hinwegturnte.
»Daß dich!« rief der Vater lachend. »Wo willst du denn hin? Ich habe Eile und werde gleich schnell fahren. An der Brücke mußt du hinaus.«
»Nur noch den Berg hinauf bis zur Aussicht. Du fährst doch am Hellkamm entlang?«
»Daß dir's nicht zu weit wird. Und in dem Anzug!«
»Ich bin schon zur rechten Zeit zu Hause, direkt durch den Wald.«
»Bei der Aussicht halten Sie,« rief Kern dem Chauffeur zu.
Das Auto hatte inzwischen das Gartentor passiert. Auf der breiten Straße, die rechts nach den Hellbornwerken führte, bog es links ab und nahm mit mäßiger Geschwindigkeit die große Kehre, durch die der Weg ans Flußufer hinab gelangte. Jenseits der Brücke teilte sich die Straße wieder. Der Wagen fuhr am linken Ufer der Helle bergan, um in langgestreckten Windungen die Höhe zu gewinnen, die hier das weite Wiesberger Tal nach Nordwesten begrenzte.
»Vater,« begann Harda mit einem ängstlichen Blick, »kommst du auch wirklich morgen nacht wieder?«
»Kind, du weißt ja, absolut sicher ist nichts bei uns. Mir liegt sehr viel daran, hier zu sein. Übermorgen soll die Zwölfhundertpferdige fertig montiert sein. Aber wenn mir Krakauer Schwierigkeiten macht, muß ich vielleicht noch nach Hildenführ reisen, oder wenn die Berliner Vertretung der Nordbank nicht genügend instruiert ist, muß ich noch nach Hamburg, oder es kommt sonst eine neue Nachricht –«
»Nun ja, also Abschluß »H« und Abschluß »N«, und dann vielleicht noch »X«, »Y« und »Z«. Das kann lange dauern.«
»Mit dem »Z« kannst du recht haben, das kommt vielleicht noch. Aber erst kehre ich zurück. Ich habe die beste Hoffnung.«
»Ja?« rief Harda fröhlich. »Mit beiden?«
Kern nickte. Er sprach jetzt leiser in Hardas Ohr.
»Hildenführ wird nachgeben, denn ich habe das Patent auf das Härtungsverfahren sicher und ohne das nutzt ihnen das Kochverfahren nichts. Das werde ich jetzt Krakauer sagen, dann wird er auf Hildenführ drücken. Sobald wir aber das Kochpatent besitzen, haben wir einen solchen Vorsprung, Resinit im Großen herzustellen, daß uns kein anderes Werk einholen kann. Und dann wird auch die Nordbank sich beeilen. Denn unsre Gebäude stehen, die Kocher werden in vierzehn Tagen fertig. Frickhoff weiß das sehr genau, und der gibt doch den Ausschlag; das weißt du ja.«
»Acht Millionen,« sagte sie bedenklich.
»Soviel brauchen wir. Aber das wird bald wieder verdient sein. Die Kautschukeinfuhr kann den Bedarf nicht decken, und das Resinit ist das vollständige Ersatzmittel. Wir werden es viel billiger liefern – – und es hat noch in andrer Hinsicht eine große Zukunft, falls es spezifisch leicht genug wird –«
Kern verfiel in Nachdenken. Harda fragte nicht weiter. Sie wußte auch, warum er Frickhoff erwähnt hatte.
So saßen Vater und Tochter schweigend neben einander, beide mit ihren Gedanken beschäftigt.
Harda schrak auf, als der Vater plötzlich seine Hand auf die ihre legte und fragte:
»Nun, Herzel, wo denkst du denn noch hin? Wir sind sofort da.«
»Ich wollte, du nähmst mich mit.«
»Du kannst ganz ruhig sein, Harda. Für alle Fälle weißt du ja –«
»Ach Vater, ich möchte überhaupt fort, weit fort.«
»Kind, du weißt doch, es geht nicht, jetzt nicht. Und später –«
Harda schüttelte den Kopf. In diesem Augenblick hielt der Wagen.
Harda war sofort herausgesprungen.
»Adieu, Vater!«
»Adieu! – Nun aber vorwärts!« sagte Kern zum Fahrer und griff nach seiner Schutzbrille.
***
Harda stand auf dem Fußwege, der hier von der Straße links ab in den Wald führte, und blickte dem Wagen nach, der bald ihren Augen entschwunden war.
Oberhalb der Straße am Waldrande befand sich ein Tisch mit zwei Bänken. Der Platz hieß die »Aussicht«, und mit Recht. Der Blick schweifte nach Osten über die gesamte Ebene des fruchtbaren Tales von Wiesberg, über weite Getreidefelder, unterbrochen durch die dunkelgrünen Obstgärten der Dörfer, die mit ihren weißen Häusern und roten Dächern freundlich hervorlugten. Am Fuße der Waldberge sah man die Gebäudemassen, Kirchen und Schornsteine der verkehrsreichen Kreisstadt, deren Vorstädte sich bis nahe an den Abhang heranzogen, von dem Harda herabschaute. Hier bezeichneten Rauchwolken das Gebiet, wo sich die Industrie angesiedelt hatte und die Bodenschätze ausnützte, die der Absturz des Gebirges darbot.
Harda blickte weiter rechts in den nächsten Vordergrund. Daselbst trat der Fluß, die wasserkräftige Helle, durch eine kurze Schlucht von seinem Oberlaufe im Gebirge hervor, um durch das Wiesberger Tal einem größeren Strome zuzueilen. Gerade vor ihr, etwas tiefer, am bergansteigenden Ufer der Helle, leuchtete die stattliche Villa Kern mit ihren Nebengebäuden aus den parkartigen Anlagen. Die Entfernung war nicht groß, denn die Fahrstraße hatte sich in einer langen Kehre an der Berglehne dem Flusse wieder genähert, und hier, wo sie aufs neue zurückbog, lag die »Aussicht«. Harda konnte hinter der Villa auf dem höhergelegenen Tennisplatz die Figuren der Spieler sehen und glaubte sogar Sigi herauszuerkennen.
Sie warf noch einen Blick hinüber nach den Fabrikgebäuden, unter denen die hohen Neubauten ihre Aufmerksamkeit anzogen. Sie beobachtete eine Weile die Bahngeleise, wo eben ein langer Lastzug hereindampfte; dann wandte sie sich entschlossen um und trat in den Schatten des Waldes.
Der Fußweg senkte sich allmählich. Harda nahm sich Zeit. Unter die dunklen Fichten mischten sich breitästige Buchen, dazwischen bedeckte sich der Boden mit Gras und Kräutern, einzelne moosbewachsene Felstrümmer ragten hervor.
Je weiter sie schritt, um so mehr schwanden die Falten zwischen ihren Augenbrauen, und die Wangen röteten sich wieder jugendlich. Das volle aschblonde Haar über der Stirne glänzte in dem gebrochenen Lichte des Waldes in grünlichem Schimmer. Hier und da bückte sie sich nach einer Blume oder einer frühen Erdbeere, die gerade auf dem nach Süden abfallenden Berghang ein sonniges Plätzchen gefunden hatte.
Jetzt bog der Weg nach rechts. Harda blieb stehen und blickte in seiner Richtung. Ihre Augen ruhten wie in weiter Ferne, obwohl der sich windende Weg bald wieder im Walde verschwand. Sie seufzte leise.
»Wozu erst das Haus sehen,« dachte sie. »Es ist ja niemand da.«
Sie bog von dem Wege ab und stieg einen schmalen Pfad hinunter, der an der Kante des abfallenden Bergriegels hinführte. Dichter und wilder wurde der Wald. Über Steintrümmer, Baumäste und Wurzeln mußte sie ihren Weg suchen, und jetzt, an einer kleinen Waldwiese, hörte er ganz auf.
Aber Harda wußte Bescheid. Sie schritt auf die gegenüberliegende Ecke der Wiese zu, nach einer Lücke im Unterholz, und gelangte wieder in Hochwald, wo mächtige Buchen über grünem Rasenboden einen weiten Dom bildeten. Der Bergrücken selbst verengte sich mehr und mehr und endete jetzt mit einem gewaltigen Felsblock, um den sich Harda auf schmalem Stege absteigend herumwand, und nun befand sie sich auf einem kleinen Plateau in völlig abgeschlossener Waldeinsamkeit.
Hinter ihr erhob sich der überhangende Fels und bildete eine Art Grotte, die von einer breitästigen Buche, einem alten Waldriesen, überschattet war. An den drei andern Seiten blickte man direkt in die Wipfel hoher Fichten und Buchen; denn die Felsen stürzten steil ab, und es gab nur eine Stelle, an der man mit Hilfe einiger Stufen und einer Holztreppe, die in den Felsspalt geklemmt war, hinabsteigen konnte. Dies war die Fortsetzung des Pfades, auf dem Harda von oben herab gekommen war. Unten aber im Grunde umrauschten die Wasser der Helle die Felsecke und belebten mit ihrem gleichmäßigen Gurgeln und Plätschern die Stille des abgeschiedenen Platzes. Dicke Moospolster bedeckten die Felstrümmer und den Boden. Vor der dunklen Grotte zog sich junges, eigenmächtig aufgeschossenes Buchengebüsch um den Felsen und bildete mit seinem hellen Grün eine froh anmutende Pforte, als gäbe es dort einen Ausweg zum Lichte.
Die große Buche stand soweit von der Felswand ab, daß ihre machtvolle Krone nicht an der Ausbreitung behindert war, und ihr Wipfel ragte weit über die Felsen empor. Ihr Stamm und ein großer Teil ihrer Äste war von dichtem Efeu umschlungen, der an ihr hinauf zum Lichte strebte.
Unter der Buche, von Hardas Standpunkt aus noch nicht sichtbar, befand sich eine Bank mit einem einfachen Holztische davor. Sie war nach der Seite gerichtet, durch die man an einzelnen Stellen zwischen den Baumwipfeln hindurch den Blick ins freie Land mehr erraten als gewinnen konnte. Die Abgeschlossenheit blieb erhalten, aber man wußte, daß dort die lebendige Welt mit Himmelsblau und Sonnenschein lag.
Auf dieser Bank gedachte Harda sich niederzulassen. Hier war ihre Zuflucht in allen stürmischen Stunden, die ihr Herz freudig oder traurig bewegten. Hierhin floh sie, wenn ihr drüben in der Villa die Gesellschaft zu groß oder zu laut war, hierhin, wenn sie sich nicht mehr Rat wußte, wie sie sich durch andringende Fragen hindurchfinden sollte. Hier war ihre Waldkapelle, hieran knüpfte sich alles Tiefste und Innigste ihres jungen Lebens, Frieden und Sehnsucht. Und hier – –
Nun ja, es wird auch wieder sein!
Und sie bog das junge Buchengebüsch beiseite, das sie noch von dem Ruheplatz trennte.
Am Riesengrab
Beim erstem Blicke, den Harda durch die Zweige warf, zuckte sie zusammen. Es saß jemand auf der Bank. Ein Name wollte ihren Lippen entfliehen – wer auch sonst konnte hier – aber nein, es war nicht möglich, ihn hätte sie sogleich erkannt – es mußte ein Fremder sein. Wer hatte hier etwas zu suchen? Wollte man sie auch hier stören? Wie ärgerlich!
Es war ein einziger Augenblick, worin ihr diese Gefühle aufstiegen. Ohne Zögern trat sie auf den Platz und sah nun, wer der Eindringling war. Ein leichtes Lächeln spielte um ihren Mund. Der würde ihr jedenfalls keine Schwierigkeiten machen.
Auf dem Tische befanden sich ein Strohhut, einige mit ihren Wurzeln ausgelöste Pflanzen, Messerchen, Schere und zwei Glasfläschchen. Der Inhaber dieser Utensilien aber war so eifrig beschäftigt, daß er Hardas Kommen nicht einmal bemerkt hatte. Er betrachtete mit tief herabgebeugtem Kopfe durch die Lupe aufmerksam ein mit der Pinzette gehaltenes Blättchen. Erst als Harda dem Tische sich näherte, und er ihre Schritte vernahm, blickte er auf, und es dauerte noch kurze Zeit, ehe er seine Brille zurechtgeschoben und die Augen der Entfernung akkomodiert hatte. Dann sprang er auf und verbeugte sich höflich.
»Fräulein Kern!« sagte er überrascht. »O, da muß ich gewiß sehr um Entschuldigung bitten. Ich fürchte, ich bin hier ohne Erlaubnis auf Ihrem Grund und Boden eingedrungen. Aber, gnädiges Fräulein, ich kann versichern, ich bin mir dessen in keiner Weise bewußt gewesen.«
»Fürchten Sie gar nichts, Herr Doktor,« antwortete Harda freundlich. »Der Grundbesitz der Hellbornwerke reicht hier nur bis ans rechte Ufer der Helle. Aber aus meinem Anzuge könnten Sie freilich schließen, daß ich noch innerhalb der Parkgrenzen umherliefe.«
»O bitte –«
»Es ist aber ganz gleich, ich geniere mich nicht und setze mich ein wenig her. Aber Sie dürfen sich auch nicht stören lassen, nehmen Sie wieder Platz und – Ach!« unterbrach sie sich fast heftig, »da haben Sie ja meinen Sternentau!«
»Was habe ich? Wie nennen Sie die Pflanze? Sie kennen sie? Sternentau?« fragte der Doktor lebhaft.
»Nein, nein,« beruhigte Harda. »Ich nenne die blauen Blumensterne nur so für mich wegen der runden Erhebung im Innern, die wie ein Tautropfen glänzt. Es ist bloß ein Privatname zu meiner stillen Freude. Die Pflanze findet sich nämlich sonst nirgends als hier in der Nähe des Riesengrabs, und sie scheint überhaupt noch nicht entdeckt. Ach, ich drücke mich wohl sehr dumm aus. Sie steht in keiner Flora. Nun haben Sie die Blumen entdeckt und ich habe sie nicht mehr für mich. Aber das mußte ja doch einmal kommen.«
»Ich bitte Sie, Fräulein Kern,« sagte der Doktor mit ganz erschrockenem Gesicht, »wenn es sich wirklich so verhalten sollte, daß die Pflanze noch nicht bestimmt ist – mir ist sie allerdings völlig fremd, auch fremdartig – wenn sie bisher nur Ihnen bekannt war, so werde ich selbstverständlich Ihr Entdeckerrecht achten. Die Untersuchung wäre ja freilich sehr interessant, ja eine wissenschaftliche Pflicht – aber ohne Ihren ausdrücklichen Wunsch, das verspreche ich Ihnen, werde ich nichts bekannt geben.«
Harda sah ihn dankbar an, daß ihm ganz merkwürdig zumute wurde, und sprach lächelnd:
»Es ist doch wahr, was unsre Leute von Ihnen sagen: Der Doktor Eynitz ist ein guter Mann.«
»Hm – bitte –« sagte Eynitz verlegen, und ein leichtes Erröten lief über sein freundliches Gesicht – »Das braucht nicht immer ein Lob zu sein, es kann auch eine Schwäche bedeuten.«
»Wenn Sie es lieber wollen, tun Sie mir einen Gefallen aus Schwäche. Eine Schwäche ist's ja auch, wenn ich das Pflänzchen noch eine Weile für mich behalten möchte. Aber die Pflanzen sind mir nun mal überhaupt ans Herz gewachsen. Die sind doch nicht einfach eine Sache, sie leben und fühlen ja, und jede einzelne ist was für sich. Ich bilde mir immer ein, wenn ich so ein Pflänzchen recht lieb habe, müßte mich's auch wieder gern haben.«
Sie nickte dem Blümchen, mit dem ihre Hand spielte, unwillkürlich vertraulich zu. Eynitz nickte ebenfalls.
»Ja, Herr Doktor,« fuhr Harda fort, »Ihr freundliches Anerbieten kann ich natürlich nicht ganz annehmen, aber wir könnten uns einigen. Sie studieren den Sternentau und bestimmen ihn und werden Ihr Resultat veröffentlichen, aber den Fundort, nicht wahr, den Fundort geben Sie nicht an, damit wir hier nicht von Botanikern überlaufen werden. Oder geht das nicht?«
»Nun« – Eynitz drehte bedenklich an seinem braunen Schnurrbärtchen und ließ die Augen zwischen Harda und dem Walde hin und hergehen, als lauerten dort schon Pflanzenjäger – »verschweigen kann man ja den Fundort freilich nicht – aber es ließe sich wohl ein Ausweg finden. Hat denn diese Felsgruppe einen offiziellen Namen?«
»Wir nennen sie das Riesengrab, weil die Leute behaupten, hier läge ein Riese begraben, aber ich glaube nicht, daß der Name auf einer Karte steht. Wo haben Sie denn den Sternentau überhaupt gefunden?«
»Hier unter dem Efeu und – ja, und dann auch ganz versteckt abseits zwischen den Felstrümmern am Wege hier herauf – d. h. Weg ist ja nicht da – ebenfalls unter Efeublättern.«
»Sonst nirgends? Nun ja, er wächst auch sonst nirgends. Aber dann genügt doch, wenn Sie sagen: »Westlich von Wiesberg, Ufer der Helleschlucht, unter Efeu. Dann können die Leute suchen. Und daß sie nicht hier heraufkommen, dafür will ich schon sorgen. Das Plateau hier oben, das muß eingezäunt werden – unauffällig. Die Gegend ist überhaupt nicht mehr ganz sicher vor Touristen. Ist's Ihnen so recht?«
»Mir ist alles recht, wie Sie's wünschen. Aber ich denke, dieses Terrain gehört nicht zu Ihrem Besitztum.«
»Allerdings nicht, aber ich kenne den Besitzer gut, und ich weiß, das tut er mir sicher zu Gefallen.«
»So sind wir hier auf Privatbesitz? Wem gehört denn dieser Wald?«
»Ach, es ist nur ein mäßiges Stückchen Fels, Wald, Wiese und ein umgebautes ehemaliges Bauernhäuschen. Solves heißt der Besitzer. Sie werden den Namen kennen.«
»Geo Solves etwa?«
»Freilich.«
»Ach gewiß! Jetzt erinnere ich mich ja, daß er sich vor einigen Jahren hier angekauft hat. Und das ist ein guter Freund von Ihnen?«
»Jetzt unser Nachbar. Aber ich kenne ihn freilich von Jugend auf. Er ist mein Pate.«
»Geo Solves Ihr Pate? Das ist interessant. Da sind Sie ja zu beneiden.«
»Ich beneide mich ja auch – Aber bitte, für was erklären Sie nun das Blümchen? Ist es nicht reizend mit den fünf glockenförmig nach außen gebogenen Blättchen, über die es von der Mitte her, von dem glänzenden Köpfchen, wie ein leichter, silberglitzernder Schleier von seidenen Fäden fällt! Und dieses feine Spitzengewebe der Ranken und Blätter! Eigentlich sieht's wie ein kletterndes Farnkraut aus, wenn's so was gibt. Aber diese offene Blüte? Man möchte an eine Akelei denken.«
»Ein Blümchen ist's nicht, gnädiges Fräulein. Ich habe schon mit der Lupe gesehen, daß kein Samen vorhanden ist, und die Fäden, die Sie wohl für Staubblätter halten, sind irgend ein anderes Organ. Und hier ganz im Innern, was Sie sehr bezeichnend mit einem Tautropfen verglichen, das ist kein Stempel. Das möchte ich für ein Sporangium halten, für eine Kapsel, darin die Sporen reifen. Ob man aber die Pflanze zu den Farnen rechnen darf, oder ob sie eine ganz neue Gattung von Kryptogamen vorstellt, das läßt sich nur mit Hilfe des Mikroskopes entscheiden, wenn man die weitere Entwicklung im Generationswechsel beobachtet.«
Harda sann einen Augenblick nach, dann begann sie wieder: »Mag's auch keine Blütenpflanze sein, so kann ich doch ruhig weiter Sternentau sagen. Das ist ein neutraler Name. Ich will Ihnen noch etwas Seltsames mitteilen, Herr Doktor. Die Pflanze ist nämlich erst seit vorigem Jahre hier aufgetreten. Das wird Ihnen erklären, warum sie noch nicht wissenschaftlich untersucht ist. Ich habe nun versucht, sie durch Ableger zu verpflanzen, sie ist aber nur an zwei Stellen fortgekommen, nämlich wo sie auch unter Efeu steht. Und dann habe ich aufs genaueste aufgepaßt, ob das Pflänzchen denn keine Früchte trägt, aber ich habe nie etwas finden können. Das würde ja mit dem stimmen, was Sie sagen. Von dem Generationswechsel habe ich gelesen, aber sehr klar ist es mir gegenwärtig nicht.«
»Wenn Sie gestatten – ein etwas groteskes Beispiel wird den Ausdruck sogleich klar machen. Nehmen Sie an: Eine Henne legt ein Ei, daraus kröche aber nicht wieder ein Hühnchen heraus, sondern es wüchse zunächst ein Strauch hervor. Der Strauch bilde zweierlei Blüten, weibliche und männliche; und eines schönen Tages lösen sie sich ab und fliegen als kleine Hühnchen und Hähnchen davon. Wenn sie erwachsen sind, finden sie sich zusammen, und die Hühnchen legen wieder Eier, aus denen dann Sträucher hervorwachsen. So lösen sich immer Strauch und Vogel in der Nachkommenschaft ab. Das wäre ein richtiger Generationswechsel.«
Harda lachte.
»Ja wohl,« rief sie lebhaft, »jetzt erinnere ich mich wieder. Der Vorgang ist gar nicht so abenteuerlich, wie er sich in dieser Form von Hühnern und Sträuchern anhört. Denn die Quallen, die so schön schillernd im Meere schwimmen, machen es tatsächlich ähnlich.«
»Ganz richtig,« sagte Eynitz. »Eine Qualle bringt ein Ei hervor, daraus entwickelt sich aber nicht eine frei schwimmende Qualle, sondern zunächst ein Wesen, das mehr Pflanze als Tier scheint, ein Polyp, der am Boden festsitzt. Aus ihm wachsen erst durch Knospung die Quallen heraus, die sich dann loslösen und fortschwimmen. Nun, unter den Pflanzen zeigen die Kryptogamen meist etwas Ähnliches. Nehmen wir an, unser Sternentau hielte es auch so, dann würden aus den Sporen dieser blauen Becher nicht wieder die Sternentaupflänzchen entsprießen, sondern irgend ein ganz andres Gewächs, vielleicht mikroskopisch klein, oder wenigstens unscheinbar, wie z. B. die grünen Täfelchen beim Farnkraut, die man den Vorkeim nennt. Erst an diesen Vorkeimen würden sich später Bildungen von zwei getrennten Geschlechtern zeigen, die Hühnchen und Hähnchen unseres Beispiels. Es könnte auch sein, daß die ganze Entwicklung sich schon innerhalb der Kapseln vollzöge und die Jungen Hühnchen und Hähnchen gleich fertig herausflögen. Und erst, wenn nachher die Hühner Eier legen, will sagen, wenn die betreffende zweite Generation ihrerseits Sporen hervorbringt, so wächst aus diesen durch Sprossung die grüne Sternentaupflanze heraus. Aber – ich langweile Sie – entschuldigen Sie, ich komme so leicht ins Dozieren.«
»Nein, nein, Herr Doktor. Ich danke Ihnen. Wenn sich's so verhält, so ist's ja ganz klar, warum ich keine Früchte finden konnte. Wer sagt uns denn, wie dieses Zwischengeschlecht beim Sternentau beschaffen ist? Es ist vielleicht ein ganz anderes Wesen, ein höheres – gar keine Pflanze mehr! Vielleicht ist's ein Elfchen, ein richtiges Geistchen, natürlich auch mit einem richtigen Körperchen. Sie lachen – ganz recht – was ich rede, ist wohl sehr dumm. Aber schön wär's doch, wir selbst hätten auch solchen Generationswechsel, natürlich nach Willkür, wie es Menschen geziemt, und man könnte manchmal aus seiner Haut heraus als ein freieres Wesen schweben – –«
Sie sah mit einem leichten Anhauch von Wehmut in die Ferne.
Eynitz lachte nicht. Er sah ganz ernsthaft aus, als er sagte:
»Wenn man nur sicher wäre, daß die eine Generation sich auch noch der andern erinnerte. Aber, gnädiges Fräulein, wer so glücklich ist wie Sie –«
Harda sah ihn fragend an.
»Ich meine, nach dem, was ich heute an Ihnen kennen lernte, da haben Sie ja das freie Wesen immer in sich. Sie brauchen nicht aus sich herauszugehen, Sie ziehen sich nur in Ihre Persönlichkeit zurück. Wenn Sie vom Haus oder der Fabrik oder dem Tennis in diesen Wald treten und mit den Pflanzenseelen leben, da wandeln Sie schon in dem höheren, in Ihrem eignen Reiche –«
»Ach bitte, nein,« rief Harda aufspringend, »philosophieren Sie nicht über mich, es lohnt sich wirklich nicht. Sehen Sie nur einmal diesen Efeu an, wie er an der Buche emporstrebt, und in welcher Fülle, immer höher und höher.«
Eynitz reckte seine lange Gestalt empor.
»Er will zum Lichte,« sagte er, »denn nur dort kann er blühen.«
»Und er will blühen, das glaube ich. Sehen Sie – wenn wir nun ein Generationswechsel vom Efeu wären? Wenn unser Bewußtsein von Zeit zu Zeit einmal durch die Efeuseele hindurchginge? Warum wächst der Efeu so oft auf Gräbern?«
»Weil wir ihn dort hinpflanzen.«
Harda bog die Blätter des Efeus beiseite. »Und sehen Sie, wie unser Sternentau sich ganz dicht an den Efeu schmiegt? Ich glaube, die haben etwas zusammen, die hecken etwas aus.«
»Ich habe mit der Lupe gesehen, der Sternentau besitzt ganz feine Fasern, die sich an den Efeu heften. Man muß das noch näher untersuchen.«
»Das tun Sie nur. Aber hier will ich Ihnen noch etwas zeigen, Sie müssen mir nur versprechen, das wirklich nicht weiter zu sagen – nur Ihnen als Botaniker verrat' ich's.«
Sie ging nach dem Felsen zu.
»Bitte, hier drüben müssen Sie ein paar Schritte hineinkriechen, und dann blicken Sie hinunter in den breiten Spalt des Felsens. Bücken Sie sich aber tüchtig – bitte hier.«
Harda drängte die Buchenzweige vor dem Grotteneingang beiseite und schlüpfte in die Höhlung. Eynitz folgte.
»Warten wir, bis sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat.«
Es war ganz still; draußen hörte man die Insekten summen.
»So!« sagte Harda. »Und nun – da unten – das sind die Schätze des Riesens, der hier begraben liegt.«
Sie standen schweigend vor der dunkeln Höhlung. Da drunten aber funkelte es grüngelb wie Gold und Edelsteine aus dem Geheimnis des Berginnern.
»Ein Märchen,« sprach Eynitz bewundernd.
»So fühlt man's, nicht wahr? Und das soll nicht mitfühlen? Sollte gar nichts merken, daß es mitstrebt, wie wir nach dem großen Gotte, dem Lichte?«
» Schizostega osmundacea«, sagte Eynitz leise vor sich hin.
»Ja, Leuchtmoos,« bemerkte Harda. »Ich weiß es. Lichtbrechende Zellen beleuchten sich ihr eignes Blattgrün. Aber Sie haben den Zauber gelöst – gehen wir, Sie müssen vorankriechen.«
Und draußen fragte sie: »Sie sind doch Mediziner, woher haben Sie Ihre botanischen und biologischen Kenntnisse?«
»Aber, gnädiges Fräulein, woher haben Sie die Ihren?«
»Ich habe keine. Ich habe nur hier und da etwas aufgeschnappt und habe mir manches erklären lassen können. Ich lese auch gern – ich hoffte ja, Botanik zu studieren.«
Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen und sie schwieg.
Eynitz wagte nicht zu fragen. Er begann:
»Ich habe nun wirklich Biologie studiert, ich bin eigentlich Biologe, oder ich wollte es werden. Mein »Doktor« ist philosophioae, nicht medicinae. Dann mußte ich leider mein Studium aufgeben, als mein Vater plötzlich starb. Ich war gezwungen, ein Brotstudium zu ergreifen, und meine biologischen Vorkenntnisse ermöglichten mir, in verhältnismäßig kurzer Zeit das medizinische Staatsexamen zu bestehen. Jetzt habe ich kaum noch Zeit zu meinen Lieblingsarbeiten. Ein Kassenarzt, Sie wissen, ist mehr als vollauf beschäftigt. Aber –« und er machte sich daran, seine Utensilien und Pflanzen zusammen zu packen – »für den Sternentau muß sich doch noch Zeit finden.«
»Ich danke Ihnen aufrichtig, Herr Doktor. Nun sagen Sie mir bloß noch – ich bin wohl sehr neugierig – wie und woher sind Sie eigentlich hier heraufgekommen?«
»Ich botanisierte am linken Helle-Ufer aufwärts und geriet dabei mehr und mehr in Dickicht und Felstrümmer. Die wenigen Exemplare Ihres Pflänzchens, die ich fand, lockten mich immer höher, und schließlich sah ich, daß ich nicht mehr zurück konnte. Ich kroch also weiter, und auf einmal treffe ich auf richtige Steinstufen und dann auf eine Holztreppe. Das ist jedenfalls der Weg, den Sie heraufgekommen sind?«
»Nein, ich komme von oben. Da gibt es auch noch einen Weg, der aber zuletzt absichtlich vom Besitzer für den Fremden unkenntlich gemacht ist. Aber den von Ihnen gefundenen Weg werden wir dann hinabgehen.«
»Wo kommt der heraus?«
»An einem Laufstege über die Helle, der drüben mit einem Gatter verschlossen ist. Und den Schlüssel zu diesem Gatter habe ich hier.«
Sie holte mit einiger Mühe aus ihrer Tasche einen Schlüssel, den sie triumphierend vorwies.
»Und wo führt der Steg hin?«
»In den Park der Villa Kern, die Ihnen bekannt sein dürfte. Wie spät ist es denn überhaupt? Ich habe keine Uhr bei mir.«
»Sieben Uhr und zwanzig Minuten,« sagte Eynitz.
»Ach, da haben wir aber wirklich keine Zeit mehr. Ich glaubte, es wäre erst so weit nach sechs Uhr. »Wir« sage ich, entschuldigen Sie, denn ich muß Sie mitnehmen. Erstens wegen des Schlüssels, denn sonst finden Sie keinen gangbaren Weg. Und zweitens – ich habe nämlich den offiziellen Auftrag von meinem Vater, Herrn Doktor Eynitz zum Abendessen einzuladen. Was hiermit geschieht.«
Sie knickste mutwillig.
Eynitz machte ein verblüfftes Gesicht
»Mich? Ja, aber Sie konnten doch nicht wissen, daß Sie mich hier treffen würden.«
Harda lachte übermütig.
»Nein, Herr Doktor, so schlau war ich nicht. Aber da ich's nun so gut getroffen habe, so konnte ich's gerade persönlich ausrichten. Sonst hätte ich schon früher nach Hause laufen müssen, um Sie telephonisch einzuladen. Entschuldigen Sie die Formlosigkeit, es handelt sich natürlich um keine Gesellschaft.«
Eynitz sah höchst bekümmert aus. Nach kurzer Überlegung sagte er: »Haben Sie herzlichsten Dank, gnädiges Fräulein, aber sagen Sie Ihrem Herrn Vater –«
»Mein Vater mußte freilich plötzlich verreisen, aber Sie finden noch einige Herren bei uns, die wir auch erst nachmittags gebeten haben – Herrn Kommerzienrat Frickhoff, Leutnant von Randsberg, Leutnant Thielen.«
»Es tut mir ganz außerordentlich leid, ich kann die Einladung nicht annehmen, ich habe noch einige unumgängliche Besuche zu machen, die bis neun Uhr erledigt sein müssen. Nebenbei, ich müßte vorher auch erst nach Hause, denn nach dieser Kletterei kann ich unmöglich in solchem Aufzuge – und dann würde es doch zu spät werden –«
»Das ist ja schade,« bemerkte Harda nach einem prüfenden Blick auf Eynitz gleichmütig. »Nun, vielleicht kommen Sie noch nach Ihren Besuchen, vor elf gehen die Herren nicht.«
»Sehr liebenswürdig. Ich kann nur nichts versprechen. Sie wissen, der Arzt kann nicht über seine Zeit verfügen.«
»Sehen Sie zu. Ich gehe voran.«
Eynitz warf seine Expeditionstasche über die Schulter und folgte langsam. Er kannte den Weg nicht wie Harda, und so war ihre geschmeidig Gestalt auf dem buschigen Zickzackwege ihm bald entschwunden. Er beeilte sich auch nicht, denn erstens erforderte der kaum gebahnte Pfad Aufmerksamkeit, und zweitens waren seine Gedanken damit beschäftigt, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, die unerwartete Einladung anzunehmen.
Er hatte ja im Hause des Direktors der Hellbornwerke, das einen gesellschaftlichen Mittelpunkt von Wiesberg und Umgegend bildete, nur in den formellsten Grenzen verkehrt, zumal ihm weder seine Zeit gestattete, noch seine Neigung ihn drängte, lebhaftere Geselligkeit zu suchen. So kannte er auch die Töchter hauptsächlich vom Hörensagen als gefeierte Tänzerinnen und umworbene gute Partieen. Nur mit Harda war er bei Krankenbesuchen in den Familien der Beamten und Arbeiter und im Krankenhaus einige Male zusammengetroffen und hatte sie dort in ihrer teilnehmenden Fürsorge schätzen gelernt. Und nun hatte er hier am Riesengrabe im Banne der Pflanzenseelen noch etwas ganz anderes erfahren – – Das Geheimnis des Sternentaus mußte sie notwendig wieder zusammenführen. Und dieser Verkehr hatte so viel Verlockendes! Es war in Wiesberg wirklich kein Überfluß an anregenden Persönlichkeiten – sollte er diese erste familiäre Einladung ablehnen? Komisch, wie war nur der Direktor gerade heute darauf gekommen? Sollte Harda improvisiert haben? Dann mußte er doch hin, wenn er sie nicht verletzen wollte. Aber nein – wie konnte er sich so etwas einbilden. Er ärgerte sich über sich selbst.
Da erblickte er den Steg dicht vor sich. Harda stand schon am andern Ufer, wo sich die Tür des Gatters befand, das am ganzen rechten Ufer hinlief und den Park der Villa abgrenzte.
Sie hatte die Tür geöffnet. Auf dem weißen Kleide spielten rötliche Strahlen der niedergehenden Sonne, grünlich schimmerten dagegen Haar und Schultern unter dem Widerschein des breiten Buchenlaubes, und die braunen Augen leuchteten ungeduldig aus dem mit der Hand beschatteten Gesicht, als sie ihm entgegenrief:
»Kommen Sie endlich, Herr Doktor? Hier müssen Sie noch hinüber, drüben an Ihrem Ufer geht kein Weg.«
Da stand sie wie eine lebendig gewordene Blume. Das Tor des Zaubergartens war geöffnet. Jetzt schloß es sich hinter dem Eingetretenen.
Einen Augenblick verharrte er unentschieden. Sollte er seine Ablehnung unter irgend einem Vorwande widerrufen?
»Wollen Sie direkt in die Kolonie?« fragte Harda. »Da gehen Sie am nächsten mit mir hier herauf an der Villa vorbei.«
»Nein,« antwortete Eynitz. »Ich muß zuerst in meine Wohnung.«
»Dann wandern Sie hier am Zaune entlang, aber langsam bergauf, da kommen Sie auf den Fahrweg, das Tor ist ja immer offen. Also –«
»Leben Sie wohl, gnädiges Fräulein, herzlichsten Dank. Über den Sternentau berichte ich, sobald ich klarer sehe.«
Harda reichte ihm die Hand und nickte mit dem Kopf.
»Adieu!« sagte sie und sprang den steilen Weg in den Park hinauf.
Er sah ihr nach, bis sie hinter den Bäumen verschwand. Dann ging er seinen Weg in Gedanken verloren. Es kam ihm vor, als wäre Harda nach seiner Ablehnung zurückhaltender geworden. War er ungeschickt gewesen?
Als er aus dem Gartentor herausschritt, rollte der Wagen des Kommerzienrats hinein.
Eynitz grüßte, dann warf er den Kopf in die Höhe und sprach bei sich:
»Nein, es wäre Torheit. Ich gehe nicht hin.«
Ebah, der Efeu
Am Riesengrabe spielte der Abendwind leicht in den Blättern der hohen Buche, unter ihr schwirrten kleine Fliegen und Käfer, Spinnen arbeiteten an Silberfäden, über den Boden raschelte eine Eidechse und im Grase zirpten die Grillen.
Das war alles, was der Menschen stumpfe Sinne vernehmen konnten. Aber zwischen Licht und Luft, Wasser und Erdreich bestrahlten, benetzten, berührten sich die zahllosen Zellen der Pflanzen in unerschöpflichen Einwirkungen. Alle bergen sie ihre Wurzeln und Würzelchen im gemeinsamen Bodenreich der Mutter Erde. Aus ihrer großen Einheit, wo aller Kräfteaustausch zusammenfließt, strömen die feinen Wandlungen der Stoffe zurück und werden wieder gespürt von Zellen und Blättern, von Kraut und Baum als die Regungen des gemeinsamen Ursprungs. In diesem weiten Felde von Wechselwirkung chemischer, elektrischer, mechanischer Spannungen pflanzt sich jede organische Veränderung gesetzlich fort, und jedes Organ nimmt nach seiner Eigenart die gebotenen Energien auf. Da werden die Gewächse ihres Lebens inne.
Die Seele des Planeten, die im Genius der Menschheit spricht wie im Flattern des werbenden Falters, wacht verbindend auch in den Pflanzen und leiht ihnen eine Sprache, die freilich für Menschensinne unverständlich bleibt.
Eine ganz leichte Änderung der Spannung in den Kletterwurzeln, womit der Efeu sich an die Rinde der Buche klammert, macht dem Baume den Zustand der Schlingpflanze unmittelbar verständlich. Dadurch sind beide Gewächse direkt verbunden und befreundet. Im übrigen verkehren alle Pflanzen mit einander durch Vermittlung des Erdreiches, und die Organe ihres Bewußtseinsaustausches sind die Wurzeln. Aber natürlich, auch die Pflanzen sind sehr verschiedenartig entwickelt und gestimmt; nicht alle verstehen sich und können sich mit einander verständigen.
Ebah, die Efeupflanze, die sich an der Buche emporrankte, hatte sehr aufmerksam all die leisen Einwirkungen aufgenommen, die durch Licht und Schall, Luft und Boden von der Anwesenheit Hardas zu ihr drangen. Durch das sanfte Berührungsspiel ihrer Haftwurzeln fragte sie die Buche:
»Die Treter sind wohl fort? Merkst du sie noch?«
»Nicht mehr, liebe Ebah,« antwortete die Buche in ihrer Art. »Sie streifen schon unten an den jungen Fichten vorüber.«
»Es war einer dabei, den ich noch nie gesehen habe,« bemerkte Ebah.
»Ich auch noch nicht. Aber Harda kannte ihn. Du wirst leicht erfahren können, wie die Menschen ihn nennen, wenn du mit deinen Sprossen sprichst.«
»Um Hardas willen möcht' ich's wissen,« sagte Ebah. »Sonst käme nicht viel darauf an. Ich wundre mich immer, daß sich die Treter so von einander unterscheiden; und man sagt doch, daß es ihrer so viele gibt.«
»Freilich. Wenn auch nicht so viele wie Buchen, aber doch sehr viele. Es waren aber auch Zeiten, da es erst wenige und andre gab, die wohnten bei uns im Walde.«
»Hast du die gekannt?«
»Ich bitte dich! Du weißt doch, daß wir Buchen nicht so alt werden. Schon viele Geschlechter von Buchen sind hier entsprossen und zertrümmert, seit der Gott entschlummerte und die alte Eiche stürzte.«
»Erzähle mir doch mehr von der alten Kunde. Wann höre ich alles?«
»Jetzt nicht, Ebah. Noch lacht die Sonne länger von Tag zu Tag, noch wacht der Wald im jungen Grün. Gedulde dich, bis die Tage sich kürzen. Lange wirst du nicht mehr zu warten brauchen.«
Ebah schwieg eine Weile, dann begann sie leise:
»Vernimmst du's, Schattende? Unten erzählen die Kräuter, der Treter habe viele von ihnen abgeschnitten und ausgegraben. Auch von der fremden Pflanze, meinem stummen Schützling, nahm er einige. Wir sahen sie ja auf dem Tische liegen. Sollen wir das dulden?«
»Kind, wir können's doch nicht hindern.«
»Ich begreift nicht, daß den Tretern das erlaubt ist. Sie sind doch dazu da, uns zu dienen.«
»Das gehört auch dazu, daß sie Nutzen von uns ziehen, wie wir von ihnen. Du solltest nicht immer so verächtlich von »Tretern« reden. Sie selbst nennen sich Menschen, und das halten sie für etwas sehr Gutes.«
»Was Gutes! Ohne uns könnten sie überhaupt nicht leben, so gut wie die andern Treter und Kriecher und Flieger, die sie Tiere nennen.«
»Freilich, aber sie könnten auch uns nicht dienen, wenn sie nichts von uns nehmen dürften.«
»Meinetwegen! Nur töten dürften sie uns nicht, ausreißen, daß wir sterben müssen wie die Pflänzchen dort auf dem Tische.«
»Sterben? Was heißt das für uns, Ebah? Der Mensch wohl kann getötet werden, weil er keine Dauerseele hat wie wir. Wir aber, wir sprossen doch weiter, wenn auch große Teile von uns zerfallen, ja wenn der ganze Einzelbaum hinsinkt. Was wir webten und fühlten im Sonnenlicht, das wirkt weiter im großen Wald und im dauernden Erdreich und in seiner Seele, zu der wir gehören.«
»Dann begreif ich's erst recht nicht,« sagte Ebah, »daß dem Menschen so viel Gewalt über uns gegeben ist. Oder – manchmal denke ich ja selbst, es muß etwas Besonderes sein, so für sich zu wachsen und zu wandern, ohne sich zu kümmern, wie die andern fühlen und gedeihen im Walde. Das muß wohl stark machen – vielleicht aber auch feindlich. Vielleicht ist der Mensch darum unser Feind? Denn er verfolgt uns doch, er tritt uns, er haßt uns. Soll ich ihn da nicht wieder hassen?«
»Auch Harda?«
»Nein, nein! Das ist freilich etwas anderes. Harda ist gut, ist kein Feind. Ich wünschte, sie gehörte nicht zu den Tretern – Menschen, wollte ich sagen. Ich nenne sie auch nicht so, ich nenne sie, wie sie sich selbst nennt, Harda.«
»Siehst du, daß du den Menschen vielleicht unrecht tust? Ich glaube, du hast manchmal zu viel auf das Geschwätz der unzufriedenen Fichten gehört. Gerade der Mensch, den du wirklich näher kennst, ist gut. Und wieviel Menschen kennst du überhaupt?«
»Gleichviel, um Hardas willen muß es mir leid tun, daß sie ein Mensch ist. Denn so hat sie doch keine Seele – ich meine, sie kann nicht weiterleben wie wir im unsterblichen Reiche Urd. Das kennen doch wohl die Menschen gar nicht?«
»Sie kennen es schon, sie nennen's Natur, aber sie halten es für tot, für unbeseelt«
»Wie dumm! Das kann Harda unmöglich glauben. Oder sie muß es besser lernen! Sie ist so gut – weißt du noch, Schattende, als der Treter mit der Axt in mich einschlug?«
»Freilich, meine arme Ebah, du weintest ja –«
»Nun, das war sicher ein schlechter Mensch, nicht wahr? Ein Feind, den ich hassen muß! Doch Harda kam zum Glück dazu. Wie sie den Treter schalt, wie sie ihn fortschickte! Sie hat mich gerettet. Aber eine tiefe Wunde hatte ich weg, und ein Zweig war mir abgehackt.«
»Die Wunde ist wieder geheilt, und der Zweig –«
»Ach ja, meine Hedo, meine liebe Hedo. Der Zweig wurde mein größtes Glück, und das danke ich auch Harda. Sie nahm den Zweig mit hinüber nach dem Garten, wo die vielen Zypressen stehen, drüben hinter dem Fluß. Dort pflanzte sie ihn auf einen kleinen Hügel, da schlug er Wurzel und wuchs, mein starker Sproß. Hedo nannte ich ihn, und mit den Jahren hat er den ganzen Hügel bedeckt und eingehüllt mit seinen Blättern. Hedo hat mir alles erzählt, sobald sie durch die Wurzeln sprechen konnte. Oftmals kommt Harda hin und ist traurig, wenn sie aber meine Tochter genetzt und den Hügel mit frischen Blumen geschmückt hat, da wird sie wieder froh.«
»Daran solltest du doch denken, Ebah! Was dir ein großes Übel erschien, das der Mensch tat, durch den Menschen wurde es zu deinem Glück, du hast eine Tochter –«
»Zwei habe ich ja! Auch die zweite, meine Kitto, verdanke ich Harda. Das war später. Wie lange ist es denn her? Zwei Sommer. Da war sie glücklich und fröhlich. Selbst suchte sie sich einen Zweig aus und schnitt ihn ab, und ich freute mich. Singend sprang sie mit dem Zweige davon. Den pflanzte sie ein, aber leider nicht draußen im Erdreich, sondern in einen Kasten in ihrem Zimmer, und als er wuchs, zog sie ihn um einen weißen Stein, der dort stand und aussieht wie der Kopf eines Menschen. Und Kitto kann nun Harda alle Tage sehen.«
»Wie glücklich bist du also!«
»Dankbar bin ich, denn ich selbst – ich habe ja noch nicht geblüht –«
»Um so besser für dich, daß du Sprossen besitzest.«
»Ach ja – aber blühen – es muß doch ganz etwas anderes sein, wenn man aus Samen herauswächst? Nicht wahr, ich bin aus Samen gewachsen? Du weißt es?«
»Ich weiß es, Ebah. Ich weiß es noch genau. Weiter oben im Walde, über dem Tale, liegt eine graue Ruine, ganz mit altem Efeu umwachsen. Dort steht deine Mutter. In jedem Herbste blüht der Efeu, und im Frühjahr trägt er schwarze Beeren. Und an einem sonnigen Frühlingsmorgen kam eine kleine Grasmücke, ein lustiges Vögelein, das trug eine Efeubeere im Schnäbelchen. Sie setzte sich auf einen meiner Zweige und knabberte. Der Samen aber fiel zwischen meine Wurzeln. Und daraus bist du hervorgesprossen und hast dich ausgedehnt, bis du mich ganz umsponnen hast, meine liebe Ebah. Und nun kannst du bald hinaussehen ins Freie.«
»Und blühen! Ja, Schattende, ich will blühen! Bin ich denn noch nicht hoch genug? Ich bin doch schon so alt. Nicht wahr, diesen Herbst, da werde ich blühen? Mir ist's so, als wüchsen mir oben schon spitzige Blätter, und ich fühle, die Sonne scheint darauf.«
»Du bist wacker heraufgekommen in den letzten Jahren, wir wollen hoffen, daß du's in diesem Jahre erreichst.«
»Und blühen, blühen!« Ebah rief's so recht aus innerster Tiefe heraus.
»Na, na, na! Bitte, etwas weniger lebhaft,« murrte die alte Fichte am Abhang. »Wenn du deiner Schattenden Geständnisse machst, so schreie nicht so, daß wir's hier unten hören.«
Von Schreien reden die Pflanzen, wenn die Unterhaltung über die Wahrnehmung der nächst Beteiligten hinausdringt, und das gilt für unanständig. Bei Ebahs Erregung hatten sich nicht nur die Haftwurzeln, sondern auch die Erdwurzeln beteiligt.
»Entschuldige, liebe Fichte,« sagte Ebah, »ich wollte dich nicht stören.«
»Ach was, stören! Meinetwegen blüh' du jedes Jahr dreizehnmal wie der Mond! Wenn dir's nur bekommt. Aber davon macht man kein Aufhebens.«
»Das glaub' ich dir,« mischte sich die Buche ein. »Es ist auch danach bei euch nacktsamigen Nadelhölzern! Wenn man keine Fruchtblätter hat –«
»Na, mit deinen grünen Kätzchen ist's auch nicht weit her! Übrigens, man wird ja sehen, wer's weiter bringt! Wir drängeln euch immer weiter zurück, ihr Laubbäume!«
»Und wir fürchten uns nicht vor euch, ihr Raubbäume! Aber wir wollen nicht streiten.«
»Mir ist's recht,« sagte die Fichte. »Ich will dir sogar einen guten Rat geben. Wenn du's mit dem Efeu gut meinst, so treib' ihn nicht zum Blühen. Warum hat er's denn so eilig damit?«
»Warum bist du denn unten erst so seitwärts gewachsen und hast dich gekrümmt, ehe du in die Höhe kamst?« antwortete der Efeu direkt.
»Weil ich zum Lichte will, vorlauter Efeu, und das Felsstück hier am Abhang mich daran hinderte. Aber ich kam darüber hinweg und brauche keine fremde Hilfe dazu, wie andere Leute.«
»Und warum wolltest du denn zum Lichte,« sagte die Buche. »Doch eben, weil du wachsen und blühen wolltest.«
»Was denkst du denn, was du daran besonderes haben wirst?« wandte sich die Fichte fragend an Ebah.
»Ich weiß es ja nicht recht. Aber ich meine, dann beginnt ein andres Leben, dann hält mich die Stelle nicht mehr hier, dann flieg' ich hinaus in den Raum und suche andre Orte, von denen mir hier nur berichtet wird.«
»Du fliegst hinaus?« rief die Fichte. »Täusche dich nicht, Efeu. Du bleibst hier wurzeln, nur die Früchtchen, die du etwa hervorbringst, die können dann wandern.«
»Sollt' ich da nicht selbst mit darin sein? Wo ist denn der Teil von mir, worin nicht meine ganze Seele ist? Stehen wir nicht überall im selben Zusammenhang? In jedem Zellchen leb' ich weiter, das ich erzeugt habe.«
»Eben darum, liebe Ebah,« bemerkte die Buche freundlich, »bedürfen wir auch nicht so unbedingt der Blüten und Früchte. Eben darum können wir uns gedulden, weil wir die Dauerseele haben.«