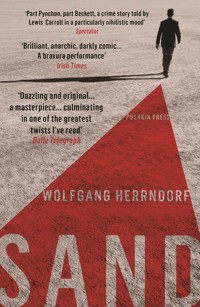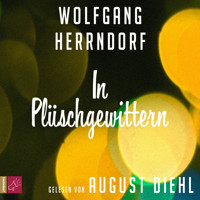Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass Unfertiges, Unvollendetes, gänzlich Unveröffentlichtes aus seinem Nachlass publiziert wird, wollte Wolfgang Herrndorf nicht. In seinem Testament verfügte er, solche Arbeiten seien zu vernichten. Daran haben die Erben sich gehalten. Es gibt aber eine Anzahl von Texten, die schon zu Herrndorfs Lebzeiten einen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatten, sei es abgedruckt an entlegenem Ort, sei es durch Lesungen, vor allem aber digital: Herrndorf war Mitglied des Internet-Forums «Wir höflichen Paparazzi», einem Verbund von Selbstdenkern und kreativen Menschen, aus dem inzwischen namhafte Autoren wie Kathrin Passig, Klaus Cäsar Zehrer oder Christian Y. Schmidt hervorgegangen sind. Das Forum war, so formuliert es Tex Rubinowitz, «eine beinharte stalinistische Schreibschule». Und alle, die dabei waren, sind sich einig: Am strengsten bei der Beurteilung eigener und fremder Texte war Wolfgang Herrndorf. Meist schrieb er unter dem Pseudonym «Stimmen». Der vorliegende Band präsentiert eine Auswahl, Texte, die mal an «In Plüschgewittern» erinnern, mal an «Tschick», mal an die magischen Erinnerungsfragmente aus «Arbeit und Struktur». Es gibt u.a. eine Fahrt mit einem gestohlenen Schrottauto über Land, nur sind es keine Jugendlichen und das Auto ist kein Lada; Herrndorf selbst verirrt sich nachts mit dem Fahrrad im Wald und klingt wie Isa auf ihren Wanderungen im Mondschein. Nichts findet sich hier, das nur Dokument oder Autorenreliquie wäre; alles ist Literatur, auch das unvollendet Gebliebene, wo es vom Autor selbst in die Tradition des romantischen Fragments gestellt wird. Ein Schatz für Wolfgang Herrndorfs Leser.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Herrndorf
Stimmen
Texte, die bleiben sollten
Über dieses Buch
Dass Unfertiges, Unvollendetes, gänzlich Unveröffentlichtes aus seinem Nachlass publiziert wird, wollte Wolfgang Herrndorf nicht. In seinem Testament verfügte er, solche Arbeiten seien zu vernichten. Daran haben die Erben sich gehalten. Es gibt aber eine Anzahl von Texten, die schon zu Herrndorfs Lebzeiten einen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatten, sei es abgedruckt an entlegenem Ort, sei es durch Lesungen, vor allem aber digital: Herrndorf war Mitglied des Internet-Forums «Wir höflichen Paparazzi», einem Verbund von Selbstdenkern und kreativen Menschen, aus dem inzwischen namhafte Autoren wie Kathrin Passig, Klaus Cäsar Zehrer oder Christian Y. Schmidt hervorgegangen sind. Das Forum war, so formuliert es Tex Rubinowitz, «eine beinharte stalinistische Schreibschule». Und alle, die dabei waren, sind sich einig: Am strengsten bei der Beurteilung eigener und fremder Texte war Wolfgang Herrndorf. Meist schrieb er unter dem Pseudonym «Stimmen».
Der vorliegende Band präsentiert eine Auswahl, Texte, die mal an «In Plüschgewittern» erinnern, mal an «Tschick», mal an die magischen Erinnerungsfragmente aus «Arbeit und Struktur». Es gibt u.a. eine Fahrt mit einem gestohlenen Schrottauto über Land, nur sind es keine Jugendlichen und das Auto ist kein Lada; Herrndorf selbst verirrt sich nachts mit dem Fahrrad im Wald und klingt wie Isa auf ihren Wanderungen im Mondschein. Nichts findet sich hier, das nur Dokument oder Autorenreliquie wäre; alles ist Literatur, auch das unvollendet Gebliebene, wo es vom Autor selbst in die Tradition des romantischen Fragments gestellt wird. Ein Schatz für Wolfgang Herrndorfs Leser.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-10080-0
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
I
Meine erste Freundin hieß Katharina Rage, ich war fünf Jahre alt. Wir wohnten im selben Treppenhaus. Im Flur hingen Briefkästen mit Hammerschlaglack, in denen wir mit Zweigen rumstocherten, bis die Post rausfiel. Ich stand dabei mit einem Fuß auf der Treppe. Auf der achten Stufe von unten war ein Totenkopf.
Rages wohnten zwei Stockwerke über uns. Als ich zum ersten Mal bei ihnen auf dem Balkon stand und von ganz oben über die Felder sah, wollte ich nicht mehr weg. Katharinas Mutter kämmte ihr die Haare. Sie waren lang und glatt, bevor sie gekämmt wurden, und sie waren lang und glatt hinterher. Ich wurde gefragt, ob ich auch gekämmt werden wollte. Ich küsste Katharina.
Jeden Tag waren wir draußen. Katharina durfte bis zum Zaun, ich durfte überallhin. Ich bekam auch nie eine Zeit mit, ich durfte alles. Bevor wir unter dem Stacheldraht durchkrochen, schaute Katharina sich um, dann liefen wir ins Kornfeld. Wir zerdrückten Erdklumpen mit Stöcken und schütteten einen Kaninchenbau zu. Der Himmel war von Licht gesprenkelt, die Bäume waren hoch, die Felder gelb. Das war jeden Tag so, es änderte sich nie.
Auch wenn meine Erinnerung mich trügt, kann es nur ein Sommer gewesen sein, in dem ich Katharina kannte. Wir hatten im Feld einen Puppenstuben-Blechherd gefunden. Ich besorgte Streichhölzer, und wir machten Feuer mit Gras und Zweigen und Vogelfedern und Draht und Lehm und Tannenzapfen. Nicht alles brannte, die Flammen leckten aus der runden Öffnung. Einmal berührte ich mit dem Finger den glühenden Herd, es war ein furchtbarer Schmerz. Wenn Katharina nicht hinsah, steckte ich den Finger in den Mund. Auch nach langer Zeit ließ der Schmerz nicht nach, und ich war mir nicht sicher, ob er mich nicht mein restliches Leben begleiten würde. Zum Abschied nahm ich Katharina in den Arm und versteckte meinen Kopf in ihren braunen Haaren, damit sie nicht sehen konnte, wie ich an meinem Finger lutschte.
Zu Hause hielt ich meine Hand in einen Plastikbecher mit kaltem Wasser und lief damit durch mein Zimmer. Meine größte Sorge war, dass meine Eltern den Becher bemerken könnten, bemerken könnten, dass ich durch eigene Dummheit für immer beschädigt war. Vor dem Einschlafen schob ich den Becher unter mein Bett, und als meine Mutter mich geküsst und das Licht gelöscht hatte, zog ich ihn wieder heraus. Mit dem Arm über der Bettkante schlief ich ein.
Am nächsten Tag zeigte ich Katharina meinen Finger. Sie zeigte mir ihren, der ebenfalls verbrannt war. Wir verglichen die glatten Fingerkuppen. Katharina sagte, sie habe es niemandem erzählt und ihre Hand den ganzen Abend in einen Eimer gehalten, und damit sei sie auch schlafen gegangen. Ich war überzeugt, dass wir eines Tages heiraten würden.
Als ich in die Schule kam, lernte ich Fridtjof kennen, der mein bester Freund wurde, und ich verlor Katharina aus den Augen. Wir wohnten noch mindestens zehn Jahre lang im selben Treppenhaus, ohne miteinander zu tun zu haben. Nur einmal wollte jemand wissen, wie Katharina und ich uns früher geküsst hätten. Ich demonstrierte es, alle lachten, und mir machte das nichts aus. Es war die letzte Berührung mit einem Mädchen, bis ich erwachsen war.
Die Leichtigkeit, mit der das Geschlechterverhältnis praktiziert wurde, konnte ich nie begreifen. Wenn Fridtjof zu Besuch war, fragte mein Vater oft – er fragte immer nur, wenn Fridtjof zu Besuch war –, ob ich denn schon eine Freundin hätte. Dann fragte er meinen besten Freund, und mein bester Freund erzählte manchmal von einem Mädchen, das er toll fand. Mein Vater antwortete jedes Mal, er habe in unserem Alter schon fünf Freundinnen gehabt. Es klang so, als sei es großartig, fünf Freundinnen zu haben, oder als sei das ein großer Witz. Ich verstand den Witz nicht. Mit sechs Jahren hatte ich noch keine sehr bildhafte Vorstellung von der Liebe, aber Mädchen machten genau den gleichen Eindruck auf mich wie zu jeder späteren Zeit. Ich mochte erwachsene Frauen, wegen ihres Körpers. Aber ich verliebte mich in ein Mädchen aus meiner Klasse. Sie hieß Susanne Lemke. Ich erzählte niemandem etwas davon, am wenigsten ihr selbst.
Ich habe sie genauso geliebt, wie ich als Erwachsener geliebt habe. Es war nichts Schlichtes oder Beiläufiges. Es war ein Sechzehn-Tonnen-Gewicht, das herunterfiel. Ich blieb in Susanne Lemke verliebt bis zum Ende der vierten Klasse, dann zog ihre Familie in eine andere Stadt, und ich kam aufs Gymnasium. Dort dachte ich noch ein Jahr an Susanne Lemke, dann verliebte ich mich in Martina Schleifheim, das dauerte bis zum Ende der Sechsten. Martina Schleifheim fehlte ein Finger an der linken Hand, den sie sich beim Schlittschuhlaufen abgefahren hatte. In der Siebten kam Caroline Metzger in unsere Klasse, eine Sitzenbleiberin. Sie hatte einen Busen, und ich war zwei Jahre lang in sie verliebt. In der Neunten liebte ich wieder Martina Schleifheim, die sich vollkommen verändert hatte. Zwischendurch verliebte ich mich im Urlaub in ein Mädchen aus Köln, das, glaube ich, Stephanie Gotterbarm hieß. Ab der Zehnten hieß meine Liebe Yvonne Mai. Mit keinem dieser Mädchen habe ich mehr als drei Sätze geredet.
1996 hatte ich mein erstes 56k-Modem. Ich suchte nach bekannten Namen und fand keinen einzigen. Es dauerte drei Jahre, bis einer aus meinem Abiturjahrgang im Netz auftauchte, und fünf Jahre, bis ich sein Foto entdeckte. Es war das Foto eines alten Mannes. Es musste viel Zeit vergangen sein. Auf ein Abiturtreffen bin ich nie gegangen, ich habe auch sonst allen Kontakt zu meinen Mitschülern verloren, aber im Netz suche ich regelmäßig nach ihren Namen, meistens, wenn ich deprimiert bin. Die Suche deprimiert mich dann noch mehr. Mehr als zehn Jahre nach der allgemeinen Verbreitung des Internets sind weniger als fünf Prozent meiner Jugendfreunde auffindbar. Wenn jemand auftaucht, hat er einen bis zwei Treffer in Form von Gästebucheinträgen mit gmx-Adresse. Beruflich scheinen die meisten in einem Psycho- oder Heilpraktikergewerbe gelandet zu sein. Von allen meinen Jugendlieben gibt es nur einen einzigen Treffer: Martina Schleifheim, eine Adresse bei Siemens. Von Katharina Rage habe ich nie wieder gehört.
Vor zwei Jahren erzählte meine Mutter mir, sie habe Frau Rage beim Einkaufen getroffen. Der Vater sei gestorben, Frau Rage nach Morsum gezogen, Katharina lebe in Berlin. Ich schaute im Berliner Telefonbuch nach, aber da ist sie auch nicht drin. Ich hoffe, dass kein Foto von ihr auftaucht. Der Tag im Kornfeld, bevor wir uns die Hand verbrannten, war in gewisser Weise der perfekte Tag.
Zu Beginn meiner Pubertät begann sich der Freundeskreis meiner Kindheit langsam aufzulösen, und es folgte nicht viel nach. Ich war oft allein, litt aber keine Langeweile. Nur meine Mutter muss um meine Entwicklung besorgt gewesen sein; sie unternahm allerlei Versuche, mir Spielkameraden zu besorgen. Ich hatte sie nicht darum gebeten, und es war grauenvoll. Schon als ich noch ganz klein war, sagte sie auf dem Spielplatz oder am Strand oder sonst wo, kaum dass wir angekommen waren, immer in dringlichem Tonfall: «Guck mal, da sind ganz viele Kinder. Vielleicht kannst du da mitspielen.» Das hatte ich meistens ohnehin vorgehabt, aber nach dieser Aufforderung wurde mir der sensible Prozess des Kennenlernens erschwert durch den Gedanken: «Hallo, ich soll hier mitspielen, weil es meine Mutter glücklich macht.»
In der Pubertät wurde alles anders, meine Mutter änderte ihre Strategie. Ob sie das tat, weil ich zu dieser Zeit vereinsamte, oder ob ich vereinsamte, weil sie die Strategie änderte, lässt sich nicht mehr so klar sagen. Jedenfalls plante sie Verabredungen für mich. «Ich habe dich zusammen mit Oliver Grmbrm (Name geändert) aufgehängt», eröffnete sie mir eines Tages im Tennisclub. (An einer grünen Tafel wurden die Namensmarken aufgehängt, um einen Platz zu reservieren. Ein verbindliches Ritual.) «Was?», rief ich, denn mir schwante Übles. Ich kannte keinen Oliver Grmbrm. Meine Mutter zeigte diffus in eine Richtung, wo gerade ein Spacken zusammen mit seiner Mutter das Gelände verließ.
«Auf gar keinen Fall», sagte ich. «Da geh ich nicht hin. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist.»
«Aber warum, vielleicht ist er doch ganz nett.»
«Vielleicht auch nicht! Und ist mir wurscht, ob er nett ist.»
«Aber jetzt haben wir euch schon aufgehängt.»
«Du hättest mich vorher fragen müssen!»
«Aber du warst gerade nicht da.»
«Nein! Nein! Nein!» etc.
Dabei war mir damals schon klar, wie solche Dinge zustande kamen. Meine Mutter und Frau X saßen auf der Terrasse und unterhielten sich über ihre Söhne. Sagt die eine: Er hat ja nicht viel Freunde. Sagt die andere: Oh, meiner auch nicht! Der Rest war reine Formsache, und das Ergebnis lautete: Samstag, acht Uhr früh, Tennisspielen mit Oliver Grmbrm.
Oliver Grmbrm war mir auf Anhieb unsympathisch, ein kontaktgestörter Dreizehnjähriger, hühnerbrüstig, ergeben, nerdisch, mein Spiegelbild, und ich dachte, gut, bringen wir die Peinlichkeit hinter uns, sieht ja keiner. Wir spielten ein paar Bälle übers Netz, und nach wenigen Sekunden ging Oliver Grmbrm auf seiner Seite in die Knie, krabbelte wie ein Hund die Grundlinie entlang und verharrte dort. Ich stand auf der anderen Seite des Platzes und sah mir das an. Dann rief ich: Was machst du da? Und Oliver Grmbrm bedeutete mir stumm, rüberzukommen. Ich weigerte mich. Er verharrte. Nach fünf Minuten ging ich auf die andere Seite. Mein neuer Spielgefährte sah mich an, senkte dann seinen Kopf und schien irgendetwas mikroskopisch Kleines zu beobachten, das zwischen seinen beiden Händen als schwarzer Punkt die Grundlinie entlangkrabbelte.
«Ein Sowieso-Sowieso-Käfer», sagte Oliver Grmbrm zu mir.
«Und, können wir jetzt weiterspielen?», sagte ich.
Aber das war nicht das Schlimmste daran. Das Schlimmste, der Albtraum, war die Pubertätserkenntnis, dass es einen Grund haben musste, warum es immer nur diese Trottel waren, mit denen ich verbandelt wurde, und niemals coole Kinder. Dass mich von diesen Trotteln vermutlich nicht viel unterschied. Nur behämmerte Kinder werden von ihren Müttern mit anderen behämmerten Kindern zwangsbefreundet. Das Einzige, was mir auffiel, war: Mir war das furchtbar unangenehm. Oliver Grmbrm nicht. Vielleicht hat mich das gerettet. Im Nachhinein ist das Ganze auch meiner Mutter peinlich.
Ich bin verliebt in Sabine Namegeändert, von der ersten Klasse an. Sie ist die Schönste und die Beste. Ich bin so verliebt in sie, dass ich nicht mit ihr rede, nur mit ihren Freundinnen. Eines Tages auf dem Nachhauseweg prügelt Sabine sich mit Gabi. Ich bin überrascht, es passt nicht zu Sabine. Gabi ist sportlicher, eigentlich müsste sie auch stärker sein, aber Sabine schlägt sich gut. Es gibt keine Siegerin, nur verzerrte Gesichter. Corinna macht mir gegenüber Andeutungen, es sei um wichtige Dinge gegangen. Ich verstehe die Andeutungen nicht. Überhaupt habe ich einen Widerwillen gegen diesen mädchenhaften «Oh, ich kann es dir nicht sagen»-Scheiß.
Zum Ende der Grundschulzeit machen wir eine Klassenfahrt nach Fehmarn. Es gibt eine strikte Mädchen-Jungen-Trennung. Am letzten Tag eine Party, es wird getanzt. Tanzen liegt mir nicht. Alle stehen allein auf der Tanzfläche und treten von einem Fuß auf den anderen. So was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo sie das herhaben. Schließlich halte ich es nicht mehr aus, wie sich alle amüsieren, und gehe aufs Zimmer. Ich sehe im dunklen Fenster die Ostsee, Positionslichter von Schiffen. Die Abende zuvor haben wir mit unseren Taschenlampen stundenlang SOS gemorst, und irgendjemand hat irgendwann behauptet, dass die Schiffe das Signal zurücksenden, und wir gerieten in Panik, und das nächste Spiel war, einen Aufruhr der christlichen Seefahrt herbeizuhalluzinieren.
Irgendwann kommt Corinna und sagt, ich soll runterkommen. Sabine will mit mir tanzen. Ich sage: Ich kann nicht tanzen. Das zeigt sie dir dann schon, sagt Corinna.
Sabine steht auf der Tanzfläche und sagt, du musst die Arme auf meine Hüften legen. Nicht da, wo sind denn die Hüften? Dann legt sie ihre Arme um meinen Hals. Zwischen uns ein halber Meter. Woher weiß sie, wie man das macht, denke ich. Meine Hände schwitzen, und ich bewege sie keinen Millimeter von dort, wo Sabine sie hingelegt hat. Das Lied dauert drei Minuten, danach setze ich mich wieder in die Ecke. Ich habe nie herausgefunden, was das zu bedeuten hatte.
Bauer Peine war der Eigentümer der Kornfelder, die wir als Kinder immer verwüsteten. Er hat nie geschimpft, überhaupt nie gesprochen, fuhr immer nur stoisch auf seinem Trecker an uns vorbei.
Renate Peine ging in meine Klasse. Sie sah nicht gut aus und war nicht charmant. Auf dem Schulweg zeigte sie mir einmal, was sie mit den Armen konnte: Hände vor dem Bauch falten, dann durchgestreckte Arme über den Kopf auf den Rücken. Obwohl ich ein guter Turner war, konnte ich das nur mit einem zwanzig Zentimeter langen Seil zwischen den Händen.
Einmal besuchte ich Renate auf dem Bauernhof. Wahrscheinlich zum Spielen, aber ich weiß es nicht mehr, es ist kein Bild hängengeblieben. Nur der Gestank. Im Haus stank es wie in einem Misthaufen (oder was heißt: wie), gemischt mit stickigem Essensgeruch aus der Küche. Ich flüchtete und kam nicht wieder. Irgendwann wurden Renate und ihr kleiner Bruder von einem Auto überrollt. Der Bruder starb, Renate überlebte und blieb lernbehindert, 60 oder 70 Prozent. Das erzählte uns unsere Grundschullehrerin wenige Tage, bevor Renate aus dem Krankenhaus zurückkehrte, damit wir sie nicht auslachten (gute Idee).