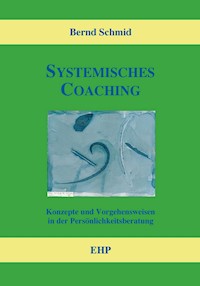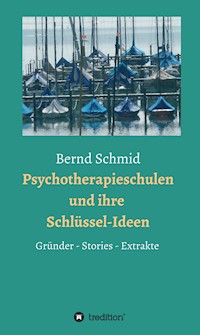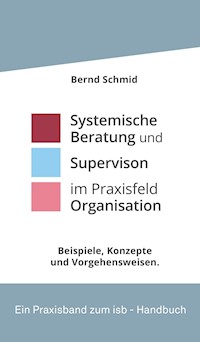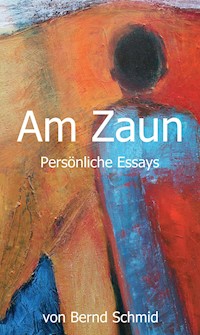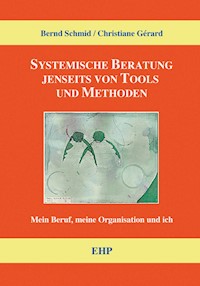
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHP Edition Humanistische Psychologie
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: EHP - Handbuch Systemische Professionalität und Beratung
- Sprache: Deutsch
Wie kann mit Menschen für Menschen gewirtschaftet werden? Wie können Organisationen dafür gestaltet werden? Wie können Menschen als Professionelle und in Organisationsfunktionen sinnvoll handeln? Welche Haltungen und Kompetenzen braucht es dafür? Wer muss was wie lernen, und wie soll Lernkultur sein, dass sie zu einer humanen Organisations-, Professions- und Wirtschaftskultur beiträgt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EHP – HANDBUCH SYSTEMISCHE PROFESSIONALITÄT UND BERATUNG
Hg. Bernd Schmid
Autor und Autorin:
BERND SCHMID, Dr. phil., (Jg. 1946), studierte Wirtschaftswissenschaften (Universität Mannheim) und promovierte in Erziehungswissenschaften und Psychologie; Gründer und Leiter des ISB-Wiesloch; Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft; Preisträger des Eric Berne Memorial Award 2007 der Internationalen TA-Gesellschaft ITAA und des Wissenschaftspreises 1988 der Europäischen TA-Gesellschaft EATA; Mitgründer und Vorsitzender des Präsidiums des Deutschen Bundesverband Coaching DBVC; Beirat und Kolumnist der Zeitschrift Konfliktdynamik; Mitbegründer der Zeitschrift Profile. Internationale Zeitschrift für Veränderung, Lernen, Dialog / International Journal for Change, Learning, Dialogue; Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher; Texte, Audios und Videos zum kostenlosen Download: www.isb-w.de; Blog: www.blog.bernd-schmid.com; www.bernd-schmid.com.
CHRISTIANE GÉRARD, Jg. 1948, hat als Verhaltenstherapeutin, Transaktionsanalytikerin und Neuropsychologin 25 Jahre in einem neuropädiatrischen Krankenhaus gearbeitet. Als ehemalige Ausbildungsschülerin von Bernd Schmid hat sie eine systemische Sichtweise von Hirnschädigung entwickelt und dazu mehrfach veröffentlicht.
© 2012 EHP – Verlag Andreas Kohlhage, Bergisch Gladbach
www.ehp-koeln.com
Redaktion: Ingeborg Weidner
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagentwurf: Gerd Struwe
– unter Verwendung eines Bildes von Peter Schmid (1984-2001): ›o.T. V.‹ –
Satz: MarktTransparenz Uwe Giese, Berlin
Gedruckt in der EU
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.
eBook-ISBN 978-3-89797-538-5
eBook-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
2. »Unter uns«
2.1 Vorbemerkung
2.2 Dialog zwischen den Autoren
2.3 Und Sie? Ein Fragebogen zur persönlichen Orientierung
3. Mensch und Beruf – ein Überblick
3.1 Menschen im Beruf
3.2 Menschen in Organisationen
3.3 Professionelle Persönlichkeitsentwicklung
3.4 Kernfragen der Ökonomie
3.5 Integrierende Perspektiven
3.6 Passung
3.7 Umgang mit Überkomplexität
3.8 Unternehmen und Organisationen
3.9 Kulturentwicklung in Organisationen
3.10 Die systemische Perspektive
3.11 Persönliche Orientierung
4. Mensch und Professionalität
4.1 Der Beruf als Unternehmen
4.2 Neue Professionen
4.3 Professionalisieren
4.4 Systemische Professionalität
4.5 Beruf als Lebensform
4.5.1 Gestiegene Anforderungen
4.5.2 Einstieg ins Berufsleben
4.5.3 Orientierungshilfen
4.5.4 Jenseits der Lebensmitte
4.5.5 Seniorexperten
4.5.6 Beruf als Lebensinhalt
4.6 Professionelle Kompetenzen
4.7 Beratermarktübung
4.8 Kompetenzperspektiven
4.8.1 Fachkompetenz
4.8.2 Feldkompetenz
4.8.3 Marktkompetenz
4.8.4 Netzwerkkompetenz
4.8.5 Sichtbarkeit und Originalität
4.8.6 Sensibilität und Robustheit
4.8.7 Weltläufigkeit und Bodenständigkeit
4.8.8 Kulturkompetenz und die Metaperspektive
4.9 Wieslocher Kompetenzformel
4.10 Professionelle Persönlichkeitsentwicklung
4.11 Persönliche Orientierung
5. Mensch und Organisation
5.1 Zentrale menschliche Motive
5.1.1 Etwas bewegen
5.1.2 Bewegt sein
5.1.3 Sich bewegen
5.1.4 Organisation und Ich
5.2 Kernfragen der Ökonomie
5.2.1 Wirtschaften
5.2.2 Wettbewerb
5.2.3 Wachstum
5.2.4 Leistung
5.3 Einige Organisationsperspektiven
5.3.1 Unternehmertum
5.3.2 Strategie und Führung
5.3.3 Übersicht und Detailkenntnisse
5.3.4 Ganzheitlichkeit und Partialoptimierung
5.3.5 Integrationsfähigkeit statt Polarisierung
5.3.6 Distanz und Engagement
5.4 Wenn Organisationen desintegrieren?
5.4.1 Entstehung von Krisen
5.4.2 Meist trifft es die Falschen
5.4.3 Was kann getan werden?
5.4.4 Kultur – ein verderbliches Gut
5.5 Verantwortungskultur
5.5.1 Drängende Fragen
5.5.2 Auf der Suche nach der verlorenen Verantwortung
5.5.3 Eine Metapher
5.5.4 Eine Herausforderung im Alltag
5.5.5 Eine Integrationsleistung
6. Wie man sich als Professioneller persönlich entwickelt
6.1 Professionelle Individuation
6.1.1 Spielräume
6.1.2 Intuition und innere Bilder
6.1.3 Persönliche Orientierung
6.2 Selbstempfinden und Identitätsbeschreibungen
6.2.1 Wie bin ich?
6.2.2 Sind wir viele?
6.2.3 Zwar verschieden, aber immer derselbe!
6.2.4 Jeder ist anders
6.2.5 Sich gegenseitig vorstellen
6.2.6 Rahmenvereinbarungen auf Augenhöhe
6.2.7 Wie beschreibe ich mich?
6.2.8 Wie beschreibe ich mich in Beziehungen?
6.2.9 Metabetrachtungen
6.2.10 Intuition und Spiegelung
6.2.11 Flyerarbeit
6.2.12 Persönliche Orientierung
6.3 Persönlichkeit im beruflichen Kontext
6.3.1 Scheitern – ein Beispiel
6.3.2 Persönlichkeit als Ichzustände und deren Verknüpfungen
6.3.3 Umgang mit psychischen Belastungen im Beruf
6.3.4 Rollen, Welten und Kompetenzen
6.3.5 Gesundheit und Kultur
6.4. Individuation und Persönlichkeit als Erzählung
6.4.1 Berufsbezogene Sinnerzählungen
6.4.2 Die Theatermetapher
6.4.3 Das biographische Interview
6.4.4 Konzeptionelle Überlegungen
6.4.5 Zur Konzeption von Persönlichkeit
6.4.6 Persönlichkeit und schöpferische Begegnungen
6.4.7 Konsequenzen für die Beratung
6.4.8 Beratungsbeispiel mit der Theatermetapher
6.5 Lebensinszenierungen
6.5.1 Eine Geschichte
6.5.2 Wirklichkeit ist Beziehungswirklichkeit
6.5.3 Man kann nicht nicht inszenieren
6.5.4 Zweierlei Narzissmus
6.5.5 Die eigene Story
6.5.6 Gemeinsam eine Geschichte erzählen
6.5.7 Sinnstiftende Schlüsselerzählungen
6.5.8 Lebensentwürfe und kreative Anpassungen
6.5.9 Als WER und WIE leben?
6.5.10 Persönliche Orientierung
6.6. Entwicklung der professionellen Identität
6.6.1 Entwicklungsstufen – nach Erik Erikson
6.6.2 Hilfe bei Identitätsfragen
6.6.3 Weitere Beispiele
6.6.4 Identität und Identifizieren
6.6.5 Identitätsdebatten in Berufsfeldern
6.6.6 Entwicklungsfragen in Aus-, Weiterbildung und Supervision
6.6.7 Persönliche Orientierung
6.7 Entwicklung von professionellen Haltungen
6.7.1 Einleitung
6.7.2 Das Stufenmodell von Lenhardt
6.7.3 Weiterentwicklung des Stufenmodells
6.7.4 Entwicklung professioneller Haltungen
6.7.5 Professionalitätsschulen und Sektenbildung
6.7.6 Persönliche Orientierung?
6.8. Professionelle Essenz – eine Metapher
7. Professionelle und ihre Wirklichkeiten
7.1 Milieu – ein wenig beachteter Faktor
7.1.1 Einleitung
7.1.2 Eine Geschichte
7.1.3 Was meint Milieu?
7.1.4 Milieu, Anlagen und Kompetenzen
7.1.5 Passungsprobleme und Lösungsrichtungen
7.1.6 Milieu und professionelle Qualifizierung
7.1.7 Milieu-Beheimatung und Milieu-Mobilität
7.1.8 Milieus und gesellschaftliche Klassen
7.1.9 Gläserne Zäune und Milieu-Aufstieg
7.1.10 Beratermilieus und Tabus
7.1.11 Es geht um Ent-Tabuisierung
7.1.12 Persönliche Orientierung
7.2 Störungen und Störungsbeseitigung
7.2.1 Vorstellungen von Störungen und Heilsein
7.2.2 Realität und Autonomie
7.2.3 Gestörte Wirklichkeiten und Veränderung durch Störungen
7.2.4 Psychoanalytisch orientierte Ansätze
7.2.5 Verhaltenstherapeutisch orientierte Ansätze
7.2.6 Familientherapeutische Ansätze
7.2.7 Der Systemische Ansatz
7.2.8 Hypnosystemische Ansätze
7.2.9 Störungen aus Sicht der Analytischen Psychologie
7.2.10 Was ist dann Heilung?
7.2.11 Persönliche Orientierung
7.3 Wirklichkeitserzeugung in Therapie und Beratung
7.3.1 Eine Übung
7.3.2 Die Entstehung gemeinsamer Wirklichkeit
7.3.3 Intuition als Beurteilungsvorgang
7.3.4 Informationsbegriff des Systemischen
7.3.5 Intuition als Information
7.3.6 Wirklichkeitsfinden
7.3.7 Verantwortung für Wirklichkeit?
7.4 Weitere Perspektiven professioneller Entwicklung
7.4.1 Ist Entwicklung machbar?
7.4.2 Entwicklungsstreben
7.4.3 Suche und Sucht
7.4.4 Entwicklungsfreundlichere Gangarten
7.4.5 Persönliche Orientierung
8. Drei Thesenpapiere
8.1 Charisma und Professionalität
8.1.1 Ausgangslage
8.1.2 Was können Fachleute für Professionalisierung tun?
8.1.3 Die Zusammenhänge mit anderen Worten
8.2 Professionalität und Ehrenamt
8.3 Kybernetischer Humanismus
8.3.1 Eine Hinführung
8.3.2 99 Thesen zum Integrativen (kybernetischen) Humanismus
9. Literatur
10. Veröffentlichungen von Bernd Schmid
Vorwort
Nun erscheint der Band über »Professionalität« vor dem angekündigten Band über »systemische Lernkultur«. Für beide liegen schon länger Rohmanuskripte vor. Doch will gut Ding eben Weile haben. Diesen Band konnten wir erst jetzt rund machen, da Christiane Gérard ihr Berufsleben abgeschlossen und Bernd Schmid – nun 65-jährig – wesentliche Funktionen in die Hände anderer gegeben hat, um sich auf neue Horizonte hin auszurichten.
Der Band über systemische Lernkultur wird nach weiterer Reifung folgen.
Zu den Themen, die uns am Herzen liegen, gibt es viel mehr wertvolle Veröffentlichungen anderer als wir berücksichtigen konnten. Für mehr hat die Kraft nicht gereicht. Wir bitten, uns das nachzusehen. Doch haben wir nach bestem Wissen deutlich gemacht, was wir von anderen übernommen haben. Dass wir viele Querverweise auf eigene Schriften machen, hat weniger mit Eitelkeit zu tun als mit dem Versuch aufzuzeigen, wie die jeweiligen Ausführungen mit anderen Zweigen der sich vielfältig entwickelnden Kultur des Wieslocher Instituts in Beziehung stehen.
Wir danken dem Verleger Andreas Kohlhage für seine Geduld und sein unvermindertes Engagement auch anspruchsvollen Vorhaben gegenüber. Unser Dank gilt auch allen Mitwirkenden im ISB-Wiesloch, die erst den Freiraum geschaffen haben, in dem gemeinsame Reflexionen zu Texten werden konnten. Insbesondere danken wir Ingeborg Weidner, die seit Jahren unsere Schriften betreut und auch diesmal Text, Fußnoten und Literaturhinweise in eine verlagstaugliche Form gebracht hat.
Bernd Schmid / Christiane Gérard
Wiesloch im Dezember 2011
1. Einleitung
Hinter jedem Beruf beziehungsweise jeder beruflichen Tätigkeit steht ein Verständnis von Professionalität. Ebenso hinter jeder Rolle bzw. jeder Funktion in einer Organisation. Typischerweise werden zur Beschreibung professioneller Positionierungen und Vorgehensweisen zunächst Attribute gewählt, die etwas mit den Zielen der Tätigkeit, den bevorzugten Inhalten, den dabei verwendeten Konzepten und Methoden, den bevorzugten Settings und Inszenierungsweisen und so weiter zu tun haben. Diese Themen wurden in den ersten Bänden des EHP-Handbuchs Systemische Professionalität und Beratung ausführlich behandelt. Dieser Band hingegen fokussiert vermehrt übergeordnete Beschreibungen und Ausleuchtungen von Hintergründen.
Oft bietet erst das Abtasten solcher Hintergründe die Chance auf ein umfassendes Verständnis von Professionalität, eingewoben in vielschichtige Zusammenhänge und Sinnerzählungen. Dafür brauchen wir Betrachtungsperspektiven – metaphorisch gesprochen: Scheinwerfer – mit deren Hilfe wir Innen- und Außenwelten, gesellschaftliche und geistige Sphären ausleuchten können. An solchen Ausleuchtungen haben fast alle Professionellen im Laufe ihrer Entwicklung immer wieder Interesse, wenn sie mit einem Erkenne-dich-Selbst verbunden sind. Da sich viele Professionen aber auch mit dem Verstehen und Entwickeln der Professionalität anderer befassen, brauchen sie solche Scheinwerfer auch für das Ausleuchten der Hintergründe ihres Gegenübers beziehungsweise der Zusammenhänge, in denen die Arbeit stattfindet.
Solche Scheinwerfer richten sich auf die handelnden Menschen, ihre Biografien, ihre Eigenarten und Bestimmungen, auf die Milieus, denen sie entstammen und in denen sie sich bewegen. Sie beleuchten die Bedürfnisse nach einem Sinn, die auch im Berufsleben gestillt werden sollen, und Identitäten und Kulturzugehörigkeiten, die helfen, sich zu positionieren. Sie erfassen Entwicklungen, zu denen man umgekehrt selbst beiträgt, wenn auch nur in bescheidenem Maße. In den Blick kommen Zugehörigkeiten zu Schulen, professionellen Gemeinschaften und die dort repräsentierten Wirklichkeitsverständnisse und Betrachtungsweisen. Da es nach Adorno kein richtiges Leben im falschen gibt, erfordern solche Betrachtungen auch eine Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, mit Märkten, Organisationen, Strömungen im Zeitgeist und mit den Formen von Wirtschaften, mit denen jede Lebensführung unauflösbar zusammenhängt.
Wie also kann mit Menschen für Menschen gewirtschaftet werden? Wie können Organisationen dafür gestaltet werden? Wie können Menschen als Professionelle und in Organisationsfunktionen sinnvoll handeln? Welche Haltungen und Kompetenzen braucht es dafür? Wer muss was wie lernen und wie soll Lernkultur sein, dass sie zu einer humanen Organisations-, Professions- und Wirtschaftskultur beiträgt? Da kann einem schon schwindlig werden, wenn man erkennt, wie vielschichtig und vielfältig die Zusammenhänge und Betrachtungsweisen sind, die zu einer geläuterten Professionalität gehören. Sich mit dem allem auseinanderzusetzen ist ein lebenslanger Prozess.
Die meisten Leser kennen vermutlich den magischen Würfel, ein Geduldsspiel, bei dem man durch das Drehen verschiedener Reihen oder Spalten jede Würfelseite so verändern soll, dass am Ende jede Seite eine einheitliche Farbe hat. Bei jeder Drehbewegung auf der einen Seite werden gleichzeitig die Muster der anderen Seiten mitverstellt. Um die Seiten also aufeinander abzustimmen, muss man immer wieder seine Perspektiven verändern. Der Hintergrund wird zum Vordergrund gemacht, oben wird mit unten getauscht, die linke Seite wird zur rechten und umgekehrt, so lange, bis man eben ein stimmiges Muster über alle Dimensionen hinweg bilden kann. Und so ähnlich arbeiten wir in diesem Buch. Stand beispielsweise soeben die Organisation im Vordergrund, so behalten wir das Gesagte im Hinterkopf, drehen aber den Würfel und blicken nun auf den Vorgang der professionellen Individuation.
Über allem steht die Frage, wie Menschen im Beruf und in ihrer Organisation die einzigartige Persönlichkeit verwirklichen können, die in ihnen steckt. Dies gilt zumindest für Berufe und Tätigkeiten mit hohem kreativem Anteil. Nicht immer stammen die illustrierenden Beispiele aus den jeweils vertrauten Berufsbereichen der Leser. Doch glauben wir, dass sich die jeweiligen Betrachtungen auf Beratung und Entwicklung von Professionalität allgemein anwenden lassen. Professionalität und Ansichten über Professionalität haben neben allen fachlichen und gesellschaftlichen Perspektiven eben auch mit den Wesenszügen des jeweiligen Menschen und mit Aspekten seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte zu tun. Zumindest scheinen diese als Hintergründe immer durch und entscheiden oft, ob sich die Seele für das berufliche Tun interessiert, ob man Bereicherung erlebt oder nicht.
Zur Einstimmung geben wir den Lesern zunächst die Möglichkeit zur persönlichen Begegnung mit uns, den Autoren. Sonst bietet dieser Band Streiflichter aus unseren Welten, um die Leser zu inspirieren und um die Möglichkeit zu eröffnen, sich – über die wichtigen Vordergründe hinaus – mit ihren hintergründigen Fragen an Professionalität auseinanderzusetzen. Fangen wir also im folgenden Kapitel mit einem eher persönlichen Gespräch zwischen den Autoren an. »Programmatischer« geht es dann ab Kapitel 3 weiter.
2. »Unter uns«
2.1 Vorbemerkung
Ich, Christiane Gérard, kenne Bernd Schmid nunmehr seit 25 Jahren, seit ich 1984 meine Transaktionsanalyse-Ausbildung in seinem Institut begonnen habe. Auch nach meinem klinischen TA-Examen 1989 blieben wir durch gemeinsame Interessen und Neigungen bis heute miteinander verbunden.
Wir blicken beide auf jeweils mindestens 30 Jahre Berufstätigkeit in den Bereichen Beratung und Psychotherapie und dazugehörender Erwachsenenbildung zurück. Wir befinden uns beide in einer Lebensphase, in der das Bedürfnis wächst, die Essenz der vergangenen Berufsjahre zu überdenken und anderen zum Nachdenken anzubieten. Dabei passen unsere Reflexions- und Erzählweisen in vielerlei Hinsicht zusammen oder ergänzen sich.
Wir sind uns bewusst, dass die Arbeitsbedingungen und Arbeitslebensweisen der Leser sich von den unseren stark unterscheiden können. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass sie von unseren Anregungen profitieren können. Und auch wir Autoren unterscheiden uns trotz aller Übereinstimmungen in mancher Hinsicht und bilden damit selbst eine Spanne möglicher Betätigungsfelder und persönlicher und institutioneller Voraussetzungen ab:
Bernd Schmid arbeitete bzw. arbeitet vorwiegend freiberuflich in vielfältigen Rollen als Erwachsenenbildner, Supervisor, Berater, Unternehmer und Leiter seines eigenen Weiterbildungsinstituts in Wiesloch, Orientierungsgeber, Gesprächspartner für seine MitarbeiterInnen, Buchautor, Vortragender auf Kongressen und ist aktiv in Hochschulen und Verbänden. Ich war dagegen immer angestellt und arbeitete zuletzt 25 Jahre lang als Neuropsychologin und Psychotherapeutin in einer Kinderklinik – halbtags.
Wir beide haben recht unterschiedliche Lebensinszenierungen, denen unterschiedliche Lebensentwürfe zugrunde liegen. Lebensentwürfe sind geprägt
• von der Wesensart,
• von Talenten und Ambitionen,
• von Ausstattungen und Aufträgen durch die Familie,
• vom Lebensgefühl und von den Lebensstilen der Milieus, in denen man aufgewachsen ist und in denen man sich später bewegt,
• durch prägende Lebenserfahrungen, die oft in Schlüsselerlebnissen und inneren Bildern verdichtet sind. (Schmid 2008d)
Auch wenn sich Menschen oberflächlich betrachtet in gleichen Berufen oder Funktionen bewegen und sich z. B. als Psychotherapeuten, Berater, Bildungsfachleute, Führungskräfte oder Unternehmer bezeichnen, so stecken hinter diesen Titeln doch oft sehr unterschiedliche Lebensinszenierungen. Das trifft bei uns beiden Autoren ebenso zu. Das folgende Gespräch zwischen uns – spontan aufgezeichnet, stark gekürzt, bearbeitet und ergänzt – soll die Leser zu ähnlicher Selbstreflexion einladen. Wir stellen uns Fragen, die uns, manchmal unterschiedlich stark, während unseres Werdegangs und jetzt in der Lebensphase des bilanzierenden Rückblickens beschäftigt und/oder die wir häufig als Fragestellungen bei Kollegen und Kolleginnen vernommen haben.
2.2 Dialog zwischen den Autoren
CHRISTIANE GÉRARD: Wir beide schauen auf eine lange und reiche Berufszeit zurück. Angenommen, du könntest noch einmal darüber entscheiden: Würdest du diesen Berufsweg wieder so einschlagen oder würdest du etwas anders machen, und wenn ja, was?
BERND SCHMID: (…) Ursprünglich wollte ich ja mal Lehrer werden. Aber nach meinem ersten Schulpraktikum wurde mir klar, dass ich nicht Schullehrer werden wollte. Und zwar nicht wegen der Schüler, sondern weil ich im Praktikum das Lehrerkollegium wie eine Versammlung Untoter erlebt habe. Und da habe ich entschieden: Ich will nicht mit solchen Zombies in einem solchen Raum sitzen. Also war für mich klar, dass ich nicht in die Schule gehe. Lehrer wollte ich aber gerne werden. Die Alternative war dann Hochschullehrer. Ich war ja schon früh Assistent an einem Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre. Diese Alternative war dann aber deswegen wiederum nicht möglich, weil ich für diese zumindest damals sehr traditionelle Disziplin mit meinen psychologischen Interessen ein zu »bunter Hund« war. Ich wurde über viele eigene Bewegungen und Wechselfälle des Schicksals (Schmid 1992, 2001c) das, was ich geworden bin, und heute wüsste ich nicht, was ich beruflich ändern sollte. Im Nachhinein schien sich alles zu fügen.
CG: Du sagst also, das bin ich, das war ich und das will ich auch weiter sein.
B.: Ja, ich habe ja immer alles mit großem Engagement gemacht, war damit sehr identifiziert und habe daraus auch immer viel Kraft geschöpft. Auf der anderen Seite gab es auch Bereiche, in denen ich mich versucht habe, die mal besser und mal schlechter gingen, letztlich aber nicht wirklich gepasst haben, wie z. B. Vortragsreden vor einem größeren, mir unbekanntem Publikum.
CG: Du hast mal erzählt, dass du als Kind gerne als Zauberer oder Zirkusdirektor das Publikum zum Staunen bringen wolltest. Ich hätte daher erwartet, dass dir Auftritte vor einem Publikum liegen. Was hat da nicht gepasst?
BS: In kleinerer Manege ist mir das meist gut gelungen. Doch wäre ich auch gerne in großer Manege besser zur Geltung gekommen. Aber dafür war ich vielleicht nicht extravertiert genug. Während befreundete Kollegen auf der Bühne erst richtig in Fahrt kommen und den Stecker in der Steckdose zu haben scheinen, haben solche Auftritte meinen Akku strapaziert. Ich habe mich auch oft zu mehr Extraversion genötigt als wirklich für mich gestimmt hat. Dieses Bemühen hat zwar meine Persönlichkeit erweitert, aber ich bin heute ganz froh, dass ich jetzt mehr Introversion leben kann und nicht so oft auf die Bühne gehe. Wenn meine Institutskollegen in der Gruppe oder beim Kunden präsentieren, kann ich an meinen Schreibtisch gehen und trotzdem eine Rolle in dem Zirkus haben.
CG: Du meinst in deinem Institut? Und dort hast du die Mitwirkenden ausgebildet, betreust sie und stärkst das Kraftfeld mehr hinter den Kulissen?
BS: Genau, ich bin jetzt mit allem eng verbunden, bin wichtig und bringe meine Erfahrung und meine Kreativität ein, muss aber nicht mehr Auditorien bei Laune halten.
CG: Wie meinst du das?
BS: Als Lehrtrainer muss man neben hoher Fachlichkeit dafür sorgen, dass sich eine Gruppe wohl und gut unterhalten fühlt, weil das fürs Lernen wichtig ist. Da wir von der Gunst eines anspruchsvollen Publikums leben, geht das nicht ohne. Ich war aber eher ein Entwickler, der anderen seine neuen Entwicklungen erläutern wollte, als ein Lehrer, der neue Generationen mit bekannten Inhalten immer wieder neu beseelt.
CG: Das heißt, du hast dir ein breiteres Repertoire entwickelt, um aufzubauen, was heute eine Institution geworden ist, konzentrierst dich aber jetzt wieder auf bevorzugte Funktionen.
BS: Richtig. Ich habe über viele Jahre die Organisation so entwickelt, dass alle Funktionen gut ausgefüllt sind und ineinander greifen. Ich kann jetzt an all dem partizipieren, was mir wichtig ist, ohne selbst zu Dimensionen beitragen zu müssen, die ich zwar kann, aber lieber anderen überlasse.
CG: Ja, das klingt, als seiest du da sehr im Reinen mit dir.
BS: Ja, viele sehen das so, melden mir dies zurück und nehmen auch für sich daran Maß. Es ist gelungen, eine Kultur zu schaffen, in der ich und andere, mit denen die Passung gestimmt hat, gute Rollen finden können. Auch bin ich irgendwie meiner ursprünglichen Berufung als Hochschuldidaktiker treu geblieben. Ich habe nun »meine eigene Hochschule«. Und da wir nie öffentliche Finanzierung in Anspruch genommen haben, bestand auch die Notwendigkeit, geistig anspruchsvolle mit wirtschaftlich tauglichen Angeboten zu kombinieren. Wir stellen uns damit einem manchmal verdrängten Zusammenhang, dass Kultur ohne eine leistungsfähige Wirtschaft geringe Chancen hat. Diese Kombination aus humanistischem Bildungsideal und marktwirtschaftlichem Verantwortungsprinzip hat uns immer gezwungen, gute Kompromisse zwischen gesellschaftstauglichen Anforderungen und eigenen Wertevorstellungen zu finden. Das hätte uns eine öffentlich finanzierte Hochschule nicht so konsequent abverlangt.
CG: Du warst aber auch im Hochschulrat einer Bildungshochschule tätig.
BS: Ja, das war eine ganz eigene Erfahrung. Dort wird gerne das Humboldt’sche Bildungsideal beschworen – doch nicht immer in überzeugenden Begründungszusammenhängen. Wilhelm von Humboldt hat seine Schulreform in 18 Monaten autoritär durchgezogen. Wer nicht mitspielte, war draußen. Das ist heute nicht möglich und vielleicht in einer Demokratie auch nicht wünschenswert. Aber es gibt Momente, in denen ich das bedauere.
Aber erzähl du doch mal! Wie ergeht es denn dir mit deinem Beruf? Würdest du ihn noch einmal wählen?
CG: Ich würde möglicherweise nicht noch einmal Psychologin werden wollen? Also, es gibt schon Bereiche in meiner Arbeit, in denen ich mich wieder finde: das Kreative, das Experimentieren, das Problemlösen! Vieles mache ich immer noch sehr gerne. Aber ich fand es entsetzlich langweilig immer dann, wenn ich dachte zu wissen, wie eine Lösung aussehen könnte, dann diesen ganzen, manchmal mühseligen Prozess der Therapie selbst zu begleiten. Sicher muss man dabei bedenken, dass meine Arbeit mit Hirnverletzten bzw. mit den von diesem oft plötzlichen Schicksal betroffenen Familien auch besonders kräftezehrend war. Andererseits war es auch eine echte Herausforderung, sich in das Denken, Fühlen und Erleben von Menschen, deren Hirnorganisation sich von unserer unterscheidet, hineinzuversetzen. Das war der kreative und sehr spannende Teil. Andererseits würde ich heute wahrscheinlich eher direkt etwas Kreatives machen und dann schauen, dass ich mein Kontaktbedürfnis zu Menschen privat befriedige.
BS: Kreativ im Sinne von künstlerisch? Im klassischen Sinne: malen, schreiben, bildhauern, Musik machen …?
CG: Ja auch, aber mehr im Sinne von Etwas erfinden! Oder aber, was ich schon immer als Kind toll fand: Verhaltensbeobachtung! Du beobachtest einfach nur und gibst den andern mit, was du siehst, ohne dass du selbst was machen musst …
BS: Also nicht das Gestalterische, sondern eine andere Form des Wirkens. Ist es das, was Michael Endes Momo kann? So zuzuhören, dass etwas anders wird, ohne einen Ratschlag geben zu müssen?
Ja, das verstehe ich gut. Ja, ich hab das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr erlaube ich mir, einfach nur zuzuhören und zu beobachten ohne einzugreifen.
CG: (…) wobei ich nicht weiß, ob mir dann nicht wieder etwas fehlen würde.
BS: Ja, da ist was dran. Auch ich erlebe dabei einen Verlust.
CG: Wovon?
BS: Mir ist ein Stück weit die »Werkel-Lust« verloren gegangen. Ich empfinde es auch als sehr segensreich, wenn Menschen einfach Lust haben, die Ärmel hochzukrempeln, und wirklich etwas zu gestalten.
Also insofern habe ich Verständnis für deine Idee. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das nicht einfach ein aufgestautes Bedürfnis bei dir ist, was bisher zu kurz kam, oder ob du das wirklich damals schon anders hättest machen wollen.
CG: Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe mich aber eigentlich nie wirklich als Psychotherapeutin gefühlt. Das war etwas Fremdes, was ich machen musste, was ich auch gut gemacht habe, aber ich habe mich nie dazu berufen gefühlt. Von daher denke ich, würde ich den Beruf mit dem Wissen, das ich heute habe, nicht mehr ausüben.
BS: Psychotherapeutin. Gibt es irgendeine Konkretisierung dieses Berufslebensweges oder ist es einfach die Nennung einer Kategorie?
CG: Als ich damals zu dir in die Ausbildung kam, hatte ich mir überlegt, ob ich eine Schreinerlehre mache oder bei dir in die Lehre gehe. Letzteres passte dann sehr gut, weil ich auch bei dir ein Kunsthandwerk gelernt habe, die systemische TA. Und ich wollte wirklich ein Handwerk lernen. Ich habe immer die Berufsgruppen beneidet, die mit konkreten Werkzeugen in der Hand durch die Gegend liefen und wussten, was sie womit anpacken sollten. Schreinern wäre etwas gewesen, was ich sehr gerne gemacht hätte. Selbst Möbel erfinden und zusammensetzen. Es ist etwas Heiles, etwas Gesundes …
BS: Ja, und man kann etwas anfassen … also ich verstehe die Dimension. Ob das ein heilerer Berufslebensweg gewesen wäre, das ist noch einmal eine andere Frage.
CG: Es hätte mir dann vielleicht etwas anderes gefehlt …
BS: Ja und es zeigt einfach, dass deine tatsächliche Berufslebensentwicklung doch Dimensionen unterversorgt gelassen hat.
CG: Lass uns noch auf die andere Seite schauen: die Schattenseiten dieses Berufs.
Mir selbst fallen zwei Aspekte ein, die mich gestört haben. Das ist einmal das Image des Berufs in der Öffentlichkeit. Im Krankenhaus, in dem die Leute ja nicht freiwillig zu mir kamen, sondern geschickt wurden, brachten diese oft auch viele Vorurteile gegenüber meiner Rolle mit. Ich musste erst einmal dagegen anarbeiten, um guten Kontakt herzustellen. Das war nicht entscheidend, aber dieses Image der Psychotherapeutin oder der Beraterin in der Öffentlichkeit hat mich auch im Privaten gestört. Dort hatte ich das Gefühl, dass Leute oft Privates und Berufliches vermischten. Etwa so: Wenn du Sorgen hast, dann kannst du halt zur Christiane gehen, auch privat, sie ist ja Psychotherapeutin. Am Anfang meiner Berufsjahre habe ich diese Tendenz sicher auch selbst gefördert. Das war ja auch eine Einfluss verheißende Rolle: Man konnte damit wichtig sein und wurde gebraucht. Später aber empfand ich diese Erwartungen dann eher als lästig. Ich fand es deswegen manchmal schwierig, privat neue Kontakte zu knüpfen, weil ich misstrauisch war, ob ich nicht wieder »ausgenutzt« oder nur deswegen gemocht werden würde, weil man ja immer so »anständig« zuhört und nett ist und so. Das fand ich schade … Wie ist es dir gegangen?
BS: Bei mir war das ganz anders … Ich war immer froh, wenn jemand Interesse an meiner Kreativität hatte und ich aktiv sein konnte. Ich habe mich mit meiner Kreativität identifiziert und mich daher bei Wünschen nach Unterstützung persönlich gemeint gefühlt. Dazu kommt noch mein anderer institutioneller Kontext. Ich war Freiberufler. Leute sind zu mir gekommen, weil sie zu mir wollten und ich konnte sie mir dann auch mehr oder weniger aussuchen.
CG: Aber du hast doch auch deinen privaten Umkreis?
BS: Ja, vorwiegend über die Familie. Sonstige private Beziehungspflege war nicht mein Heimspiel. Die meisten Privatbeziehungen sind im Berufsfeld entstanden. Dort habe ich Arbeitsformen gefunden, die für mich auch viele private Begegnungsmöglichkeiten und vertrauensvolle Beziehungen ermöglichten, für die ich sonst nicht die Motivation und die Verhaltensweisen gehabt hätte.
Wir haben in unserem Institut einen Rahmen entwickelt, in dem privatpersönliche und berufliche Kontakte fließend ineinander übergehen. Meistens sind auch meine Mitarbeiter und Lehrtrainer Menschen, die gerne menschliche Begegnungen mit dem Beruf kombinieren, wie ich das auch tue.
Für meine Lehrtrainer und Mitarbeiter bin und war ich auch immer ein bisschen der Mentor und Seelsorger und bin das gerne. Umgekehrt haben sie auch Anteil an unserem Leben genommen. Das haben wir intensiv erlebt, als unser Sohn Peter gestorben ist. Die liebevolle Zuwendung, die uns zuteil geworden ist, hat mich sehr berührt. Von daher habe ich diese Beziehungen als einen sehr lebendigen und gegenseitigen Austausch erlebt.
Und mir fällt es leichter, Beziehungen zu gestalten, wenn ein Lebensvollzug – sei es beruflich oder privat – miteinander möglich ist.
CG: Das passt ja auch wieder zu dem Beziehungstyp, als den du dich beschreibst, als den Ich-Es-Typen, für den es wichtig ist, sich über ein Thema auf den anderen beziehen zu können.
BS: Ja, das müssen keine großen Themen sein. Heute Mittag zum Beispiel habe ich für alle Mitarbeiter im Wok Gemüse gekocht. Es geht auch um konkrete Tätigkeiten, über die ich in Beziehung sein kann.
CG: Das ist schon auch etwas Ungewöhnliches: diese Kombination von Lebens- und Arbeitsform.
BS: Ja, wir achten im Institut drauf, dass Leben und Arbeiten im Zusammenhang bleibt. Wenn jemand z. B. mit uns kooperieren will, dann lade ich ihn zum Gespräch ein. Wir reden erst. Dann nimmt er an unserem Mittagessen teil und kann sehen, wo er ist. Und wir sehen, wer er ist in dieser Runde. Und dies hilft uns, über mögliche Kooperationen zu entscheiden.
CG: Da bist du schon eine Ausnahme. Ich denke, viele Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, die möchten wirklich so eine Trennung haben. Also: »Nach der Arbeit möchte ich keinen Patienten und möglichst auch keine Probleme mehr sehen. Hier bin ich privat«.
BS: Ja klar. Es gibt auch diese déformation professionelle: In der Regel habe auch ich keinen großen Hunger auf Kontakt, weil ich davon eher zu viel habe als zu wenig. Bei privaten Begegnungen wie bei Festen treffe ich auf interessante und wertvolle Menschen, will sie aber meistens nicht näher kennen lernen, weil ich keinen Platz in meiner Seele habe.
CG: Ja, das geht wohl vielen älteren Kollegen so und ich höre von vielen, dass sie eigentlich »psychotherapiemüde« sind.
BS: Ich habe nach 20 Jahren Psychotherapie das Gefühl gehabt, ich habe es durch. Und dann habe ich etwas anderes gemacht.
CG: So ging es mir auch. Wenn ich irgendetwas konnte oder kannte, dann wurde es mir langweilig, dann wollte ich auch nicht mehr dort weitermachen.
Passung
BS: Das ist auch ein Kreuz in unserer Gesellschaft: Wir haben viel zu starre Berufe und institutionelle Funktionsbilder. Daran hängen dann viele Menschen fest, obwohl es sich überlebt hat. Nur für ganz wenige Menschen bleiben ihre Berufe Lebensberufe. Hier wären mehr Beweglichkeit und immer wieder neue Ausrichtung gesünder und kompetenter. Wir beschäftigen uns am ISB intensiv mit diesem sogenannten Passungsthema. Also: Wie passe ich zur Organisation und zur Rolle und wie passen die Institution und Rolle zu mir? Es finden ja Veränderungen auf beiden Seiten statt, sowohl gesellschaftlicher wie persönlicher Art. So können sich ehemals erfüllende Tätigkeiten für den Rolleninhaber erschöpfen oder so verändern, dass sie nicht mehr zur Person passen. Eigentlich gehört zu einer gehobenen Professionalität und zu einer Organisationskultur, dass man immer wieder einen Passungsdialog – wie wir das nennen – durchführt. Das heißt, man schaut, ob Person, Institution, Organisation, Rolle usw. noch zusammenpassen. Und wenn man merkt, es passt bald nicht mehr zusammen, kann man frühzeitig etwas am Rollenportfolio ändern oder man kann die Funktion in der Organisation umgestalten. Und wenn das nicht möglich ist, muss man sich fragen, wie man in einer anderen Organisation zu neuer seelischer Lebendigkeit gelangen kann. Die Erhaltung von Leistungsfähigkeit hat viel mit Lebendigkeit und daher viel mit einem kompetenten Passungsdialog zu tun …
CG: Dann wäre ich vielleicht doch Psychologin geblieben …
BS: … wenn du einfach mehr Möglichkeiten gesehen hättest, als Psychologin in anderen Funktionen und Rollen tätig zu werden?
CG: Als ich zum Beispiel eine Weile zusätzlich Marketingaufgaben hatte, fand ich das super. Ja, ich hätte wohl mehr Gestaltungsfreiraum für meine Ideen gebraucht.
BS: Ja eben, von daher ist es vielleicht weniger die Profession, die nicht deine wäre, sondern es waren die Organisationsfunktionen, die zu eng oder zu unbeweglich blieben.
CG: Ja, das stimmt. Insofern müsste ich in einem »neuen« Leben eher darüber nachdenken, welcher institutionelle und organisatorische Rahmen besser zu meinen Neigungen und Potenzialen passen würde.
BS: Wann bin ich eigentlich schon Psychotherapeut, Berater oder was mir als Identität vorschwebt? Diese Frage treibt einen jungen Menschen durchaus um.
CG: Welche Herausforderungen sind die richtigen? Wir beide haben ja schon öfter festgestellt, dass wir uns aufgrund unserer verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen recht unterschiedlich an Herausforderungen heranwagen. Mich haben die ersten Berufsjahre sehr verunsichert. Das Studium selbst bereitet dich ja wenig auf den direkten Kontakt mit zukünftiger Klientel vor. Ich habe mich lange gefragt, woran ich mich eigentlich bei meiner Arbeit orientieren kann und soll. Du selbst beschreibst dich dagegen als einen Menschen, der eher gerne an die eigene Kompetenz geglaubt hat. Dennoch hast du vor über 20 Jahren eine Wirksamkeitsstudie (1988a, 1988b) zu deinen Intensivseminaren durchgeführt? Das passt für mich gar nicht zu dem wenig selbstzweiflerischen Eindruck, den du auf mich machst.
BS: Dafür gab es vor allem zwei Gründe: Zum einen konnte ich mich in den bestehenden Psychotherapie-Schulen schlecht beheimaten. Ein ganz typisches Muster für mich ist, dass ich, sobald ich an Dogmen und Schemata stoße, sofort deren Begrenzungen aufzeigen möchte. In einem Fall können Menschenbilder sinnvoll sein, aber im anderen Fall käme es einem Götzendienst gleich, wenn man sie als Wahrheiten erstarren ließe. Ich glaube, dass ein gebildeter Mensch bei jeder Frage aufgerufen ist, in seiner Weise, aus seiner Zeit, aus seinem Kontext, aus seinem Milieu kommend mit seiner Biografie stimmig neue Antworten zu finden. Insofern fühlte ich mich immer als eine Art Wilderer, der sich zwar der Konzepte und Ideen aus den üblichen Schulen bedient, sich aber den Dogmen nie unterworfen hat. Diese Freiheit hatte auch ihren Preis. Ich hatte immer das Problem, meine Identität zu definieren: Wer bin ich, wenn ich mich in keinen festen Rahmen, der mir eine Autorisierung oder eine gesicherte Identität verleiht, einfügen mag? Ich hatte und akzeptierte also identitätsbildende Rahmen um mich in nur geringem Maße und musste mir eine eigene Heimat sowie meine eigene Arbeitsweise und Struktur schaffen, wie z. B. diese Intensiv-Seminare mit einem mir gemäßen Stil.
Selbstwertzweifel oder Selbstkompetenzzweifel machten mir damals Sorgen, ohne dass mir ein traditioneller Rahmen den Rücken gestärkt hätte oder ich den jeweiligen Moden nachgegeben hätte. Ich wurde in der sehr emotionsintensiven, alternativen Psychotherapieszene manchmal mit kritischen Infragestellungen konfrontiert. Mein eher kognitiv orientierter Stil wurde verdächtigt, eine Folge von eigenen frühen Störungen zu sein, weshalb ich mich emotionalen Dingen nicht in dieser Intensität widmen könne, die damals üblich war. Um mir dazu ein etwas objektiveres Bild zu machen, habe ich alle meine Klienten schriftlich befragt.
CG: Ja, die Untersuchung wurde 1988 durchgeführt. Das war die Zeit, in der es »en vogue« war, möglichst viele Gefühle in der Therapie zum Ausdruck zu bringen. Und du fielst aus dieser Schablone heraus.
BS: Genau. Man war sich in meinen Kreisen relativ einig: Wo die Gefühle sind, da geht es lang, und je mehr eine gegenwärtige Situation auf einen früheren Konflikt oder ein früheres Erlebnis, am besten noch vorsprachlich, zurückgeführt werden kann, um so elementarere Arbeit leistet man und desto mehr gelangt man an die Wurzeln des Übels. Störungen hat man durch Fehlentwicklungen in der Kindheit bedingt verstanden und fast ausschließlich entwicklungspsychologisch beschrieben. Mir persönlich lag dieses schematische Verständnis von Störungen als auch der daraus abgeleitete Therapiestil nicht sehr. Obwohl ich durchaus gelernt hatte, mit Gefühlen umzugehen und die hinter der Gegenwart liegende, belastete Vergangenheit aufzuspüren. Empathie wurde damals ganz stark als Eingehen auf intensive Gefühle verstanden. Der Exklusivanspruch des Emotionalen, ja der Motivpsychologie überhaupt, war mir persönlich immer zu kultisch. Und bei uns ging es eben nicht so expressiv und schon gar nicht so stark kindheitsorientiert zu.
Und ich habe mich gefragt, ob ich trotzdem wertvolle Persönlichkeitsarbeit mache, und ob sich die Leute verstanden und emotional angesprochen fühlen, auch wenn ich selbst mich hauptsächlich kognitiv gesteuert habe. Am meisten hat mich beschäftigt, ob meine Art verständlich ist und Auswirkungen auf das hat, was anderen wichtig ist.
Dass es mir an emotionaler Schwingungsfähigkeit fehlte, das habe ich immer auch gespürt. Und wenn mich Leute in der Hinsicht als gestört dargestellt haben, habe ich mich durchaus darin wiedergefunden. Was mich störte bzw. zunächst verunsicherte, war die Pathologisierung meiner Persönlichkeitsausprägung. Später haben mich Lehrer wie z. B. Theodor Seifert, der Jungianer, oder andere Autoritäten, die diese Pathologisierung nicht mitgemacht haben, eher be- und gestärkt, weiter meinen Weg zu gehen. Dieser Weg war natürlich nicht nur durch Einseitigkeiten, sondern auch durch viele Kompetenzen geprägt. Ich habe dadurch im Laufe der Jahre zu einem Okay-Gefühl gefunden. Wenn ich auch heute noch manchmal Defizite feststelle und merke, da fehlen mir Dinge, die andere Menschen haben, bedauere ich das, weil ich gerne diese menschliche Dimension mehr erleben würde. Aber es ist keine Frage mehr eines Okay-Seins und Nicht-okay-Seins.
CG: Du konntest also die Nicht-okay-Gefühle loslassen und hast damit auch persönlich von der Auseinandersetzung mit deiner Berufsrolle profitiert. Und die Evaluationsstudie war eine der Möglichkeiten, die Frage deiner professionellen Wirksamkeit zu überprüfen.
BS: Genau … Insgesamt haben sich meine Hoffnungen, dass ich durch die Art und Weise, wie ich arbeite, auch Menschen ganz verschiedenen Typs erreiche und etwas Relevantes für ihre Lebensentwicklung beitragen kann, durch diese Arbeit – soweit man dies auf diese Weise erforschen kann – sehr bestätigt. Ich habe mir, wenn man so will, mit dieser Untersuchung das Plazet der relevanten anderen geholt. Und damit war die Diskussion für mich eigentlich abgeschlossen.
Resonanz und Wirkung waren gut bei dem ungewöhnlich geringen Ressourceneinsatz dieser Arbeitsform. Die meisten der TeilnehmerInnen haben die Seminare nur ein-, höchstens zweimal besucht. Und sie sind nicht deswegen nicht wiedergekommen, weil es ihnen nicht gefallen hat, sondern weil ihnen die vier intensiven Tage ausgereicht haben. Diese Ökonomie entspricht auch meiner ganzen Haltung, dass Menschen in ihrer Aufmerksamkeits- und Energiebesetzung durch Therapie und Beratung möglichst wenig aus ihren Lebenszusammenhängen abgezogen werden sollen. Vielmehr sehe ich beide Arbeitsformen als einen Boxenstopp, bei dem Klienten einen Kick bekommen, ansonsten aber in ihrem Leben bleiben, sodass Therapie und Beratung nicht zu Ersatzbühnen werden.
CG: Nun sind ja die Ergebnisse solcher Evaluationsstudien – zumal wenn sie vom Behandler selbst durchgeführt werden – an sich kein objektiver Beweis und können strengen wissenschaftlichen Kriterien nicht genügen.
BS: Nein, natürlich nicht. Aber damals war ich mir unsicher, ob das, was mir persönlich plausibel war, auch für die betroffenen Menschen über den Augenblick hinaus relevant war. Man bildet sich ja gerne was ein und findet um sich herum dann auch die Menschen, die einen darin bestätigen, und darum ist man immer in Gefahr eine Sekte zu werden. Und deswegen habe ich Fragen, die mich bewegt haben, in einem Fragebogen gestellt, wie z. B.: Fühlen Sie sich emotional angenommen? Fühlen Sie sich richtig verstanden? Hat es Ihnen gut getan? Hat es Wirkungen auf ihren Alltag? usw. Dies waren die Fragen, vor denen meine Arbeit Bestand haben sollte.
Heute brauche ich diese Absicherung in der Weiterbildung von kompetenten Professionellen nicht mehr. Unsere Teilnehmer sind erfolgreiche Professionelle, im Durchschnitt ca. 40 Jahre alt und in vielerlei Hinsicht ganz unterschiedlich (Rollen, Vorbildungen, Branchen, Organisationstypen, Zuständigkeiten und so weiter). Wenn Leute, die im Leben auf vielen Bühnen in der Bewährung stehen, öfter wiederkommen, obwohl sie stattdessen ihr beachtliches Ein- und Fortkommen mehren könnten, und wenn sie ihre Freunde, Partner, Mitarbeiter und Vorgesetzte schicken oder durch ihre Empfehlung das Vertrauen in ihre Urteilskraft riskieren, dann gibt es für mich heute keine bessere Bestätigung dafür, dass wir auf einem guten Weg sind.
Resümee
CG: Mein Resümee des Bisherigen ist: Im Grunde genommen geht es immer wieder um die Frage der Auseinandersetzung mit dem eigenen Werdegang und der Passung. Passungsklärung ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess, in dem ein lebendiges und labiles System immer wieder ausbalanciert werden muss. Antworten auf Passungsfragen werden daher immer situations- und kontextbezogen bleiben. Sie ändern sich mit den Bedingungen: ein Halbtagsjob mag solange erfüllen, solange man in der anderen Hälfte des Tages durch andere Aufgaben gefordert ist. Fallen diese weg, ändert sich möglicherweise auch die Passung. Ein bisher eher schüchtern auftretender Mensch, der seine dominante Seite entdeckt, wird in seiner Firma vielleicht eine andere Funktion wahrnehmen wollen. Die Lebensform eines Freiberuflers, die bisher gepasst hat, kann ihren Reiz durch private Veränderungen verlieren usw. Die Variationsmöglichkeiten, die zu einer Unpässlichkeit führen, sind komplex und vielfältig, die Anzahl möglicher Passungen jedoch begrenzt: Ich kann mich nicht überall anpassen, ohne meine seelische Lebendigkeit zu verlieren, und institutionelle und organisatorische Bedingungen haben ebenfalls ihre begrenzte Veränderungskapazität. Das Spielfeld dazwischen jedoch erscheint mir recht groß. Um die Spielräume wahrnehmen zu können, scheint es mir wichtig zu sein, mich selbst wesentlich wahrnehmen zu können. Dazu brauche ich relevante andere, die mich spiegeln, mir notfalls dysfunktionale Anpassungen aufzeigen, mir aber auch neue Passungsmöglichkeiten aufzeigen.
Und ich brauche den Mut, Veränderungen vorzunehmen, wenn ich spüre, dass mir als Zeichen mangelnder Passung meine seelische Lebendigkeit abhanden zu kommen droht.
2.3 Und Sie? Ein Fragebogen zur persönlichen Orientierung
3. Mensch und Beruf – ein Überblick
Haben Sie schon einmal einen größeren französischen Supermarché besucht? Es gibt fast alles, aber Sie finden nichts. Ähnlich mag es Ungeübten ergehen, wenn sie sich im Berufsleben zu orientieren versuchen. Welche Betrachtungen sind für eine geklärte Professionalität von Belang? Augenfällig sind Fachkenntnisse aller Art. Aber wie viele Professionelle (z. B. Lehrer) scheitern an fehlenden Fachkenntnissen? In einer breit angelegten Studie zu Coaching-Weiterbildung scheinen Inhalte nur zu ungefähr zehn Prozent deren Qualität auszumachen. Schwerer beschreibbare sonstige Kulturkomponenten solcher Weiterbildungen sind viel entscheidender. Für Professionalität sind die Komponenten, die traditionell als hintergründig angesehen werden, so entscheidend wie Ober- und Untertöne für Musik. Sie bestimmen den unverwechselbaren Sound, der charakteristisch bleibt, auch wenn Melodien wechseln. Wie in der Einleitung beschrieben, sind die zu einer geläuterten Professionalität gehörenden Hintergründe vielschichtig und vielfältig. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen ist ein lebenslanger Prozess und letztlich viel spannender als Inhalte.
Wir werden jetzt einen kleinen Überblick geben, aus welchen unterschiedlichen Wirklichkeitsbereichen (Denk-)Angebote in diesem Buch zu finden sind.
3.1 Menschen im Beruf
Es geht um den Menschen, der im Beruf nicht nur einen Job oder eine Einnahmequelle sieht, sondern der sich in einem Berufsleben mit seiner professionellen Persönlichkeit, mit seinen Talenten und seiner Wertorientierung verwirklichen möchte.
Es geht um den Menschen, der sich im professionellen Selbstverständnis selbst erfahren, sich in seinem gesellschaftlichen Engagement selbst verwirklichen will. Es geht also um den Menschen, der die Gestaltung seines Berufslebens als wesentlichen Bestandteil seiner Lebensgestaltung begreift.
3.2 Menschen in Organisationen
Es geht um den Menschen in Organisationsfunktionen, da Berufstätigkeit in der Regel mit Zugehörigkeiten zu und Funktionen in Organisationen verbunden ist. Die dort vorgefundene Organisationskultur berührt unmittelbar die Lebenskultur der darin wirkenden Menschen. Professionelle Persönlichkeitsentwicklung und Organisationskulturentwicklung stehen daher in einem engen Zusammenhang. Im Funktionsträger treffen Professionskultur und Organisationskultur aufeinander. Sie können sich im kritischen Dialog bereichern oder zu schwer erträglichen Konflikten führen. Beide können als eigene Dimensionen beschrieben werden: die Charakteristika des Berufsfeldes wie die Eigenschaften einer Organisation in ihren Umwelten.
3.3 Professionelle Persönlichkeitsentwicklung
Zur Funktion kommt die Individualität des Menschen hinzu. Sie kann auch unabhängig von Beruf und Organisation beschrieben werden, da sie sich auch in anderen Bereichen in ihrer Unverwechselbarkeit zeigt. In jedem Fall betrachten wir Persönlichkeit immer im Zusammenhang mit konkreten Welten und Lebensvollzügen darin. Daher kann professionelle Persönlichkeitsentwicklung tiefer gehend nicht losgelöst von der Entwicklung der Professionen selbst, den professionellen Gemeinschaften und der Organisationen verstanden werden. Wer also den Menschen und seine Entwicklung im Beruf und in der Organisation verstehen will, muss sich um ein Verständnis von Professions- und Organisationswelten bemühen.
3.4 Kernfragen der Ökonomie
Die Professionen und die sie vertretenden Gemeinschaften wiederum können kaum ohne die Entwicklung der Märkte für Arbeits- und Dienstleistungen verstanden werden. Und diese sind wiederum mit anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf schwer durchschaubare Weise vernetzt.
Es muss also heute in der persönlichen und beruflichen Selbstverwirklichung eine Komplexität berücksichtigt werden, die privat unmittelbar einfühlbare Perspektiven überfordert. Wer mithalten will, muss lernen, irgendwie damit umzugehen. Mangelnde Kompetenz im Umgang mit dieser Komplexität führt zu Misserfolgen, die wiederum die professionelle Entwicklung, die Lebensgestaltung und das Lebensgefühl erheblich beeinträchtigen.
Wer sich als Spielball der Entwicklungen blind und ohnmächtig fühlt, reagiert auf Dauer mit seelischen und sonstigen gesundheitlichen Belastungen. Fachleute beobachten eine dramatische Zunahme depressiver Erscheinungsbilder. Man kann sich leicht vorstellen, dass dies auch mit den erschwerten Anforderungen an berufliche Lebensgestaltung zu tun hat.
3.5 Integrierende Perspektiven
Es geht damit auch um das Leben auf privaten und sonstigen gesellschaftlichen Bühnen. Entsteht Entwicklungsbedarf, stellt sich auch die Frage, welche Verfahren (z. B. Psychotherapie) oder multidisziplinäre Ansätze eher geeignet sind, Menschen bei ihrer Lebensgestaltung und ihrer persönlichen und beruflichen Selbstverwirklichung in einem derartig komplexen Bedingungsgeflecht zu unterstützen.
Zwar lassen sich berufsbedingte psychische Störungen treffend in psychotherapeutischen Dimensionen beschreiben, jedoch ist Psychotherapie gesellschaftlich gesehen keine Lösung. Davon haben uns viele Jahre als Praktiker und Lehrer auf dem Gebiet der Psychotherapie überzeugt. Durch die Einseitigkeit der Ansätze dort, bei gleichzeitigem Anspruch auf umfassende Erklärung menschlicher Schicksale, sind Wirksamkeit und Anschlussfähigkeit der Psychotherapie begrenzt. Trotz einiger weiterführender Ansätze wird meist versucht, die individuelle Lebensgestaltung der Menschen auch im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich aus der privaten Lebensentwicklung heraus zu verstehen und zu verändern. Die konkreten beruflichen und gesellschaftlichen Lebenswelten müssten in der Psychotherapie wesentlich mehr und besser berücksichtigt werden. Dies ist ohne eine umfassende Veränderung der Perspektiven, der Konzepte und Methoden der Psychotherapie kaum möglich.
Wahrscheinlich funktioniert es umgekehrt: Eine gelungene multidisziplinäre Auseinandersetzung mit der Berufs- und Organisationswelt stellt den entscheidenden Beitrag auch zur Gesundheit des Einzelnen und der Gesellschaft dar. Für das Berufsleben und ein kompetentes Ausfüllen von Organisationsfunktionen sind psychotherapeutische Betrachtungen nur eine und oft nicht die entscheidende Perspektive. Dort, wo diese hilfreich sind, sind sie willkommen, sollten aber in Konzepten und Methoden kompetent mit den vielen anderen Perspektiven der Berufs- und Organisationswelt integriert werden.
Warum unterscheiden wir zwischen Menschen im Beruf und Menschen in Organisationen?
Menschen mit beruflichen Kompetenzen können in bestimmten Organisationen dennoch wenig erfolgreich sein beziehungsweise wenig Zufriedenheit erfahren. Dies kann damit zu tun haben, dass sie die Welt dieser Organisation nicht hinreichend verstehen oder nicht zu ihr passen. Umgekehrt gibt es Menschen, die in bestimmten Funktionen und Organisationen groß geworden sind, die jedoch kein eigenes professionelles Selbstverständnis entwickelt und sich in keiner professionellen Gemeinschaft beheimatet haben. Sie wissen dann oft nicht, wer sie beruflich sind, und geraten völlig aus dem Lot, wenn sie sich plötzlich auf dem Arbeitsmarkt neu orientieren müssen. Daher unterscheiden wir den beruflichen Lebensweg einerseits und bestimmte Funktionen in bzw. die Zugehörigkeit zu Organisationen andererseits. Die Perspektiven zu unterscheiden, schafft die Voraussetzung für getrennte Betrachtungen und für Fragen der Passung der Entwicklungen in beiden Sphären.
3.6 Passung
Viele Menschen geraten in berufliche Tätigkeiten und Organisationsfunktionen, die sie nicht befriedigen und ausfüllen können. Das ist gar nicht so selten, wird jedoch oft eher unterschwellig empfunden. Sich dies einzugestehen, ist häufig mit Scham behaftet und wird leicht ausgeblendet, zum Beispiel wenn es nicht zum gewünschten Selbstbild passt. Unzureichende Passung wird dann als diffuses Unbehagen erlebt. Manchmal schwelt im Hintergrund stumme Verzweifelung (Berne 1964, Schmid 1989). Wenn man damit zu tun hat, ist es nicht einfach, angemessen zu beschreiben, wo die Diskrepanzen liegen und was zu tun wäre, um Abhilfe zu schaffen. Dazu bedarf es feinsinniger Gespräche.
Kompetenz und Bereitschaft zu gemeinsamen Klärungen solcher Fragen sind in professionellen Gemeinschaften und Organisationen meist nicht sonderlich ausgeprägt. Daher leben die Menschen und die Organisationen oft viele Jahre mit Minderleistungen und persönlichen Belastungen. Diese könnten durchaus vermieden werden, wenn die differenzierte Klärung solcher Passungs-Fragen selbstverständlicher Bestandteil professioneller Kompetenz und Organisationskultur wäre. Hierzu bedarf es, neben Gesprächstechniken, eines differenzierten Verständnisses von Persönlichkeit bezogen auf Berufs-lebenswege und Organisationsfunktionen. Diese sind heute in komplexer gewordene Welten eingebettet und können immer weniger losgelöst von einer umfassenderen gesellschaftlichen Umwelt verstanden werden. Daher geht es um den Menschen als Mittelpunkt einer persönlichen Biografie und gleichzeitig als Mitglied einer sich zunehmend globalisierenden Gesellschaft.
3.7 Umgang mit Überkomplexität
Stehen wir also wie David vor dem Goliath der Überkomplexität, mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen? Antworten finden wir meist nicht mehr dadurch, dass wir uns auf einige Beschreibungen und Steuerungsebenen konzentrieren und die eigene Kompetenz dort perfektionieren. Dies käme einem Versuch der illusionären Beherrschung der Aufgabenstellungen gleich. Hingegen ist Der flexible Mensch (Sennett 1998; orig.: The Corrosion of Character) heute der Mensch, der lebenslang an möglichst kompetenten Varianten der prinzipiellen Unwissenheit arbeitet.
Es geht also um Selbstverständnisse und Kompetenzen an den Knotenpunkten zwischen Persönlichkeitskultur, Professionskultur, Organisationskultur und der Kultur des Wirtschaftens unserer Gesellschaft.
3.8 Unternehmen und Organisationen
Die starke Betonung des Menschen könnte den Eindruck erwecken, dass hier von einem Gegensatz zwischen der Wohlfahrt des Menschen und den Bedürfnissen von Organisationen ausgegangen wird. Dies ist aber natürlich nicht notwendig der Fall. Im Gegenteil sind wir davon überzeugt, dass es keine nachhaltige Entwicklung für die einzelnen Menschen gibt, wenn sich die Gesellschaft nicht in dafür geeigneter Weise entwickelt. Auch wird hier kein Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesellschaft proklamiert, sondern wir folgen dem Verständnis von Luhmann (1988), nach dem Wirtschaft und Gesellschaft nicht zwei verschiedene Bereiche sind, sondern Wirtschaften eine wichtige Dimension von Gesellschaft und der Lebensvollzüge darin ist. Von daher ist Wirtschaftskultur ein Bestandteil von Gesellschaftskultur. Gesellschaftskultur ohne oder gar gegen Wirtschaftkultur entwickeln zu wollen, wäre genauso, als wenn man die Lebenskultur einer Familie ohne den Umgang mit Zeit, Geld, dem Können, dem Engagement ihrer Mitglieder – also der Ökonomie der Familie – bestimmen wollte.
3.9 Kulturentwicklung in Organisationen
Darüber hinaus sind wir überzeugt davon, dass größere soziale Systeme, also auch Unternehmen und Organisationen, ohne eine geeignete Kultur überhaupt nicht steuerbar sind (Schmid/Meyer 2010). Sie sind so komplex, dass der Versuch, alle Prozesse technisch kontrollierbar und lenkbar zu machen, die verfügbare Steuerungskompetenz und -kapazität um Dimension überschreiten würde. Größere soziale Systeme sind nur dadurch steuerbar, dass die handelnden Menschen verstehen, worauf es ankommt, wie Leistungen zu erbringen sind, wie man dabei mit sich und anderen umgehen soll, was zum Stil dieses Unternehmens gehört und was nicht. Dies klingt vielleicht wie ein Anspruch, ist aber eine Tatsache – auch wenn sie oft ausgeblendet wird.