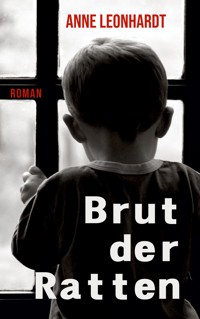2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine frühzeitig explodierte Bombe zerfetzt einen jungen Linksradikalen. Seine Gefährtin Claudia überlebt und flüchtet sich zu Lisa. Die hilft, kann aber Claudias Verhaftung nicht verhindern. Es ist Mitte der 1980er Jahre. Westdeutschland. Trotz zweier von Deutschland initiierter Weltkriege, Massenmord und Holocaust peitscht die herrschende westdeutsche Elite ab Ende 1982 den US-NATO-Doppelbeschluss, die Remilitarisierung des Landes gewaltsam durch: Von hier aus sollen wieder Angriffskriege geführt werden. Ein traumatisierender und re-traumatisierender Umbruch für gleich zwei Generationen. Die verbünden und radikalisieren sich schnell, erheben sich zu Hunderttausenden, bilden die zweite Massenbewegung nach den 1968ern. Demonstrationen, Petitionen, Mahnwachen, der Bau von Hüttendörfern gegen die Abholzung von Wäldern und den Bau von Start- und Landebahnen für Kriegsflieger, Blockaden gegen die Stationierung der Pershing 2 und wachsende Militanz, aber alles prallt ab an der Macht der Herrschenden. Untertauchen! Jetzt! Lisa, Nora und Pan, der vom Schulterschluss mit der RAF träumt, haben die Nase voll von Niederlagen, der kalten Arroganz der Politiker und Kriegen in aller Welt! Im »wirklichen Land«, wie Gramsci die Illegalität nannte, nach den Sternen greifen, Teil werden der neuen Front, die schaffen kann, woran alle bislang scheiterten: die Kriegsmaschinerie der Eliten zerstören! Sich einreihen in die internationale Revolution aller, die sich gegen Kapital und Ungerechtigkeit erheben. Und bald schon basteln sie an einer Bombe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
»Aber … da kommen wir her: Die Brut aus den Vernichtungs- und Zerstörungsprozessen der Metropolengesellschaft, aus dem Krieg aller gegen alle, der Konkurrenz jeder gegen jeden, aus … der Spaltung des Volkes in Männer und Frauen, Junge und Alte, Gesunde und Kranke, Ausländer und Deutsche (…) aus den Betonsilos der Vorstädte, den Zellengefängnissen, Asylen und Trakts, aus der Gehirnwäsche durch die Medien, den Konsum (…); aus der Depression, der Krankheit, der Deklassierung, aus der Beleidigung und Erniedrigung des Menschen, aller ausgebeuteten Menschen im Imperialismus (…)«
(Aus der Rede von Ulrike Meinhof, 1974, zur Befreiung von Andreas Baader)
Die folgenden geschilderten Ereignisse sind reine Fiktion. Ähnlichkeiten mit Personen, Orten oder tatsächlichen Vorkommnissen wären rein zufällig. Diverse Ortschaften sind aus der Fantasie entstanden, für diese Geschichte mit Eigenheiten und Besonderheiten ausgestattet, die in der Realität so nicht existieren.
Wichtige Personen
Beatrix Moringer, Spitzname »Trixi« (geb. 1968), 16, haute schon vor Jahren von zuhause ab. Sie ist spindeldürr und 1,50 m groß. Die Hoffnung, noch zu wachsen, hat sie nicht mehr. Aber das macht nichts. Sie trägt die Haare gern bunt, macht Musik, liebt Lisa und das, wofür sie steht, und lebt neuerdings im »Hotze«, einem besetzten Haus in Frankfurt-Rödelheim.
Claudia Töpfer (geb. 1960), ist fast 24, als sie nur knapp dem Tod entkommt, aber nicht dem Gefängnis.
Sabine Dietz (geb. 1962), 22, blond, blauäugig und schmal. Sie lebt und arbeitet zufrieden vor sich hin, bis ihre Kindheitsfreundin Lisa ihr Leben durcheinanderrüttelt.
Ralf Dietz alias (Agent) Lars (geb. 1959), 25, war einmal Sabines großer Bruder. Aber das ist lange her. Nach einigen Jahren Bundeswehr ist er jetzt Agent und als »Lars« angesetzt auf die linksradikale Nora. Für sie entwickelt er Gefühle, die der Erfüllung seiner Aufgabe nicht förderlich sind.
Boris Dietz (geb. 1970), grüngraue Augen, mittelblond, weich, zart und sehr zerbrechlich. Er starb mit sechs und ist präsent in der Erinnerung derjenigen, die ihn liebten.
Lisa Mönning (geb. 1963), 21, 1,65 groß, kompakt, hat mausbraune Schnittlauchlocken und grüne Augen, beißt sich schon lange so durch. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich lohnt, für ein besseres Leben zu kämpfen. Und zögert keine Sekunde, als Claudia ihre Hilfe braucht.
Uwe Gebhardt alias (Deckname) Robert (geb. 1956), 28, seit acht Monaten illegal. Kaum in der RAF angekommen, zwingt ihn die plötzliche Verhaftung seiner engsten Genossen und Genossinnen, die Zähne zusammenzubeißen.
Nora Steermann (geb. 1960), 24, färbt ihre mittelbraunen Haare mit Henna, lernte durch ihren Bruder Stefan das Hüttendorf gegen die Startbahn West kennen. Und die großen Träume, die daran hängen. Die bleiben, auch nachdem Stefan sich umbringt.
Bernhard Steinert (geb. 1940), Anti-Terror-Spezialist, 44, nach drei Jahren Aufstandsbekämpfung-Schulung in den USA kehrt er nach Frankfurt am Main zurück, um das dort erfolgreiche Counter Insurgency Programm auch in Deutschland umzusetzen.
Herbert Michaelis (geb. 1931), 53, ist grobschlächtig, ungeduldig und nicht sonderlich intelligent. Aber Bulle mit Leib und Seele, Bierbauch und Halbglatze. Steinert kotzt ihn an, der ihm vor die Nase gesetzt wird – auf den Posten, der für ihn vorgesehen war.
Norbert Sammert, Spitzname »Niko« (geb. 1954), 29, rehbraune Augen, dunkelblonde Haare, ist vor vier Monaten untergetaucht, trägt seinen Kopf versteckt zwischen hochgezogenen Schultern, liebt Thea, die Menschen im Allgemeinen und Kinder im Besonderen. Letzteres wird ihm zum Verhängnis.
Thea Dillinger (geb. 1951), 33, dunkelbraune Augen, hat Haare auf den Zähnen und einen Sack voll Erfahrung. Taucht zusammen mit Niko unter.
Hans Peter Richter, Spitzname »Pan« (geb. 1958), 26, hat sich in Thea verknallt, verlässt sein legales Leben als militanter Widerständler und träumt vom »zusammen kämpfen und siegen«.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil Eins
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9
Tag 10
Tag 11
Tag 12
Teil Zwei
Tag 13
Tag 14
Tag 15
Tag 16
Tag 17
Tag 18
Tag 19
Tag 20
Tag 21
Tag 22
Tag 23
Epilog
Prolog
Die Fremde tauchte letzten Herbst bei mir auf. Ich schätzte sie um die sechzig, sie war sympathisch und wickelte mich schnell um den Finger. Meine Arbeiten mit Zeitzeugen gefielen ihr ausgesprochen gut, lobte sie. Die habe sie im Internet entdeckt und sofort gewusst, dass ich die Richtige für sie sei. Ob ich Interesse an einem Auftrag hätte, nur von kurzer Dauer, gut bezahlt?
Ich solle eine wahre Geschichte, in die sie selbst involviert gewesen sei, aufnehmen und nach ihrem Tod veröffentlichen.
»Sabine« kam als reisefertiger Geist. Metastasierender Magenkrebs zerfraß ihren Körper und die Zeit, die ihr blieb. Ich mochte sie und war mal wieder pleite, also sagte ich zu. Da hatte ich noch keine Ahnung, worum es ging. Sonst hätte ich sicher die Finger davongelassen.
Gut, dass ich unwissend war, denke ich jetzt, wo Sabine tot ist und ich frei bin.
Wenige Tage nach unserem ersten Treffen setzte ich mich auf ihr Sofa, schaltete das Aufnahmegerät an und zuckte kurz darauf zusammen, als der Name Lisa in ihrer Erzählung auftauchte. Das riss eine Wunde in mir auf, noch bevor klar war, dass Sabine tatsächlich die Frau meinte, die auch ich gekannt hatte.
Ich stemmte mich tapfer gegen die in mir aufquellenden Gefühle, ließ mir nichts anmerken und war froh, als meine Auftraggeberin zwei Stunden vor der vereinbarten Zeit Schluss machen wollte. Ich versprach, morgen wiederzukommen, und verkniff mir all die Fragen, die mir zu »Lisa« auf der Zunge brannten. So hielt ich es auch, als klar wurde, dass ihre Lisa die war, die auch ich gekannt hatte, denn Sabines Zustand hatte sich rapide verschlechtert und ich wollte sie nicht noch mehr aufregen.
Sieben Tage nach Beginn unserer Aufnahmen kam sie ins Krankenhaus. Sie lächelte, als ich mit Blumen an ihr Bett trat.
»Wir schaffen das schon noch«, sagte sie, als läse sie meine Gedanken, »es ist ja nicht mehr weit.« Und wir machten weiter, gleich dort.
Sie redete schneller jetzt, der näher rückende Tod saß auf ihrer Bettkante, erzwang Pausen in immer kürzeren Abständen, gefolgt von sturzbachartigen Monologen, getrieben von der Angst, das Ende der Geschichte nicht mehr herauszubringen. Und je weiter sie kam, desto erleichterter wirkte sie. Das Sprechen wie Wehen, die blutende Erinnerungen aus ihrem Körper pressten, aus Neuronen, Amygdala und Gewebe, Vorhut einer Geburt im Endspurt des Todes.
Diese Geschichte sollte bleiben, wenn sie ging. Dafür trat Sabine verkeilte Türen ein, ertrug ausströmende Schmerzen und schritt voran, auch in Räume, die voller Blut standen. Nicht nur das eigene. Sie zog mich mit in modrige Katakomben, Tunnel und Schlupflöcher, in fremdes Terrain, das mir zunehmend bekannter vorkam. Mein professionelles Zuhörer-Ich strauchelte in Wunden, deren Existenz ich verleugnet hatte, verschwamm im Klang von Sabines Stimme, in ihrem Atem, tauchte durch ihre erweiterten Pupillen in platzende Erinnerungsblasen, verschmolz in aufquellenden Gefühlen und verlor sich dort, genau wie sie.
Sabine verließ die hiesige Welt an einem frühen Morgen, fünfzehn Tage nach unserem ersten Treffen. Anderthalb Tage zuvor, wenige Stunden nachdem sie die letzten Sätze ihrer Geschichte gesprochen hatte, war sie abgetaucht in diesen Zustand zwischen Leben und Tod, in dem der Körper noch da, aber die Seele schon auf Reisen ist.
Sie kam nicht mehr zurück.
Ich besuchte Sabine an ihrem letzten Tag. Saß neben ihrem Bett, betrachtete ihr Gesicht, die geschlossenen Lider, beugte mich immer wieder näher heran, horchte auf ihren dünnen Atem, in dem ein fernes Röcheln hing, als trüge sie einen Koffer, der viel zu schwer war. Jetzt war sie fort, ich konnte nichts mehr tun, sie nichts mehr fragen. Erste Zweifel plagten mich. Würde ich halten können, was ich versprochen hatte? Verfremden müsse ich ihre Erzählung, hatte Sabine betont, Orte, Gegebenheiten, Leute, Hintergründe. Niemanden gefährden und doch alles erzählen! Mich drückte die Last der Aufgabe, und ihres Vertrauens.
Am späten Abend nickte ich ein. Und träumte von ihr. Sie stand mittig auf einer schmalen, hölzernen Brücke, sah gelöst und glücklich aus und vierzig Jahre jünger, als sei ihr Weg nach drüben ins Nirwana auch einer zurück in ihre Jugend. Sie hob die Hand, winkte mir zu, lächelte, drehte sich um und verschwand. Ich wachte auf und sah sie an. Kein Röcheln mehr, ihr Gesicht, tief ins Kissen gesunken, sah friedlich aus. Ich hielt meinen Handrücken vor ihre leicht geöffneten Lippen, aber da war nichts mehr. Ich beugte mich über sie, schob ihr eine störrische Haarlocke aus dem Gesicht und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Gute Reise.«
Draußen, auf dem Weg zurück in mein Leben, fragte ich mich, ob Sabine mich, von wo auch immer, beobachtete. Ob sie ihre Geschichte, die ich nun aufschrieb, würde lesen können.
Jetzt, sechs Monate später, hoffe ich das. Und dass sie zufrieden ist. Ich habe getan, was ich konnte, um dem, was sie erlebt hat, gerecht zu werden. Und mir. Denn in dieser Erzählung geht es auch um mich, um jene wenigen Wochen meines Lebens, die mich mehr als alles davor oder danach geprägt haben. Und zu der machten, die ich heute bin.
Diese Geschichte ist die von ein paar Leuten und ein Splitter in der Historie dieses Landes. Nicht mehr und nicht weniger.
Beatrix Moringer, die Protokollantin, Mai 2019
TEIL EINS
Trixi
Lisa. Schon der Klang ihres Namens tat fürchterlich weh. Und machte mir schlagartig klar, dass nichts vergessen war. Gar nichts. Über fünfunddreißig Jahre hatte ich geschwiegen, Familie und Freunde verlassen, mehrmals die Stadt gewechselt, zweimal das Bundesland, auch ins Ausland war ich, aber vergessen? Wenn da eine Wunde in dir ist, die größer ist, als du erträgst, dann verschwindet sie nie, egal wie weit du flüchtest. Aber du selbst tust es. Denn diese Wunde, das bist du. Und die Kilometer, die Städte, die immer neuen, fremden Menschen, die du zwischen die Wunde und dich zu schieben versuchst, verhärten nur die Maske, die aus deinem wahren Gesicht wird. So war es bei mir. Auch wenn ich das nicht merkte.
Bis Sabine mich fand und ihre Geschichte erzählte. Als sie Lisas Namen das erste Mal nannte, war sofort klar, dass das ganze verdammte Leben, das ich nach ihr geführt hatte, für die Tonne gewesen war. Denn schon ihr Name genügte, um mich zum Bluten zu bringen, geradeso, als sei das Damals eben erst passiert.
Es war Mitte Juli 1983, als Lisa mich von der Straße holte. Ich war gerade sechszehn geworden und als Registrierte hätte neben meinem Namen das Kürzel gestanden: »ofW« (ohne festen Wohnsitz). Aber noch hatte mich niemand auf dem Radar. Ich hatte schnell gelernt da draußen. War kurz nach meinem vierzehnten Geburtstag abgehauen aus einem Zuhause, das nie wirklich eins gewesen war. Bis auf die sechs Monate, nachdem mein Alkoholiker-Vater abgetaucht war und ich mit Mutter allein zurückblieb. Sie jammerte, dass er »uns sitzen gelassen« habe, aber ich war dreizehn und heilfroh, dass er weg war. Aber das hielt nur kurz, weil dann der Neue kam. Der hat mir gleich am zweiten Tag eine gescheuert, um klarzumachen, wer jetzt das Sagen hatte. Als Mutter von der Arbeit kam, hat er es abgestritten, und sie glaubte ihm. Na klar. Ich blieb dann nicht, um mir auch noch den ganzen Rest abzuholen, das kannte ich ja alles schon. Außerdem war es Frühsommer und warm genug, um nichts auf die lange Bank zu schieben. Am nächsten Tag nach der Schule wartete ich, bis Mister Schweinsgesicht in seine Eckkneipe am Ende der Straße verschwand, packte meine Sporttasche, leerte die Teedose mit dem mickrigen Rest Haushaltsgeld, die er übrig gelassen hatte, krallte mir den Schmuck meiner Mutter aus der leeren Schuhputzdose im Schlafzimmerschrank und machte die Fliege. In der nächsten Großstadt verscherbelte ich am Bahnhof die Halskette und zwei Ringe und zog weiter. Ich genoss den Platz, den ich mit einem Mal hatte, unter diesem Himmel, der allen genug Luft bietet, um zu atmen. Und Licht, um zu leuchten oder einfach nur zu sein, je nach Stimmung. Bis mir das Geld ausging. Aber bis dahin hatte ich die notwendigsten Dinge aufgesaugt von denen, die schon länger auf Trebe waren. Das Allerwichtigste hatte ich eh schon drauf, verinnerlicht, bevor ich laufen lernte: mich unsichtbar zu machen. Das half beim Vermeiden von Bullen, Personenkontrollen und Sozialarbeitern, geriet man nämlich auf ihren Schirm, war man schneller in einen der Ersatzknäste diverser Betreuungseinrichtungen verschubt, als man gucken konnte. Und Minderjährige wurden ratzfatz dahin zurückgeschoben, wo sie herkamen.
Als ich Lisa begegnete, war ich noch nicht lange in Frankfurt aufgeschlagen und seit knapp zwei Monaten mit einem Typ zusammen, der mein Opa hätte sein können. Er war der Dritte, den ich mir geangelt hatte, seit ich auf Trebe war, und Frankfurt am Main meine dritte Stadt. Einen Typen hier draußen wieder loszuwerden, das war kein Zuckerschlecken. Und schlimmer. Es war immer besser, dann auch die Stadt zu wechseln. Das war nicht toll. Aber trotzdem besser einen dieser Typen zu haben, statt ständig Freiwild für alle zu sein.
Als Lisa mich anquatschte, auf diesem Open Air Konzert im Günthersburgpark, hatte ich vor meinem aktuellen Typen schon mehr Angst als davor, Freiwild zu sein. Auch er hatte sich – wie alle – als Mogelpackung gezeigt, machte auf nett und Beschützer, bis er mich rumgekriegt hatte. Danach war er wieder der geworden, der er wirklich war, ein runzeliger Drecksack, der an der Flasche hing. Wie die meisten, die ich bis dahin draußen kennengelernt hatte.
Ein paar Tage vor dem Open Air hatte er eine Menge Fusel aufgetan, schleppte morgens um halb drei kistenweise feinen Wodka von einer Lieferpalette aus dem Hinterhof eines neu eröffneten Restaurants. Seitdem trank er das Zeug, wie andere Leute atmeten. Natürlich trank ich mit, aus Gewohnheit und um meine Angst vor seinen Tobsuchtsanfällen in Watte zu packen, für die schon ein Blick von mir reichte, wenn der mal zwei Sekunden nicht auf ihn gerichtet war.
Ohne Lisa wäre ich bald vor die Hunde gegangen, da bin ich sicher. Hätte endlos gesoffen und immer so weitergemacht, mich an diese Typen gehängt, die mein Anker sein sollten, auch wenn sie Schweine waren.
Der Abend im Günthersburgpark war schon fortgeschritten, die letzten Wodkaflaschen leer, er schrie mich gerade mal wieder zusammen, als ihn ein unverhoffter Lichtblick ablenkte: ein halb voller Kasten Bier, vorn neben der Bühne, zwischen zwei seiner Kumpels. Er eilte rüber zu ihnen, und kaum war er weg, kam Lisa mit energischen Schritten auf mich zu. Ihre mausbraunen, halblangen, dünnen Haare flirrten im Wind ihrer Entschlossenheit, dann blieb sie vor mir stehen und rammte ihre Hände in die nicht vorhandene Taille.
»Du siehst verdammt nett aus«, ihre grünen Augen durchbohrten mich, »und ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso du deinem ätzenden Alten keine scheuerst, der dich wie den letzten Dreck behandelt.«
»Das ist nicht mein Alter«, brummelte ich, schlagartig nur noch halb benebelt.
»Ach so, na dann …« Sie sah ostentativ rüber zur Bühne zu den beiden Typen, vor denen meiner sich grad aufpumpte und den Dicken machte, um ein paar Flaschen abzustauben.
»Ich bin Lisa und hab auch mal draußen gelebt«, fuhr sie fort, als läse sie das ofW von meinen zusammengepressten Lippen, kritzelte ihre Adresse auf ein Stück Papier und steckte es mir zu, »gar nicht so lange her. Das fand ich besser, als zu bleiben, wo ich war, und weiter die Abtretematte für alle möglichen Arschlöcher zu sein. Ich wohne in der Nähe, falls du mal einen Ortswechsel brauchst, ich hab ein Zimmer frei, winzig, aber umsonst. Es gibt nur eine Bedingung.« Sie spähte rüber zur Brüllerei, die sich eben um den Bierkasten erhob. »Arschlochtypen dürfen weder von mir noch von meiner Bude was mitkriegen.«
Drei Nächte später klingelte ich sie raus, morgens um halb drei. Ich hatte sie offensichtlich aus dem Tiefschlaf geweckt, aber sie winkte mich rein, als habe sie mich erwartet. »Schön, dass du da bist. Das Bett ist gemacht, ich bring dich rüber und geh wieder pennen, okay? Bin hundemüde. Morgen können wir reden. Wenn du willst.« Sie öffnete die Tür zu einem 7-Quadratmeter-Zimmerchen und knipste das Licht an. Vom Bettzeug auf der Matratze, die auf Paletten thronte, stieg Lenor-Duft auf, und durchströmte mein neues Reich, das von der ersten Sekunde an mein Paradies wurde.
Am späten Morgen beim Frühstück drückte sie mir die Schlüssel für ihre Wohnung in die Hand, machte sich über die frischen Brötchen her, die sie geholt hatte, schenkte mir Kaffee ein, schob mir Milch und Zucker rüber und warf mir hin und wieder diesen ganz speziellen Blick zu. Sie fing nicht an, mich zu löchern, was mir Schlimmes passiert oder warum ich so jung weg war von zuhause oder so. Sie ließ es sich schmecken, las ihre Zeitung, war ganz da mit mir und doch ganz bei sich, wie immer dann, wenn wir beisammensaßen. Ich blieb, weil ich sie mochte, und spürte, dass ich willkommen und sicher war, dass ich in einer Weise, die ich weder kannte noch verstand, dorthin gehörte, an diesen Ort, mit ihr. Ohne das ständige Gefühl, falsch und fehl am Platz zu sein und liefern zu müssen, was auch immer. Zufrieden igelte ich mich also ein, in diesem Wunderland, das einfach so meins geworden war, mit Schlüsseln und allem. Nur ganz am Anfang und ein einziges Mal fragte ich Lisa nach Alk, am Abend des zweiten Tages, nachdem ich, während sie weg gewesen war, trotz akribischer Suche keinen Tropfen fand, nicht mal einen ordentlichen Hustensaft.
Lisa war gerade reingekommen, stellte zwei volle Einkaufstüten auf den Boden und räumte die Sachen in ihr Holzkistenregal im Flur. Sie habe keinen Alk, antwortete sie, sie habe diesen elenden Dreck jahrelang selbst in sich reingeschüttet und die Schnauze voll davon. Dabei hielt sie mir lächelnd leckere Quarkstückchen vor die Nase, und das Thema war erledigt. Sie konnte nicht kochen, brachte aber supergutes Essen mit: Schinken, Käse, Körnerbrot, Butter und gefrorene Fertiggerichte. Vieles ließ sie mitgehen, alles andere bezahlte sie vom Geld ihres Hehlers, dem sie regelmäßig geklaute Kunstbände und Luxuslederaccessoires brachte. Aber das kapierte ich erst später und auch, dass sie Sozialhilfeempfängerin war und sich mein Durchfüttern eigentlich nicht leisten konnte. Keinen Ton hat sie darüber verloren. Sie kaufte ein wie Krösus, und darauf wäre ich auch reingefallen, hätte ich nicht am dritten Tag, in der neuerlich aufkeimenden Hoffnung auf ein Tröpfchen, noch mal gründlicher ihre Wohnung durchsucht. Das ging schnell, bei anderthalb Zimmern mit 28 Quadratmetern plus Kochfeld und Kühlschrank im Flur und Gemeinschaftsdusche und Klo draußen. Ich kramte bis in die letzte Ecke, mittlerweile auch nach Geld oder Schmuck. Aber nichts. Bis auf ein paar 1- und 2-Pfennigstücke, die auf dem verdreckten Boden unter Lisas Bett klebten … nicht mal leere Flaschen oder ungestempelte Briefmarken trieb ich auf, die auf die Schnelle umsetzbar gewesen wären. Aber Lisas Sozialhilfeunterlagen fielen mir in die Hände – in einer unteren Schublade ihres Schreibtisches, versteckt unter einem Haufen Polit-Broschüren über Atomkraftwerke, die Startbahn West und die NATO.
Es war mein Glück, dass ich nichts Verwertbares fand. Schon mit einer Handvoll Münzen oder einem noch so winzigen Silberring wäre ich sicher über meinen dünnen Schatten gesprungen, die Fantasie eines langen, wunderbaren Schlucks hätte mich zur gemeinen Diebin gemacht und ich wäre ausgeflogen, um Fusel zu kaufen. Nicht mal die Angst, meinem Ex über den Weg zu laufen, hätte mich davon abgehalten – oder seinen Kumpeln, die sich wie ein Spinnennetz über die ganze Stadt zogen und ihm gesteckt hätten, wo ich war.
Der erzwungene Entzug flaute meinen Lechz nach Alk bis zum vierten und fünften Tag gewaltig runter, und ich sah allmählich klarer. Nur Lisa gab mir weiter Rätsel auf. Bei meiner Fummelei stellte sich ihre Wohnung als oberkrasses Chaos heraus, der aufgestapelte Rumpel aus Klamotten, Schuhen, Zeitungen und Büchern in ihrem Zimmer, der Geruch von ungewaschenen Haaren und Schweiß, der ihrem Bett entströmte, erinnerte mich an meine letzten Behausungen. Und ich fragte mich, wieso nur meine Bettwäsche nach Weichspüler roch. Trotzdem ich darauf keine Antwort hatte, wusste ich nun definitiv, dass Lisa weder eine verkappte Sozialarbeitertussi war, die kommende Prügel der Umerziehung hinter ihrem sanften Lächeln verbarg, noch eine dieser verschwurbelten Müslie-Emanzen. Viel mehr wusste ich nicht von ihr. Wohl deshalb verschonte sie mich mit ätzenden Fragen: weil auch sie am liebsten schwieg.
Tag 1
Nahe Frankfurt am Main, Mitte der 1980er Jahre
Ein Mann und eine Frau liefen schnellen Schrittes auf das Ende der Neubausiedlung zu, sechsunddreißig Häuser mit Garten und Garage, drei Reihen mit zwölf Einheiten, typisch im Westdeutschland dieser Achtzigerjahre, in dem Hunderte solcher Siedlungen als neue Vororte aus den Nähten überfüllter Großstädte platzten.
Die beiden, drei- und vierundzwanzig Jahre alt, ließen eben die letzte Häuserreihe hinter sich, erreichten das Ende der Straße, wo der Asphalt abrupt endete wie abgebissen. Ein Trampelpfad führte ins Brachland, hinaus in einige Hektar freie Ebene, kärglicher Rest ehemaliger Felder, deren Bewirtschaftung dem Siedlungsbau zum Opfer gefallen war. Der Mann bückte sich unter seinem schweren Rucksack, warf einen Blick über die Schulter zu den noch dunklen Fenstern des letzten Häuserblocks. Die Frau hielt sich dicht hinter ihm. Die nachtkalte Erde knirschte unter den schneller werdenden Schritten, neben fernem, noch dünnem Vogelzwitschern das einzige Geräusch, das die frühmorgendliche Stille störte. Die beiden eilten voran, ahnten nichts über den Charakter ihrer Abdrücke, die sie unauslöschlich hinterlassen würden als Protagonisten einer historischen Umbruchphase, als tragische Subjekte ihres Schicksals und der Geschichte. Als Rebellen, deren Entscheidung zu handeln gefallen war. Jetzt stand die Tat unmittelbar bevor. Vielmehr ihr Scheitern. Und der Tod, der nur noch Atemzüge entfernt auf sie wartete.
Der junge Mann war jetzt weit voraus.
»Jan! Warte doch!«, rief Claudia.
Aber er reagierte nicht.
Sie versuchte, Schritt zu halten. War gestresst, erschöpft, die vergangene Nacht, unfreiwillig durchgemacht, zehrte an ihr. Weil Jan den Treffpunkt verwechselt hatte, kam er über vier Stunden zu spät zu ihr, tauchte erst nach Mitternacht in der konspirativen Unterkunft auf. Hektisch und angespannt hatte er sich nach kurzem Gruß hinuntergebeugt und sich die Schuhe von den Füßen gezerrt. Claudia hatte ihn gemustert und gedacht: Er hat sich verändert. Noch war sie nicht ganz sicher gewesen, ob zum Besseren oder Schlechteren. Sie kannten sich seit der Oberstufenzeit. Sieben Jahre war das her. Obwohl Jan ein Jahr älter war, waren sie damals schnell Freunde geworden. Warfen sich in die aufflammenden Schülerproteste, stemmten sich mit Tausenden gegen die Oberstufenreform, die Zerschlagung ihrer Klassengemeinschaften, protestierten für gemeinsame, fachübergreifende Lernprozesse, verweigerten sich den staatlichen Plänen, sie und nachfolgende Generationen per Kurssystem zu maximal verwertbaren Fachidioten zu machen. Zu funktionierenden Rädchen der Maschinerie einer durchkapitalisierten Zukunft zwecks Gewinnmaximierung für eine winzige Minderheit.
Über vierzehn Monate weiteten sich die Proteste aus, schul- und städteübergreifend: Demonstrationen, Straßenblockaden, Sprayaktionen, Flugblätter, das Stören von Lehrerkonferenzen und Politikerreden … und waren am Ende gescheitert. Aber die dabei waren, hatten eine Menge gelernt fürs wahre Leben, übers Rebellieren, über Würde und Stolz, Loyalität, Lüge und Verrat. Eine Menge Altachtundsechziger-Lehrer hatten sympathisiert, über Solidarität schwadroniert und rhetorisch brilliert, aber als es ernst wurde, knickten sie ein und ließen ihre Schüler über die Klinge springen. Erwiesen sich als staatstreue Beamte, als aktiver Teil der betonierten Machtverhältnisse, an denen sich die Schüler, die den schönen Reden Taten folgen ließen, die Köpfe blutig schlugen. Die meisten der an den Protesten Aktiven an Jans und Claudias Schule flogen oder schafften das Abi nicht wegen schlechter Noten, von konservativen Lehrern als Retourkutsche verpasst. Nur wenige fielen sanft. Darunter Claudia und Jan, deren bildungsbürgerliche Elternhäuser Vitamin B einsetzten, um ihre geschassten Sprösslinge rechtzeitig an einer nahen Gesamtschule unterzubringen, wo sie das Abitur glimpflich zu Ende brachten. Nicht nur die erlittene Niederlage schlug die Rebellen des Schüleraufstands 1976/77 auseinander, sondern auch die Herkunft, die bestimmte, wer wo wie danach landete.
Aber das alles war an diesem Morgen eine gefühlte Ewigkeit her. Mittlerweile studierten Jan und Claudia an der Frankfurter Goethe Universität, wenn auch mehr auf dem Papier. Beide waren seit zwei Jahren höchst aktiv im Widerstand gegen die Startbahn West. Aber auch der war gescheitert, das Hüttendorf geräumt, der Wald gerodet. Und dann war Jan vor drei Monaten von einem Tag auf den anderen verschwunden, nicht mal Claudia wusste, wo er war. Bis ein Freund sie vor vier Wochen wieder mit ihm verknüpfte. Jan war untergetaucht, um Ernst zu machen mit Widerstand und Revolution. Sie trafen sich konspirativ in einem Café, wo er Claudia mit leuchtenden Augen von seiner neu gegründeten Gruppe erzählte. Mit militanten Aktionen wollte die nun aufs Ganze gehen. Die Schulen als Schmieden für die Kapitalistensklaven, der Mörfelder Wald als Abschussrampe für die NATO, die Rebellion an einzelnen Symptomen scheitere immer, argumentierte Jan, man müsse das Ganze infrage stellen, um voranzukommen, mit organisierter, zielgerichteter revolutionärer Militanz. Die sei nicht nur legitim, sondern notwendig. Ein jeder habe ein Recht auf Selbstverteidigung gegen diesen organisierten Imperialismus, der die Unterjochung, Versklavung und den Tod der Mehrheit der Menschheit bedeute. Die Aktionen seiner Gruppe richteten sich immer nur gegen Sachen, Baufirmen, militärische Projekte – so was eben. Menschen kämen niemals zu Schaden. Ob Claudia bei ihnen mitmachen wolle?
Ja und noch mal ja! Stolz hatte sie sich gefühlt, euphorisch! Endlich mehr tun. Zusammen mit Jan, sich endlich nicht mehr unterkriegen lassen. Kurz bevor sie sich an jenem Nachmittag trennten, fragte Jan plötzlich, ob Claudia kurzfristig für jemanden einspringen könne, ein Genosse sei krank geworden. Ausgerechnet. Seit Monaten sei eine Aktion vorbereitet, sie stünden kurz davor, sie umzusetzen, und jetzt … Natürlich hatte sie »Ja« gesagt.
Gestern Nacht rieb Jan seine schmerzenden Zehen, richtete sich auf, straffte den Rücken und stand auf. »Komm!« Er sah Claudia nur flüchtig an, ging ins Zimmer rüber. »Legen wir los!«
Und da wusste sie, dass seine Veränderung nicht zum Besseren war.
»Warte!«, rief Claudia jetzt noch einmal, lauter. Aber wieder keine Reaktion. Sie riss sich zusammen und lief schneller, kam Jan etwas näher. Das Gewicht des Rucksacks beugte seinen Rücken. Aber er hatte ja partout nicht abwechseln wollen, seit sie vor einer halben Stunde im Hinterhof eines Abbruchhauses neben der Neubausiedlung vom Motorrad gestiegen und den beschwerlichen Weg zum knapp drei Kilometer entfernten Ziel losgelaufen waren.
Jetzt hatten sie die Autobahnbrücke erreicht. Fünfzehn Meter über ihren Köpfen donnerte ein Laster über den Asphalt. Claudia hob den Blick. Noch war wenig Verkehr. Bald ist es geschafft, dachte sie.
Fünfzehn Meter von ihr entfernt drehte Jan sich endlich um. »Nun mach schon!«, rief er. »Oder willst du hier festwachsen?« Und lief weiter, verschwand hinter einem Betonpfeiler. Von dort drang plötzlich ein lautes Zischen herüber.
Sie hielt an. »Jan?« Kein Laut.
Auch er war offenbar stehen geblieben, blieb hinterm Pfeiler verborgen.
»Jan?!« Aber keine Antwort. Nur dieses Zischen, längst vorbei, vibrierte jetzt in ihrem Gehör nach. Wie ein Echo aus jener Totalität der Stille, die nicht nur sämtliche Geräusche absorbierte, sondern gleich alles Leben mit. Sie durchdrang nun jede Faser von Claudias Körper, fraß wie ein Piranhaschwarm ihre Innereien weg, bis nur dieses Grauen übrig war, dunkle, nackte Angst. Und in ihrem Schatten braute sich in Claudia die Quintessenz der vergangenen Stunden und Minuten zusammen, verdichtete sich in dieser einen Sekunde zu einem Gemisch aus archaischem Wissen, Ahnung und Intuition zu einer einzigen grässlichen und glasklaren Erkenntnis: kein Entrinnen. Vorbei!
Sie wollte schreien: Jaaaaan! Aber ihre Lippen klebten zusammen, die Zunge war zur Bleikugel geworden, zerknirschte den Atem. Ihr Herz raste jetzt, pumpte Todesangst durch ihre Eingeweide, kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn, und ein mächtiger Adrenalinschub schraubte sie am Boden fest und die grausige Wahrheit weitete ihre Pupillen, noch bevor der folgende ohrenbetäubende Knall ihr linkes Trommelfell zerriss.
Die mächtige Detonation verwandelte die Luft in einen dichten Nebel aus Staub, Betonkiesel und Steinbrocken. Die Druckwelle, vom Brückenpfeiler abgelenkt, hob Claudia vom Boden und schleuderte sie vier Meter weiter auf die erzitternde Erde zurück.
Als sie Minuten später aus ihrer Bewusstlosigkeit erwachte, lag sie auf der Seite, ihr Mund voll Staub und Kiesel. Sie würgte. Ins rechte Ohr drang ein Geräusch, seltsam, dünn, von ganz weit weg. Sie hielt die Luft an und horchte. Das Läuten einer fernen Kirchturmuhr.
Sie mühte sich, die blut- und staubverkrusteten Augen zu öffnen. Vergebens. Zaghaft pendelte sich ihr Puls zurück. Sie wollte aufstehen, aber ein stechender Schmerz im Bein hinderte sie daran. Also blieb sie liegen. Der Wind blies starke Böen aus Nordost und das ferne Läuten näher heran, Schlag um Schlag, melodisch. Schön. Sie lauschte, saugte den Klang in sich auf. Sie war so fürchterlich müde, ließ sachte los. Das alles hier. Auch wenn sie sich nicht erinnerte, was genau. Sanft schwang ihre Seele sich in diese Melodie hinein, ritt auf ihr fort, Ton um Ton, weit, weit weg. Und bald umschlang Claudia eine zarte Welle federleichten Glücks. Die Reise ins Jenseits, dachte sie. Ist sie das?
Aber dann war es plötzlich still.
Trixi
Es klingelte Sturm, mitten in der Nacht. Ich schreckte aus dem Schlaf, sprang aus dem Bett, presste mein Ohr an die Zimmertür und hielt die Luft an. Hatte mein Ex mich entdeckt!? Oder einer seiner Kumpane, oder die Bullen?
Aber es ging nicht um mich. Ich hörte Lisa draußen im Flur leise und eindringlich mit jemandem reden. Kurz darauf klopfte es kaum hörbar an meine Tür.
»Ja?«, hauchte ich, und Lisa schob sich sachte herein und nahm mich direkt in den Arm, als wüsste sie, dass ich mir die Seele aus dem Leib schlotterte.
»Alles in Ordnung«, flüsterte sie mir ins Ohr, »es ist nur eine alte Bekannte, die Hilfe braucht.«
Ich wusste auf der Stelle, dass sie mich nur beruhigen wollte. Es war ihr Tonfall und wie sie mich weg von der Tür zog und sie schloss. Sie wollte nicht, dass wer auch immer da draußen bemerkte, dass ich da war.
»Ein Notfall. Ich muss kurz weg«, fuhr sie leise fort, »bis ich zurückkomme, rührst du dich nicht aus deinem Zimmer. Meine Bekannte liegt drüben bei mir, ihr geht’s nicht gut. Und ich will auf keinen Fall, dass du hier bei mir gesehen wirst. Hast du das verstanden, versprichst du mir, dich nicht zu rühren?« Sie starrte mich an.
»Na klar, verlass dich drauf.«
»Okay, ich hol meine Bekannte nachher hier ab, in einer Stunde oder so. Danach kannst du machen, was du willst. Aber bleib hier in der Wohnung, bis ich wiederkomme. Selbst wenn es zwei, drei Tage dauert. Einkauf ist genug da. Und wenn es klingelt, mach auf keinen Fall auf, okay?« Sie drückte mich fest, schob mich von sich, legte den Finger auf den Mund, lächelte und sah mich an. Liebevoll. Und fragend.
Ich nickte. Sie hob den Daumen, drehte sich um und ging. Wieder Gemurmel draußen, drei Minuten später klappte die Wohnungstür zu. Und ich hörte Lisas Schritte im Treppenhaus, leise, aber deutlich. Sie rannte, als sei der Teufel hinter ihr her.
Tag 2
»Bini? Ich bin’s, mach auf!«, rief eine Stimme leicht verzerrt durch die Sprechanlage.
Obwohl es halb zwei in der Früh und Sabine aus dem Schlaf gerissen worden war, erkannte sie sie sofort. An dem Spitznamen, den Lisa ihr verpasst hatte. Lange her.
Sabine schlang den Bademantel enger, drückte den Türöffner und wünschte kurz darauf, sie hätte es nicht getan.
»Hallo«, sagte Lisa mit sanftem Lächeln, als sei nichts weiter, dabei hatte sie all die Jahre nie was von sich hören lassen. Jetzt schob sie diese Fremde herein, die kein Wort sagte, aber blicklos ins Nirgendwo starrte. Ihre Haare klebten teerartig zusammen, und aus ihrem zerrissenen Hosensaum tropfte Blut in den elfenbeinfarbenen Flokatiteppich, den Sabine einmal im Monat kämmte. Aber statt Lisa samt ihrer Begleiterin aus der Wohnung zu schieben und die Tür zuzuschlagen, trat Sabine beiseite, lotste die beiden in ihr makelloses Wohnzimmer, sah fragend von einer zur anderen. Dabei war die Tragödie deutlich genug in die Gesichter ihrer Besucherinnen gestanzt. Aber das zählte in diesem Augenblick nicht. Einzig Lisa tat das. Denn obwohl ihre Freundschaft ewig her war, traute Sabine ihr noch immer mehr als dem Leben, das sie nun führte. Schon das Tremolo von Lisas Bariton in der Sprechanlage hatte alles entschieden. Überflutete Sabines Inneres mit dem Schönsten ihrer Kindheit, riss die sorgsam aufgeschichteten Wälle und vernagelten Zäune um ihr angestrengt errichtetes Selbst aus den Angeln. In diesem Augenblick soff der vor Jahren begonnene Prozess ab, den Sabine damals noch mit dem »Erwachsenwerden« verwechselte. In der Flutwelle des fremden Lebens, das Lisa in jener Nacht in ihre Existenz knallte. Einfach so.
»Es tut mir echt leid«, hatte sie dann begonnen. »Wir wussten nicht, wohin. Meine Freundin hier … äh, Rosana, ihr Freund ist ein Scheißtyp, ein echter Brutalo, er hat sie … äh, superschlimm verprügelt.«
Lisas verräterisches Zögern erinnerte Sabine sofort an all die phänomenalen Geschichten, die sie schon als Kind immer parat gehabt hatte. Aber schreckte sie das? Nein! Im Gegenteil. Es verstärkte ihr erwachtes Gefühl der Heimkehr in diese einzigartige Freundinnenschaft, einem glücklichen und nahezu vergessenen Ort ihrer Kindheit.
Mit vereinten Kräften betteten sie Rosana schließlich aufs Sofa. Und Sabine griff zum Telefon, um den Notarzt zu rufen. Aber Lisa riss ihr den Hörer aus der Hand. »Auf keinen Fall!« Rosanas Freund würde sie finden! Der sei doch Taxifahrer, erklärte sie, und höre garantiert den städtischen Funkverkehr ab! Und verschwand ins Bad, kehrte mit Handtüchern und der Hausapotheke zurück, stopfte Tücher unter Rosana und verarztete sie, so gut es eben ging.
Unterdessen lauschte Sabine interessiert der Fortsetzung von Lisas Geschichte mitsamt Charakterstudie des gewalttätigen Freundes. Seit Monaten würde Rosana von diesem Schwein terrorisiert, berichtete Lisa. Vorhin hatte sie endlich einen Koffer gepackt und war gerade aus dem Haus, als ausgerechnet in diesem Moment der Typ früher als üblich nach Hause kam. Rosana überquerte eben die Straße, da hatte das Schwein sie auch schon entdeckt, sei aufs Gaspedal seiner Schrottlaube getreten, habe die arme Rosana gottlob nur gestreift und die Karre danach gegen einen Poller gesetzt. Nur deshalb sei das misshandelte Mädchen davongekommen, habe es knapp zu Lisa geschafft, die ein paar Häuser weiter wohnte. Natürlich waren sie sofort weg, weil der Arsch ja von ihrer Freundschaft wusste, und bei der Frage, wohin, war Lisa in letzter Sekunde Sabine eingefallen.
In der Not frisst der Teufel … schoss es der an dieser Stelle durch den Kopf. Da half auch Lisas nachgeschobener zärtlicher Singsang nicht, wie sehr sie die Freundin in den letzten Jahren vermisst, wie oft sie an sie gedacht und bei ihr geklingelt habe. Aber Sabine sei nie da gewesen. Echt. All das sprudelte flüssig aus Lisa raus. Und Sabine fragte nicht nach. Sie war in dieser Nacht erst dreiundzwanzig, ihr Bewusstsein nichts als ein dichter Dschungel aus verfilztem Gewirr. Lisas Überfall katapultierte sie zurück in ihre Kinderzeit. Und deshalb ahnte Sabine in jener Nacht, dass auch diese Geschichte von Lisa, egal wie viel davon erfunden war, ganz sicher auch Wahrheit und Echtes enthielt.
Nun wäre es also am besten, fuhr Lisa unbeirrt fort, erst mal hierzubleiben. Denn dieser Dreckskerl würde garantiert die Gegend draußen durchkämmen. Mitsamt seinen Kumpels. Es sei jetzt viel zu unsicher, zurück nach draußen auf die Straße zu gehen.
Und an dieser Stelle hatte Lisa den Blick von ihren Schuhen gehoben.
»Das ist einfach viel zu gefährlich«, sagte sie und beäugte Sabine, die in diesem Moment klar und deutlich erkannte, was auf jeden Fall echt war: Lisas Angst.
*
Lisa Mönning war anderthalb Jahre jünger als Sabine. Sie waren in der Römerstadt in einer Ernst-May-Siedlung im Nordwesten von Frankfurt aufgewachsen. 1050 kleine Einfamilien-Reihenhäuser, dazwischen 12 Mehrfamilien-Häuser mit vier Stockwerken und Wohnungen. 1927 erbaut, wurde die Siedlung Ende der 40er Jahre mit Ostgeflüchteten und ausgebombten und kinderreichen Familien der Region belegt. Sabine, das mittlere Kind einer fünfköpfigen Frankfurter Familie, wusste schon früh, dass Lisa zwar keine aus dem Osten, aber ein Bastard war und die Mutter ein Flittchen. Lisa musste man also fernbleiben, und natürlich trieb die sich herum. Wie der Herr, sagte Sabines Vater, so’s Gescherr. Ob es stürmte, hagelte oder schneite, immerzu lungerte dieser Bastard, wie er nicht müde wurde zu betonen, da draußen auf der Straße herum. Und bevor sie sich erstmals von Angesicht zu Angesicht begegneten, hatte Sabine Lisa immerzu von ihrem Zimmer aus beobachtet, streckte sich im ersten Stock neidisch über den Schreibtisch zum Fenster, hinter dem sie nachmittags ihre Hausaufgaben machte. Warum durfte dieses Bastard-Mädchen immerzu raus?
Ihr erstes Zusammentreffen hatte nichts mit Sabine zu tun, sondern mit Boris, ihrem damals zweijährigen Bruder. Lisa kam ihm zu Hilfe an einem Samstag. Der Duft von frisch gemähtem Rasen hing in der Luft, vor den Reihenhäusern reckten sich stramm Tulpen und Geranien aus gleichförmigen Vier-Quadratmeter-Beeten. Darüber gebeugte Mütter zupften Unkraut oder setzten Topfpflanzen, ihre Kinder scharwenzelten um sie herum. Vorn an der Straße polierten Familienoberhäupter ihre Autos um die Wette. Kopf an Kopf, Kühlerglanz an Kühlerglanz, die ganze lange, sich krümmende Straße hinunter. Eine Pflichtübung aller, die ein Auto ihr Eigen nannten, sie sprang jeden Samstagvormittag von Haus zu Haus. Entdeckte man einen Nachbarn mit dem Eimer, sputete man sich, es ihm gleichzutun.
An diesem speziellen Samstag war es kurz nach halb elf, Sabines Mutter noch nicht vom Einkaufen zurück, zwei Nachbarn wienerten bereits ihre Wagen. Sabine drückte sich oben in ihrem Zimmer herum, in das sie vor dem Vater geflohen war, der unten wieder einen seiner Anfälle hatte. Sie sah aus dem Fenster, gerade als Lisa quer über die Straße auf das Haus zu rannte. Sabine stellte sich auf Zehenspitzen und drückte ihre Nase an die Scheibe. Boris lag draußen vor der Eingangstreppe, die Vater ihn wieder wegen irgendeiner Kleinigkeit hinabgestoßen hatte, nicht das erste Mal. Sabine ging runter, blieb zwei Meter vom Vater entfernt auf der Treppe stehen, der breitbeinig in der offenen Haustür stand und Lisa wutentbrannt anstarrte. Die hockte draußen neben Boris, friemelte ein verknäueltes Tempo aus ihrer Hosentasche, wischte damit Blut von Boris’ Wange und redete zärtlich auf ihn ein. Der Vater hatte sich schließlich wortlos umgedreht und war in sein Arbeitszimmer verschwunden. Erst da traute Sabine sich zur offenen Haustür.
»Das wird alles wieder gut, glaub mir«, hörte sie Lisa murmeln, die sich um die glotzende Nachbarschaft nicht scherte, sondern weiter mit Boris’ sprach. Er weinte wie immer lautlos. Seine Tränen verdünnten das aus der geplatzten Braue laufende Blut; wegen Lisas Tupferei mit dem Tuch sah es jetzt wie Windpocken aus.
Sabine, beide Ohren auf die mögliche väterliche Rückkehr gespitzt, schaute auf die beiden hinunter. Sie konnte sehen, dass Lisa auf ein Wort von Boris wartete. Die kannte ihn ja nicht, wusste nicht, dass er nichts sagen würde.
Vollidiot, nannte der Vater ihn, sobald er ins Schreien geriet. Lass ihn doch, erwiderte die Mutter, falls sie in der Nähe war und sich traute.
Boris’ rehbraune Augen waren auf Lisas Gesicht geheftet, die ganze Zeit.
»Geht’s wieder?« Lisa zerdrückte das blutige Tempo zu einem kleinen Ball und schnippte es in hohem Bogen fort. Erst da riss Boris’ seinen Blick von ihr los und folgte dem Flug des blutgetränkten Knäulchens. Es landete mittig auf dem akkuraten Rasenstück, das der Vater regelmäßig per Nagelschere trimmte. Boris’ Augen weiteten sich.
Er wandte sich wieder Lisa zu. Und lächelte.
Hatte er das jemals zuvor getan?, fragte sich Sabine.
Lisa stand auf. »Der redet wohl nicht mit jedem, was?«
»Nein.« Sabine ging zu ihm und schnappte Boris’ Hand, zog ihn hoch und Richtung Tür. Aber er machte sich steif.
Da erschien der Vater wieder im Flur. »Na, wird’s bald!«, brüllte er. »Rein, aber dalli!«
Boris wollte nicht, stemmte sich weiter dagegen. Aber Sabine zerrte ihn mitleidslos hinter sich her. Auf gar keinen Fall wollte sie jetzt mit dem Vater allein sein.
*
Rosana schlief schnell ein, schrie aber in der Nacht häufig. Sabine und Lisa sprangen dann auf, beruhigten sie, wechselten das verschwitzte Laken oder einen verrutschten Verband.
Jetzt am Morgen waren Rosanas Augen extrem starr, die Farbe um ihre Pupillen hell, fast durchsichtig. Sah man lange hinein, sprang Horror zurück. Das erschreckte, aber klärte die Dinge auch. Rosanas Grauen war wie ein brennender Strom, in dem alles Unwichtige verglühte. Und ohne jedes Zutun übernahm eine unnatürliche Gelassenheit die Regie.
Komplizenhaft und ohne viel Worte taten sich nun die drei Frauen zusammen wie Blutsschwestern, unfreiwillig aneinandergeschweißt von dieser Krise, deren Hintergründe, Zusammensetzung und Folgenschwere Sabine von allen am wenigsten auch nur erahnte.
Lisa bestand darauf, dass Sabine zur Arbeit ging, als wäre nichts geschehen. Das würde sie schützen, erläuterte sie, falls was schiefginge, denn es mache klar, dass Sabine von nichts eine Ahnung hätte. Und obwohl dieses Argument nicht wirklich zu ihrer Geschichte mit Rosanas brutalem Freund passte, folgte Sabine ihren Anweisungen ohne Widerworte. Fuhr früher los zur Arbeit, ging eine längere Strecke zu Fuß, machte Umwege. Prüfte, so gewissenhaft es ihr möglich war, ob es Verfolger gab. Am späten Nachmittag kehrte sie mit einem Großeinkauf zurück, darunter diverse rezeptfreie Medikamente. Und mit der guten Nachricht: Sie hatte keine Schatten bemerkt.
Noch immer sprach Rosana kein Wort. Aber die Blutung hatte aufgehört, das Fieber war gesunken, und sie aß, wenn auch nur eine halbe Schüssel Grießbrei. Am Abend schauten sie zusammen den Fernsehkrimi.
»Sie ist über’n Berg«, murmelte Lisa, nachdem Rosana eingeschlafen war. »Oder?«
Sabine nickte, auch wenn sie keine Ahnung hatte, ob das stimmte.
»Sie muss sich noch ausruhen, dann kommt sie wieder auf die Beine!«, meinte Lisa. »Aber ich muss jetzt los.«
Wegen Sabines entsetztem Blick ergänzte sie hastig: »Für Rosana eine andere Bleibe finden!« Die Wohnung sei viel zu nah an diesem Schwein dran, sicher lauere der Typ noch immer da draußen und Sabine solle all diesen Ärger auch nicht länger als nötig am Hals haben.
»Aber du musst morgen wieder zurück sein, bevor ich zur Arbeit gehe!«
»Na klar«, antwortete Lisa, »aber jetzt musst du mich noch hier wegbringen, ohne dass es einer da draußen mitkriegt.«
Gib ihr einen Finger, dachte Sabine, und sie reißt dir Arm und Schultergelenk mit raus.
Kurz darauf fuhren sie mit dem Aufzug in die Tiefgarage, stiegen in Sabines kleinen Fiat, Lisa legte sich hinten vor die Rückbank und schmiss die mitgebrachte Wolldecke über sich. Erst als sie das Ostend verlassen hatten, lugte Lisa unter der Decke vor und dirigierte Sabine über den Main, sie müsse nach Neu-Isenburg, sagte sie. Am Ende der Schweizer Straße überlegte sie es sich plötzlich anders, dirigierte hektisch zurück, in die Färberstraße ans Ende eines Hinterhofs, und verkündete: »Ich steig hier schon aus! Werfe wohl besser meiner Anwältin noch was ein.« Sie nahm Sabine das Versprechen ab, die Sache mit Rosana für sich zu behalten, schwor Stein und Bein, dass sie morgen früh wieder da sei, umarmte sie zum Abschied, trabte davon und sagte nicht: »Bis morgen.«
Trixi
Am frühen Nachmittag hörte ich den Schlüssel in der Tür. Endlich! Ich hatte mir Sorgen gemacht, rannte Lisa entgegen, schlang meine Arme um ihren Hals und drückte sie an mich.
Sie ließ die Einkaufstüten fallen und lachte. »Ich koch uns was, ja?« Und während sie geschäftig mit Einkäufen und dem Topf auf der Herdplatte hantierte, merkte ich, wie sehr ich sie vermisst hatte. Mehr als ich wollte. Ein komisches Gefühl. Dabei wusste ich noch immer kaum etwas von ihr. Erst am fünften Abend nach meiner Ankunft hatte sie die magische Tür ein paar Zentimeter geöffnet und mir einen Blick in ihr Leben erlaubt.
Lisa war bei ihrer Großmutter mütterlicherseits aufgewachsen. Die schlug oder trat gern mal zu und sperrte sie in den Keller. So wurden Kindergarten, Schule und Hort, der Status als Schlüsselkind, zur Befreiung, weil das Lisas Zeit im Haus der Großmutter reduzierte. Die kontrollierte weiter, soweit es ging, pustete beim Hausaufgabenmachen ihren Nikotinatem in Lisas Nacken und flippte oft aus, riss sie an den Haaren, donnerte ihr Gesicht ins aufgeschlagene Buch und brüllte: »Du dummer Bastard, lerne, lerne, lerne! In diesen Büchern steckt alles, was zählt: Wissen! Und Wissen ist Macht!«
Lisa war mit vierzehn abgehauen, am ersten Tag der Sommerferien, und weil die Großmutter sie auf der alljährlichen Kinderverschickung der Evangelen glaubte, meldete sie die Enkelin erst elf Tage später als vermisst, da hatte Lisa ihr neues Leben unter freiem Himmel schon im Griff. Es hielt knapp fünf Monate, sie entging zweimal knapp, aber glimpflich einer Vergewaltigung, und als sie beim dritten Mal fast draufging, weil sie aus einem fahrenden Laster sprang, richtete sie sich ein heimliches Nachtlager im Heizungskeller einer alleinstehenden, älteren Dame ein. Ihr erzählte sie, sie wohne um die Ecke, führte ihren Dackel aus und ging für sie einkaufen. Bis zum Frühjahr hatte sie damit und durch weitere Hilfsjobs, dem Klauen von Kaufhausschmuck und Fälschen von Monatsmarken für das Verkehrsnetz genug Geld beisammen für eine Bleibe. Ein 8-Quadratmeter-Zimmer für 130 Mark, inoffiziell untervermietet von einem Sozialhilfeempfänger, der die Miete vom Amt bekam und bei seiner Freundin wohnte.
Deshalb verstand sie, ohne mich langatmig auszuquetschen.
Jetzt saß ich in Lisas Zimmer auf ihrem verkrümelten Zweiersofa, nachdem sie Klamotten und Bücher hinter die Lehne gekippt hatte, um Platz zu machen. Sie gab Essen auf unsere Teller und setzte sich neben mich. Und trotzdem ihre Nudeln wie immer verklumpt und die Käsesoße wässrig war, mümmelte ich glückselig vor mich hin. Aber nicht lang.
»Ich bin da in was reingeraten«, sagte Lisa, kaum hatte ich die ersten Bissen runter. »Und hab keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Kann sein, die Bullen kreuzen demnächst hier auf. Aber ich will dich da raushalten, dein Leben ist schwierig genug.« Sie sah von ihrem Teller auf, und noch bevor ihr trauriger Blick mich traf, wusste ich, was kam, und würgte an einem Kloß im Hals.
»Ich hab eine neue Bleibe für dich organisiert«, fuhr sie fort. »Da wirst du dich wohlfühlen, dein neues Zimmer ist größer und das Haus ist voll mit jungen Leuten, die Miete nur fünfundzwanzig Mark im Monat, warm.« Sie kramte zwei Fünfzig-Mark-Scheine aus ihrer Hosentasche und gab sie mir. »Damit kommst du erst mal rum.« Und dann ruhte dieser ganz spezielle Blick auf mir, zärtlich und hart zugleich. »Wir sehen uns wieder, sobald ich klarer sehe!«
Ich wollte cool sein und »Alles klar« sagen, aber kaum kriegte ich meine Lippen auseinander, heulte ich los.
»He, he …« Lisa nahm mich in den Arm »Ich würd dich auch lieber hierbehalten, das kannst du mir echt glauben. Aber dieser Mist ist jetzt nun mal dazwischengekommen. Und später … wenn der sich geklärt hat: Solltest du aus deiner neuen Superbutze tatsächlich wieder zu mir Omma zurückwollen, dann kommst du eben wieder.« Sie strich mir die Tränen von den Wangen und lächelte. »Ich mag dich nämlich ziemlich gern.«
Und ich sah ihr an, dass das keine Lüge war.
Tag 3
Rosanas Stirn war schweißnass, ihre Augäpfel flatterten hinter den geschlossenen Lidern. Sie träumte ...
… war auf dem Weg zum Abiturfest ihrer Schule. Wo sie Jan wiedertreffen würde. Endlich. Viel zu lang hatten sie sich nicht gesehen. Aber jetzt war es soweit! Freudig hüpfte sie im Rücken einer Häuserreihe entlang, hielt dabei Jans Nachricht umklammert, die sie am Morgen in ihrem Schülerfach gefunden hatte. »Wir treffen uns an der Brücke.« Sie bog in einen Pfad ein, der durch brachliegende Felder führte. Kurz darauf ragte zwanzig Meter vor ihr eine Brücke auf, hohe Säulen hielten sie unter den Himmel geklemmt. Hier wurde der Boden weicher, verwandelte sich in ein Meer aus hellem Sand. Sie zog ihre Schuhe aus und eilte voran. Und da entdeckte sie Jan! Er lief vor ihr, seine Gestalt verschwamm im grellen Sonnenlicht, sie hob die Hand vor ihre Augen und lief los. »Jan!«, rief sie. »Warte!« Schneller und schneller rannte sie, um ihn einzuholen. Und als die Brücke über ihr war, verdunkelte sie den Himmel und Jan war weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ein ohrenbetäubender Knall ließ den Boden erzittern, schleuderte sie zu Boden, und von oben regneten Schmutz und Steine und Geröll auf sie herab. Sie wollte aufstehen, losgehen, aber der Sand hatte sich in rotes Moor verwandelt und saugte schmatzend an ihren Füßen. Sie schrie, ruderte mit den Armen, um nicht weiter zu versinken, und etwas prallte gegen ihr Gesicht. Sie griff danach, ein Ast? Aber es war ein Beinstumpf, weich und blutig, und vor ihr im Moor schwamm ein zerfetzter Unterarm vorbei, in den ein Lederriemen eingebrannt war … von Jans Rucksack. Sie schrie. Und schrie und schrie …
»Es ist nur ein Traum«, Sabine schüttelte sie sanft, »ein böser Traum!«
Rosana schlug die Augen auf, ihr Schreien erstarb. Sie sah verstört um sich, um ihre Pupillen leuchtete es, als hielte jemand dahinter eine grelle Lampe hoch.
»Jetzt ist alles gut!«, murmelte Sabine.
Rosana nickte.
Sabine ging raus, schmierte ein Brötchen und machte Kamillentee, als sie mit dem Tablett zurückkam, war Rosana wieder eingeschlafen. Sie schlich davon, schloss die Tür und streckte sich kurz darauf in ihrem Sessel im Wohnzimmer, machte den Fernseher an und den Ton leise, biss ins Brötchen und nahm einen Schluck Tee. Im Hintergrund des ernst dreinschauenden Tagesschausprechers war das Foto einer Autobahnbrücke zu sehen, darunter viel Geröll – die Kamera zoomte das Foto näher. Die Polizei hatte weiträumig ein rot-weißes Absperrband gespannt. Dann verschwand der Sprecher, mitsamt Autobahnbrücke, und ein anderes Foto füllte nun den Bildschirm aus, mit einem Gesicht, darunter ein Name: Claudia Töpfer. Sabine hörte auf zu kauen. Sie kannte die Frau! Sie lag nebenan und schlief.
*
Lisa schob sich durch die offene Tür des mehrstöckigen Hauses und eilte das Treppenhaus hinauf, es stank nach Terpentin. Aus einer Wohnungstür im zweiten Stock schob sich eine grauhaarige Frau, stützte sich auf ihren Besenstiel und sah ihr entgegen. »Grüß Gott!«
»Guten Tag.« Lisa drückte sich an ihr vorbei.
»Hier riecht es aber streng!«, rief die Frau. »Was um Himmels willen ist das?«
Lisa drehte sich um. »Ölfarbe! Wahrscheinlich sind Handwerker im Haus. Schönen Tag noch.« Sie ging weiter nach oben, blieb stehen, horchte. Unter ihr schloss sich die Tür. Sie eilte zwei Stockwerke weiter, vierte Etage, linke Wohnung, hatte Claudia ihr gestern Abend, als Sabine mal raus war, zugeflüstert. Lisa klopfte. Viermal kurz, einmal lang. Hinter der Tür näherten sich Schritte …
»Pizza kommt später«, wiederholte Lisa den Satz, den Claudia genannt hatte.
Ein Mann öffnete, Ende zwanzig, schmal, kurzes dunkelbraunes Haar, einen Kopf größer als sie. Sanft zog er sie in die Wohnung und schloss die Tür. Der Terpentingestank kam von hier.
»Robert?«, fragte Lisa.
Er nickte, unter seinen blauen Augen lagen dunkle Schatten. »Die neugierige Alte aus dem Zweiten hat dich abgepasst, stimmts?«
»Ja! Hat mich wegen dem Gestank gefragt, ich hab sie beruhigt, von wegen Handwerker im Haus. Sie ist wieder rein, hat nicht mitbekommen, wo ich hin bin.«
»Gut!« Er führte sie ins Zimmer, wies auf ein durchgesessenes Schlafsofa, dem einzigen Möbelstück. »Setz dich. Was kann ich für dich tun?« Sein Blick bohrte sich in Lisas. Er suchte nach etwas, um seine Befürchtungen zu zerstreuen. Und fand es nicht. »Raus damit. Was ist passiert?«
»Claudia schickt mich. Sie kam vorgestern Nacht zu mir, verletzt. Aber mehr weiß ich nicht. Sie hat mich hergeschickt in diese Wohnung. Und deinen Namen genannt. Mehr nicht.«
»Wo ist sie jetzt?« Er setzte sich neben sie.
»Ich hab sie bei einer Freundin untergebracht, wir haben sie verarztet. Sie war total fertig, die Klamotten blutig, zerrissen, hat lange keinen Ton gesagt, nur geschrien …«, berichtete Lisa. Und wie Claudia mitten in der Nacht vor ihrer Tür stand und ihr einen Schlüssel entgegenstreckte: »Bitte, ich … ich schaff das nicht …«, hatte sie gestammelt, »das Motorrad ist draußen, es muss weg!« Lisa hatte sie eilig in ihr Zimmer bugsiert, hatte Trixi instruiert, schnappte sich Lappen und Terpentin und rannte hinunter. Das Motorrad lag vor der Hinterhaustür, der Tank voll blutiger Schlieren. Es sprang gottlob beim vierten Versuch an. Lisa stellte es vier Kilometer entfernt in einem Hinterhof ab, reinigte es, kehrte in ihre Wohnung zurück und brachte Claudia zu Sabine. Jetzt erwähnte sie weder Trixi, noch nannte sie Sabines Namen, sagte nur, dass sie vertrauenswürdig war, politisch null aktiv und dem Staatsschutz garantiert unbekannt.
Robert hörte aufmerksam zu, bis Lisa abrupt verstummte und an den Knöpfen ihrer Jacke nestelte. »Anbieten kann ich dir leider nichts«, murmelte er in die Stille hinein, »hab alles schon entsorgt.« Er zeigte auf eine gepackte Sporttasche in der Ecke, daneben Tüten mit Abfall, und beäugte Lisas bleiches Gesicht, die blutleeren Lippen. »Du bist wohl eine gute Freundin von Claudia?«, fragte er.
»Nein! Ich kenne sie nicht mal, nur vom Sehen, und das bloß von Weitem.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich hab keine Ahnung, wieso sie zu mir kam oder woher sie meine Adresse hat.«
»Vermutlich wusste sie, dass du zuverlässig bist. So etwas spricht sich in der Szene rum, leider! Aber in diesem Fall …« Er lächelte, »war das Claudias Rettung. Gut gemacht!«
Lisa presste die Lippen zusammen, schluckte schwer. Und plötzlich waren sie da, die Tränen.
»He, he, alles wird gut.« Er legte den Arm um sie.
Sie presste die Stirn an seine Schulter, ihre Tränen hinterließen einen dunklen Fleck auf seinem blauen Pullover. Die Wucht der plötzlichen Bürde war einfach zu viel gewesen. Aber das merkte Lisa erst jetzt. Unfreiwillig zum Anker eines sinkenden Schiffs auserkoren, biss sie seit Tagen die Zähne zusammen, um tapfer zu sein inmitten der Katastrophe. Jetzt fühlte sich ihr Körper kalt und hart an, wie mumifiziert. An ihm hatte Claudia Halt gefunden, hatte sich angeklammert, statt unterzugehen.
»Du kannst jetzt auf keinen Fall zurück zu dieser Freundin«, sagte Robert. »Zu riskant. Lass ihr ein paar Zeilen zukommen. Sie muss unbedingt wissen, dass du sie nicht hängenlässt. Nach Claudia wird mittlerweile öffentlich gefahndet. Ich hab’s vorhin im Radio gehört, es heißt, sie sei an einem fehlgeschlagenen Sprengstoffanschlag beteiligt gewesen.«
»Verdammt!« Lisa sah ihn geschockt an.
Dann half sie ihm, die Wohnung fertig zu putzen. Robert hatte beschlossen, sie sofort aufzugeben. Und was er seit gestern Abend befürchtete, war jetzt klar: Etwas war schiefgegangen. Jemand hatte Robert vor zwei Wochen gesteckt, dass Jan eine militante Aktion plane. Deshalb hatte er hektisch ein Treffen mit seinem langjährigen Freund, den alle Jeyjey nannten, eingefädelt. Jetzt war er fast sicher, dass Jan in dieser missglückten Sache mit drinsteckte. Warum sonst war er gestern Nachmittag nicht zu ihrem Krisentreffen gekommen? Es war dringend, das wusste Jan, und er hatte zugesagt. War aber nicht aufgetaucht. Ohne Nachricht. Das stank zum Himmel. Denn Jan war zwar ein fürchterlicher Querkopf, aber zuverlässig. Die Tatsache, dass Lisa nun hier war, befeuerten Roberts Befürchtungen. Denn er kannte Claudia nicht, und nur von Jan konnte sie von der Wohnung hier erfahren haben und dass er dort anzutreffen war. Aber wo verdammt noch mal war Jeyjey abgeblieben? Keine der Meldungen hatte ihn erwähnt. Das war keine Entwarnung. Aus ermittlungstaktischen Gründen verschwieg der Staatsschutz viel. Gut möglich also, dass er verhaftet worden war, möglicherweise war auch Jan verletzt.
Robert wirbelte mit seinem Lappen über die Fenstergriffe, versuchte, seine Sorgen abzuschütteln. Säubern und diese Bude dichtmachen, das war alles, was jetzt zählte. Sie nutzten sie ohnehin zu lange schon, über ein Jahr. Und Jan war einer von nur drei Leuten, die sie kannten. Aber jetzt, mit Claudia und Lisa, waren es schon fünf. Also nichts wie raus hier. Und sollte Jeyjey tatsächlich verhaftet worden sein, hatten die Bullen ihn durchgefilzt wie ein Stück Hefeteig unter den Händen eines Bäckers, da genügte ein notiertes Kürzel oder eine winzige Fingerspur Fett auf einer bei ihm gefundenen Stadtkarte nah diesem Viertel, um diese Wohnung jetzt hochgradig zu gefährden. Der Staatsschutz würde ausschwärmen und alles im Umkreis von drei Kilometern auf den Kopf stellen, die Nachbarschaft auseinandernehmen, Fotos herumzeigen. Vielleicht waren sie schon da draußen … zumal leider auch nicht auszuschließen war, dass Lisa, die Anfängerin, observiert wurde und Bullen mit hergeschleppt hatte, ohne es zu merken.
Sie waren noch nicht ganz durch, da scheuchte Robert sie zur Tür, gab ihr diverse Anweisungen, umarmte sie und ließ sie raus. Siebzehn Minuten später ging auch er.
*
Frankfurt am Main, Sonderabteilung K 7
»Einer weniger, super! Die sollen sich gern alle selbst in die Luft sprengen!« Harald Michaelis’ Finger pochte auf das Foto der gestern aufgefundenen Leiche des jungen Attentäters. »Andererseits«, er stand auf und grinste, »ist’s natürlich schade, dass man nicht selbst mal in diesen Sauhaufen reinhalten darf …«
Stefan Steinert warf ihm einen missbilligenden Blick zu, verkniff sich jeden Kommentar, es wäre reine Energieverschwendung. Er konzentrierte sich weiter auf die Fotos auf seinem Schreibtisch. Kein schöner Anblick. Die Körperteile des jungen Toten lagen im Radius von 115 Metern verstreut. Sie waren eindeutig identifiziert. Jan Jakobi, wäre in zwei Monaten fünfundzwanzig geworden und wurde seit über zwei Jahren als linksradikaler Terrorsympathisant in den Akten geführt. Spitzname: Jeyjey.
»Die engmaschige Beobachtung der Szene, aus der der Tote kam, ist eingefädelt, wir heben die Nachrichtensperre über seine Beteiligung in wenigen Stunden auf. Sobald die Info raus ist, wird das die Szene weiter aufscheuchen, mehr noch als die Fahndung nach seiner Komplizin. Mit den in den nächsten Tagen gesammelten Infos können wir dann präziser weitermachen.«
»Präziser also, hm.« Michaelis rollte die Augen und zog die Tür auf. »Besser wäre, der verdammte Rest sprengt sich auch noch in die Luft!« Sein grölendes Lachen übertönte die sich entfernenden Schritte.
Stefan Steinert war froh, als er weg war. Er hielt nichts von Michaelis. Ein ewig Gestriger mitsamt veralteten Methoden aus den Siebzigern. Reinhalten, das war von vorgestern. Gegen diesen antiquierten Schwachsinn war die westdeutsche Guerilla längst immun. Das hatten die vergangenen Jahre bewiesen. Nach jedem Fahndungserfolg oder Toten waren der Hydra des westdeutschen Linksterrorismus immer neue Köpfe gewachsen. Jetzt war das einstmalige Sympathisantenheer zwar überaltert und verbraucht, aber dafür boten die neuen Bewegungen frisches und unerschöpfliches Rekrutierungspotenzial. Aber trotz verfeinerter und potenzierter Überwachungsmethoden stocherten die Ermittlungsbehörden zunehmend im Dunkel. Darauf waren die hiesigen Staatsdienst-Träumer unsanft gestoßen worden, vor fünf Monaten, als sechs Mitglieder der RAF erwischt wurden. Ein Zufallstreffer, der vor allem eins bewies: wie ahnungslos die Anti-Terror-Fahnder in Wirklichkeit waren, auch über die Zusammensetzung der derzeitigen RAF-Truppe. Von den sechs gefassten Mitgliedern waren zwei völlig unbekannt gewesen! Mehr als dreiunddreißig Prozent! Zwei von sechs! Bewaffnete Staatsfeinde, Topterroristen, über die es keinerlei Hinweise gab, keine Akten, nicht die klitzekleinste Notiz! Namen und gesichtslose Phantome, die trotz flächendeckender Überwachungsmaßnahmen und Hunderter Spitzel über Jahre unsichtbar geblieben waren! Diese Erkenntnis war bitter, hatte am Ende aber auch etwas Positives gehabt. Ohne diesen Schock hätte es vermutlich weitere Jahre gedauert, bis die Korinthenkacker im Innenministerium endlich Nägel mit Köpfen gemacht hätten. Aber so hatte die bundesdeutsche Anti-Terror-Elite eilig mit Innenministerium und Geheimdiensten beraten und stellte dann hurtig die faktisch längst laufende Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Polizei auf eine andere gesetzliche Grundlage, vernetzten die Strukturen verschiedener Behörden enger und gründeten die Koordinierungsgruppe Terrorismus, die KGT. Zunächst ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen, ein derzeit noch geheimer Dachverband für die effizientere Jagd der Zukunft. In ihm würde der europäische Datenaustausch und länderübergreifende, polizeiliche und geheimdienstliche Zusammenarbeit kontinuierlich intensiviert. Es hatten diskrete Treffen stattgefunden. Spätestens in zwölf Monaten, so der Plan, würde die KGT dann auch offiziell aus der Taufe gehoben werden. Eine erste Entscheidung in diesem Rahmen war der unmittelbare Import des Counter Insurgency Programms, kurz CIP, aus den USA. Deshalb war Steinert hier. Er war als einziger bundesdeutscher Spezialist für dieses Programm aus Nevada zurück nach Deutschland an die Spitze der Sonderabteilung K 7 in Frankfurt am Main beordert worden, um das CIP von Hessen aus, der Mitte Deutschlands, an die heimischen Gegebenheiten anzupassen und mit ihm dem Linksterror endlich beizukommen – in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener BKA.
Steinerts ranghöchster Vorgesetzter war offiziell der Polizeipräsident. Inoffiziell erhielt er seine Weisungen aus dem Innenministerium. Von Schöller, der dort seit über acht Jahren einen hoch dotierten Posten innehatte, auch wenn niemand so recht wusste, was genau er machte. Hinter vorgehaltener Hand nannte man ihn den Schattenmann, und es ging das Gerücht, er sei nicht nur die rechte Hand des jeweils im Amt befindlichen Geheimdienstkoordinators, sondern auch sein Hirn. Schöller hatte bei ihrem ersten Treffen in Nevada unmissverständlich klargemacht, dass er direkter und permanenter Ansprechpartner sein würde, um für den reibungslosen Ablauf der anstehenden strategischen Weichenstellungen zu sorgen.
»Unsere neuen Wunderwaffen – das sind vor allem geheimdienstlichen Einsätze.« Schöller war Fan des CIP und machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung. Kein Wunder. Der konsequente Einsatz des CIP hatte in den USA geschafft, was vor zehn Jahren noch ausgeschlossen schien: die wachsende, überaus starke Black Panther- und Weathermen-Bewegung zu vernichten. Staatsfeinde, die Tausende Mitglieder, Zehntausende Helfer und ein Mehrfaches an Sympathisanten gehabt hatten! Dagegen waren die RAFler hier ein Pappenstiel. Aber ärgerlich resistent. Eben. Der CIP-Einsatz in Westdeutschland war die einzig adäquate Antwort auf diese Tatsache. Die Rekrutierung der jüngsten Generation der RAF fand