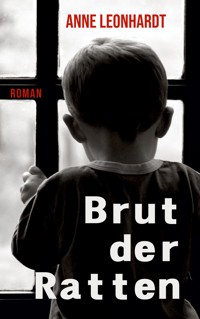
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Andrea Meisners Hausmitbewohnerin stirbt auf tragische Weise. Selbstmord heißt es. Astrid Rohndorff, die Tochter, glaubt nicht daran. Tage später werden im Pharmakonzern DPT die beiden Leiter eliminiert. Der Mörder: ein Phantom. In der Wohnung ihrer Mutter findet Astrid Notizen über DPT. Zusammen mit Andrea forscht sie weiter. Bald führt eine heiße Spur die beiden zu einem monströsen Komplott, dessen lange Schatten bis in die Euthanasie der 1940er Jahre reicht, und zu den Opfern der Gegenwart: tausende Kleinkinder aus Heimen und pädagogischen Einrichtungen der 1970er und 1980er Jahre. Dann nimmt eine Fremde mit Andrea Kontakt auf. Sie ist eins der Kinder, die entkommen sind. Und ihren Peinigern den Krieg erklärt haben. Aber die schlagen zurück und eine Serie von hunderten Todesfällen erschüttert das Land. Jetzt müssen auch Andrea und Astrid um ihr Leben fürchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Andrea Meisner ist zu spät, um die alte Dame aus ihrem Haus zu retten. Die habe sich aus dem Fenster ihrer Wohnung gestürzt, heißt es. Astrid Rohndorff, die Tochter der Toten, glaubt nicht daran. Aber die Polizei sieht keinen Anlass für Ermittlungen.
Kurz darauf werden im Pharmakonzern DPT die beiden Leiter eliminiert.
Der Mörder: ein Phantom.
Andrea und Astrid verfolgen bald eine heiße Spur. Steht der Tod von Astrids Mutter mit einem monströsen Komplott in Verbindung? Die Euthanasie des Zweiten Weltkrieges wirft lange Schatten. Die neuen Opfer: Tausende Kleinkinder aus westdeutschen Heimen und pädagogischen Einrichtungen der 1970er und 1980er-Jahre.
Eine Fremde, die Opfer war, nimmt mit Andrea Kontakt auf. Sie ist nicht allein und hat ihren Peinigern den Krieg erklärt. Als dieser eskaliert, erschüttert eine Serie von Hunderten Todesfällen das Land. Und auch Andrea und Astrid müssen plötzlich um ihr Leben fürchten.
Die Autorin
Geboren 1960, aufgewachsen in Frankfurt am Main, Stockholm und London. Lebte u. a. in Kopenhagen und Berlin. Meist aber in Frankfurt am Main. Broterwerb v. a. als Datentypistin, Putzfrau, Kleinhändlerin und Handwerkerin.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
TEIL I
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
TEIL II
KAPITEL SECHSZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
EPILOG
Quellen
PROLOG
Die Sterbende lebte gerade noch lang genug, um ein letztes Mal den Himmel zu sehen. Und einen Namen zu flüstern.
Dann war es vorbei.
Andrea kniete neben ihr, fühlte nichts mehr, ihr Körper wie Stein, als habe der letzte Atemzug der Sterbenden auch aus ihr alles Leben gesaugt. Dabei ahnte sie da noch nicht, dass das erst der Anfang war. Denn wenige Wochen später waren sie alle tot.
Nur Andrea war noch da. Und tauchte unter. Zog von einem bis zum anderen Ende der Welt, bis sie sich sicher fühlte. Sicher genug, um zu bleiben. Und diese Geschichte zu erzählen.
TEIL I
Sommer 2008
EINS
Sonntag, 11.45 Uhr
Siegrun Rohndorff war kaum vier Jahre alt, als sie im Frühjahr 1940 an der Hand der Mutter erstmals die Treppen hinunterstolperte, mitten in der Nacht, raus, nur raus; die Fliegeralarmsirenen jaulten durchs Viertel, sie rannten ins Haus nebenan und stolperten die steilen Stufen in den Keller hinunter, wo Nachbarn und Fremde dicht gedrängt auf dem Boden hockten und sich aneinanderklammerten. Es roch nach Schweiß, Urin und Angst. Wie immer dann.
In den darauffolgenden Jahren ging Siegruns Kindheit weiter unter im Bombenhagel tief fliegender Kampfjets, unzähliger Detonationen und den Schreien Sterbender. Mit sieben lief sie durch das zerbombte Frankfurt, stakste über verletzte, schreiende Menschen, über tote Körper und vereistes Blut, das der bitterkalte Winter für die Zukunft zu konservieren schien.
Nun ging Siegrun Rohndorff auf die zweiundsiebzig zu. Alt genug also, um zu glauben, sie habe schon alles gesehen. Aber das stimmte nicht. Das war ihr schlagartig klar geworden, vor zwei Minuten, seit sie die Wiedergabe des Videorekorders gedrückt und die ersten Sekunden des Films gesehen hatte.
Alle Farbe war aus Siegruns Gesicht gewichen, das sie erschrocken abgewandt hatte. Sie holte tief Luft, spulte zurück und zwang sich, wieder hinzusehen. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme war ohne Ton und grottenschlecht. Der Junge, mit dem der Film begann, war höchstens vier. Er lag in einem winzigen Raum auf einer Pritsche, sein Körper verkrümmt, die Knie bis zum Kinn angezogen. Seine Augen quollen aus den Höhlen, der Mund war weit aufgerissen.
Siegruns Pupillen weiteten sich. Der erneute Schock verlangsamte ihre Reaktion, in Zeitlupe drangen die Bilder des Films bis zu jenem Bereich ihres Gehirns vor, auf den es ankam. Jetzt. Siegruns Oberkörper kippte nach vorn. Sie erbrach sich über den Couchtisch, schlug ihre Hand vor den Mund, stützte sich auf die Tischplatte, rappelte sich hoch und wankte ins Bad. Sackte vor der Toilettenschüssel auf die Knie, beugte sich vor und entleerte, was in ihrem Magen noch übrig war. Acht Minuten später kehrte sie ins Wohnzimmer zurück, ihre Bewegungen steif, mechanisch. Angestrengt hielt sie den Blick nach unten. Machte einen Bogen um den noch laufenden Rekorder und konzentrierte sich auf den Eimer, den sie in der Rechten umklammert hielt. Wischte den Tisch, wrang den Lappen aus, ging auf die Knie, säuberte den Boden. Die Dielen bald blitzsauber, wischte sie trotzdem weiter, inbrünstig. Nur nicht an das denken, was sie soeben gesehen hatte … nicht rüber zum Bildschirm schauen.
Sie ignorierte das Sausen in ihren Ohren. Hielt schließlich inne, holte Luft und wünschte nichts mehr als zu vergessen oder einfach hier unten zu bleiben, auf Knien, auf dem Boden ihrer Wohnung, für den Rest ihres Lebens. Aber sie riss sich zusammen. Ließ den Lappen in den Eimer gleiten, richtete schwerfällig ihren Oberkörper auf, streckte die Hände aus und betrachtete sie. Sie zitterten.
Am Rand ihres Gesichtsfelds flimmerte es vom Bildschirm her. Siegrun atmete aus und warf einen kurzen Blick rüber. Sehr kurz. Nur Streifen dort. Das Video war zu Ende.
Sie presste die Lippen zusammen. Du darfst jetzt nicht einknicken, schoss ihr durch den Kopf, nicht aufgeben. Nicht jetzt, nicht auf den allerletzten Metern. Irgendjemand musste diese Verbrecher stoppen.
Sie drückte ihren schmerzenden Rücken durch, erhob sich stöhnend, trug den Eimer zurück ins Badezimmer, spülte den Lappen aus und verstaute die Utensilien im Putzschrank im Flur. Dann kehrte sie ins Wohnzimmer zurück. Straffte die Schultern und trat vor zum Bildschirm, spulte das Band zurück und drückte auf Start. Schwerfällig setzte sie sich aufs Sofa und zwang sich, erneut hinzusehen.
Die Pritsche, auf der der Junge lag, das einzige Mobiliar im Raum, hob sich ab von der weißen Wand. Auch in den folgenden Szenen waren Kinder zu sehen, einzeln, auf Pritschen, immer dieselbe vielleicht. Der Raum, etwa sechs Quadratmeter groß, grobe Steinmauern, geweißt. Die Mädchen und Jungs, zwei, drei, vielleicht vier Jahre alt, jede Sequenz ein anderes Kind, minutenlang. Direkt über der Pritsche befand sich eine handtellergroße Luke in der Wand, die sich irgendwann öffnete, mal schneller, mal später.
Die Kamera hatte sich auf die Gesichter konzentriert. Das siebte Kind war ein Mädchen, möglicherweise etwas älter als die anderen. Sie rollte sich nicht zusammen, wehrte sich. Wohl deshalb griffen die Ratten an. Blut rann über ihr Gesicht, den Hals, wurde vom Kragen der hellen Bluse aufgesogen.
Siegrun würgte erneut. Wandte sich ab.
In diesem Augenblick klingelte es an der Tür. Sie runzelte die Stirn, stand auf, schlich auf Zehenspitzen in den Flur hinaus und spähte durch den Spion.
»Du?« Erleichtert riss sie die Tür auf. »Wie schön!« Sie lächelte.
Vier Minuten später pumpte sich nackter Terror durch Siegrun Rohndorffs Blutbahn. Aber sie litt nicht mehr. Der Schock paralysierte alles. Und neutralisierte den sanften Luftstrom, der ihr Gesicht streichelte, kurz bevor ihr Körper auf den Asphalt schlug. Aber als sie starb, wusste sie, warum.
*
12.09 Uhr
Andrea Meisner riss die Arme über den Kopf und duckte sich. Am Küchenfenster ihrer Hinterhauswohnung schoss etwas vorbei, prallte auf den Steinboden draußen vorm Fenster. Der Krümel übersäte Linoleumboden zitterte. Dann Stille. Nur das. Kein Erdbeben, kein Tornado, kein Weltuntergang. Andrea ließ die Arme sinken, hob den Kopf und sah ängstlich hinaus.
An der Wand gegenüber hing der verblasste Läufer über der rostigen Teppichstange. Wie immer. Andrea stand auf, lehnte sich über den Tisch und sah hinaus auf den Hinterhof. Ein vertrockneter Holunder versperrte die Sicht. Sie streckte sich auf Zehenspitzen. Und schrie auf. Draußen lag Frau Rohndorff aus dem obersten Stock kaum zwei Meter von der Hausmauer entfernt auf dem Rücken, das linke Bein klemmte verdreht unter der Hüfte. Reglos starrte die alte Dame in den wolkenlosen Himmel.
Andrea schluckte schwer, schnappte ihr Handy, wählte den Notruf, riss die Wohnungstür auf und hechtete durch die offene Hinterhaustür nach draußen.
»Sie kam von oben und jetzt liegt sie da«, überschrie sie die präzisen Fragen der Stimme aus dem Handy. Es dauerte, bis sie ihr zuhörte. »Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es schlimm ist, sehr schlimm!« Sie gab die Adresse durch, legte auf und kniete sich neben Siegrun Rohndorff. Die sah jetzt nicht mehr in den Himmel, sondern Andrea an. Starr. Aus ihrem Mundwinkel sickerte ein Faden Blut.
Sie ist tot, dachte Andrea. Aber dann kam plötzlich Spannung in den starren Blick, und die Wimpern … sie flimmerten!
»Halten Sie durch«, sagte Andrea. Und gleich noch mal, lauter. Blasiges Blut quoll aus dem Mund der alten Dame und ein Röcheln.
Andrea wollte etwas tun, aber was? Diffuse Fetzen aus dem einstmaligen Erste-Hilfe-Kurs … die Seitenlage … waberten durch ihr Gehirn, verdichteten sich … das Ersticken verhindern, das war wichtig! Also zog Andrea behutsam an Siegrun Rohndorffs Schulter, drehte ihren Kopf ein klein wenig zur Seite. Darunter war der Boden rotgetränkt, Blut rann aus dem Hinterkopf.
»Halten Sie durch!«, rief Andrea. »Gleich kommt Hilfe!«
Siegrun Rohndorffs Wimpern flatterten. Die Halsschlagader spannte sich, ihr linker Arm zuckte. Mehrmals. Die Sterbende wollte sich aufrichten. Dafür sammelte sie alle Kräfte. Aber da waren keine mehr. Die Ader, die sich von der Nasenwurzel quer über ihre Stirn bis zum Haaransatz zog, schwoll an, die Farbe um die Pupillen wurden heller, die Augen weiteten sich, fixierten Andrea.
Die kämpfte gegen das Gefühl des Ertrinkens an in diesem Graublau, in dem das ganze Leben der Sterbenden schwamm.
»Halten Sie durch, bitte«, flüsterte Andrea den Tränen nah.
Der Mund unter ihr öffnete sich leicht, der Körper krampfte. Andrea hielt ihr Ohr an die Lippen der Sterbenden. Aber nur ein dünnes Pfeifen drang heraus. Dann ein Flüstern, nicht mehr als ein Stakkato des Atems. Der Körper erschlaffte.
Neun Minuten später kam die Ambulanz. Zu spät. Beamte des nächstgelegenen Reviers trafen zeitgleich ein, befragten die Hausbewohner aus dem Vorder- und Hinterhaus. Viele hatten sich um die Leiche versammelt. Keiner hatte engeren Kontakt zu Siegrun Rohndorff gehabt. Niemand wusste, was passiert war. Der eintreffende Arzt stellte keinerlei Fremdverschulden fest. Ein Abschiedsbrief oder sonstige Hinweise, die Aufschluss hätten geben können, wurden in der Wohnung der Verstorbenen nicht gefunden. Nahezu alle Bewohner waren an diesem Sonntagmittag zu Hause gewesen. Einige hatten einen Aufprall gehört. Zwei gaben an, kurz zuvor habe eine Frau geschrien, waren auf Nachfrage unsicher, ob das aus ihren laufenden Fernsehern oder Frau Rohndorffs Wohnung gekommen war. Nur Andrea hatte den Kurier bemerkt, der gegen elf am Hinterhaus geklingelt hatte. Sie wohnte im Erdgeschoss und war gerade in ihrer Küche gewesen, konnte die grellorange Weste des Boten beschreiben, aber nicht, wo der Mann geklingelt hatte. Jemand war die Treppen hinuntergekommen, eine weibliche Stimme hatte ihn hier unten im Flur abgefertigt. Möglich, dass es Siegrun Rohndorff gewesen war. Denn gleichzeitig waren die Orgelklänge im Haus verstummt. Auch das war nur Andrea aufgefallen. Kein Wunder. Seit sie in dieses Haus gezogen war, hatte sie das sonntägliche Gedudel aus der Rohndorffschen Wohnung genervt. Es beamte sie zurück in die zugige Vorhalle des Kinderheims, wo sie vor über zwei Jahrzehnten allmorgendlich strammstand. In Reih und Glied, mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen. Der Blick der Ordensschwester allgegenwärtig, ihr Keifen, das sich durch den Geruch von Bohnerwachs und Kinderschweiß fräste.
Am Spätnachmittag des folgenden Tages war der Hinterhof gereinigt, die Befragungen beendet. Niemandem war Verdächtiges aufgefallen. Der abschließende Polizeibericht schloss Fremdverschulden aus. Siegrun Rohndorff, so hieß es, habe sich gegen zwölf Uhr mittags in suizidaler Absicht aus dem Fenster ihrer Wohnung im fünften Stock gestürzt. Die Verstorbene hinterließ eine Tochter, Astrid Rohndorff. Die lebte in Prag, studierte Betriebswirtschaft an der europäischen Handelsschule. Ihre Festnetznummer klebte auf Siegrun Rohndorffs Flurschrank neben dem Telefon. Erfolglos hatte man versucht, sie zu erreichen, hinterließ schließlich eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, sie möge bitte dringend zurückrufen. Es ginge um einen tragischen Zwischenfall, der ihre Mutter beträfe.
*
Erst am Nachmittag des folgenden Montags gegen halb drei meldete sich Astrid Rohndorff telefonisch. Sie sei gerade erst von einem verlängerten Wochenende zurück, was denn passiert wäre. Man stellte sie durch zum zuständigen Kriminalhauptkommissar Jensen. Der versuchte redlich, die hässlichen Fakten zu vernuscheln und Astrid Rohndorff zu einem Flug nach Frankfurt zu bewegen. Aber die ließ nicht locker. Fragte und fragte und fragte.
»Es tut mir sehr leid«, blieb KHK Jensen am Ende keine Wahl, »aber Ihre Mutter hat sich gestern das Leben genommen.« Stille.
»Hallo?«, rief Jensen in die Leitung. Nichts. »Sind Sie noch da?«
»Das kann nicht sein«, sagte Astrid Rohndorff. »Ein Irrtum. Eine Verwechslung.« Das wiederholte sie mehrmals. Laut. Und lauter.
Als KHK Jensen endlich wieder zu Wort kam, sprach er langsam, leise und ruhig. Schlug diese spezifische Tonlage ein, die er in einer Schulung erlernt hatte. Klar, aber sanft. Das vereine Mitgefühl, Respekt und die nötige Distanz, hatte es geheißen, würde den Hinterbliebenen beistehen. Hubert Jensen hatte nahezu vierzig Dienstjahre und über zwei Dutzend persönlich überbrachte Todesbotschaften auf dem Buckel und glaubte nicht mehr an diesen Quatsch. Aber das ließ er sich nicht anmerken. Wie so vieles.
Hubert Jensen war unter seinen Kollegen und Kolleginnen nicht beliebt. Aber auch nicht das Gegenteil. Kein Wunder. Er war keiner, der seine Gefühle zu Markte trug. Bot nichts zum Anfassen. Gar nichts. Das erlaubte allen, alles Mögliche in ihm zu sehen. Kein Gesicht zu haben war auch eine Art von Profil. Jensen glänzte mit Wortkargheit, gepaart mit stoischer Ruhe. In Turbulenzen gab er sich unerschütterlich, ein Fels. Demonstrierte Stärke. An die nur er selbst nicht mehr glaubte. Schon lang nicht mehr. Dass seine Frau sich vor drei Jahren von ihm getrennt hatte, machte es nicht besser. Sie wolle einen Mann, der sie nicht wie ein abgeschabtes Möbelstück behandele, waren ihre Worte gewesen. Nicht das erste Mal. Aber dann plötzlich endgültig. Das hatte Jensen erschüttert. Und die in den folgenden Jahren wachsende Erkenntnis, dass es nicht eigentlich der Verlust seiner Ehefrau war, der ihm am meisten zu schaffen machte, sondern das Alleinsein. Wenn ihm nun sein zerknittertes Gesicht allmorgendlich im Spiegel begegnete, sang es immer dasselbe Lied. Von mühsamen Nächten voller Träume, in denen er ein anderer war. Einer, der nicht verlassen wurde. Einer, den er nicht kannte. Oft wachte Jensen mitten in der Nacht auf. Dann tigerte er herum und bekämpfte die Realität mit Kühlschrankrazzien. Fraß sie zurück ins Vergessen. Dahin, wohin er zeit seines Lebens auch alles andere geschluckt hatte.
Genau das hatte ihn stetig nach oben gebracht. Dorthin, wo Gefühle nicht mehr gefragt waren. Oder Freunde.
»Glauben Sie mir«, sagte er jetzt mit sonorer, wohltemperierter Stimme, »zumindest hat Ihre Mutter keinerlei Schmerzen gehabt.«
Astrid Rohndorff schrie ohne jede Vorwarnung los. Markerschütternd schraubte sich ihr Crescendo in schrille Höhen. Jensen riss den Telefonhörer vom Ohr, holte tief Luft und zählte bis fünf. Dann nutzte er eine winzige Atempause der Schreienden und bat sie erneut, zu kommen. Selbstverständlich würde er einen Kollegen schicken, der sie vom Flughafen abhole. Keine Antwort.
»Hallo?«, fragte er.
Aber die Leitung war tot. Astrid Rohndorff hatte aufgelegt.
Knapp drei Stunden später stand sie in Jensens Büro, eine kleine Reisetasche in der Hand. Trotz ihrer 1,68 Meter wirkte sie zierlich. Lange, schwarze Haare und ein kurzer Pony umrahmten das schmale, hohlwangige, blasse Gesicht, das versteinert wirkte, die mandelförmigen Augen riesig darin.
Jensen bat sie, Platz zu nehmen.
»Das kann nicht meine Mutter sein.« Sie starrte auf die Wand hinter ihm. »Deshalb bin ich hier. Ganz sicher nicht.«
Er klärte sie über die Tatsachen auf. Klar, leise und sanft. Trotz der Entfernung, die der massige Schreibtisch zwischen ihnen schaffte, sah er die bläuliche Ader an Astrid Rohndorffs linker Schläfe pochen.
»Selbstmord ist unmöglich«, fuhr sie fort. »Niemals würde sie so etwas tun. Diese Tote … das ist nicht meine Mutter.«
Jensen begleitete sie in die Pathologie zwecks Identifizierung. Vierzig Minuten später waren sie zurück.
»Es war kein Selbstmord.« Astrid Rohndorff presste die Reisetasche gegen ihren Bauch.
»Wann haben Sie Ihre Mutter zuletzt gesehen?« Jensen plagten stechende Kopfschmerzen.
Augen wie Scheinwerfer richteten sich auf ihn. Starr. »Es war kein Selbstmord.«
Das hier hat keinen Sinn. Jensen schickte sie nach Hause, er würde sie später befragen. Bat noch um ihre Handynummer und darum, informiert zu werden, falls sie abreisen wollte. Sie nickte und verließ sein Büro wortlos, ihr Körper aufrecht, als habe sie einen Stock verschluckt. Noch immer keine Träne. Der Schock.
Zwei Minuten später war sie zurück, stand in seiner Tür. »Ist sie schon freigegeben, die Leiche?«
Wer von den stumpfsinnigen Kollegen hatte ihr gegenüber diese hässlichen Worte gebraucht, fragte sich Jensen und sagte: »Ja.«
»Ich bin nicht von gestern, wissen Sie.« Sie trat näher.
»Natürlich nicht.« Jensen unterdrückte den Impuls, wegzulaufen.
»Es gibt keine Untersuchung mehr, nicht wahr?«
»Wir fanden keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden. Ja, tatsächlich ist der Fall abgeschloss…«
»Der Fall!«, unterbrach Astrid Rohndorff und sah auf ihre Schuhe.
Jensen lehnte sich über seinen Schreibtisch, zog eine Visitenkarte aus einem Kästchen und streckte ihr die Karte hin. »Falls Sie Hilfe brauchen, es gibt da eine Psychologin in der Nähe …«
Sie warf ihm einen undefinierbaren Blick zu, nahm die Karte und trat in den Flur. Er folgte ihr hinaus, sah ihr nach. Sie warf die Karte in den Mülleimer neben dem Getränkeautomaten und eilte Richtung Ausgang.
Die folgenden Stunden verbrachte Astrid Rohndorff wie in Trance. Sie nahm sich ein Hotelzimmer am Bahnhof, stellte dort ihre Tasche ab, ging wieder und ließ sich treiben. Über die Kaiserstraße hinein in die City, in die Fußgängerpassage der Zeil, die wie immer am späten Nachmittag von Menschen geflutet war. Über eine Stunde lang war sie blind für alles um sie herum, nur ein tauber Körper, Spielball der Bewegungen der Massen, die ihn in sich aufnahmen. Irgendwann ergatterte das grelle Rot eines Hosenanzugs ihre Aufmerksamkeit hinter einem Schaufenster, gegen das eine Traube älterer Damen sie drückte. Danach suchte sie nach einem passenden Kleid für ihre Mutter, ein Totengewand für ihre letzte Reise. Natürlich hätte sie eines aus der Wohnung holen können, aber allein der Gedanke, dort hinzugehen, ließ Astrid erschauern. Nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen …
Am späten Abend kehrte sie in ihr Hotelzimmer zurück, und kaum hatte sie die Tüte mit dem eingekauften pastellgrünen Kostüm neben das Bett gestellt, fiel das betäubende Polster geschäftiger Aktivität von ihr ab. In ihrer Erinnerung rasten Bilder der Mutter vorbei. Astrid eilte ins Bad, zog sich aus, duschte, zog sich um und eilte aus dem Zimmer nach unten in die Hotelbar. Schwankte nach Mitternacht zurück, warf sich aufs Bett und sah hinauf zur schwimmenden Decke. Mehrmals schleppte sie sich ins Bad und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Zurück im Bett war es, als schaukele sie auf einer zwischen zwei Masten vertäuten Hängematte auf einem durch wilde See pflügenden Kutter. Um halb sechs schlief sie ein.
Drei Stunden später war sie hellwach und noch immer überzeugt, dass ihre Mutter sich nie und nimmer umgebracht hatte. Auch wenn sie keinen Schimmer hatte, was genau in letzter Zeit in Siegrun vorgegangen war. Fast hätte sie sie am letzten Sonntag sogar noch gesehen, wäre sie bloß hin zu ihr … Es war ein spontaner Gedanke gewesen. Astrid, auf ihrer Heimreise, kam aus Göttingen, hatte ihre Mutter überraschen wollen, und war am Sonntagvormittag aus dem Zug am Frankfurter Hauptbahnhof gestiegen statt weiter bis zum Flughafen zu fahren. Da ihr Flug nach Prag erst drei Stunden später ging, war Zeit genug für eine Stippvisite. Aber dann … Sie rang um Erinnerung, geriet ins Grübeln; warum genau hatte ihr Besuch bei Siegrun eigentlich nicht geklappt? Die U-Bahn nach Bornheim Mitte, erinnerte sie sich jetzt vage, hatte erhebliche Verspätung gehabt wegen Gleisarbeiten. Sie sorgte sich, den Flug vielleicht doch zu verpassen, hatte sich beeilt, das wusste sie noch, als sie schließlich die knapp hundertfünfzig Meter die Berger Straße hochgelaufen war. Aber dann? War Siegrun nicht da gewesen? Oder war sie zurück zur U-Bahn? Aber da war nur Nebel. Vermutlich der Schock. Der letzte Besuch bei der Mutter, der jetzt klar und deutlich in Astrid aufstieg, das war … Sie überlegte, rechnete. Ja. Der war vor fast zwei Monaten gewesen, ein kurzes Wochenende im Juli, die übliche Frankfurter Käseglockenhitze drückte, sie hatten es sich in der Bornheimer Wohnung gemütlich gemacht. Liebevoll servierte Siegrun ein Drei-Gänge-Menü und die letzten Neuigkeiten. Ernster als üblich war sie gewesen. Mit dem Grund dafür platzte sie aber erst am Sonntagnachmittag heraus, da war Astrid schon am Gehen, stand in der offenen Tür, ihre gepackte Reisetasche in der Hand.
»Ich habe endlich eine Spur von ihm!« Siegrun hatte freudig gelächelt. »Bin da aber noch ganz am Anfang. Wenn du das nächste Mal kommst, erzähle ich dir mehr.« Astrid hatte nicht nachgebohrt. Wozu auch? Siegruns Familienforscherei hatte vor ein paar Jahren begonnen. Ein Hobby, ein sinnloses, fand Astrid. Und traurig dazu. Wenig begeistert hatte sie Siegrun zugenickt, sie umarmt und war gegangen.
Christian Rohndorff, Siegruns Vater, galt seit Sommer 1945 als verschollen und wurde ein paar Jahre später für tot erklärt. Er war kein Nazi gewesen, betonte Siegrun bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, sondern Arzt. Der sein Studium im Universitätsklinikum München kurz vor Ausbruch des Krieges beendete, ein Jahr darauf habilitierte und danach ein Sanatorium leitete. Er war nicht in die Nazischlachten gezogen und hatte es nach Kriegsende trotzdem nicht zurück nach Hause geschafft. Wurde stattdessen Teil jener zahllosen Geister, die im eilends organisierten Frieden weder lebten noch starben. Nie hatte es eine Leiche gegeben. Oder ein Abschied. Nur diese kargen Zeilen einer Mitteilung, die Ende Februar 1948 in die Hände von Siegruns Mutter flatterte:
… müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Ehemann verstorben ist. Er wurde bei der Bombardierung Magdeburgs schwer verletzt und verstarb wenige Tage später …
Am Tag der Ankunft dieser Nachricht war Siegrun zwölf. Die Mutter war in die Küche gekommen, setzte sich an den Tisch und legte das Blatt darauf. »Es ist vorbei«, hatte sie geflüstert.
»Mama?« Siegrun war zu ihr geeilt, streckte die Arme nach ihr aus. »Mama?« Keine Reaktion. Die Frau, die eben noch ihre Mutter gewesen war, verschwand in dieser Sekunde. Eingesaugt in die lange anklopfende Depression, zuvor leidlich abgewehrt durch die Hoffnung auf Rückkehr des geliebten Ehemannes oder den Erfolg ihres DRK-Suchantrages, einer von vierzehn Millionen. Alle paar Tage war Siegruns Mutter in die Innenstadt gepilgert, um dort die Tafeln mit Hunderten aufgepinnten Notizen abzusuchen und sich danach in die Schlange vor dem Büro des Suchdienstes zu stellen.
Die Todesnachricht entriss ihr die letzte Kraft. Die Depression übernahm und radierte in Sekunden aus, was an Leben übrig gewesen war. Siegrun Rohndorff blieb allein zurück. Kämpfte verzweifelt darum, ihre Mutter zurückzuholen. Wenigstens noch einen Hauch dessen zu erhaschen, was einmal da gewesen war: Zuneigung, Liebe. Ohne Erfolg. Auch wenn Siegrun kein Kleinkind mehr war, war sie noch immer viel zu jung, um zu verstehen. Sie war überzeugt, sie sei schuld am eingetretenen Elend. Und übernahm die Aufgaben des Alltages, den die Mutter, wie sich selbst, einfach hatte fallen lassen. Sie sprach kein Wort mehr, saß nur noch stumpf herum. Da half alles nichts. Siegruns Schufterei, Fragen, alles Bravsein, Weinen und Flehen, Verzweiflung und Liebe, Märchen erzählen, Witze, Kopfstand, alles gab Siegrun hin, aber es änderte nichts. Die Mutter blieb schwer und traurig und stumm. Die sie gewesen war, kehrte nie zurück. Nur ihr Körper war noch da, der Geruch, schmerzlich vertraut, aber in ihm war nur noch diese Fremde, die die anderthalb Zimmer der kleinen Wohnung vollpumpte mit monströsem Leiden.
Siegrun rettete sich in Träume. In ihnen ließ sie den Vater auferstehen, holte mit ihm auch die verschollene Mutter zurück, das verlorene Heim, Geborgenheit und Liebe. Es hatte eine Verwechslung gegeben, redete Siegrun sich fortan ein, der in diesen schrecklichen Zeilen verkündete Tote war ein anderer Mann! Ihr Vater würde zurückkehren! Der Glaube daran wurde Siegruns Mantel gegen das Erfrieren, wurde zum Blut, das in ihren Adern floss, wurde ihre Luft zum Atmen. In ihrer Fantasie variierten die Details seines wundersamen Überlebens. Mal humpelte der Vater einbeinig in der Fremde herum wie der kürzlich heimgekehrte kriegsversehrte Nachbar, mal stellte sie ihn sich als Erblindeten vor, wie er mit Stock und gelber Armbinde mit leeren Augen irgendwo da draußen in der Welt, die ihn verschluckt hatte, den Weg nach Hause suchte, zu ihr. Er würde es schaffen, weil sie ihn nicht aufgab. Sätze eines Beobachters der Nürnberger Prozesse, die Siegrun im Frühsommer 1948 aus dem Radio aufschnappte, wurden zum Wasser auf ihre Mühle. »Die Angeklagten negierten alle Schuld. Viele von ihnen behaupteten, sich an ihre Taten nicht erinnern zu können. Sie haben nicht nur jegliche Moral, sondern auch ihr Gedächtnis verloren.«
Siegrun wusste nicht, was Moral war, aber die Worte lieferten ihr jene Variante, die ihre glimmende Hoffnung zu einem lodernden Feuer anfachten. Natürlich! Auch ihr Vater hatte sein Gedächtnis verloren! Und irrte seit Jahren durch Dörfer, Städte und Felder, heimatlos, gepeinigt von Hunger, Kälte und Einsamkeit. Ein Gequälter, dessen Vergessen ihm den Weg nach Hause abgeschnitten hatte, das war Siegruns finale Vision. Ein unzerreißbares Band aus Liebe und Leidenschaft geknüpft. Es war alles, was ihr von ihm blieb, hielt den Vater am Leben – und auch Siegrun.
Im Sommer 1953, Tage nach ihrem siebzehnten Geburtstag, erlag die Mutter einem Infarkt. Schnell wich Siegruns Trauer einem anderen Gefühl: dem der Befreiung. Endlich war sie auf und davon, diese Fremde, die stetig immer schwerer geworden war. Siegrun löste die Wohnung auf, verkaufte das Mobiliar und zog in ein Schwesternheim der Diakonie direkt neben dem Krankenhaus, in dem sie eine Stelle als Hilfsschwester gefunden hatte. Die Tage waren lang, die Arbeit schwer, aber der Tod der Mutter verblasste schnell und bald auch Siegruns Vaterträume. Das Leben hatte sie wieder.
Erst vierzig Jahre später rüttelte eine TV-Dokumentation Siegrun auf. Die Sendung berichtete von der jahrzehntelangen Suche einer Frau nach dem für tot erklärten Bruder. Sie fand ihn am Ende lebend. Wochen später begann Siegrun mit ihren Recherchen zum Verbleib ihres Vaters. Zaghaft, und Schritt für Schritt, nicht nur weil sie alleinerziehend und dennoch voll berufstätig war, sondern auch weil der Zugang ins Internet damals erst wenigen vorbehalten war und die entscheidenden Archive erst Jahre später digitalisiert wurden. Die Jahre vergingen ohne jegliche Spur. Erst als Astrid fürs Studium aus dem Haus war, Siegrun zunächst in eine halbe Stelle gewechselt und dann in Rente gegangen war, kümmerte sie sich intensiver um ihre Suche. Erlaubte sich, sich auf etwas zu konzentrieren, das ihr – ihr ganz allein – am Herzen lag. Es ging bei ihrer Vaterforschung letztlich auch um die Rückeroberung der langen Zeit, die in ihren jungen Jahren mit ihren Vaterträumen verschüttgegangen war. Um die Rekonstruktion ihres früheren Lebens, das unter der abwesenden Lichtgestalt des Vaters begraben lag. Um Teile ihrer Identität, um Heilung, Wachstum und Selbstbehauptung.
Siegrun suchte ihren Vater auch, um ihn endlich loszuwerden. Dieses unsterbliche Phantom, das, so tief es auch schlummerte, sie noch immer gefangen hielt. Mit der Allmacht jener kraftzehrenden Fantasie, die sie als Kind einmal gerettet hatte. Es war Zeit, sich freizumachen.
Das war der Stoff, der Siegrun zu guter Letzt enorme Kräfte verlieh. Und die Tapferkeit, standzuhalten. Auch als die grausame Wahrheit sich zu entblättern begann, wich Siegrun nicht zurück, selbst dann nicht, als es um Leben und Tod ging. Denn hatte es das nicht immer getan? Am Ende hatte sie nicht einmal mehr Angst gehabt. Dafür war sie zu weit gekommen. Ihr erbitterter Kampf um die Wahrheit hatte sie am Ende auch zum Kern ihres Selbst geführt. Zu diesem unverwundbaren, nackten und vollkommenen Ich, das blieb, wenn man sich von allem anderen frei gemacht hatte.
*
In der Totenhalle des Bornheimer Friedhofs presste Astrid ihre Handflächen gegen die hölzerne Tür und reckte sich an das kleine Fenster. Dahinter stand eine Liege, darauf aufgebahrt Siegrun. Ihre Hände lagen auf dem Bauch, im Gebet gefaltet. Dafür hatte ihr jemand vom Beerdigungsinstitut die totenstarren Finger gebrochen. Aber das wusste Astrid nicht.
Dennoch brach ihr jetzt der Schweiß aus. Sie begann zu zittern und fror. Ihr Blick wanderte über das weiße Tuch, das Siegruns Körper bedeckte, und hielt an ihrem Gesicht inne.
Es stimmt nicht, dass die Toten Frieden ausstrahlen, dachte Astrid, ohne zu wissen, was genau sie beunruhigte. Aber das war auch besser so. Denn trotz Make-up und der geschlossenen Augen war es noch da, das namenlose Entsetzen von Siegruns letzten Minuten, eingefräst in ihre kalkweißen Gesichtszüge. Astrid lehnte ihre Stirn an die kalte Scheibe und wimmerte.
»Nun komm schon, Liebes.«
Freund Bernd, vor zwei Stunden eigens aus Prag eingeflogen, legte den Arm um sie und zog an ihrer Schulter. »Es wird Zeit.«
»Zeit?« Astrid schüttelte ihn ab. »Wofür?« Sie schlang die Arme um den Oberkörper. »Lass mich.«
»Aber ich will doch nur …«
»Lass mich!«
Bernd marschierte beleidigt davon. Das Echo seiner Schritte prallte von den Wänden, dann fiel eine Tür ins Schloss. Astrid hörte es nicht. Ihr Atem ging stockend und beschlug das Fenster, hinter dem ihre tote Mutter lag.
*
Andrea Meisner beugte sich vor zum Spiegel und rieb die Augen. Aber die schwarzen Schatten blieben. Die halbe Nacht hatte sie sich gewälzt. Siegrun Rohndorffs Sterben ging ihr nach. Die letzten Atemzüge der alten Dame flirrten in ihrer Erinnerung, ihr zerbrochener Körper, das Blut. Andrea fühlte sich wie ausgekotzt. Und sie mochte nicht, dass es ihr so viel ausmachte. Das kratzte an ihrem Selbstbild. Ein Haufen beschissener Jahre hatte sie hinter sich gebracht und war sich sicher gewesen, es gäbe dieses Naturgesetz, das, wenn es wieder hart auf hart käme, auf der Stelle einen Elefanten aus ihr machte. Oder einen Fels. Unverwundbar. Von wegen.
Es klingelte.
Vor der Tür trat Astrid von einem Fuß auf den anderen. »Ich wollte, äh, ich habe gehört, äh …« Sie senkte den Blick. »Sie sind Frau Meisner, ähm, Sie waren bei meiner Mutter, als sie …«
»Stimmt, aber reinkommen darfst du nur, wenn du mich duzt!« Andrea wedelte sie herein, ging voran ins einzige Zimmer. »Ich mach gerade Kaffee. Willst du auch eine Tasse?«
»Gern.«
»Alles klar. Jetzt setz dich doch.« Und weg war sie.
Astrid sah sich um. Der Schaukelstuhl ächzte unter Kisten, die sich auf der Sitzfläche stapelten, das Bett quoll über mit Wäschehaufen und Büchern. Sie ließ sich auf dem einzig freien Platz nieder, einem Sitzsack. Es knirschte bedenklich, und ein Schwall Styroporkügelchen quoll aus einem Riss, verteilte sich auf dem fleckigen Teppich. Sie mühte sich, aus dem Ding wieder hochzukommen.
»Bleib besser sitzen.« Andrea kam mit zwei dampfenden Bechern rein. »Ich hab nämlich nix anderes, ist vom Sperrmüll, hab gedacht, der ist okay. War wohl nix.« Sie streckte Astrid eine Tasse hin und quetschte sich zwischen die Kleiderhaufen auf ihr Bett. »Du auch?« Sie hob einen Zuckerstreuer, Astrid schüttelte den Kopf und hörte nicht auf, ihr Gegenüber anzustarren. Andrea ahnte, weshalb. Spätestens jetzt sollte sie wohl endlich ihr Beileid bekunden. Etwas in der Art. Aber so fühlte sie nicht. Also schwieg sie. Höflichkeit war nicht ihre Stärke. Oder Nettigkeiten. Vielleicht hatte sie deshalb keine Freunde. Aber das machte nichts. Für echte Bindungen war Andrea ohnehin viel zu oft umgezogen. Schon ihr Leben lang. Das hatte sie eckig, kantig und ziemlich sperrig gemacht. Außerdem stieß sie Leute lieber gleich vor den Kopf oder hielt sie auf Abstand als sie irgendwann wieder zu verlieren. Danach lebte Andrea, auch wenn ihr das nicht klar war. Sie hatte sich längst daran gewöhnt, allein zu bleiben. Wozu sich verbiegen? Sie hatte nichts zu verlieren. Schon lange nicht mehr.
Eine Mutter hatte sie nie gehabt. Wusste also nicht, wie das war. Und auch nicht, was es bedeutete, eine zu verlieren. Eben. Sie würde jetzt kein Verständnis für etwas heucheln, was ihr so fern war wie der Mond, sondern tat, was naheliegend war. Verrührte den Zucker in ihre Tasse und beäugte Astrid. Die saß krumm auf dem geplätteten Sitzsack, die langen Haare strähnig, die Augen verheult, und knibbelte nervös an ihren Fingernägeln.
Sie lässt sich hängen, dachte Andrea, und ein Hauch Verachtung stieg in ihr hoch. Kein schönes Gefühl. Schnell sah sie woanders hin. Sie hatte nie jemanden gehabt, dem irgendetwas leidtat. Vielleicht war das auch besser so. Wenigstens musste sie niemandem dankbar sein. Zähne zusammenbeißen und durch. Weiter machen. Das hatte sie immer geschafft, auch ohne Mitleid oder Mitgefühl.
Astrid trank einen Schluck. »Danke«, murmelte sie.
»No problemo«, brummte Andrea und wälzte unschlüssig Worte auf ihrer Zunge herum. Sollte sie etwas sagen? Aber was?
»Ich hab’s endlich geschafft, in Siegruns Wohnung zu gehen«, bemerkte Astrid. »Gerade eben. War nicht lang drin, aber immerhin. Kanntest du meine Mutter gut?«
»Nein«, sagte Andrea. »So gut wie gar nicht.«
»Ja klar. Du bist ja wohl auch gerade erst eingezogen.« Astrid wies auf die Kisten.
»Nein, nein. Ich bin schon ewig hier, für meine Verhältnisse. Zwei Jahre.« Und wie üblich hatte sie es nicht geschafft, alles auszupacken, es sich gemütlich zu machen.
»Deine Mutter hab ich bloß mal am Briefkasten unten gesehen oder im Hof. Ein Hallo hier und da, mehr war da nicht. Das ist aber mit allen hier so. Zumindest für mich.«
»Hell ist es hier ja nicht gerade.« Astrid sah aus dem Fenster auf die gegenüberliegende Hauswand.
»Stimmt. Nur gegen zwölf kommt Sonne rein, wenn sie mal da ist, für ’ne halbe Stunde, dann ist sie weg. Aber dafür ist die Bude billig.« Andrea zerrieb sich ungern in Arbeit, bloß um ihr Dach über dem Kopf zu bezahlen.
»Hat sie Schmerzen gehabt am Schluss?« Astrid umklammerte ihre Tasse.
»Nein.« Andrea war froh, nicht lügen zu müssen. Genau diese Frage hatte sie dem Notarzt auch gestellt. Der Adrenalinstoß bei solch einem Sprung betäube den gesamten Körper, lautete die Zusammenfassung seines ellenlangen Vortrags. Er redet so viel, weil er sich mies fühlt, hatte Andrea geschlossen. Weil nichts mehr zu machen gewesen war. Sie trank ihren letzten Schluck.
»Es heißt, sie hätte noch gelebt.« Astrid sah jetzt aus, als würde sie gleich losheulen. »Hat sie noch etwas gesagt?«
»Ja. Deinen Namen.« Andrea konzentrierte sich auf ihre Schuhe. »Und dann war es vorbei.«
*
Eva Tölzer stöhnte, schon wieder ein Krampf im Fuß! Sie mühte sich, ihn zu lockern, der Schmerz verging. Aber nicht Evas Anspannung. Vorgebeugt auf dem durchgesessenen Sessel switchte sie sich weiter durch die TV-Sender. Aber auch in der Spätausgabe der Hessenschau gab es keine Meldung. Keine Nachricht ist eine gute? Eva, die sich seit vorgestern Sorgen machte, zweifelte daran. Sie switchte weiter, zog die Knie hoch und schlang ihre Arme darum. Vorgestern waren sie mit Siegrun Rohndorff verabredet gewesen. Aber die war nicht aufgetaucht. Seitdem warteten sie auf ein Zeichen. Aber nichts.
Eva fröstelte es. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass etwas Furchtbares passiert war. Und machte sich Vorwürfe. Siegrun war ihnen zufällig über die Füße gelaufen, hatte sich der Gruppe quasi aufgedrängt. Aber trotzdem, warum hatten sie das zugelassen? Ihre Sache war zwar eine Gute, aber das gab ihnen nicht das Recht, andere zu gefährden. Auch wenn das Blut dieser Schlacht schon seit Jahrzehnten floss. Es gab da eben diesen entscheidenden Unterschied. Ob man unschuldig war oder Bescheid wusste. Und wer Bescheid wusste, war verantwortlich. Auch für alle anderen.
Ganz plötzlich sehnte Eva sich mit Wucht zurück in die Zeit, als sie selbst noch keine Ahnung hatte. Unschuldig gewesen war. Über acht Jahre war das her. Damals war sie verhaftet worden, von der Straße weg. Am späten Nachmittag in die U-Haft. Die Zellentür war ins Schloss gefallen, mit lautem Klacken hatte sich der Schlüssel gedreht, dann ein Ratschen, als die Wärterin das Guckloch öffnete und Eva begaffte. Sekunden später entfernten sich ihre Schritte, hallten im langen Flur nach. Dann war sie allein. In der 3,5 x 2 Meter großen Zelle ein niedriges Metallbett, ein schmaler Schrank, ein zerschabter Resopaltisch, pastellgrün, ein Stuhl in gleicher Farbe, ein Regalbrett an der Wand, das wars. Tausendmal und mehr stieg Eva über die Jahre auf den Stuhl, streckte sich auf Zehenspitzen, um den schmalen Streifen Himmel zu sehen, dessen Blau durch die Drahtrollen auf der drei Meter entfernten Mauer zu ihr hindurchschimmerte.
Man behauptete, Eva habe jemanden umgebracht. Sie verstand damals nicht, was vor sich ging. In ihrem Kopf war nichts als Leere gewesen. Wochenlang. Aber allmählich schlichen sich Erinnerungsfetzen in ihre Zelle, wüteten in ihren Albträumen. Nacht für Nacht wachte sie schreiend aus ihnen auf, schweißgebadet. Die aufgerissenen Augen einer Fremden vor sich, ihr bleiches Gesicht, und im Erwachen roch sie deren Angst, bevor die Unbekannte zurück in den Nebel der Nacht verschwand. Von Anfang an kam ihr das Gesicht bekannt vor. Sicherlich, davon war Eva zuerst überzeugt, von den Polizeifotos, die ihr während der Vernehmungen vorgelegt worden waren. Sie habe eben diese Frau, hieß es dort, getötet – mit einem Messer. Absurd!
Aber dann hatte sich die Fremde auch in Evas Tagträumen breitgemacht. Und je häufiger der Körper der Frau sich auf dem Steinboden ihrer Zelle streckte, desto stärker begann Eva zu zweifeln. Die Zartheit der fremden Haut, die Rundung ihrer Brüste, der schmale Nacken, die weichen dunklen Locken … Sogar deren Blut verfolgte sie hin und wieder, rann aus ihrem Oberkörper, genau dort, wo auf den Polizeifotos die Einstiche zu sehen gewesen waren.
Über vier Monate saß Eva bereits in U-Haft, als dem Frauentrakt eine Psychologin zugeteilt wurde, jung, engagiert, unkonventionell, die sich mühte, den Gefangenen zu helfen. Die meisten waren junge Drogenabhängige. Sie bot sich an zum Reden, fragte nach, hörte zu. Eva ging zu ihr, war kurz vorm Durchdrehen, auch wenn das, worunter sie litt, simpel war: Erinnerung.
Ihre Gespräche mit der Psychologin brachten die Wende. Eines Morgens, sieben Wochen später, war alles wieder da, ein Flashback aus dem Nichts. Es war spätabends, Eva, auf ihrer Pritsche, beugte sich hinunter, um ihre Socken auszuziehen, als sie plötzlich den hölzernen Griff des Messers in ihrer Hand spürte und unter sich die Fremde entdeckte. Und das Messer in ihrer Rechten, und wie es niedersauste, auf der Klinge der Lichtreflex einer Deckenlampe blitzte. Und sie fühlte diesen leichten Widerstand wieder, mit dem die Klinge am Knochen des Schultergelenks vorbeischrammte, als Eva sie bis zum Heft ins Fleisch stieß. Die Augen der Frau hatten sich geweitet, die Pupillen vom Weiß verdrängt, und aus ihrem aufgerissenen Mund drang ein tierisches Jaulen. Eva hatte das Messer herausgerissen, die Faust fester um den Griff gespannt und es noch einmal in den Körper unter sich gerammt. Ein kurzes Glühen hatte die Pupillen der Fremden erhellt. Dann war sie still.
Sie wurde zu fünf Jahren verurteilt. Totschlag im Affekt, ein relativ mildes Urteil, weil Eva erst 22, noch nie aufgefallen war und ein psychologisches Gutachten ihr verminderte Schuldfähigkeit attestierte. Nachdem die Erinnerung an die Tat zurückgekehrt war, wurde Eva fortan von zwei Fremden gepeinigt. Von ihrem Opfer und der Täterin, die sie in sich selbst entdeckt hatte.
Wie war es dazu gekommen? Wer war sie in ihrem vergangenen Leben gewesen? Sie mühte sich, zu erinnern. Aber da war nicht viel. Bilder der Eltern stiegen in ihr auf, blieben diffus wie hinter einer Nebelwand: ein Mann, eine Frau … ein schmuckes Eigenheim mit Garten. Nachbarn zogen im Nebel vorbei, Kinder, Jugendliche, die Eva bekannt vorkamen, aus einer Schule, der Verkaufsraum eines Optikerladens, in dem sie ihre Lehre gemacht hatte. Aber alles blieb fern und kalt, als betrachte Eva eine Serie alter, zerkratzter Dias, in denen sie vergebens nach ihrem eigenen Konterfei suchte. Nicht als Bild, nicht als Gefühl. Auch die Gespräche mit der Psychologin halfen da nicht: Alles blieb kalt und fremd. Wie die Eltern, die sich nie aus den Bildern erhoben, um zu atmen.
Den Rest der Haft wurde Eva von dieser Leere malträtiert, die sich statt einer greifbaren Vergangenheit in ihr ausbreitete. Erschwerend kam hinzu, dass sie keinen Besuch in der Haft bekam, nicht ein einziges Mal. Wo waren die Leute, die auf die ein oder andere Art ihr altes Leben bevölkert hatten? Die Psychologin mühte sich intensiv um Kontakt zu den Eltern. Aber der Vater war strikt gegen einen Besuch, und die Mutter fügte sich. Vier Wochen vor ihrer Entlassung erfuhr Eva, dass die Mutter zwei Monate zuvor an einem Lungenödem gestorben war. Das tat ihr leid. Irgendwie. Schließlich hatte sie der Mutter Kummer bereitet. Aber fühlte Eva den Verlust? Nicht wirklich. Sie folgte dem Rat der Psychologin und schrieb noch aus der Haft heraus ihrem Vater. Zweimal. Aber er antwortete nicht.
Am Morgen nach ihrer Freilassung pilgerte sie zum Elternhaus. Nicht um den Vater zu sehen, sondern um sich an mehr zu erinnern. An das Haus, das Viertel, ihr Leben dort. Es war Spätherbst gewesen. In einen Kapuzenparka gemummelt, strich am Haus vorbei, durch die Straßen des Viertels, ging zur Schule, zum Optiker. Und zurück. Saß in ihrem Mietwagen am Ende der Straße. Und wartete. Bis ein Mann das Haus verließ. Sie beobachtete ihn, wusste, dass das einmal ihr Vater gewesen war. Aber mehr als schlichtes Wiedererkennen kam nicht auf. Sie wartete, bis er in seinen Wagen gestiegen und weggefahren war. Einer der Schlüssel des Bundes, den sie bei ihrer Entlassung zurückbekommen hatte, passte. Über zwei Stunden tigerte sie durchs Haus, schaute, suchte. Dann fand sie in der untersten Schublade des massigen Schreibtischs im Arbeitszimmer des Vaters eine Adoptionsurkunde und Entlassungspapiere aus einem schwäbischen Kinderheim. Von 1982. Da war sie vier gewesen. Eine weitere Viertelstunde fingerte sie vorsichtig durch Schubladen und Schränke, ohne mehr zu finden. Wieder draußen, hatte sie schon den Zündschlüssel in den Anlasser gesteckt, als sie entschied, auf die Rückkehr ihres Vaters zu warten. Nur er war jetzt noch übrig, den sie fragen konnte.
Sie fuhr in ein nahes Einkaufszentrum, ass, trank, lungerte herum. Am Nachmittag fing sie ihn vor dem Haus ab, nachdem er aus seinem Wagen gestiegen war. Er sagte nicht Hallo, sondern brüllte los. Verschwinden solle sie, sonst riefe er die Polizei. Ohne sie, das elende Balg, das er nie gewollt habe, würde seine Frau noch leben. Eva ging und kam nie wieder. Recherchierte aber wie eine Besessene, fuhr zu diesem schwäbischen Heim, zur Adoptionsstelle. Aber alle wimmelten sie ab, verschanzten sich hinter dem Persönlichkeitsschutz der biologischen Eltern und etlichen Paragrafen. Eva beauftragte eine Anwältin. Acht Monate dauerte es, bis ihr zumindest Zugriff auf die Papiere des Heims gestattet wurden. Sie fuhr zur genannten Stelle, um Einsicht zu nehmen. Da hieß es, die Papiere zu ihrer Person seien leider bei einem Brand in den 90er-Jahren zerstört worden.
Bis dahin war Eva gegen zu viele Mauern gelaufen, um das noch zu glauben. Sie suchte eine ehemalige Mitgefangene auf, die verschaffte ihr Kontakt zu einem vertrauenswürdigen IT-Nerd, der sich für sie in das System des schwäbischen Heims hackte.
Das war jetzt über vier Jahre her. So hatte all das hier begonnen. Und seitdem gab es kein Zurück mehr. Aber wo verdammt noch mal war Siegrun Rohndorff?
*
Andrea ruckte ihr Motorrad vom Ständer, schob es Richtung Tor, saß auf und kickte den Starter. Mehrmals. Aber kein Mucks. Sie fluchte. Sie würde schon wieder zu spät kommen. Der zwangsweise verordnete Arbeitseinsatz in der städtischen Gärtnerei kotzte sie schon genug an, auch ohne Ärger mit dem Vorarbeiter. Sie kickte den Starter ein viertes Mal. Nicht mal ein Röcheln. Sie stieg ab, bockte die Maschine auf – und entdeckte Astrid. Die saß auf der wurmstichigen Bank unter der Teppichstange.
»Du bist aber früh wach«, rief sie.
»Schlafen ist grad schwierig und ich musste mal raus.« Astrid erzählte von ihrem abendlichen Telefonmarathon; von 69 Nummern aus Siegruns zerfleddertem Adressbuch existierten mehr als die Hälfte nicht mehr. Die sie erreicht hatte, wussten nun über die Beerdigung Bescheid. »Das mit dem angeblichen Selbstmord hab ich aber weggelassen.«
»Wieso ist deine Familie nicht hier, um zu helfen?«
»Es gibt keine. Ich bin Einzelkind, meine Eltern haben sich vor Ewigkeiten getrennt, meinen Vater hab ich danach nie wiedergesehen. Er ist ausgewandert, soweit ich weiß, und Großeltern gibts schon lange nicht mehr.«
»Komm!« Andrea zog sie von der Bank und mit sich ins Hinterhaus. »Zeit für ein gutes Frühstück.« Drinnen drückte sie Astrid auf den wackeligen Stuhl ihrer Mini-Küche, schnappte das Telefon und meldete sich, von Hustenanfällen geschüttelt, krank. Sie stellte ein leidliches Frühstück zusammen und erzählte Astrid währenddessen von ihrem Ein-Euro-Job. Seit drei Jahren erwerbslos, hatte sie keine Wahl mehr gehabt, als den vor zwei Monaten anzunehmen, sonst drohten Kürzungen. Das Dasein als Neosklavin, wie Andrea es titulierte, setzte ihr zu. Eine vom wachsenden Heer an Ein-Euro-Jobbern zu sein, mit denen eine Minderheit ein Milliardengeschäft machte. Anders als öffentlich dargestellt, war der Ein-Euro-Job weder »sozial« noch sorgte er für Ausbildungen oder Festanstellungen. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Ein-Euro-Jobber wurden in Stellen eingesetzt, die zuvor Festangestellten vorbehalten gewesen war. Einzig Vorständen, Firmenbesitzern und Leitungspersonal bescherte die vom Steuerzahler subventionierte Ein-Euro-Industrie eine goldene Zukunft. Auch Sozialverbände wie Caritas, AWO und andere steigerten mit den so verdienten jährlichen Millionen vor allem die Gehälter ihres Führungspersonals. Bei 2,5 Millionen der mit 320 Euro pro Kopf und Monat staatssubventionierten Jobs ein äußerst lukratives Milliardengeschäft. Zumal im selben Zeitraum bundesweit über eine Million Festanstellungen im Niedriglohnsektor eingespart wurden.
Andrea beendete ihren Vortrag. Astrid weinte!
»Hey sorry, ich quatsch dich hier voll mit meim Zeug …«
»Schon gut. Aber ich hab da keinen Kopf für, das stimmt.« Astrid schob die Tomate auf ihrem Teller hin und her. »Meine Mutter hat sich nicht umgebracht! Da bin ich absolut sicher. Hab deshalb sogar mit meinem Freund gestritten. Der hat mir an den Kopf geknallt, ich wolle bloß die Fakten nicht wahrhaben, weil ich die Wahrheit nicht vertrage! Und hat mich gedrängt, direkt nach der Beerdigung mit ihm zurückzufliegen. Ätzend. Ich habe ihn weggeschickt und weiß grad nicht mehr, wie ich es die letzten Jahre mit diesem Typen ausgehalten habe. Jemand hat meine Mutter ermordet!« Sie friemelte ein Taschentuch aus der Hose, schnäuzte sich.
Andrea schwieg. Sie kannte zwei Leute, die sich selbst umgebracht hatten. Das war unfassbar und hatte damals bei denen, die ihnen nahestanden den Reflex ausgelöst, sich an alles zu klammern, was den Suizid widerlegen könnte. Ein Versuch, ihre grässlichen Schuldgefühle loszuwerden. Die Selbstmörder nicht gerettet, sie allein gelassen, nichts gemerkt zu haben. Auch sie hatten einen Schuldigen gesucht.
»Ist Siegruns Wohnung sehr aufgeräumt?«, fragte sie.
»Im Gegenteil. Nicht mal ihr Frühstück war abgedeckt.« Astrid runzelte die Stirn. »Warum?«
»Selbstmörder machen meist sauber vor ihrem finalen Abgang. Ziehen den letzten Strich unter ihrem Dasein. Schauen alles noch mal durch, Fotos, Briefe, Tagebücher, Erinnerungen, das, was von Beziehungen übrig bleibt. So überprüfen sie alles noch mal. Auch ihre Entscheidung. Und dann, zack! Schließen sie die Tür!«
»Aber nicht Siegrun! Nicht so, nicht ohne ein Wort!« Astrids Stimme zitterte.
»Vielleicht hast du was übersehen? Eine Botschaft kann winzig sein, ein paar hingekritzelte Sätze, ein Gedicht … Soll ich mal nachsehen? Für mich ist das einfacher.«
»Ja.« Astrid schob den Teller mit dem unberührten, zerstocherten Frühstück von sich. »Du kennst dich wohl aus?«
Andrea stand auf. »Gehen wir?«
*
Eva Töpfer schreckte hoch. Der Albtraum stob davon. Aber die Panik blieb. Da war ein Vogel gewesen, sein leuchtend gelbes Federkleid mit blutigen Klumpen verklebt. Jemand hatte seine dünnen Beine gefesselt, und jetzt war er tot. Hektisch schwang sie die Beine aus dem Bett und stand auf. Eva glaubte an die Zeichen. Und hoffte, dass sie unrecht hatte.
Unter der kalten Dusche versuchte sie, ihre Ängste fortzuspülen. Und wünschte nicht zum ersten Mal in diesen Tagen, Jan wäre Siegrun Rohndorff nie begegnet.
Eine Stunde später überquerte sie den Vorplatz des Wiesbadener Bahnhofs, eilte zur Bushaltestelle. Um kurz nach zehn betrat sie das Foyer des Staatsarchives, schritt voran in den Lesesaal und sah sich um.
»Kann ich behilflich sein?« Die Frau im Eingangsbereich sah von einem voluminösen, altmodischen Schreibtisch auf.
»Sehr gern, Frau … Lehmann«, las Eva vom Namensschild ab. »Ich bin auf der Suche nach Material zur hessischen Studentenschaft im Dritten Reich – für meine Magisterarbeit.«
»Folgen Sie mir!« Frau Lehmann erhob sich, führte Eva zu einer Reihe von Computern, klickte sich in die Bestandsdatenbank.
»Hier ist das Stichwortverzeichnis.« Sie wies auf die im Bildschirm erschienene Liste. »Wir haben insgesamt 119 Materialien zur Sofortansicht und diese hier …« Sie erklärte Eva das Verzeichnis. »Am besten, Sie gehen diese Liste in Ruhe durch, orientieren sich, notieren, was genau für Sie sinnvoll ist. Dann holen Sie mich wieder.«
Eva setzte sich. »Moment noch, äh, fast hätte ich’s vergessen. Ich soll Frau Rohndorff Grüße ausrichten! Von einem Kommilitonen, dem sie kürzlich sehr geholfen hat. Ist sie hier?«
Frau Lehmann wich einen Schritt zurück. »Nein! Sie … es ist …« Sie räusperte sich. »Sie kommt nicht mehr, sie ist plötzlich verstorben, ein tragisches Unglück … Wir alle stehen noch unter Schock, ich …« Sie verstummte.
Eva wich alle Farbe aus dem Gesicht.
»Wir können es immer noch nicht fassen«, fuhr Gudrun Lehmann fort, ihre Augen feucht. »Mehr wissen wir nicht. Es tut mir leid, aber ich muss wieder …« Sie hastete davon.
Eva sah ihr fassungslos nach, stand auf, wollte ihr folgen, aber ihre Knie gaben nach, sie hielt sich am Tisch fest, fiel zurück auf den Stuhl.
Siegrun tot! Ein Unfall? Von wegen. Eva hatte es kommen sehen. Hatte Siegrun gewarnt, immer wieder. War sie trotzdem zu weit gegangen? In diesem Moment hasste Eva diesen Ort. Denn hier hatte Jan Siegrun kennengelernt.
*
Andrea kniete in Siegruns Arbeitszimmer vor dem Schreibtisch und fingerte durch die Schubladen. Die mittlere links klemmte, sie musste zerren, damit sie nachgab. Aber drinnen lag nur ein leerer Umschlag. Andrea schob wieder zu, wieder klemmte es – und raschelte. Sie untersuchte die Unterseite, entdeckte ein mehrfach gefaltetes DIN-A4-Blatt, mit Klebeband befestigt.
Es klingelte an der Wohnungstür. Astrid öffnete. Ein spindeldürres Mädchen, nicht älter als sieben.
»Bist du die Astrid?« die Kleine sah zu ihr auf.
»Ja, warum?«
»Soll ich dir geben.« Das Mädchen streckte ihr einen Zettel hin. Astrid nahm ihn. »Von wem ist der?« Aber das Mädchen drehte sich um und stob die Treppen hinunter. Weil die freundliche Fremde in der Parallelstraße ihr weitere fünf Euro versprochen hatte, wenn sie innerhalb von sieben Minuten zurück war.
Astrid schloss die Tür, faltete die Nachricht auf:
Der Tod Ihrer Mutter war kein Unfall. Sie war an einer heiklen Sache dran, ist mächtigen Leuten auf die Füße gesprungen. Jetzt könnten auch Sie in Gefahr sein. Deshalb: Kein Wort über diese Nachricht zu niemandem. Sobald es einen sicheren Weg gibt, werde ich Sie wieder kontaktieren. Und erkläre Ihnen alles. Bis dahin: Seien Sie extrem vorsichtig!«
»Was ist?«, fragte Andrea, die in den Flur gekommen war. Astrid zögerte, dann reichte sie ihr den Zettel.
»Das passt«, brummte Andrea, als sie ihn gelesen hatte. »Ich habe was gefunden in Siegruns Schreibtisch. Sie hatte es versteckt.«
Es war die Kopie eines Zeitungsartikels aus dem Jahr 1999. Fünf Sätze waren gelb gemarkert.
Doktor Wilhelm Meister, seit seinem altersbedingten Rückzug aus dem Unternehmen Ehrenmitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Pharma Technologies (DPT), gab gestern den Namen des neuen Forschungsleiters bekannt: Professor Doktor Thierse, 54. Und auch in der Security-Leitung des Unternehmens gibt es einen Personalwechsel: Rudolf Marschner übernimmt in Kürze den Posten des vor drei Wochen bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Alfred Breuninger.
»Alfred Breuningers Tod ist ein entsetzlicher Verlust«, vertraute Dr. Meister unserer Reporterin an. »Er war für uns alle weit mehr als ein Kollege, war Weggefährte und Freund und hat zeit seines Lebens für unsere Visionen gekämpft. DPT wird sein Andenken in Ehren halten.«
»Ich versteh nur Bahnhof, kannst du was damit anfangen?«
Astrid schüttelte den Kopf.
»Und da war noch was.« Andrea reichte ihr den leeren Umschlag aus derselben Schublade. Auf der Rückseite das aufgestempelte Firmenlogo eines Fotoshops, daneben hatte ein Bote unterschrieben, der Name unleserlich, aber das Datum der Zustellung war gut erkennbar. Astrid starrte es an.
»Was immer da drin war«, murmelte sie, »es kam am Todestag meiner Mutter hier an.«
ZWEI
Jan Reichardt fuhr aus dem Albtraum hoch, sein brauner Lockenschopf klebte am Hinterkopf, die Bettdecke lag am Boden, schweißgetränkt. Verstört sah er sich um. Alles gut. Ein starkes Glücksgefühl durchströmte ihn, wie so oft: Er lebte noch!
Durch den Spalt des Vorhangs graute der Morgen, ein schwacher Lichtstreif flimmerte durchs Zimmer. Jan schloss die Augen. Hinter seinen Lidern brannten die Bilder der Nacht – das grelle Weiß der Wand, das laute Klicken, in seinen Hörgängen summte die erste Strophe Zarah Leanders Ich weiß, es wird ein Wunder geschehen und kratzte das metallene Schaben, mit dem sich die Klappe über ihm öffnete … Er atmete tief, um sie loszuwerden, die Todesangst, die sich damals in jede Pore seines kindlichen Körpers genagelt hatte. Bis heute hatte er keine Ahnung, wie lang genau diese Tortur gedauert hatte, dennoch war diese Hölle untrennbarer Teil von ihm geworden. Wie von allen, die entkommen waren.
Jan Reichardts Geburtsurkunde wies ihn als neunundzwanzig aus. Aber er wusste es besser. In Wahrheit war er erst geboren worden, nachdem Eva Tölzer ihn aufgegabelt hatte. Über drei Jahre war das her. Und schon bald hatte er seinen Nachnamen aus seinem Vokabular entfernt. Jene äußerliche Verbindung zur Vergangenheit, die zu löschen er die Macht hatte. Um wenigstens symbolisch den Faden zu zerschneiden zurück in jene fürchterlichen Jahre.
Jan war in einem Stuttgarter Vorort aufgewachsen, in dem der Drittwagen vor dem prunkvollen Eigenheim zum Standard zählte. Lange war er überzeugt gewesen, das nette, adrette Ehepaar, das ihn großzog, habe ihn auch gezeugt. Aber das hatten sie nicht. Dennoch liebten sie ihn. So weit reichte seine lückenhafte Erinnerung, die erst ab dem neunten Lebensjahr einsetzte. Undurchdringlich der Kokon der Jahre davor in dem fremden Haus, das sich Elternhaus nannte.
Als Jans Leben die entscheidende Wendung nahm, war er fast sechsundzwanzig, wohnte in einem Stuttgarter Ein-Zimmer-Appartement und fristete sein Dasein als studierter IT-Experte in einem mittleren Unternehmen, ein öder Job. Am Tag, der sein Erwachen einleitete, geriet Jan wieder in einen seiner Zustände und folgte am späten Abend einem ihm gänzlich Unbekannten. Das hatte er schon häufig getan. Auch wenn er sich daran nicht erinnerte. Aber jene Nacht war einzigartig, weil sein Trip unterbrochen worden war von Eva. Die hatte verhindert, dass er wie üblich alles vergaß. Wegen Eva hing diesmal noch Tage danach der muffige Geruch des Hausflurs, in dem der Fremde verschwunden war, in Jans Nase. Und er erinnerte sich, wie er seinen Fuß in die zu schwingende Haustür gestellt hatte, um dem Fremden hinauf ins Treppenhaus folgen zu können. Minuten später hatte Jan das Haus wieder verlassen.
Und dort war aus dem Nichts Eva aufgetaucht. Passte ihn ab vor der hinter ihm zugefallenen Haustür. Rief seinen Namen, packte wortlos seine blutige Hand und zog Jan mit sich. Sie liefen und liefen und sie redete. Natürlich begriff er da noch nichts. Aber er hatte es geschehen lassen.
Noch heute erinnerte sich Jan an die feinen Streifen des herbstlichen Nieselregens, die gegen das grelle Neonlicht der Straßenbeleuchtung auf sie beide herabgefallen waren. An die nassen Locken, die an seiner Stirn pappten, an seine Hände, die gezittert hatten, an das Blut auf seiner Haut, das der Regen auf die grauen Steine des Bürgersteiges wusch.
In jener Nacht hatte Eva den Ausbruch von Jans echtem Selbst getriggert, riss ihn aus seinem alten Dasein, entführte ihn in eine andere Existenz und wurde zur Geburtshelferin seines wahren Ichs. Eva brach in dieser Nacht in seine Trance ein, rüttelte ihn wach, dieses bis dahin auch ihm selbst fremde Wesen. Es dauerte Stunden, bis er sich selbst zu fühlen begann, ein stumpfer Körper, der aus einem endlosen Traum erwachte. Wie in einen Brunnen hatte Jan zusammen mit Eva in sich selbst hineingeschaut. In eine unbekannte Tiefe, die erst nur Panik auslöste. Aber die wich irgendwann dem Mut der Verzweiflung, und als schimmere dort unten kristallklares Wasser, erkannte er sich in der verschwommenen Spiegelung und er tauchte ein in dieses Mysterium schmerzvoller Nacktheit, die sein verschanztes Ich offenbarte. Das machte ihn stark.
In den Monaten danach stieß Jan weiter Teile jenes Panzers ab, hinter dem er sich verborgen und geschützt hatte, der ihn aber auch am Leben hinderte. Das Schweigen, Lügen, die Masken, Schicht für Schicht fiel das fremde, schwere Selbst von ihm ab wie die Häute einer Schlange. Bis heute erinnerte er sich an das triste Zimmer in der Absteige, in die Eva ihn in jener Nacht damals mitgenommen hatte. Über einer Wanne, in der sie ihn wie ein Kind badete, waren gesprungene Kacheln gewesen, er hatte die blauen Wellenlinien beäugt und Eva zugehört. Sie erzählte von sich, von denen, die an ihrer Seite waren, und diesem monströsen Schoß, in dem sie alle gefangen gewesen und dem sie entkommen waren.
Später hatte sie Jan zugedeckt und sich neben ihn aufs Bett gelegt. Zusammen hatten sie an die Decke geschaut, in den Spiegel dort. Jan hatte sich darin beäugt, diesen Fremden, der sich ihm erstmals offenbart hatte. Der sah ernst zurück, wurde größer und größer und sprang als Riese von der Decke herab, fiel über ihn her, schrie und tobte und von seinen Händen tropfte Blut. Als Jan zu weinen begann, schrie niemand mehr. Nur Evas behutsame Umarmung war da und ihre sanfte Stimme, die seine wahre Geburt willkommen hieß.
»Erst von hier aus hast du eine echte Wahl«, hatte sie geflüstert. »Wer willst du sein?«
Jetzt setzte Jan sich abrupt auf und starrte auf seine Hände. Sie zitterten. Jene Nacht schien ihm plötzlich tausend Jahre her.
Siegrun Rohndorff war tot. Und er war schuld. Weil er die alte Dame mit reingezogen, ihr viel zu viel erzählt hatte. Dabei war Eva von Anfang an dagegen gewesen. Wer immer Siegrun umgebracht hatte, ihr wahrer Mörder, das war er.
*
Doktor Rudolf Kreisheim, Europavertriebsleiter bei DPT, saß in seinem Büro. Er hatte es abgedunkelt, die Jalousien heruntergelassen, wie häufig in den letzten Tagen quälten ihn stechende Kopfschmerzen.
Es klingelte. Hektisch hob er ab. »Komplikationen?«
»Nein, alles paletti«, erwiderte Marschner, der Sicherheitschef. »Die Sache ist geritzt, die Akte geschlossen und das Material in Sicherheit.«
»Gut.« Dr. Kreisheim legte auf und lehnte sich zurück. Um ein Haar wäre ihnen alles um die Ohren geflogen! Mit den Fingerspitzen massierte er die geschwollenen Adern an seinen Schläfen. Schloss die Augen. Das war knapp, dachte er, verdammt knapp. Aber auf Marschner war Verlass. Präzise wie ein Uhrwerk hatte er die Rohndorff-Angelegenheit erledigt. In Hellers Sonntagsschicht, damit der als Erster am Ort des Geschehens war, unauffällig wie immer. Im Wohnzimmer der Frau lief der Rekorder noch. Heller hatte das Video diskret eingesackt mitsamt zugehöriger Pappkassette, die neben dem Gerät lag. Darauf fand sich der Stempel eines Fotoshops. Das Video war offensichtlich eine Kopie und das Original nirgends zu finden gewesen. Eine Katastrophe! Dieser Film in den Händen einer Fremden, noch dazu eine Kopie, war das untrügliche Zeichen dafür gewesen, dass sie die Kontrolle verloren. Diese Rohndorff war ihnen weit näher gerückt, als sie geahnt hatten. Dabei waren sie sofort von Dr. Meister alarmiert worden, als die alte Frau bei ihm auftauchte und behauptete, Rohndorffs Tochter zu sein. Ab diesem Tag hatte Marschner sich an ihre Fersen geheftet, sie danach im Auge behalten, sporadisch … Aber sie hatten sie unterschätzt. Über sie gelacht, die einsame alte Schachtel, die nichts Besseres zu tun hatte, als im Leben ihres toten Vaters zu kramen. Aber jetzt?
Der Fund des Filmes war ein Schock. Und machte auch klar: Nie und nimmer hatte sie allein geschnüffelt. Jemand hatte sich mit ihr verschworen. Jemand mit Insiderwissen. Wie sonst war Siegrun Rohndorff an diesen Film gekommen, an DPTs Heiligen Gral?
*
Jan war draußen geblieben. Ging auf Nummer sicher. Drinnen in der Kapelle des Bornheimer Friedhofs hatten sich an die dreißig Leute versammelt und er hätte die Sonnenbrille absetzen müssen. Nicht gut. Er heulte, das würde auffallen, schließlich war er ein Fremder hier. Niemand wusste, wie nah er Siegrun gekommen war.
Er war ihr vor knapp zwei Monaten begegnet, zufällig … Wegen eines Staus kam er über eine Stunde später ins Archiv als üblich. Und dann fehlte im Regal ausgerechnet das Buch, das er dringend brauchte. Im Lesesaal stieß er darauf, und auf Siegrun, ein halbes Dutzend Bücher lag auf dem Tisch um sie herum. Er setzte sich in ihre Nähe, wartete eine halbe Stunde, dann sprach er sie an.
»Oh! Entschuldigung. Ich nehme hier eine ganze Menge in Beschlag, nicht? Nehmen Sie es ruhig!« Verschmitzt hatte sie ihn angelächelt.
Er mochte sie auf Anhieb. Die Strenge ihres geflochtenen Pferdeschwanzes, mit dem sie ihre grauen Locken bändigte, passte nicht zu ihrer weichen Stimme und ihren rehbraunen Augen. Erst Tage später realisierte er, dass Siegrun im Archiv arbeitete – halbtags. Bald erzählte sie ihm, dass sie sich nach Dienstschluss gern in eigene Recherchen vertiefte, und berichtete freimütig von der Suche nach ihrem Vater. So hatte es begonnen.
»Ich habe ihn gefunden!«, rief sie zwei Wochen später und hielt ihm drei fotokopierte Fotos unter die Nase. »Das ist er!«





























