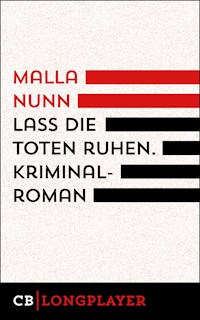9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Südafrika 1953: An einem frühen Oktobermorgen erhält Detective Emmanuel Cooper zu nachtschlafender Stunde einen Anruf: Sein Chef schickt ihn in die Drakensberge, um einen anonym gemeldeten Todesfall zu untersuchen. Zulu-Detective Shabalala soll ihn als Übersetzer und Fährtenleser begleiten. Vielleicht kann dieser Fall die beiden in Ungnade gefallenen Kriminalermittler rehabilitieren? Wie aufgebahrt liegt ein junges Mädchen auf dem abgelegenen Felsplateau. Aber woran starb Amahle, die Tochter des Zulu-Chiefs? Wer hat Blumen über sie gestreut und ihren Leichnam vor Raubtieren beschützt? Cooper und Shabalala treffen überall auf Dünkel und Argwohn. Jeder im Tal scheint Dreck am Stecken zu haben. Und je tiefer Emmanuel bohrt, desto grimmiger wird das Schweigen, das ihm entgegenschlägt. Bis jemand erneut zu Gewalt greift. »Tal des Schweigens« wurde für den Edgar Award nominiert und stand auf der Top Ten von Publishers Weekly, auf der Shortlist für den Anthony Award sowie für den Ned Kelly Award. »Ein Roman voll der Rhythmen, Gerüche und Farben Afrikas: Malla Nunn ist eine wunderbare Erzählerin. Ein in jeder Hinsicht großartiges Buch!« Deon Meyer »Eine rundum fesselnde und mitreißende Lektüre … akkurat und gesättigt mit der Stimmung der 1950er Jahre in Südafrika.« Mike Nicol
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
An einem frühen Oktobermorgen erhält Detective Emmanuel Cooper zu nachtschlafender Stunde einen Anruf: Sein Chef schickt ihn in die Drakensberge, um einen anonym gemeldeten Todesfall zu untersuchen. Zulu-Detective Shabalala soll ihn als Übersetzer und Fährtenleser begleiten. Vielleicht kann dieser Fall die beiden in Ungnade gefallenen Kriminalermittler rehabilitieren?
Wie aufgebahrt liegt ein junges Mädchen auf dem abgelegenen Felsplateau. Aber woran starb Amahle, die Tochter des Zulu-Chiefs? Wer hat Blumen über sie gestreut und ihren Leichnam vor Raubtieren beschützt? Cooper und Shabalala treffen überall auf Dünkel und Argwohn. Jeder im Tal scheint Dreck am Stecken zu haben. Und je tiefer Emmanuel bohrt, desto grimmiger wird das Schweigen, das ihm entgegenschlägt. Bis jemand erneut zu Gewalt greift.
»Tal des Schweigens« wurde für den Edgar Award nominiert und stand auf der Top Ten von Publishers Weekly, auf der Shortlist für den Anthony Award sowie für den Ned Kelly Award.
»Ein Roman voll der Rhythmen, Gerüche und Farben Afrikas: Malla Nunn ist eine wunderbare Erzählerin. Ein in jeder Hinsicht großartiges Buch!« Deon Meyer
»Eine rundum fesselnde und mitreißende Lektüre … akkurat und gesättigt mit der Stimmung der 1950er Jahre in Südafrika.« Mike Nicol
Über die Autorin
Malla Nunn
Tal des Schweigens
Ein Fall für Emmanuel Cooper
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2015
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Originaltitel: Silent Valley (Australien) bzw. Blessed are the Dead (USA, GB) © 2012 by Malla Nunn
Printausgabe: © Argument Verlag 2015
Lektorat: Iris Konopik
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 22.11.2015
ISBN 978-3-95988-030-5
Vorbemerkung
Diese aufregende Erzählung aus dem Herzen einer repressiven, zutiefst patriarchalen Kolonialgesellschaft kombiniert das unbeschwerte Vergnügen eines fulminanten historischen Kriminalromans mit tiefen Einsichten über die Art, wie Menschen sich in Gesellschaft positionieren, worauf sie mit Angst, mit Anpassung, mit Aggression oder mit gesteigerter Kompetenzbildung reagieren. Die Konflikte der Figuren zeigen viel mehr als das Südafrika der 1950er: Sie zeigen, wie Unterdrückung und Ausbeutung, Hierarchie und Abgrenzung sich in Verhaltensweisen der Einzelnen reproduzieren. Das ist große Literatur, mitten im Genre.
In ihrer Mischung aus historischer Genauigkeit, stringenter Plotführung und mitreißend geschilderten Auseinandersetzungen erlebe ich Malla Nunn als eine hochpolitische Dorothy Sayers der südlichen Hemisphäre: Wie Sayers in Gaudy Night (dt.: Aufruhr in Oxford) den Kriminalroman zum wahrhaft bildenden Bildungsroman macht, indem sie Harriet Vane mit den sanktionierten Irrationalitäten ihrer Zeit und Erwartungen an ihr Geschlecht ringen lässt, so erzählt Malla Nunn hier durch Emmanuel Coopers innere Kämpfe von einem kolonial geprägten Männer- und Menschenbild, das die Politik, die Weltkriege und die Identitätsbildung des ganzen 20. Jahrhunderts berührt.
Die Tiefe von Malla Nunns literarischen Gestalten flicht quer zu Coopers Betrachtungen und Ambivalenzen einen ganzen Kosmos aus komplex motivierten, unterschiedlich in die Verhältnisse verstrickten Personen ein, an deren Schicksalen man lebhaften Anteil nimmt: Gern würde ich Dr. Daglish durch einen weiteren Roman begleiten oder miterleben, wie es mit Mandla und Nomusa weitergeht. Dass ich Detective Sergeant Emmanuel Cooper und Constable Shabalala auch künftig überallhin folgen möchte, steht sowieso außer Frage.
Else Laudan
Für Mark
Prolog Oktober 1953
Detective Sergeant Emmanuel Cooper erwachte vom Krachen der Stiefel, die gegen seine Schlafzimmertür traten. Er warf die Decke beiseite und tastete im Nachttisch nach seiner Waffe. Reglos in der Dunkelheit, den Webley-Revolver auf die Tür gerichtet, lauschte er auf was immer als Nächstes kommen mochte. Das Krachen wurde leiser und organischer. Er spürte den Rhythmus. Es war nicht splitterndes Holz, was ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Es war sein eigenes Herz. Es hämmerte gegen seine Brust wie ein Gefangener, der aus seinem Käfig aus Muskeln und Knochen auszubrechen versucht.
Er ließ sich zurücksinken und atmete tief durch, wobei er einen schwachen Hauch blühenden Jasmins wahrnahm. Drei Monate nachdem er offiziell wieder zur Detective Branch gestoßen war, kehrten die Träume zurück, jetzt allerdings heftiger als alles, was er bisher durchgemacht hatte.
Die altvertraute Vision seines Platoons, zusammengekauert unter einem zinngrauen Himmel voller heulender Raketen, war nun ersetzt durch unzusammenhängende Bilder von roten Flammen und schwarzem Rauch. In diesen neuen Träumen rannte er durch brennende Trümmer auf etwas zu, woran er sich nicht erinnern konnte. Es regnete heiße Asche. Der dunkel-erdige Blutgeruch und die hohlen Schreie Sterbender füllten die Leere. Er wusste, in welche Richtung er rennen musste, doch Flammen versperrten seinen Weg. Der Rauch wurde dicker und versengte seine Lungen.
Er stieg aus dem Bett und tappte über den Linoleumboden zum offenen Fenster. Eine Katze verfolgte ein unsichtbares Nachtgeschöpf über die leere Auffahrt und schlüpfte in eine wuchernde Bougainvillea, schwer von Frühlingsblüten.
»Emmanuel«, murmelte eine verschlafene Stimme. »Komm wieder ins Bett.«
Er warf einen Blick auf die Frau, beleuchtet von einem Streifen Straßenlicht, der durch die Vorhänge fiel. Lana Rose lag nackt auf dem Bett, die Baumwolllaken in der Hitze von sich gestrampelt, das schwarze Haar floss übers Kopfkissen wie ein Band aus Seide.
»Schsch …« Das Geräusch kam ganz automatisch über seine Lippen. »Ich bin gleich wieder da.«
Die Katze kehrte mit einer Eidechse im Maul zurück, der Schwanz der Echse zuckte.
»Immer noch wahnsinnig?«, fragte Lana, kuschelte sich ins Kissen und schlief wieder ein.
Emmanuel antwortete: »Soweit ich weiß.«
Der Beweis für seinen Wahnsinn lag in seinem Bett.
Lana war Colonel van Niekerks Freundin, aber wenn die Woche um war, würde der Colonel verheiratet sein und Lana unterwegs zu einem neuen eigenen Leben in Kapstadt. Das rechtfertigte nicht diese Nacht reinen Vergnügens. Noch ein paar Tage lang war sie nach wie vor die Geliebte seines Chefs und hätte unberührbar sein sollen. Eines Abends früher in diesem Jahr hatte sie ihn in ihre Wohnung eingeladen, und sie waren ins Bett gefallen und ineinander ertrunken. Doch am nächsten Morgen kehrte Lana zu van Niekerk und seinen tiefen Taschen zurück. Danach gingen sie sich aus dem Weg und verdrängten die Erinnerung daran, wie perfekt sie zusammenpassten. Als sie anrief und einen Abschiedsdrink vorschlug, hatte Emmanuel gewusst, dass ihr eigentlicher Abschied im Bett vor sich gehen würde. Heute Nacht, mit ihrem halb in seine Laken gehüllten Körper, gestattete er sich die Illusion, dass er nicht allein war. In der Morgendämmerung jedoch würde Lana aus seinem Leben verschwinden: noch eine Frau, die er nicht hatte festhalten können.
Inzwischen hellwach, erinnerte er sich an einen Rat, den seine Mutter ihm vor Jahren erteilt hatte. »Versuch doch mal dem Ärger auszuweichen, statt immer mit Volldampf auf ihn zuzusteuern. Nur ein einziges Mal, Emmanuel«, hatte sie gesagt, als sie die gestohlenen Zigaretten unter seinem Bett in ihrer Hütte in Sophiatown entdeckte. Da war er zwölf Jahre alt und hegte bereits die schreckliche Gewissheit, dass er nie zu dem gütigen, freundlichen Mann heranwachsen würde, der er ihrem Traum nach hätte werden sollen.
Das Telefon auf dem Nachttisch läutete. Emmanuel durchquerte den Raum. Er hob den Hörer ans Ohr.
»Ja«, sagte er leise, um Lana nicht zu wecken.
»Sie sind auf.« Colonel van Niekerks Stimme drang klar durch die Leitung. »Schlafstörungen, Cooper?«
»Ich schlafe sehr gut, danke, Colonel.« Emmanuel hatte nicht vor, den Afrikaanerpolizisten in seinen Kopf hereinzulassen. Je weniger van Niekerk über seine geistige Verfassung wusste, desto besser. Lana rollte sich auf den Rücken, die Bettfedern quietschten.
»Sie haben Gesellschaft«, bemerkte der Colonel.
Emmanuel ignorierte die Feststellung und legte Lana sanft einen Finger auf den Mund. »Was kann ich für Sie tun, Sir?«, fragte er.
Am anderen Ende entstand eine Pause, kurz genug für ein einfaches Sammeln der Gedanken, aber lang genug für Emmanuel, um sich vorzustellen, der Colonel könnte wissen, wie er die Nacht verbracht hatte und mit wem.
»Packen Sie eine Tasche«, sagte van Niekerk. »Das Nötige für ein paar Tage. Ich habe einen Fall für Sie. Einen Mord.«
Emmanuel nahm die Hand von Lanas Mund und schrieb die Koordinaten in sein Notizbuch. Ein Mord in Roselet, einem abgelegenen Nest in den ländlichen Ausläufern der Drakensberge, vier Stunden von Durban. Wer immer den Mord gemeldet hatte, hatte keine näheren Angaben zum Opfer beigesteuert.
»Ich breche gleich am frühen Morgen auf, Colonel«, sagte er und hängte ein. Unbefestigte Straßen mit Schlaglöchern, in denen man ein Kind baden konnte, umherstreifende Ziegen und Kühe machten eine Fahrt zum Berg in der Dunkelheit zu gefährlich. Er würde erst bei Tagesanbruch losfahren.
Er warf einen Blick auf die Nachttischuhr. Viertel vor vier am Sonntagmorgen. Der Colonel wusste, dass er noch für Stunden nicht loskonnte, warum also rief er mitten in der Nacht an? Van Niekerk tat nichts ohne Grund. Was für einen Grund hatte er diesmal?
»Emmanuel …« Lana streckte sich, trat gegen die verwühlten Laken und reckte die Arme über den Kopf. »Musst du sofort los?«
1
Ein Zuluhirtenjunge wanderte schnell den Trampelpfad bergan, den knochigen Oberkörper nach vorn gelehnt, um das steile Gefälle des Berghangs auszugleichen. Das rhythmische Stapfen seiner nackten Füße auf dem unebenen Grund trat Steine los und wirbelte roten Staub in die Luft.
»Höher, ma’ Baas.« Der Junge klang entschuldigend, besorgt, den weißen Polizisten in dem feinen blauen Anzug mit gegen die Sonne tief ins Gesicht gezogenem schwarzem Hut zu überlasten. »Wir müssen höher steigen.«
»Ich bin unmittelbar hinter dir«, sagte Emmanuel. »Geh einfach weiter.«
Das gleichmäßige Schritttempo war nichts verglichen mit dem Ausbildungscamp der Army oder den drei Jahren im Einsatz, als er im Krieg über die Schlachtfelder Europas marschiert war. Detective Constable Samuel Shabalala von der Native Detective Branch folgte direkt hinter ihm, und der Rhythmus seines nahen Atems spornte Emmanuel an.
»Bald, ma’ Baas«, versprach der Junge. »Bald.«
»Ich bin dicht bei dir«, sagte Emmanuel. Die Toten waren geduldig. Für sie war Ewigkeit dehnbar, und Zeit bedeutete nichts.
Für Polizeiermittler jedoch war Zeit alles. Je schneller der Tatort aufgespürt und in allen Einzelheiten dokumentiert war, desto größer die Chance, den Mörder zu fangen.
Der Hirtenjunge blieb plötzlich stehen und schlüpfte dann seitwärts in das üppige Gras, das den Pfad säumte. »Da lang, ma’ Baas.« Er zeigte mit einem dürren Finger bergan. Der Pfad schlängelte sich um einen ins Gras gebetteten riesigen Sandsteinbrocken herum. »Ihr müsst um den Felsen gehen und weiter hoch.«
Der Junge wollte nichts zu tun haben mit dem, was dahinter lag.
»Meinen Dank«, sagte Emmanuel, wandte sich um und blickte zurück. Er sah den Pfad, auf dem sie vom Grunde des Kamberg Valley heraufgewandert waren, sah drüben in der Ferne das Gebirge aufragen. Hinter den Gipfeln türmten sich Wolken aufeinander. Die bronzefarbenen Bergspitzen, manche mit Schnee bestäubt, sahen aus wie Festungen für Götter. Es gab auf der ganzen Erde nichts, was den Drakensbergen glich.
»Wohin, Sergeant?«, fragte Shabalala, als er an Emmanuels Seite stand.
»Um die Biegung da vorn«, sagte Emmanuel. »Unser Führer ist ausgeschieden.«
Sie gingen weiter, umrundeten langsam den Felsblock. Drei Zulumänner, die traditionellen Kuhfelle über bedruckten Baumwollhemden, standen Schulter an Schulter auf dem schmalen Pfad, blockierten ihn. In den Händen hielten sie Knüppel aus Hartholz und Assegais, mit Rohleder umflochtene Jagdspeere mit scharfen Klingen. Zusammen bildeten sie ein Impi, eine Kampfeinheit. Der größte der Männer stand in der Mitte.
»Vorschläge?«, fragte Emmanuel Shabalala.
Die Zulus erweckten nicht im Geringsten den Eindruck, als hätten sie vor, den Pfad freizugeben. Auch militärische Niederwerfungen durch die britische Armee und Burenkommandos hatten sie nicht einschüchtern können. Sie standen da wie ihre Vorfahren vor hundert Jahren: furchtlose Herren ihres Landes.
»Sollten wir nicht besser auf die Ortspolizei warten?«, fragte Shabalala. Weit unter ihnen, auf der anderen Seite des smaragdgrünen Talstreifens, lag das Städtchen Roselet, die nächstmögliche Quelle für Verstärkung durch andere Ordnungshüter.
»Es kann Stunden dauern, ehe der Revierkommandant meine Nachricht erhält«, sagte Emmanuel und bezog sich auf den handgeschriebenen Zettel, den er vor einer Stunde an die Tür des geschlossenen Polizeireviers geheftet hatte. Auch in dem kleinen Sandsteinwohnhaus auf dem angrenzenden Grundstück hatten sie niemanden angetroffen. »Ich will nicht noch mehr Zeit verlieren.«
»Dann müssen wir zusammen gehen. Langsam. Mit offenen Händen, so.« Shabalala hob beide Hände und zeigte den Zulus leere Handflächen. Die Geste war schlicht, universell. Sie besagte: Keine Waffen. Keine bösen Absichten.
Emmanuel tat es ihm nach.
»Jetzt müssen wir warten«, sagte Shabalala. »Nicht wegschauen, Sergeant.«
Sonnenschein gleißte auf den geschliffenen Speerspitzen der Krieger. Diese Waffen waren keine staubigen Antiquitäten aus Großvaters Hütte. Auch die Männer selbst waren keineswegs Relikte. Sie waren hochgewachsen und muskulös. Ein Leben lang diese Berge hochzurennen und Wild zu jagen hatte ihnen ihre Tödlichkeit bewahrt, nahm Emmanuel an. »Das würde mir nie einfallen«, sagte er.
»Wer seid ihr?«, fragte der Mann in der Mitte auf Zulu. Er war der älteste der drei.
»Sawubona, Inkosi. Ich bin Detective Constable Samuel Shabalala von der Native Detective Branch. Dieser ist Detective Sergeant Cooper, der oberste aller Polizeiermittler aus Durban.«
»Yebo, sawubona.« Emmanuel sprach die traditionelle Begrüßung. Seine jähe Beförderung zum Oberboss stellte er nicht in Frage. Wenn Shabalala glaubte, dass sie erhöhten Status brauchten, um hier weiterzukommen, traf das wahrscheinlich zu.
»Cooper. Shabalala. Wir sehen euch.« Der Älteste nickte eine Begrüßung, lächelte jedoch nicht. »Kommt. Das erstgeborene Kind der Schwester meines Vaters wartet.«
Emmanuel versuchte nicht, die Verbindung zu entwirren. Zulus hatten keinen Stammbaum, sie hatten riesige Familiennetze. Die Männer wandten sich um und liefen in Formation den Hang hinauf, die Waffen sicher in entspannten Händen, die ihr Gewicht gewohnt waren.
»Nach dir«, sagte Emmanuel zu Shabalala. Der Zulu-Detective trug die Standarduniform der Detective Branch, einen Anzug mit polierten Lederschuhen und einem schwarzen Fedora, doch die Hügel und das wilde Buschland waren der Spielplatz seiner Kindheit gewesen. Er kannte dieses Land und seine Leute.
Sie stiegen noch etwa zwei Minuten lang den steilen Hang hinauf. Ein schauriges, tiefes Klagen ertönte, schwoll an, erhob sich über die Baumwipfel, dann klang es wieder ab.
»Was ist das?«, fragte Emmanuel, ohne seinen Schritt zu verlangsamen.
»Die Frauen.« Sparsame Worte, knapp, doch zugleich auch voller Schwermut. Shabalala war dieser Klang vertraut.
Die Zulus blieben stehen und deuteten mit ihren Assegais auf eine Felsenfeige, die beinahe horizontal aus einer zerklüfteten Felsformation wuchs. Der Klang war jetzt eindeutig: weibliche Stimmen, die in der Wildnis wehklagten und heulten.
»Sie warten«, sagte der ältere Zulu.
Wieder überließ Emmanuel Shabalala die Führung. Ein paar Schritte neben dem Pfad dünnte das hohe Gras und Buschwerk aus, und eine Gruppe Frauen wurde sichtbar. Sie saßen im Kreis und wiegten sich vor und zurück. Wie ein Wachtposten breitete die Felsenfeige ihre Äste über sie. Emmanuel zögerte. Ein Schritt näher, und die Trauer würde ihn umschlingen, ihn rückwärts ziehen in eine Zeit und an einen Punkt in seinem eigenen Leben, den er lieber vergessen wollte.
»Sergeant«, drängte Shabalala leise, und Emmanuel schritt weiter. Er hatte dieses Leben unter Verwundeten und Toten selbst gewählt. Mit den Lebenden umzugehen gehörte zwingend zu seinen Aufgaben.
»Sie ist hier, Inkosi.« Eine der Frauen rutschte zur Seite, um eine Lücke im Kreis zu öffnen, durch die Emmanuel sich der Leiche nähern konnte. Im frischen Frühlingsgras lag ein schwarzes Mädchen und starrte hinauf in den sanften blauen Himmel mit den Silhouetten durch die Luft sausender Vögel. Ihr Kopf ruhte auf einer zusammengerollten Schottenkaro-Decke. Winzige rote und gelbe Wildblumen waren über sie und den Boden verstreut. Drei oder vier der Blüten waren in ihren leicht geöffneten Mund gefallen.
»Wir müssen näher heran«, sagte Emmanuel zu Shabalala, und mit gesenkter Stimme gab der Zulu-Detective das Anliegen weiter. Die Frauen lösten den Kreis auf, versammelten sich aber dafür unter den Zweigen einer nahen Dornenakazie. Ihr Klagen verebbte und wich gedämpften, heruntergeschluckten Schluchzern.
»Hibo …«, flüsterte Shabalala, als sie zu beiden Seiten des Mädchens in die Hocke gingen. Dies war keine wilde Messerstecherei, kein aus dem Ruder gelaufener Familienkrach, nichts, worauf sie sich gefasst gemacht hatten, als Colonel van Niekerk sie für diesen Fall abstellte.
»Ja, ich weiß.« Emmanuel musterte das Opfer. Sie war jung, vielleicht siebzehn Jahre alt, und wunderschön. Hohe Wangenknochen, anmutig geschwungene Brauen und volle Lippen: Züge, die sich bis ins hohe Alter erhalten hätten. Vorbei. Alles, was blieb, war die Ahnung, was hätte sein können.
»Keine Spuren eines Kampfes«, bemerkte er. Die Fingernägel des Mädchens waren wohlgeformt und unbeschädigt. Die Haut an ihren Handgelenken, ihrem Hals und ihren Oberarmen wirkte unberührt. »Wenn ihre Augen zu wären, würde ich sagen, sie schläft.«
»Ja«, stimmte Shabalala zu. »Aber sie ist nicht hierher gelaufen, Sergeant. Jemand hat sie hergebracht. Man sieht es an ihren Füßen.«
Emmanuel beugte sich vor, um besser sehen zu können. Schmutz und abgerissene Grashalme klebten an ihren rauhäutigen Fersen und schlanken Knöcheln. »Sie wurde hergeschleift und dann zurechtgelegt.«
»Das denke ich«, sagte Shabalala.
Unter normalen Umständen, mit einer Holzbarrikade rings um den Tatort und ein paar uniformierten Beamten auf Posten, hätte Emmanuel jetzt den Ausschnitt des Kleides beiseitegeschoben, um Schultern und Achselhöhlen nach Blutergüssen abzusuchen. Schamgefühl bereitete den Toten keine Sorgen, nie mehr. Doch die Anwesenheit der versammelten Zulufrauen hinderte ihn daran, und so zog er Notizbuch und Stift aus seiner Jackentasche.
Zu Shabalala sagte er: »Sie wurde nicht einfach bloß abgeladen oder unter Buschwerk versteckt.« Auf die erste Seite schrieb er die Buchstaben R.I.P. Ruhe in Frieden. Wer immer das Opfer hierher geschleift hatte, wollte sie an einem friedvollen Ort zur Ruhe betten, über ihr eine Felsenfeige, unter ihr das weite Tal.
»Und dann die Blumen.« Shabalala stand auf und inspizierte den Berghang. Tupfer aus hellem Rot und Gelb durchbrachen hier und da das Grün. »Sie wachsen hier überall, aber ich glaube nicht, dass der Wind sie hierher geblasen hat.«
»Es sieht aus, als hätte man sie mit Absicht über sie gestreut.« Emmanuel hob eine winzige rote Blume aus der Armbeuge des Mädchens. Er verstand dieses Bedürfnis, die Gefallenen zu markieren. Kleine Gesten machten etwas aus, sogar in der weißen Glut des Krieges: ein Helm auf der Brust oder ein Poncho über dem Gesicht eines toten Soldaten, irgendetwas gerade Verfügbares, das einer Ehrenbezeugung oder einem Abschiedsgruß möglichst nahe kam.
Emmanuel schrieb geliebt auf die nächste leere Seite. Es war das erste Mal, dass ihm an einem Mordschauplatz dieses Wort in den Sinn kam. Kein Zweifel, das Mädchen war geliebt worden und wurde es noch immer. Selbst jetzt, im Tod, wachte ein Kreis trauernder Frauen über sie, und eine Gruppe bewaffneter Männer.
»Was glaubst du, wie lange ist sie schon hier?«, fragte er Shabalala. Es konnten nicht mehr als zwölf Stunden sein, dachte er. Die Geier und Wildkatzen hatten noch nicht angefangen, ihren Körper zu zerlegen.
»Eineinhalb Tage.« Shabalala schritt das Umfeld des Fundorts ab, untersuchte gebrochene Zweige und geplättetes Gras. »Die Spuren der Frauen sind von heute Morgen, aber die tiefen Furchen ihrer Fersen sind wesentlich älter.«
Emmanuel stand auf und ging dorthin, wo Shabalala über einem zerdrückten Blatt kauerte. »Sicher, dass sie die ganze Zeit hier draußen war?«
»Ja, Sergeant. So ist es.«
»Aber sie ist so gut wie unversehrt.« Er blickte auf das Mädchen. Zwischen ihren schlanken Beinen war eine Schulterbreite Platz, das linke Knie leicht angewinkelt, als ob sie sich gleich aufsetzen und Hallo sagen würde. Der Saum ihres weißen Kattunkleids flatterte um ihre Oberschenkel – unmöglich zu sagen, ob vom Wind hochgeblasen oder von Menschenhand hochgeschoben. Ein erbsengroßer blauer Fleck verunzierte die glatte Haut auf der Innenseite ihres linken Schenkels. »Keine Tiere waren an der Leiche. Und es gibt keine Spur von Verletzungen bis auf den Bluterguss da.«
»Das alles sehe ich auch.« Shabalala hielt inne. Er zögerte, weiterzusprechen. Andere Detectives verbrannten jede Menge Sauerstoff, warfen mit halbgaren Theorien um sich und produzierten Spekulationen über das Wie und Warum eines Mordes. Nicht so Shabalala. Er sprach nie, solange er sich der Fakten nicht sicher war. Das war erlernte Zurückhaltung. Schwarze Detectives steuerten kaum je spontane Kommentare bei oder beteiligten sich sonst wie an dem wetteifernden Geplänkel über einem toten Körper. Sie waren rangniedere Kollegen, die man nur zu einem Fall hinzuzog, wenn spezielle Kenntnisse im ›Eingeborenenkontext‹ gebraucht wurden.
»Sag es mir«, bat Emmanuel. »Es muss keinen Sinn ergeben.«
Wilde, aus der Luft gegriffene Theorien hatten oft ihren Nutzen.
»Was ich sehe, ist seltsam«, sagte Shabalala.
»Erzähl es mir trotzdem.«
Der Zulupolizist deutete auf Schrammen am Boden und auf einen schweren Stock, der im Gras lag. »Ich glaube, dass die Tiere sich nicht herangewagt haben, weil der, der das Mädchen an diesen Ort gebracht hat, sie fernhielt.«
»Das musst du mir erläutern«, sagte Emmanuel. Die Furchen im Staub sagten ihm nichts, und der Stock wies weder Blutspuren noch andere Zeichen von Gebrauch auf.
»Ein Mann …« Der Zulu-Detective zögerte und trat ein Stück nach rechts, um ein weiteres Fleckchen aufgewühlter Erde zu untersuchen. »Ein kleiner Mann war hier. Er rannte mit dem Stock von dort, wo das Mädchen liegt, hierher. Siehst du es, Sergeant?«
Die Fährte einer Wildkatze war sogar für Emmanuels ungeschultes Auge erkennbar. »Er hat angegriffen, um die Leiche gegen Raubtiere zu verteidigen. Das bedeutet, er muss bei ihr geblieben sein.«
»Yebo. Ich glaube es.«
Emmanuel unterstrich das Wort geliebt und fügte beschützt hinzu.
»War er ein menschliches Raubtier und das Mädchen seine Beute?«, fragte er sich laut. Menschen töteten oft die, die sie am meisten liebten.
Shabalala schüttelte den Kopf, unzufrieden, weil er nicht das ganze Bild zu sehen vermochte. »Ich kann nicht sagen, ob dieser Mann der war, der ihr etwas angetan hat. Leute sind hergekommen und überall herumgelaufen. Manche der Frauen haben mit den Händen die Erde aufgewühlt und ihre Körper im Schmutz gewälzt. Viele Spuren sind zerstört. Ein Mann hat sie hergebracht und die Tiere ferngehalten. Das ist alles, was ich sehe.«
»Wir wissen schon wesentlich mehr als bei unserer Ankunft«, sagte Emmanuel. »Wir wollen noch einen Blick auf die Leiche werfen, dann sprechen wir mit den Frauen und sehen, was sie uns über das Opfer sagen können.«
»Yebo«, stimmte Shabalala zu, und sie begaben sich zurück an die Stelle, wo das Mädchen lag. Ein gelber Grashüpfer war in der Mulde ihres Halses gelandet und geschäftig dabei, seine Flügel und langen Fühler zu putzen.
»Keine sichtbaren Verletzungen«, sagte Emmanuel und wedelte den Grashüpfer fort. Eine natürliche Todesursache konnte bis jetzt noch nicht ausgeschlossen werden. »Wir müssen sie umdrehen und finden, was verborgen ist.«
Sie wälzten den Körper auf die Seite, so dass der Rücken sichtbar wurde. Von den Frauen unter der Dornenakazie kam ein leises kollektives Luftschnappen. Das Mädchen gehörte zu ihnen und war in ihren Gedanken noch lebendig. Es schockierte sie, sehen zu müssen, wie leicht sie aus ihrer Fürsorge in die Hände von Fremden glitt.
»Da«, sagte Emmanuel. Das Kattunkleid wies knapp über der Taille ein kleines Loch auf, so groß wie der Kopf einer Reißzwecke. Blutige Flecken sprenkelten den Stoff. »Könnte die Eintrittswunde einer Kugel sein.«
»Vielleicht auch ein Messer.« Shabalala steckte prüfend seine Fingerspitzen in die Erde, wo das Mädchen gelegen hatte. »Die Erde und das Gras sind feucht von Blut, aber nicht vollgesogen.«
»Verblutet ist sie nicht. Aber jetzt ist kein guter Zeitpunkt, um die Eintrittswunde zu untersuchen.« Die Trauernden waren wieder näher herangerückt, ihre Aufregung war spürbar. »In ein paar Tagen dürfte der Bezirksarzt Antworten für uns haben. Bis dahin können wir nur raten, was die Wunde verursacht hat. Wir legen sie wieder auf den Rücken und finden erst mal raus, wer sie ist.«
Sie rollten die Mädchenleiche in ihre ursprüngliche Position zurück, und Shabalala schob die Decke wieder unter ihren Kopf, als könne es ihr sonst unbequem werden.
»Willst du die Fragen stellen?«, fragte Emmanuel. Er sprach selbst Zulu, war mit Zulujungs und -mädchen aufgewachsen und bei ihren Familien aus und ein gegangen, bis die gewaltsamen Ereignisse seiner Jugend ihn und seine Schwester auf eine entlegene Rinderfarm verbannten und dann auf ein Internat für Weiße. Doch diese Situation hier war anders.
»Der Sergeant muss den Anfang machen«, sagte Shabalala. »Die Leute hier wissen, dass die Polizei es ernst meint, wenn ein weißer Polizist das Sagen hat.«
Das leuchtete ein. Für eingeborene Polizisten und Ermittler gab es einen Knüppel als Waffe und ein Fahrrad als Gefährt. Es war ihnen nicht gestattet, Polizeiwagen zu lenken. Die Macht der Schusswaffe, des Automobils und des Rechts selbst lag in den Händen der Weißen. Shabalala wusste das. Die Landfrauen, die unter dem Baum warteten, wussten es ebenfalls.
»Sprich Zulu«, empfahl Shabalala ihm leise. »Und bedanke dich, dass sie sich um das Mädchen gekümmert haben, bis wir kamen.«
»Mach ich«, sagte Emmanuel. »Sollte mein Zulu den Anforderungen nicht genügen, musst du übernehmen.«
Er näherte sich den Trauernden. Sie waren zu sechst, alle barfuß und in schwere schwarze Röcke gewandet, die über die Knie reichten. Geschmeidige Leibchen aus Kuhhaut bedeckten ihre Brüste, und jede trug die exquisite schwarze Kopfbedeckung, mit Stachelschweinborsten verziert, die sie als verheiratete Frauen auswies, Mütter des Clans.
»Ich bedaure euren Verlust«, sagte Emmanuel auf Zulu. Er wandte sich an eine Frau ganz vorne, die an den Ellenbogen gestützt wurde, damit sie nicht zusammenbrach. Sie besaß die gleiche Schönheit wie das Mädchen, das im Gras lag. Bestimmt die Mutter oder eine Tante des Opfers. »Meinen Dank, dass ihr sie beschützt habt, bis wir kamen. Wir sind dankbar.«
»Amahle Matebula«, sagte die Frau. »Das ist der Name meiner Tochter.«
Amahle bedeutete ›die Schöne‹. Emmanuel war früher mit einem dicken Zulumädchen durch die Straßen von Sophiatown gestromert, das denselben Namen trug. Sie war fixer und härter als die meisten Straßenjungs und stolz darauf. Ihre Spezialität war Ladendiebstahl; ihre Beute verkaufte sie für kleines Geld und einen Kuss an Jungs, die ihr gefielen. Er selbst nahm ihre Dienste sparsam in Anspruch, erwarb aus ihren Raubzügen gelegentlich späte Weihnachtsgeschenke.
»Du hast deine Tochter gut benannt.« Emmanuel stellte sich und Shabalala vor, ehe er Notizbuch und Stift zur Hand nahm. »Wie darf ich dich anreden?«
»Nomusa.«
Mutter der Anmut. Noch ein perfekt treffender Name. Emmanuel bedeutete ›Gott ist mit uns‹. Er war sicher, seine leibliche Mutter hatte ihm seinen Namen in dieser heiteren, quirligen Stimmung gegeben, in die sie alle paar Monate verfiel, wenn sie leuchtete wie ein Feuer.
»Berichte mir von Amahle«, sagte Emmanuel. »Wann hast du sie zuletzt gesehen?«
»Freitag früh. Es war noch dunkel draußen. Sie ging zur Arbeit, aber sie kam nicht nach Hause.« Nomusa sackte zusammen, und die Frauen, die sie aufrecht hielten, konnten ihr Gewicht nicht auffangen. Sie ließen sie sacht auf den Boden sinken und stützten mit Händen und Schultern ihren Oberkörper. Emmanuel und Shabalala gingen in die Hocke und warteten ab, bis die Frauen so weit waren.
»Wo hat sie gearbeitet?«, fragte Emmanuel, als Nomusa mühsam den Kopf von der Brust hob. Noch fünf Minuten, und sie würde nicht einmal mehr dazu imstande sein.
»Im Haushalt auf Inkosi Reeds Farm.« Eine grauhaarige Frau zu ihrer Rechten flüsterte Nomusa etwas ins Ohr, und sie fügte hinzu: »Little Flint Farm. Das ist in der Nähe. Im Tal.«
»Wann war Amahle üblicherweise mit der Arbeit fertig?« Andere Mädchen, die mehr Glück hatten, kamen am frühen Nachmittag aus der Schule heim und füllten ihre Hefte mit den Vokabeln des Tages.
»Bei Sonnenuntergang. Amahle kannte die Pfade über die Berge, und sie trödelte niemals.« Nomusa hob ihren Kopf und hielt ihn hoch, angespornt von plötzlich aufblitzendem Zorn. »Das alles wurde dem weißen Polizisten am Samstagmorgen gesagt, aber er ist nicht gekommen! Er hat nicht nach ihr gesucht!«
»Ihr habt sie beim Revierkommandanten in Roselet vermisst gemeldet?«, fragte Emmanuel.
»Yebo. Constable Bagley. Bei genau diesem Mann. Er hat sich nicht bemüht, meine Tochter zu finden, und jetzt haben die Ahnen sie zu sich genommen.«
»Ruhig, Schwester.« Eine der Frauen legte Nomusa die Hand auf die Schulter. Es kam nichts Gutes dabei heraus, die Polizei zu kritisieren.
»Was ich sage, ist wahr.« Nomusa schüttelte die Hand ab und beugte sich vor zu Emmanuel. Wut leuchtete in ihren dunklen Augen. »Der weiße Polizist ist ein Lügner. Er hat versprochen zu helfen, saß aber auf seinen Händen. Ihn kümmert niemandes Tochter außer seinen eigenen beiden.«
»Bitte, Schwester«, sagte eine andere Frau. »Was geschehen ist, ist geschehen.«
Bei der Endgültigkeit in den Worten der Frau schien Nomusas Wut zu verrauchen. Ihre Miene wurde weicher, und sie sagte zu Emmanuel: »Vom Tag ihrer Geburt an waren die Augen meiner Tochter auf den Horizont gerichtet und auf das, was dahinter liegt. Ich hätte sie an meiner Seite behalten sollen, aber es gefiel ihr nicht, behütet zu werden. Jetzt ist sie fort …«
Nomusa bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und begann zu weinen. Eine Frau hielt sie umarmt und wiegte sie wie ein Kind, während sie schluchzte.
Emmanuel steckte das Notizbuch weg und stand auf. Jetzt Druck zu machen, um mehr zu erfahren, würde ihm nichts einbringen. Nomusa war in ihrem Kummer unerreichbar geworden.
»Stell fest, wer die Leiche entdeckt hat, und sieh zu, ob die Frauen uns zu einer Liste von Leuten verhelfen können, mit denen wir reden sollten«, sagte er zu Shabalala. »Ich suche die Gegend nach einer möglichen Mordwaffe ab.«
»Ja, Sergeant.« Shabalala rückte näher an die Frauen heran und wartete geduldig auf den richtigen Augenblick, um zu sprechen.
Emmanuel schritt davon. Kummer und Verzweiflung waren Teil des Berufs. Er war daran gewöhnt. Aber manchmal, wie jetzt, versuchten die Geister der Toten aus seiner Vergangenheit ins Tageslicht durchzubrechen, statt auf den Einbruch der Nacht zu warten.
Er durchkämmte das Gras auf der Suche nach einem Messer, einer Patronenhülse oder einem angespitzten Stock – nach allem, was die Wunde in Amahles Rücken verursacht haben konnte. Für die Toten des Krieges konnte er nichts mehr tun. Doch bei diesem Tod auf einem Hügel in Natal gab es noch etwas für ihn zu tun.
2
»Nichts«, sagte Emmanuel zu Shabalala, als der Zulu-Detective zehn Minuten später zu ihm stieß, um Jagd auf die Mordwaffe zu machen. »Dieser Bereich ist sauber. Der einzige Ort, der noch bleibt, ist die Felsplatte da oben.«
Sie kletterten den steilen Grat hoch bis zu dem knorrigen Feigenbaum, der seine dicken weißen Wurzeln in den Basalt bohrte. Von der Felsplatte aus hatten sie freie Sicht auf das majestätische Rückgrat der gesamten Drakensberge. Die Luft wirkte hier heller und frischer als unten im Tal.
»Warte, Sergeant.« Shabalala hob eine halb gegessene Feige auf und untersuchte den Stiel. Dann begab er sich zur anderen Seite des Felsens und beugte sich tief über sprießende Grasbüschel. »Der kleine Mann war hier. Er hat Früchte vom Baum gegessen und dann im Sand eine Toilette gemacht.«
Die Toilette war ein sorgfältig ausgehobenes Loch, mit Kot gefüllt und dann mit einem Hügel aus trockenen Feigenblättern bedeckt.
»Ein afrikanischer Mann oder ein Weißer mit Busch-Erfahrung«, sagte Emmanuel und betrachtete den weiten Streifen Land, der sich zu Füßen der Berge erstreckte. »In einer Gegend wie dem Kamberg Valley gibt es jede Menge Männer beider Sorten.«
»Ein weißer Mann ohne Schuhe, der wilde Tiere mit einem Stock vertreibt und die Früchte vom Feigenbaum isst?« Shabalala war skeptisch. »Ein Mann, der sich nach Zulu-Art eine Toilette gräbt?«
»Du hast recht. Unser wahrscheinlichster Verdächtiger ist ein eingeborener Mann, der Amahle gekannt hat.« Emmanuel spähte über die Felskante auf den grasbewachsenen Abhang hinab. »Wenn das alles wahr ist, dann passt die karierte Decke nicht ins Bild.« Die Zulu benutzten geschnitzte hölzerne Kopfstützen als Kissen.
»Die Decke ist ein Rätsel. Keine der Mütter hat sie je gesehen. Sie gehört nicht dem Mädchen oder sonst jemandem aus ihrem Kraal.«
»Die Person, die die Leiche gefunden hat, könnte sie dagelassen haben.« Emmanuel wusste, dass diese Überlegung ziemlich weit hergeholt war. Warum etwas Wertvolles unter dem Kopf einer Toten zurücklassen? Wer würde Zeit und Mühe opfern, um ein totes Mädchen bequemer zu betten, wenn es nicht eine tiefe persönliche Bindung zu ihr gab? »Wer hat sie denn nun gefunden?«, fragte er.
»Ein Mann, der auf dem Weg zur Wassertaufe am Fluss war, fand Amahle heute Morgen.« Shabalala trat zu Emmanuel auf den Felsensims. »Die Mütter nehmen an, dass er immer noch am Fluss ist, aber ich glaube nicht, dass die Decke ihm gehört.«
»Und was ist mit den Blumen?«, fragte Emmanuel.
»Zulus bringen keine Blumen zu den Toten. Ich habe keine Erklärung für sie.«
Sie standen an der Kante des Felsens und schauten auf den Fundort hinab. Der Frühling war allgegenwärtig. Er lag in dem Geruch feuchter, von der Vormittagssonne erwärmter Erde und im Summen der Bienen. Es war der ideale Tag dafür, dass sich ein schönes Zulumädchen im Kattunkleid behaglich in der Sonne ausstreckte, um dem Rascheln der Blätter und dem Gesang der Vögel zu lauschen. Stattdessen hockte eine Gruppe Frauen, nun stumm vor Kummer, unter den Zweigen einer Dornenakazie und wagte nicht, ihren Leichnam aus den Augen zu lassen. Und ganz in der Nähe hielten mit Speeren und Knüppeln bewaffnete Männer Wache über den Schauplatz des Verbrechens.
»Wir untersuchen die Decke auf ein Namensschild oder Etikett, wenn die Familie außer Sichtweite ist. Wir wollen nicht, dass das Impi voreilige Schlüsse zieht und Jagd auf den Besitzer macht«, sagte Emmanuel.
Ein junger Mann mit einem verbogenen Fahrradreifen unter dem Arm kam oben über die Hügelkuppe geschossen, er rannte schnell genug, um seinem Schatten zu entwischen. Eine Wolke aus braunen und orangefarbenen Grashüpfern erhob sich springend vom Pfad, und aus dem Gras flog eine Holztaube auf. Das Impi schloss die Reihe, doch der junge Mann schlug einen Haken nach links und umrundete sie.
Er schrie: »Nehmt die Schilde hoch. Er kommt.«
Das Impi ließ die Kanten der Kuhfellschilde überlappen, um eine Barrikade zu bilden, und die Männer starrten den steilen Bergkamm hinauf. Emmanuel und Shabalala taten das Gleiche, genötigt von einem rasch wachsenden Gefühl von Gefahr.
Ein hagerer Zulu erschien auf dem Scheitel, bewaffnet mit einer kurzen Stoßlanze. Er spähte über das Land und musterte das Impi, das den Pfad bewachte. Dann hob er seinen Kurzspeer und donnerte mit dem Holzschaft gegen seinen Schild, was einen Basston wie ein schlagendes Herz erzeugte. Vier weitere Zulumänner erschienen auf dem Kamm, und jeder schlug mit dem Speer auf seinen Schild ein, bis die Hügellandschaft dröhnend widerhallte.
»Es gibt einen Kampf. Wir müssen etwas tun. Schnell. Bevor die Gruppen aufeinandertreffen.« Shabalala nahm den steilen Abhang im Laufschritt, seine Füße schlitterten das Gefälle hinab, die Arme ausgestreckt, um die Balance zu halten. Das Trommeln wurde immer lauter und schneller, das aus Menschen bestehende Herz pumpte jetzt Adrenalin.
Emmanuel hielt mit Shabalala Schritt. Militärische Taktik der Zulu war nicht sein Spezialgebiet, aber er ging davon aus, dass die Männer auf dem Hügel mit stoßbereiten Speeren den Pfad herabstürmen würden, sobald das Trommeln verstummte. Er schwenkte leicht nach rechts und peilte den Raum zwischen den zwei Zulu-Gruppen an.
Vier härtere kurze Speerschläge gegen das Rohleder, dann Stille. Ein Schrei stieg in die Luft, und die Männer oben auf dem Hügel rannten schnell auf das Impi zu, das den Pfad blockierte. Der Abstand zwischen den Kontrahenten schwand.
»Sergeant«, keuchte Shabalala. »Der Sommerflieder.«
Emmanuel sah ihn, ein zotteliges Büschel grüner Vegetation, das nur wenige Schritte vor dem stehenden Impi auf dem Pfad wuchs. Das war ihr Ziel, der letzte Punkt, an dem er und Shabalala den Pfad erreichen konnten, um einen menschlichen Puffer zwischen den sich bekriegenden Zulus zu bilden.
Schritte donnerten heran, hinter dem angreifenden Impi erhob sich eine Staubwolke. Shabalala und Emmanuel sprinteten mit aller Kraft und erreichten dicht neben dem Fliederbusch den Pfad.
»Halt das hintere Impi in Schach.« Emmanuel zückte seine Dienstmarke und öffnete sein Holster. »Ich übernehme die Angreifer.«
Die Detectives stellten sich Rücken an Rücken, die Schultern gestrafft, täuschten ein Selbstvertrauen vor, das keiner von beiden empfand. Das heranpreschende Impi rückte vor, ihre Speere blitzten in der Sonne.
»Halt! Polizei!« Emmanuel hielt seinen Dienstausweis hoch, auch eine Art von Schild, verstärkt durch die Macht der weißen Regierung. Er tastete nach dem Webley-Revolver, der gemütlich in seinem Lederholster steckte, besann sich aber eines Besseren. Er wollte die Konfrontation nicht noch aufheizen. »Die Waffen runter. Sofort!«
Der Anführer der angreifenden Gruppe drang weiter vor, unbeeindruckt von Emmanuels laminiertem Stück Pappe. Er war sehr groß, mit einem bemerkenswert schönen Gesicht voller scharfer Konturen und straff gespannter Haut. Wulstige Narben, silbern im Sonnenlicht, zogen sich über Brust und Schultern. Die Männer hinter ihm wurden langsamer, doch auch sie blieben nicht stehen.
Emmanuel wechselte ins Zulu. »Zwei Schritte zurück. Jetzt sofort.« Er bot der Herausforderung die Stirn, den Zeigefinger ausgestreckt, die Stimme laut und voll dunkler Drohung, ganz wie es das Trainingshandbuch der südafrikanischen Polizeikräfte vorschrieb. »Ich werde mich nicht wiederholen.«
Shabalala drehte sich halb und baute sich an Emmanuels rechter Schulter auf, um die polizeiliche Weisung mit Muskeln zu bekräftigen.
Der hagere Anführer des neuen Impi blieb stehen und schien das Risiko eines fortgeführten Angriffs abzuwägen. »Du sprichst sehr gut Zulu für einen Weißen«, sagte er auf Englisch, dann ließ er gnädig Speer und Schild zu Boden sinken.
Emmanuel trat auf ihn zu. »Die Hände hoch, wo ich sie sehen kann«, sagte er. »Deine Männer auch.«
Die vier Zulukrieger hielten ihre Waffen und Schilde fest. Ohne direkten Befehl ihres Anführers waren sie zu nichts bereit.
»Was soll werden?«, fragte Emmanuel. »Sollen wir reden oder kämpfen? Mir ist beides recht.«
Der Mann lächelte. »Nur ein Narr kommt mit Speeren, um gegen einen Polizisten mit einer Pistole zu kämpfen.« Er bedeutete seinen Männern, ihre Waffen ins Gras zu legen. Sie gehorchten.
Emmanuel kickte den Kurzspeer aus der Reichweite des hageren Mannes. »Name?«, fragte er.
»Ich bin Mandla, ältester Sohn des Großen Chiefs Matebula.«
Mandla. Das hieß ›der Starke‹.
»Deine Mutter?«, fragte Emmanuel. Mandla konnte durchaus Amahles leiblicher Bruder sein, die Ähnlichkeit ihrer körperlichen Schönheit war auffällig.
»Meine Mutter ist La Matenjuwa. Erste Frau des Großen Chiefs.«
»Der Erste Sohn der Ersten Frau«, sagte Emmanuel. Mandla war ein künftiger Chief und Amahles Halbbruder. »Was habt ihr hier zu suchen?«
»Ich komme die Tochter des Großen Chiefs holen.« Mandla wandte sich an das Impi, das den Pfad bewachte. »Ihr Körper gehört dem Matebula-Clan. Ihr habt kein Recht, hier zu sein.«
»Du kommst ohne Ehre«, rief der älteste Mann des ersten Impi. »Du beleidigst die Toten und die Ahnen mit deiner Gewalt.«
Mandlas Kopf fuhr hoch, seine Lippen wurden schmal. »Ein Kind gehört seinem Vater, nicht der Mutter. Das Mädchen muss mit uns in den Kraal ihres Vaters zurückkehren, wie das Gesetz es verlangt.«
»Der, der das Ei befruchtet, aber keine Zeit für die Küken hat, ist kein Vater, auch nicht bei den Zulu«, gab der ältere Mann zurück.
Shabalala holte tief Luft bei dieser Anklage und schwang herum, um erneut Emmanuels Rücken zu decken.
»Alle Mann zehn Schritte zurück!«, befahl Emmanuel beiden Seiten von Amahles Familie. »Leere Hände ausgestreckt, wo ich sie sehen kann.«
Die Männer gehorchten, wiewohl unwillig.
»Hört mir gut zu.« Emmanuel sprach mit ruhiger Stimme. »Wir sind die zuständigen Ermittler, die Amahles Tod zu untersuchen haben. Sie ist eure Schwester und eure Nichte, aber zu diesem Zeitpunkt gehört sie zuerst uns. Der Polizei. Wir allein sagen, wie und wohin sie reist. Ich weiß, das ist für euch alle schwierig, aber so muss es sein.«
Er drehte sich um und suchte den Blick des Älteren, der sie zu dem Kreis trauernder Frauen geleitet hatte.
»Ist das geklärt?«
Der Mann atmete tief ein, sichtlich noch zornig. »Das ist es, ma’ Baas«, sagte er. Amahle der Obhut der südafrikanischen Polizei zu überlassen war schlimmer, als sie dem Haus ihres Vaters zurückzugeben, aber es gab keine Wahl. Die Polizei war stärker als alle Clans des Tals zusammen.
Emmanuel wandte sich Mandla zu. »Ist das geklärt?«
Mandla verneigte sich ohne Unterwürfigkeit und antwortete: »Ich höre dich.«
Sich dem Detective zu fügen verhalf Mandla zu einem taktischen Rückzug. Emmanuel hatte den Verdacht, dass Mandla jeder Forderung zustimmen, sich jeder Drohung beugen würde, aber sobald die Polizei aus dem Tal heraus war, würde er tun, was immer ihm beliebte. Jenseits der Zäune, die die Farmen der Weißen begrenzten, waren Mandla und sein Vater, der Große Chief, das Gesetz.
»Wir können das Mädchen nicht hier draußen im Veld lassen, auch nicht mit einer Wache«, flüsterte Shabalala. Das offizielle Prozedere sah vor, das Mordopfer in der ursprünglichen Lage zu belassen, bis der Transporter des Leichenbeschauers eintraf, um den Körper abzuholen. »Wir müssen sie jetzt mitnehmen, solange noch Tageslicht ist.«
»Einverstanden«, sagte Emmanuel und zeigte auf Mandla und seine Männer. »Nehmt eure Schilde auf und geht zurück zum Kraal eures Vaters. Legt eure Speere an den Fuß des Felsens da, bis wir weg sind.«
Er traute Mandla nicht über den Weg. Würde der Mann einfach kampflos gehen? Der Stammhalter des Großen Chiefs war offensichtlich an seine Befehlsgewalt gewöhnt, und ohne Amahles Leichnam zum Kraal seines Vaters zurückzukehren konnte seiner Autorität einen schweren Schlag versetzen.
»Wie du sagst.« Mandla drehte sich um und lief zügig auf den Gipfel des Hügels zu. Oben auf dem Kamm, wo er zuerst aufgetaucht war, blieb er stehen und hockte sich ins Gras, flankiert von seinen Männern. Eine klare Herausforderung an die Detectives, ihn zu vertreiben.
»Wir haben uns einen Feind gemacht«, sagte Shabalala.
»Den ersten von vielen«, erwiderte Emmanuel.
Amahle war kein gewöhnliches Zulumädchen. Sie war die Tochter eines Chiefs, geliebt und umkämpft. Was für gefährliche Gefühle hatte sie wohl in den Herzen von Zulus und weißen Männern geweckt, als sie noch am Leben war?
3
Emmanuel steuerte den schwarzen Polizeichevrolet vorsichtig auf den holprigen Feldweg, der zwischen dem Polizeirevier von Roselet und dem Wohnhaus des Revierkommandanten verlief, einem kleinen Sandsteinhaus mit Lavendelbüschen zu beiden Seiten der Eingangstreppe. Auf der Hauptstraße war zwar alles ruhig, aber er konnte nicht riskieren, dass irgendein Fußgänger, der von der Kirche heimspazierte, zufällig in den Wagen spähte und auf dem Rücksitz ein totes schwarzes Mädchen entdeckte.
»Der Revierkommandant und seine Familie sind jetzt zu Hause«, stellte er fest. Ein blitzender Polizeiwagen war vor dem Steinhaus geparkt. Weiter hinten hockten im Schatten einer Sykomore zwei Mädchen mit schimmernden Haaren in blauen Kittelschürzen vor einem Ameisenhügel und steckten Stöckchen in die Eingänge, entzückt von der Panik der Insekten. Beim Geräusch des Wagens blickten sie gleichzeitig hoch und rannten los zur Hintertür, wobei sie riefen: »Pa, komm schnell!« und »Besuch!«
»Wir bringen Amahle zum hiesigen Arzt, sobald wir uns hier vorgestellt haben. Mal sehen, was er uns über die Wunde auf ihrem Rücken sagen kann.«
»Ich werde es ihr erklären«, sagte Shabalala, und Emmanuel stieg aus und wandte dem Chevrolet den Rücken zu. Die Zwiesprache zwischen Shabalala und Amahle ging ihm auf die Nerven, sie erinnerte ihn an die Millionen Kriegsopfer, die man einfach liegen ließ, um allein den Übergang ins Reich der Toten zu finden. Er verstand die Notwendigkeit dieser Gespräche für einen Zulu, der sich um ruhelose Geister sorgte – er wünschte bloß, die Toten würden Shabalala erzählen, wer sie umgebracht hatte.
»Sie wird hier auf uns warten«, sagte der Zulu-Detective, als er aus dem Wagen stieg. »Das ist nicht leicht für sie. Ihre Mutter Nomusa ruft ihren Geist nach Hause.«
»Wir beeilen uns, so gut es geht«, sagte Emmanuel. »Aber wir müssen die Todesursache klären.«
Doch er und Shabalala wussten nur zu gut: Sollte die ärztliche Untersuchung nicht zu klaren Ergebnissen führen, dann mussten sie Amahle möglicherweise zum nächsten Leichenschauhaus transportieren, wo eine vollständige Autopsie durchgeführt werden konnte. Eine solche Verzögerung konnte die Anspannung, die sie auf dem Hügel bereits erlebt hatten, noch deutlich steigern. Zudem gab es der Familie reichlich Zeit, sich auszumalen, wie der Körper ihrer geliebten Angehörigen nackt auf einem kalten Tisch lag, die entnommenen Eingeweide in Stahlgefäßen um sie herum.
»Wir melden uns nur beim Revierkommandanten und machen uns dann auf den Weg«, sagte er.
Die Fliegenschutztür des Sandsteinhauses schwang auf, und die Mädchen, die im Garten Ameisen gequält hatten, stürmten ans Verandageländer. Sie stützten die Ellbogen auf den hölzernen Querbalken und starrten auf die Ankömmlinge. Ihre blasse Haut, die Kringellocken und die Haselnussaugen ließen Emmanuel unwillkürlich an neugierige Elfen denken.
»Guck«, rief das ältere Mädchen über die Schulter nach hinten. »Wie wir gesagt haben. Besuch.«
»Da.« Die kleine Schwester zeigte mit dem Finger. »Im Hof.«
»Danke, meine Süßen.« Ein breit gebauter weißer Mann im grünen Sonntagsanzug kam hinter den Mädchen heraus und wuschelte ihnen durch die Haare. Er war etwa Mitte dreißig mit breiten Schultern, kurzgeschorenem rotem Haar und der Art Haut, die eher verbrennt und sich pellt, als braun zu werden.
»Kann ich Ihnen helfen, Gentlemen?«, fragte er, die grünen Augen voller Interesse. Sein Akzent klang nach der irischen Grafschaft Clare, verschliffen von Jahrzehnten des Lebens in Südafrika.
»Constable Bagley?« Emmanuel machte eine Pause und ließ dem Revierkommandanten Zeit, sich an den Anblick zweier Fremder in seinem Vorgarten zu gewöhnen – einer davon ein eins neunzig großer Zulu in einem maßgeschneiderten Anzug. »Ich bin Detective Sergeant Emmanuel Cooper von der West Street Kriminalpolizei in Durban. Und dies ist Detective Constable Samuel Shabalala von der Native Branch.«
»Yebo, Inkosi.« Shabalala entbot dem Constable den traditionellen Gruß und hielt zum Zeichen des Respekts den Hut vor der Brust. Roselet war ein weißes Farmer-Städtchen, seine Bürger würden die herkömmlichen Erwartungen an Schwarze hegen: Sie hatten hart zu arbeiten, wenig zu sprechen und sich gefälligst an die gottgegebene Ordnung zu halten.
»Oh …« Der Kommandant wirkte überrascht. Er beugte sich runter und sagte zu dem älteren Mädchen: »Geht rein und sagt Mom, dass es um die Arbeit geht, aber dass ich gleich wieder da bin. Klar, mein Schatz?«
»Ja, klar, Daddy.«
Die Mädchen zogen sich langsam zurück, sichtlich fasziniert von Shabalala. Ihre Stadt war ganz mit dem Vertrauten bevölkert: weiße Eltern, weiße Freunde, schwarze Bedienstete, vielleicht eine Handvoll brauner und indischer Kinder, mit denen zu sprechen oder zu spielen nicht erlaubt war. Wie ungewöhnlich und aufregend war es da, einen Zulu im Anzug zu sehen, aufrecht und Seite an Seite mit einem weißen Mann.
»Constable Desmond Bagley, Revierkommandant der Polizei von Roselet.« Bagley kam von der Veranda herunter und drückte Emmanuel einmal fest die Hand. Shabalala erhielt ein höfliches kurzes Nicken. »Sie sind weit weg von zu Hause. Was führt Sie hier zu uns raus, Detective?«
»Sie haben meine Nachricht nicht bekommen.« Emmanuel blickte hinüber zum Eingang der Wache. Die handgeschriebene Botschaft hing noch an der Tür. Das bedeutete, er musste Bagley ins Gesicht sagen, dass in seinem Bezirk ein Mord geschehen war.
»Normalerweise kommt einer meiner Polizei-Boys vorbei, um die Wache zu öffnen und Nachrichten entgegenzunehmen, aber heute sind alle beide bei einer Wassertaufe im Tal«, sagte Bagley. »Ich komme selber gerade aus der Kirche. Ist etwas passiert, wovon ich wissen sollte?«
»Ein Mord im Kamberg Valley«, sagte Emmanuel und hoffte, dass Bagley möglichst bald über das Gefühl der Unangemessenheit hinwegkam, weil er der Letzte war, der es erfuhr.
»Mein Gott …« Röte zog sich über das Gesicht des Constable. »Wer?«
»Amahle Matebula«, sagte Emmanuel. »Ein junges Zulumädchen.«
»Amahle …« Bagley runzelte die Stirn und warf einen Blick auf das Reviergebäude. In einer Vene auf seiner Stirn pochte sichtbar der Puls. »Der Name sagt mir irgendwas.«
»Sie wurde am Samstagmorgen vermisst gemeldet«, sagte Emmanuel. »Von ihrer Familie.«
»Wie war das gleich …« Bagley grub ein Päckchen Dunhill Cubas aus der Tasche seines Jacketts und durchstach mit seinem Fingernagel die Folie. Die verräterische Vene pochte noch stärker. »Freitagabend gab es eine Schlägerei draußen in der Location, zwei Festnahmen. Am Samstag gab’s einen Vorratsdiebstahl auf der Dovecote Farm und dann einen Einbruch im Dawson’s General Store. Die Boys und ich hatten alle Hände voll zu tun.«
»Klingt ganz danach.« Emmanuel war nicht beeindruckt von der ländlichen Verbrechenswelle, die Roselet heimsuchte. Bagley fuhr nur Ausflüchte auf, um zu erklären, dass er bezüglich der Lappalie eines vermissten schwarzen Mädchens nichts unternommen hatte. »Ist Amahle Matebulas Verschwinden denn im Wachbuch des Reviers vermerkt, Constable?« Das ›Vergessen‹ eines formalen Eintrags im Wachbuch war die simpelste Methode, sich um eine unbequeme Ermittlung zu drücken.
Bagley zog eine Zigarette heraus und klopfte das Ende gegen sein Handgelenk. »Ich versuche mich gerade an die Einzelheiten zu erinnern.«
»Lassen Sie sich Zeit«, sagte Emmanuel und wartete schweigend. Schlampige Polizeiarbeit war unentschuldbar, ganz gleich, um was für einen Fall es ging. Bagley brauchte von ihm keine Hilfe beim Vertuschen einer Pflichtversäumnis zu erwarten.
»Ja, richtig.« Der Constable kramte eine Schachtel Streichhölzer aus seiner Tasche, strich eins an und entzündete seine Zigarette. »Da war am Samstagmorgen ein Zulu-Boy da und meinte, dieses Mädchen Amahle sei am Freitag nicht von der Arbeit nach Hause gekommen. Die Einzelheiten stehen im Wachbuch.«
»Um welche Zeit kam der Junge?«, fragte Emmanuel.
Bagley bemühte sich sehr um Nonchalance, doch die Vene auf seiner Stirn sagte etwas anderes. »Gegen sieben in der Frühe.« Er schnippte Asche in ein Beet und lächelte entschuldigend. »Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Sergeant. Ich hab nicht für eine Minute geglaubt, dass das was Ernstes ist. Vermisste Mädels tauchen gewöhnlich nach wenigen Tagen wieder auf.«
»War Amahle der Polizei bekannt?«, fragte Emmanuel. Schöne schwarze Mädchen mit einer wilden Ader landeten unweigerlich in den lokalen Polizeiakten, meist im Kontext von Alkoholmissbrauch oder Unzucht mit Minderjährigen. »Eine Aufstellung früherer Vergehen wäre für uns ein guter Anfang, um nach Verdächtigen zu suchen.«
»Samstagmorgen war das erste Mal, dass der Name des Mädchens aktenkundig wurde«, sagte Bagley. »Die Eingeborenen im Kamberg Valley sind sehr traditionsbewusst und bleiben gewöhnlich unter sich, von daher ist das nicht weiter überraschend.«
Wohl wahr. Doch bei der Polizei nicht aktenkundig zu sein machte Amahle nicht notwendig zu einem Mädchen ohne Vorgeschichte. Nur Mitglieder der Zulu-Gemeinschaft würden imstande sein, ein genaueres Bild zu liefern, wer sie im Leben gewesen war.
»Könnten die eingeborenen Constables eine Ahnung haben, was ihr zugestoßen sein mag?«, fragte Emmanuel. Zwischen der schwarzen und der weißen Gemeinschaft gab es in bestimmten Arbeitsbereichen Überschneidungen: in der Küche, auf der Farm, im Kinderzimmer. Die Rassentrennungsgesetze galten am schärfsten in Kneipen und im Schlafzimmer.
»Wie ich schon sagte«, Bagley nahm einen tiefen Zug Nikotin und starrte auf den flatternden Zettel an der Tür des Reviers, »waren die letzten Tage für uns recht anstrengend.«
Nicht ein Anruf war getätigt oder auch nur eine Frage zu Amahles Verschwinden gestellt worden. Vermisstenmeldungen waren der Fluch der Polizeiarbeit, doch Emmanuel hatte keinen Zweifel, dass es alles geändert hätte, wäre Amahle blond mit blauen Augen, Sommersprossen und Stupsnase.
Wenigstens hatte Bagley den Anstand, sich wegen seiner Nachlässigkeit zu genieren. »Sergeant, ich gebe zu, ich hätte nach ihr suchen sollen. Aber Sie wissen ja, wie die Dinge laufen …«
Emmanuel wusste genau, wie die Dinge liefen. Es schmerzte ihn.
»Inkosi Bagley! Inkosi Bagley …«, rief eine Stimme von der grasbewachsenen Brache hinter dem Revier. Zwei schwarze Männer in den auffallenden weißen Roben der Zion Native Church rannten auf sie zu, schwitzend und außer Atem.
»Constables«, sagte Bagley.