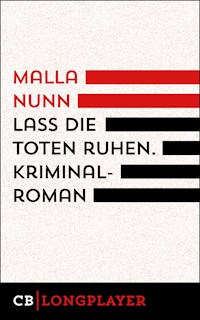9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im zutiefst korrupten Apartheidstaat Südafrika 1953: Detective Sergeant Emmanuel Cooper hat sich nach Johannesburg versetzen lassen, um hier mit seiner heimlichen Familie ein Doppelleben zu führen, von dem keiner seiner Kollegen etwas ahnen darf, schon gar nicht sein argwöhnischer Vorgesetzter Lieutenant Walter Mason. Andernfalls droht Cooper Berufsverbot und Gefängnis, ganz zu schweigen von den Repressalien, die seine farbige Frau und ihre kleine Tochter zu erwarten hätten: Die Rassentrennungsgesetze sind gnadenlos. Er muss also extrem behutsam lavieren. Als im Villenviertel ein weißes Ehepaar überfallen wird, geraten seine Loyalitäten auf den Prüfstand. Cooper kann nicht glauben, dass Constable Shabalalas Sohn ein Raubmörder sein soll. Doch für seine Kollegen ist der Fall klar: Wenn ein weißes Mädchen einen Zulu-Jungen beschuldigt, gibt es kein Zweifeln. Schon gar nicht direkt vor der Urlaubszeit. Cooper wird kurzerhand kaltgestellt. Und riskiert alles. Malla Nunns Romane aus dem Herzen einer repressiven, zutiefst patriarchalen Kolonialgesellschaft kombinieren das unbeschwerte Vergnügen fulminanter historischer Kriminal¬romane – historische Genauigkeit, stringente Plotführung und mitreißend geschilderte Auseinandersetzungen – mit tiefen Einsichten über die Art, wie Menschen sich in Gesellschaft positionieren, worauf sie mit Angst, mit Anpassung, mit Aggression oder mit gesteigerter Kompetenzbildung reagieren. Das ist große Literatur, mitten im Genre. »Nunn ist eine Meisterin darin, die Unterdrückung noch in der leisesten Körpersprache darzustellen. Eine starke Schreibe, aus der der Duft der Regenzeit des südlichen Afrikas aufsteigt.« Christiane Müller-Lohbeck, taz »Behutsam, fein und klug: Nunn.« KrimiZEIT-Bestenliste »Ein zutiefst fesselndes und hypnotisches Leseerlebnis, getränkt mit der Atmosphäre Südafrikas in den 1950ern.« Mike Nicol, Autor der Rache-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch
Südafrika 1953: Detective Sergeant Emmanuel Cooper hat sich nach Johannesburg versetzen lassen, um ein Doppelleben zu führen, von dem niemand etwas ahnen darf. Als im Villenviertel ein weißes Ehepaar überfallen wird, geraten seine Loyalitäten auf den Prüfstand. Cooper kann nicht glauben, dass Constable Shabalalas Sohn ein Raubmörder sein soll. Doch für seine Kollegen ist der Fall klar: Wenn ein weißes Mädchen einen Zulu-Jungen beschuldigt, gibt es kein Zweifeln. Schon gar nicht direkt vor der Urlaubszeit. Cooper wird kurzerhand kaltgestellt. Und riskiert alles.
»Nunn ist eine Meisterin darin, die Unterdrückung noch in der leisesten Körpersprache darzustellen. Eine starke Schreibe, aus der der Duft der Regenzeit des südlichen Afrikas aufsteigt.« Christiane Müller-Lohbeck in der taz
»Behutsam, fein und klug: Nunn.« KrimiZEIT-Bestenliste
»Ein zutiefst fesselndes und hypnotisches Leseerlebnis, getränkt mit der Atmosphäre Südafrikas in den 1950ern.« Mike Nicol, Autor der Rache-Trilogie
Über die Autorin
Malla Nunn
Zeit der Finsternis
Ein Fall für Emmanuel Cooper
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2016
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Originaltitel: Present Darkness © 2014 by Malla Nunn
Printausgabe: © Argument Verlag 2016
Lektorat: Iris Konopik
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: September 2016
ISBN 978-3-95988-058-9
Vorbemerkung
Der Zyklus um Emmanuel Cooper verbindet den Reiz opulenter historischer Romane mit der sezierenden Schärfe meisterhafter Kriminalliteratur. 1953 war die Apartheid noch jung. Jedes Jahr, in dem die Nasionale Party Südafrika regierte, brachte weitere Segregationsgesetze, vergrößerte die Kluft zwischen Nachkommen europäischer Kolonialherren und eingeborenen und eingewanderten »Nichtweißen«. In diesem düsteren Rahmen spielt »Zeit der Finsternis«. Johannesburgs weiße Villenviertel erstehen vor dem inneren Auge, so sinnesnah, dass ich sie sehen, hören, riechen kann, dazu in wildem Kontrast das legendäre Sophiatown, damals Wiege des afrikanischen Jazz, Slum und multikulturelles Mosaik aus schwarzafrikanischen, indischen, chinesischen und kolonialen Lebensweisen: Hier blühten Gegenkultur, politischer Widerstand, Korruption und Gangstertum, bis die Regierung den unregierbaren Stadtteil abreißen ließ. Ein weiterer Handlungsstrang führt uns hinaus ins Veld, in die Trockensavannen nördlich von Pretoria, wo wieder andere Konflikte und Nöte ins Bild rücken. Detective Sergeant Emmanuel Cooper, Detective Constable Samuel Shabalala und Dr. Daniel Zweigman sind das Dreigestirn, dem wir durch die Zeit der Finsternis folgen. Sie leuchten die Erzählung aus, folgen den Spuren von Unrecht, Gewalt und Gier und kämpfen mit schrägen Verbündeten gegen Korruption, Hass und selbstverständliche Grausamkeit an. Epische Spannungsliteratur mit kraftvollen Bildern: Malla Nunns elegante Kriminalromane weiten den Horizont und nähren die Vorstellungskraft.
Else Laudan
Ein ausführliches Glossar finden Sie am
Prolog Johannesburg, Dezember 1953
Freitagabend. Eine ungepflasterte Gasse außerhalb von Yeoville, wo Autos auf dem Weg aus der Stadt vorbeikamen und dann in Richtung der großen Kreuzung verschwanden, die zu den Randbezirken führte. Das Mädchen ging die Schritte von der Mündung zur Straße bis zu dem leeren Grundstück am anderen Ende ab. Manche Männer mochten es, sie auf dem freien Feld flachzulegen. Die meisten lehnten sie lieber an die Mauer der dunklen Gasse. Wenn sie ihren Druck losgeworden waren, stiegen sie in ihre Autos und verdufteten ins weitläufige Netz der Johannesburger Vorstädte: hübsche Viertel mit Namen wie Sandton, Bedfordview und Edenvale. Sie spürte das Geld gern für einen Moment in ihren Händen, bevor sie es in den finstersten Teil der Gasse trug, dort den vertrauten losen Ziegelstein herauszog und die Scheine dahinterschob.
Zwischen den Freiern stand sie etwa auf halber Strecke – im Schatten, doch leicht zu entdecken, wenn man wusste, wo man suchen musste. Die Lage der zwischen hohe Backsteinmauern gezwängten Gasse, in der hier und da zertrampelte Mohrenhirse wucherte, war ideal für Kunden, die zwischen Feierabend und dem Heimweg zehn Minuten übrig hatten.
In unregelmäßigen Abständen erhellten Autoscheinwerfer die eng stehenden Mauern. Das Mondlicht drang kaum herein, die Dächer der anliegenden Gebäude verhinderten das. Ihr machte die Düsternis nichts aus. Sie zeichnete ihr hartes Kinn weicher und glättete die Aknenarben auf ihrer rechten Wange. Sie mochte Dunkelheit. Im Dunkeln war sie vollkommen.
Das Knirschen eines Fußes im Dreck brach die Stille, sie blickte auf. Scheinwerfer strichen vorbei, kurz wurde es hell. Ein Weißer stand am Ende der Gasse, er musste eben von dem unbebauten Grundstück gekommen sein. Er war groß, breit in den Schultern, reglos. Er stand eigentlich nicht in der Gasse herum, vielmehr blockierte er das eine Ende. Ein Schauder wanderte ihre Beine hoch in den Magen.
»Hey, tut mir leid, jetzt passt es schlecht.« Furcht spitzte ihre Stimme an, und sie klang durch und durch nach einer im Slum geborenen englischen Hure, die es billig machte. »Ich mach grad Schluss für heut Nacht.«
Er kam auf sie zu: groß und immer größer. Sicherer Schritt. Keine Eile. Sie wich zurück, ihre Absätze scharrten im Staub. Auf der Hauptstraße fuhren Autos vorbei.
»Okay, Moment.« Sie warf einen Blick über die Schulter und schätzte zwanzig Schritte bis zur Sicherheit von Verkehr und Menschen, vielleicht zweiundzwanzig. »Warten Sie. Reden wir erst mal. Wir können uns vielleicht einigen. Was wollen Sie?«
»Alles«, sagte er.
An einem anderen Abend mit einem anderen Freier hätte sie vielleicht einen Scherz gemacht. ›Schön, aber das kostet dich was.‹
Nicht so jetzt. Sie drehte sich um und rannte zum Ausgang der Gasse. In ihrem Kopf blitzten Bilder eines Straßengrabens auf, das kalte Gewicht von Erde, die Schaufel für Schaufel ihren nackten Körper zudeckte. Jedes Tröpfchen Straßeninstinkt, den sie über die harten Jahre entwickelt hatte, sagte ihr, dieser Mann war auf ihr Blut und ihre Gebeine aus. Aber er würde nichts bezahlen für das, was er nahm.
Noch siebzehn, noch sechzehn Schritte bis zur Hauptstraße. In Wahrheit hatte sie sich schon verzählt. Egal. Der Verkehr wurde lauter, die Scheinwerfer heller. Sie riskierte einen Blick über die Schulter. Der Mann schlenderte den Weg entlang, die Hände tief in den Hosentaschen. In dem Tempo holte er sie nicht ein. Sie war fast in Sicherheit. Jetzt schnell nach Hause. Klinke drücken, reinschlüpfen und die Tür abschließen.
Sie knallte mit Wucht gegen einen drahtigen Körper. Der Aufprall warf sie aus dem Gleichgewicht, die Luft wich aus ihren Lungen. Ihre Schulter schlug hart auf den Boden. Sie sah hoch, verwirrt. Ein zweiter Mann ging in die Hocke und drückte ihr die Hand auf den Mund. Seine Handfläche roch nach Rohzucker. So ein süßer Duft inmitten des Gestanks von Urin und Mohrenhirse in der Seitengasse. Plötzlich begriff sie. Es waren zwei Männer in der Gasse, und zusammen hatten sie sie gefangen wie einen Vogel im Netz.
Der, der sie festhielt, sagte: »Stell sicher, dass sie wirklich weiß ist. Damit nimmt er es sehr genau.«
Der Mann, der den Ausgang zum leeren Grundstück versperrt hatte, steckte sich eine Zigarette in den Mundwinkel. Das Aufflammen eines Streichholzes erhellte kurz sein Gesicht, glattrasiert und ansehnlich mit aus der Stirn zurückgekämmtem schwarzem Haar. Ein Traumkunde. Er hockte sich hin und hielt die Flamme dicht vor ihr Gesicht. »Weiß und hässlich«, sagte er und beugte sich näher. »Willst du heut Abend mit mir heimfahren, Herzblatt?«
Der Drahtige hielt ihr immer noch den Mund zu. Sie schüttelte den Kopf, nein. Zwei Rauchfähnchen schlängelten sich aus den Nasenlöchern des ansehnlichen Kerls, und er lächelte.
1
Detective Sergeant Emmanuel Cooper schritt durch den heruntergekommenen Garten, das Jackett in der nächtlichen Hitze aufgeknöpft. Ein fetter Mond schaukelte in den Ästen eines Jacarandabaums, die Luft trug den Geruch frisch gemähter Wiese und der schamlos purpurroten Blüten des Baums mit sich. Es war ein perfekter Freitagabend, um mit seiner Tochter Rebekah auf dem Schoß herumzusitzen, ihre stämmigen braunen Ärmchen um seinen Hals, Davida barfuß neben ihm auf den Stufen. Stattdessen stand er im blinkenden Licht eines Streifenwagens an einem Tatort in Parkview.
Blaue Polizeiabsperrungen umgaben ein Backsteinhaus, aus dessen Gullys hohes Unkraut spross. Die Barrikaden wirkten wie eine Mahnung, dass seine Bewohner den Vorhang des Alltäglichen hinter sich gelassen hatten und in eine dunklere Welt aus Blut und Zerstörung übergetreten waren. Emmanuel stieg über die Tatortabsperrung und ließ das Gewöhnliche hinter sich.
»Detective, Sir.« Ein schlaksiger weißer Polizist, der nach Schweiß und Erbrochenem stank, kam die Stufen herunter. Er war drinnen gewesen, nahm Emmanuel an, und hatte wohl etwas gesehen, das er nicht vergessen würde. »Lieutenant Mason sagt, Sie sollen gleich reinkommen, Detective. Sir.«
Auf der vorderen Veranda stand ein Haufen junger uniformierter Constables herum. Zwei weitere bewachten die Haustür. Weiße Mittelklasse-Opfer brachten mit Macht die Macht zum Vorschein.
»Sergeant Cooper vom Marshall Square«, sagte Emmanuel zu den Wachposten an der Tür. Sie traten beiseite. Er trat ein.
Zertrümmerte Möbel lagen im Eingang, herausgerissene Telefondrähte schlängelten sich auf den Eichendielen. Die Scherben einer zerstörten Flurgarderobe reflektierten ein Lichtmosaik an die Decke. Emmanuel holte tief Luft. Ein einziger Anruf wenige Minuten vor Schichtende hatte den Unterschied ausgemacht: Statt mit Davida und Rebekah zusammen zu sein, war er hier, mitten im Chaos.
»Gewaltige Sauerei, was?« Detective Constable Dryer, ein grobknochiger Afrikaaner mit schütterem braunem Haar, das über eine kahle Stelle gekämmt war, stand in einem Türrahmen rechts von dem Trümmerhaufen. Dryers noch brauchbarste Eigenschaft war seine Fähigkeit, das total Offensichtliche auszusprechen.
»Mhm.« Emmanuel gab ein passendes Geräusch von sich. Die weiß-gelben Telefondrähte interessierten ihn. Das Telefon selbst lag ein Stück weiter im Flur, der Hörer war von der Schnur abgerissen, die ihn mit dem Gerät verband. Die aus der Wand gerupften Kabel mochten auf extreme Vorsicht oder brutale Raserei hindeuten. Was davon zutraf, ließ sich vorerst unmöglich sagen. Eine Krankenwagensirene heulte in der Ferne.
»Bestien. Wer sonst würde so was so kurz vor Weihnachten tun?« Dryer hakte seine dicken Daumen in den Gürtel, was seinem Bierbauch etwas mehr Bewegungsfreiheit verschaffte. »Sie werden schon sehen, Cooper. Der Polizeichef wird uns treten wie Hunde, bis dieser Fall abgeschlossen ist. Kein Feierabend, keine Auszeiten. Von unserem Urlaub können wir uns auch verabschieden.«
»Schlechter Zeitpunkt«, sagte Emmanuel. Dryer beklagte sich gern. Würde er bei der Post arbeiten, wären die Postsäcke immer zu schwer. Der fleischige Afrikaaner war eine Art Hintergrundrauschen und gehörte nun mal zu der Unbill, die Emmanuel auf sich genommen hatte, um eine kurzfristige Versetzung aus der Küstenstadt Durban ins Flachland von Johannesburg zu erwirken. Er hatte seinen Boss, Colonel van Niekerk, heftig um diese Versetzung bekniet und wusste, dass er den Gefallen irgendwann würde zurückzahlen müssen – mit Zinsen. Aber Davida und Rebekah jeden Tag sehen zu können war die härtere Arbeitsbelastung allemal wert, und Dryer war auch nicht schlimmer als die meisten Ermittler, mit denen er anderswo gearbeitet hatte.
Glasscherben knirschten unter Sohlen, und ein großer Mann mit dünnem, humorlosem Mund trat aus einem Raum weiter hinten. »Detectives«, sagte er. Schwarze Haare, schwarze Schuhe und ein faltenfreier schwarzer Anzug: Lieutenant Walter Mason hatte etwas Begräbnishaftes an sich.
»Cooper.« Mason krümmte einen Finger. »Hier rein zu mir.«
Emmanuel hielt sich auf der linken Flurseite, sorgsam darauf bedacht, die Verwüstung nicht zu beschädigen. Er warf einen Blick in ein Wohnzimmer mit lindgrünem Teppich, braunem Cordsofa und einem lamettabehängten Weihnachtsbaum, es wirkte unberührt. Auf dem Kaminsims standen vier silberne Fotorahmen in einer geraden Linie ausgerichtet. Von irgendwo im Haus war leises Weinen zu hören.
»Keine Zeit für Feinheiten jetzt, Cooper«, sagte Mason. »Die Sanitäter müssen da durchkommen. Dryer, machen Sie ihnen den Weg frei.«
»Aber …« Der Afrikaaner setzte an, sich zu beschweren. Masons eisige Miene sorgte dafür, dass ihm die Worte im Hals stecken blieben. »Schon dabei, Sir.«
Emmanuel erreichte die Tür, wo der Lieutenant wartete. Eichendielen ächzten unter jedem Schritt. Die Luft roch wie oxidiertes Kupfer nach einem Regenguss. Emmanuel kannte den Geruch gut. Es war der heiße, nasse Dunst von Blut, ein Geruch, der tief in sein Gedächtnis gebrannt war. Er hatte auf Frankreichs Schlachtfeldern während des Krieges zu viel davon gerochen.
»Gehen Sie durch.« Mason wies auf ein in helles elektrisches Licht getauchtes Schlafzimmer. Der metallische Geruch wurde stärker und brannte in Emmanuels Kehle. Ein weißer Mann ohne Hemd lag auf dem cremefarbenen Teppich, die bleichen Arme und Beine in aberwitzigen Winkeln abgespreizt. Das Gesicht des Mannes, breiig und zu fast doppeltem Umfang aufgebläht, erinnerte an eine Grapefruit, die man zum Verrotten auf dem Feld liegen gelassen hatte. Hinter einer aufgeplatzten Unterlippe zeigten sich fleckige Zähne. Er war grässlich zugerichtet. Vielleicht lebte er noch bis Mitternacht.
»Ian und Martha Brewer«, sagte Mason. »Ein Schuldirektor und eine Sekretärin der Landwirtschaftsbehörde. Nicht ganz die üblichen Opfer solcher Gewaltverbrechen.«
Emmanuel ging um das Bett herum und fand Martha Brewer. Sie war ein winziges Persönchen und lehnte am Bettrahmen wie eine Marionette mit durchtrennten Strippen. Blut verklebte ihr blond gefärbtes Haar, befleckte den Ausschnitt ihres rosa Baumwollnachthemds. Ein Puls flatterte am Ansatz ihres Halses, schwach, aber regelmäßig. Die Krankenwagensirene heulte jetzt vor dem Haus auf und ließ sämtliche Hunde in der Nachbarschaft anschlagen.
»Bleiben Sie hier, Cooper. Ich nehme die Sanis in Empfang.«
»Jawohl, Sir.« Emmanuel blieb in der Hocke und sah sich um. Trümmer eines Mittelklasselebens verunzierten jede Oberfläche des Raums. Die Wand hinter dem Bett mit dem Flickenüberwurf war im hohen Bogen mit rostroten Spritzern besprüht. Sommerkleider und schlichte Baumwollhemden quollen aus zerschlagenen Kommodenschubladen. Auch der Kleiderschrank war durchwühlt worden.
»Hier entlang.« Mason führte zwei weiße Männer ins Schlafzimmer. Jeder hatte eine Tragbahre aus Holz und Leinen unterm Arm und einen Erste-Hilfe-Koffer in der Hand. »Sehen Sie erst nach der Frau.«
Emmanuel trat in den Flur, um den Sanitätern Platz zum Arbeiten zu lassen. Sie knieten sich auf den besudelten Teppich, stillten Blutungen, verbanden Wunden. Binnen kurzem waren ihre Hände triefnass, die Knie ihrer Hosen rot durchweicht. Martha Brewers Körper machte nur eine kleine Vertiefung in die Trage, als sie sie auf dem Pfad, den Dryer durch die Trümmer im Flur gebahnt hatte, zum Krankenwagen brachten.
»Der Mann ist hin«, sagte Mason, als die Ambulanz mit kreischenden Sirenen auf der Asphaltstraße losdonnerte, Ian und Martha Brewer im Fond festgeschnallt. »So Gott will, wird die Frau die Nacht überleben.«
»Ja, Gott sei ihr gnädig.« Erneut produzierte Emmanuel die angemessenen Geräusche. An manchen Tagen schien es ihm, als gäbe er kaum etwas anderes von sich als Lügen durch Zustimmung.
»Ich habe Sie gar nicht für jemanden gehalten, der betet, Cooper«, bemerkte Mason. Die einzige wirkliche Farbe im Gesicht des Lieutenants lag in seinen Augen: Sie waren hellblau. Eiswürfel strahlten mehr Wärme aus.
»Ich gehe auf Nummer sicher.« Emmanuel untersuchte die Telefonkabel, um eine Diskussion über Religion mit Mason zu vermeiden, der ein fanatischer wiedergeborener Christ war. Zwölf Jahre lang hatte der Lieutenant bei der Einheit für verdeckte Ermittlungen im Milieu gearbeitet, mit ständigem Zugriff auf seine beiden großen Lieben, Sour Mash Whiskey und kostenlose Mösen. Dann hatte ihn ein evangelikaler Wanderprediger erweckt, und nun diente er einem freudlosen Gott, der alles missbilligte, was Vergnügen machte, sogar das Lachen.
»Also ist es wahr«, sagte Mason. »Im Schützengraben gibt es keine Atheisten.«
»Ich habe keinen getroffen«, sagte Emmanuel. Offenbar wusste sein vorgesetzter Offizier, dass er während des Krieges bei der kämpfenden Truppe gewesen war und nicht in der Etappe, doch das war eine Spitzfindigkeit, über die er später nachdenken konnte.
»Dies alles nur wegen einer Schachtel Schmuck und einem in der Unterwäsche-Schublade versteckten Bündel Banknoten.« Mason deutete auf die zertrümmerte Einrichtung. »Die Liebe zum Geld ist wahrlich die Wurzel alles Bösen.«
»Im Wohnzimmer wurde nichts angerührt«, sagte Emmanuel. »Da steht eine Reihe silberne Bilderrahmen auf dem Kaminsims. Warum so viel Energie reinstecken und die dann nicht mitnehmen?«
»Es wäre ja nicht das erste Mal, dass aus einem Einbruch ein Mord geworden ist.«
»Richtig.« Einbrecher, die jemand auf frischer Tat ertappte, töteten jedes Jahr Dutzende von Leuten und verstümmelten noch sehr viel mehr. »Dieses Ausmaß an Gewalt wirkt allerdings geradezu ausschweifend, fast als wäre es persönlich gemeint.«
Aus dem hinteren Teil des Hauses war ein Schluchzen zu vernehmen.
»Das ist die Tochter, die Sie da hören.« Mason stapfte den Flur entlang, Trümmer knirschten. »Negus macht in der Küche den Babysitter, bis eine von den Sekretärinnen aus dem Revier eintrifft. Sie braucht weibliche Einfühlung.«
Weibliche Einfühlung war Polizeijargon für: ›Die Zeugin ist hysterisch und hört nicht auf zu heulen, obwohl wir es angeordnet haben.‹ Emmanuel folgte Mason und warf einen Blick in einen Raum mit einem umgestürzten Einzelbett, einem geplünderten Kleiderschrank und Wänden mit einer gelben Kanarienvogeltapete: das Zimmer eines Teenagers, wohl des Mädchens.
»Die Polizeisekretärin kommt extra aus Benoni. Sie kann frühestens in einer halben Stunde hier sein.« Der Lieutenant mit den kalten Augen blieb vor einer geschlossenen Tür stehen und warf Emmanuel über die Schulter einen Blick zu. »Ich will, dass Sie da reingehen und versuchen, für Beruhigung zu sorgen, Cooper. Wenn ich mich recht erinnere, können Sie gut mit Frauen.«
»Ich versuch’s«, sagte Emmanuel. Gut mit Frauen? Er konnte sich nicht vorstellen, wo Masons Bemerkung herkam.
Dryer gackerte, überzeugt, dass Mason auf eine Party aus Dryers Phantasie anspielte, bei der Emmanuel und der Lieutenant sich gemeinsam in ein wahres Hurengelage gestürzt hatten, kredenzt von einer gefügigen Madam. Dryer war ein Idiot.
Emmanuel versuchte vergeblich, die Quelle von Masons Informationen zu erraten. Sie hatten noch nie zusammengearbeitet oder auch nur in derselben Bar ein Bier getrunken. Die Einheit für verdeckte Ermittlungen war eine undurchlässige Truppe. Sie glaubten an Geheimhaltung und Geld. Emmanuel hatte sich seine ganze Laufbahn über möglichst von ihnen ferngehalten – und ganz besonders, seit er wieder in Jo’burg war.
»Hier rein.« Mason öffnete die Tür zu einer verwüsteten Küche. Silberbesteck und zerschmetterte Behältnisse waren über Boden und Arbeitsflächen verstreut. Auf dem kleinen Kiefernholztisch waren Haufen aus Mehl, Reis, Kaffee und Zucker ausgeschüttet. Ein weißes Mädchen in einem Baumwollnachthemd saß auf einem Stuhl, das Gesicht in den Händen vergraben, und weinte.
»Name?«, fragte Emmanuel, ehe er hineinging.
»Cassie. Das wissen wir von dem Nachbarn, der die Ruhestörung gemeldet hat. Sie hat bis jetzt nichts von sich gegeben.«
Negus, der zum Babysitten abgestellte Detective, war ein solider Cop alter Schule, den Emmanuel vom Revier kannte. Er brachte zu jeder Schicht dreierlei mit: eine geladene Waffe, Adrenalin und ein Harter-Mann-Gesicht. Guter Cop hin oder her, er war mangelhaft ausgestattet, um eine Halbwüchsige zu trösten, deren Eltern vielleicht heute Nacht noch starben.
»Gott sei Dank«, murmelte Negus und strebte zur Tür. »Ich muss dringend pissen und eine rauchen.«
Das Mädchen, Cassie, schluchzte und hielt die Finger fest zusammen. Die Augen geschlossen, das Gesicht versteckt, versuchte sie das Chaos auszusperren. Emmanuel trat weiter in den Raum hinein: Zeit für Cassie, die Hände zu senken und die Augen zu öffnen.
»Die Ortspolizei hat sie in der Ecke da gefunden.« Mason zeigte auf einen Winkel neben einem vierflammigen Gasherd. »Wir haben versucht, sie hier rauszuholen, aber sie will nicht weg.«
Die Küche roch immerhin nach Zimt und Rohzucker statt nach Blut. Es war auch kein Blut im Raum, soweit Emmanuel sah. Der Direktor und seine Frau waren im Schlafzimmer zusammengeschlagen worden, während das Haus auf den Kopf gestellt wurde: Es waren mindestens zwei Mann am Werk gewesen. Er fand in dem Tohuwabohu einen Kessel und füllte ihn an der Spüle.
»Möchtest du eine Tasse Tee, Cassie?«, fragte er. »Oder vielleicht Kakao, wenn ich welchen finde?«
»Nichts.« Sie schniefte.
»Bist du sicher?«
»M-hm.«
Sie sprach. Das war ein Anfang. Emmanuel ließ das Wasser laufen und begutachtete sie auf Verletzungen. Blut, das an ihren Schenkeln herabrann oder von ihrem Ellbogen tropfte, wäre in dem Mehl auf dem Boden deutlich sichtbar. Das Mehl war noch sauber. Cassies sommersprossige Beine und bleiche Arme schienen ebenso unversehrt, ihr gelbes Nachthemd makellos.
»Ist das Blut?« Emmanuel beugte sich näher heran, sein Herz klopfte. Etwas Rotes zog sich über Cassies Handrücken. Wer wusste schon, was für Wunden sich in diesen jetzt fest geschlossenen Handflächen verbargen?
»Was?« Sie hickste.
»Da.« Er berührte die Stelle vorsichtig mit dem Finger und bemerkte, dass das Rot einen merkwürdigen metallischen Glanz hatte.
»Oh.« Sie ließ die Hände auf den Tisch sinken und rubbelte mit einer Fingerspitze an der Schliere. »Ich weiß nicht, wo das herkommt.«
Oh doch, das weißt du, dachte Emmanuel. Es war kein Blut, woran Cassie so wild herumrieb, es war Lippenstift.
»Ich bin Detective Sergeant Cooper«, sagte er und drehte den Wasserhahn zu. »Bist du irgendwo verletzt, wo ich es nicht sehen kann?«
»Nein.« Cassie kratzte die letzte Spur Rot mit dem Fingernagel weg und schlang sich eine Strähne krauses rotes Haar hinters rechte Ohr. Sie war ungefähr fünfzehn Jahre alt mit leuchtend hellbraunen Augen und einem breiten Mund, der in ein massigeres Gesicht gehörte. Sommersprossen sprenkelten ihre Nase, ihren Hals und die Schlüsselbeine, so dass ihre Haut eher bräunlich als weiß wirkte. »Mir fehlt nichts. Wirklich.«
Emmanuel reichte ihr sein Taschentuch und sagte: »Kannst du mir erzählen, was passiert ist, Cassie?«
Sie schnäuzte sich die Nase und runzelte die Stirn, dachte nach.
»Lass dir Zeit.« Er entzündete die Gasflamme unter dem Kessel. »Es eilt nicht.«
»Ich … ich schlief in meinem Bett, und dann war da ein … ein großer Krach. Als ob jemand im Haus war.« Das Stirnrunzeln vertiefte sich, schnitt einen Graben zwischen ihre Brauen. »Es war dunkel. Ich konnte nichts sehen.«
»Erzähl mir, was du dann gemacht hast«, Emmanuel setzte sich an den Tisch. »Nach dem Krach.«
»Ich bekam Angst, und ich bin aufgestanden.« Cassie drehte eine Ecke des Taschentuches zu einem festen Zylinder. »Dann hab ich mich hinterm Kleiderschrank versteckt.«
»Deinem Kleiderschrank?« Die geborstenen Türen und den verstreuten Inhalt hatte er aus dem Flur gesehen.
»Jaa. Genau.«
»Hast du von da aus Stimmen gehört?«
»Was?« Die Frage schien sie zu erschrecken, und die Winkel ihres breiten Mundes zuckten. »Ich … ich weiß nicht, was Sie meinen.«
Emmanuel sagte: »Du warst hinter dem Kleiderschrank, während die Einbrecher in deinem Zimmer waren. Haben sie irgendetwas gesagt?«
Cassie holte tief Luft und blickte weg, zum Küchenfenster. Draußen hing der Mond jetzt tiefer in den Ästen des Jacarandabaums. Zwei Minuten tickten in Stille vorbei.
»Zulu«, sagte sie schließlich. »Sie sprachen Zulu. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben.«
Schritte schlurften an der Tür. Mason und Dryer kamen näher, um den Rest von Cassies Geschichte mitzubekommen. So kurz vor den Weihnachtsferien würde der Polizeichef alle Urlaubstage streichen, bis eine Verhaftung erfolgte. Die Schlagzeilen morgen würden eine Welle der Angst durch die weißen Viertel schicken: »Zulu-Rotte schlägt weißes Ehepaar im Bett tot.«
»Es war nicht Pedi oder Shangaan, was du gehört hast?«, fragte Emmanuel. Johannesburg war die ökonomische Machtzentrale von Südafrika und zog mit dem Versprechen von Arbeit schwarze Afrikaner aller Stammesgruppen in die Stadt. Es war ein Babel des Industriezeitalters, in dem Dutzende Sprachen gesprochen wurden.
»Nein. Das war Zulu. Eindeutig. Ich …« Cassie begrub ihr Gesicht in den Händen und begann wieder zu weinen.
Emmanuel strich ihr mit einer Hand über den Arm, hoffte, die Wärme einer menschlichen Berührung würde sie beruhigen. Das war nicht der Fall. Cassies Schluchzen nahm noch zu. Erst vor kurzem hatte sie allein in einer Ecke gehockt, zu verängstigt, um sich zu rühren, während ihre Eltern ein paar Schritte entfernt auf dem Teppich verbluteten.
Emmanuel stand auf und legte ihr den Arm um die Schultern. Ihr nasses Gesicht drückte sich gegen seinen Bauch. Er gab die passenden Laute von sich, allerdings empfand er weder Kummer noch Mitleid oder Zorn. Er war wie losgelöst, schwebte über der demolierten Küche und fragte sich, wann das Lügen ihm so zur tief verinnerlichten Gewohnheit und dermaßen leicht geworden war. Drahtiges Haar kräuselte sich an seinem Hemd, viel lockiger, als das seiner ›gemischtrassigen‹ Tochter je sein würde. Seine kleine Rebekah würde er niemals so in der Öffentlichkeit in den Arm nehmen können.
»Ist ja schon gut.« Er sprach das vorgegebene Drehbuch nach. »Du bist jetzt in Sicherheit. Du kannst mit mir reden. Erzähl mir alles.«
»Ich hab ihre Stimmen erkannt.« Cassies Gesicht grub sich noch tiefer in sein tränennasses Hemd. »Ich weiß, wer es getan hat.«
»Du kennst ihre Namen?«, fragte Emmanuel.
Mason kam in die Küche und stellte sich dicht neben den Kiefernholztisch. Mit Schlangenaugen beobachtete er Emmanuels fürsorgliche Bemühungen. Wenn ich mich recht erinnere, können Sie gut mit Frauen. Emmanuel war in den letzten fünf Wochen bei seinen Lügen extrem sorgfältig vorgegangen, insbesondere Mason gegenüber. Über sein Privatleben zu plaudern würde ihn für drei bis sechs Jahre wegen »unsittlicher Handlungen« hinter Gitter bringen. Die Schönheit von Davida Ellis’ honigbrauner Haut auf weißen Baumwolllaken und das Himmelgrau der Augen seiner Tochter mussten unbedingt sein Geheimnis bleiben.
»Es waren Jungs vom St. Bartholomew’s College«, sagte Cassie. »Zwei von ihnen.«
»Sieh mich an, Cassie.« Emmanuel wartete, bis sie es tat. Er musste ganz sicher sein, dass hier kein Irrtum vorlag. »Du sprichst vom St. Bartholomew’s College in Sophiatown?«
Sie wich seinem Blick aus und leckte sich über die trockenen Lippen. »Ja.«
Die anglikanische Schule mit ihrer weithin bekannten roten Ziegelkapelle lag in Emmanuels altem Viertel. Die Kirchenschule war eine Oase in den rauen Straßen von Sophiatown, eine Schule für schwarze Jungs, die Lehrer oder Anwalt statt Gangster werden wollten. Der Sohn seines engsten Freundes Detective Constable Samuel Shabalala ging auf diese prestigeträchtige Schule.
»Wie hast du denn Schüler einer Eingeborenenschule kennengelernt?« Sophiatown war keine acht Meilen entfernt von dem wohlgeordneten Vorortviertel, in dem Cassie wohnte, doch es hätte ebenso gut auf einem anderen Planeten in einer weit entfernten Galaxie liegen können.
»Mein Vater«, sagte Cassie. »Er betreibt ein außerschulisches Programm für Eingeborene. Er nimmt sie mit ins Theater und zu Klassikkonzerten. Einmal pro Semester kommen sie zum Abendessen her.«
»In dieses Haus?«
»Jaa. Er dachte, es wär gut für sie, zu sehen, wie Weiße leben.«
Dryer an der Tür schnaubte. Emmanuel trat von Cassies vergrabenem Gesicht weg und hockte sich neben ihren Stuhl. Sie kaute an ihrer Unterlippe.
»Sag mir die Namen.«
»Ich … ich will niemanden in Schwierigkeiten bringen.«
»Wir reden nur mit ihnen und klären das ab. Das ist alles.« Es überraschte Emmanuel, dass er ihr die Namen der Übeltäter aus der Nase ziehen musste. Du lieber Himmel. Was kümmerte es sie, wenn zwei schwarze Jungs aus der Township Ärger bekamen, weil sie ihre Eltern zusammengeschlagen und ihr Heim verwüstet hatten?
Cassie presste sich das Taschentuch vors Gesicht. »Kibelo Nkhato. Ich glaube, das war sein Nachname«, sagte sie. »Und Aaron Shabalala.«
Emmanuel glitt zurück in seinen Körper, sein Herz hämmerte und Panik breitete sich aus wie ein Virus. Shabalala war ein verbreiteter Zulu-Nachname. Wenn man in Sophiatown ein Netz aus dem Bus warf, fing man ein Dutzend davon ein. Aber dass zwei Jungen namens Aaron Shabalala auf dasselbe Anglikaner-geführte Internat gingen, war ausgesprochen abwegig.
»Bist du dir bei den Namen ganz sicher?« Emmanuel beugte sich vor, um Blickkontakt mit Cassie herzustellen. Dass es zwischen ihm und diesem Tatort eine persönliche Verbindung gab, war von geradezu astronomischer Unwahrscheinlichkeit.
»Ja, natürlich. Sie waren ja heute Abend hier, zu dem Semesterabschluss-Essen.« Das Taschentuch dämpfte die leichte Schrillheit ihrer Stimme. »Es waren Aaron und Kibelo. Diese beiden Jungs. Ich denk mir das nicht aus.«
»In Ordnung.«
Ihr Blick flackerte ein zweites Mal zum Fenster. Bei jedem anderen Zeugen deutete die Vermeidung von Blickkontakt auf eine Lüge oder Ausflucht hin. Emmanuel war sich nicht sicher, ob diese Regeln hier galten. Cassie war ein argloses Mädchen, von dem er mutmaßte, dass sie auf dem Schulball in einer Ecke hockte, eine leere Tanzkarte auf dem Schoß und eine welkende Nelke hinterm Ohr. Vielleicht hatte er es mit dem Blickkontakt übertrieben und sie in ihr Schneckenhaus zurückgescheucht.
»Aaron Shabalala und Kibelo Nkhato.« Emmanuel setzte sich wieder hin und klappte sein Notizbuch auf. Er verfuhr wie üblich. Solange er nicht mit Sicherheit wusste, dass dieser Aaron wirklich der Sohn seines Freundes war, gab es nichts anderes zu tun.
»Beschreib mir die Jungs«, sagte er.
»Kibelo ist dünn und hellhäutig. Er trägt eine Brille und redet gern. Shabalala ist nicht so.« Hitzige Farbe stieg in Cassies Wangen. »Er ist groß, mit breiten Schultern und braunen Augen. Er redet nicht so viel, und manchmal ist sein Gesicht wie eine Maske, so dass man nicht wissen kann, was er denkt.«
Er hatte nie einen von Shabalalas Söhnen persönlich getroffen, aber ein großer Zulu mit breiten Schultern und der Fähigkeit, seine Gedanken für sich zu behalten – diese Beschreibung passte sehr gut auf Detective Constable Samuel Shabalala von der Native Detective Branch.
»Hat dein Vater Geld im Haus aufbewahrt?« Emmanuels Stimme blieb ungeachtet seines hämmernden Herzens kühl und ausdruckslos.
»Nein«, sagte Cassie. »Er hat den Jungs immer gern vorgebetet, dass die Bank der einzig sinnvolle Ort ist, um Geld aufzubewahren. Man verdient Zinsen mit jedem Guthaben, und das Geld ist versichert, falls es je zu einem Raub kommt.«
Solide Beratung, die Cassie mit gläsernem Blick wiedergab. Emmanuel machte sich klar, dass diese Abschlussessen für Cassie wahrscheinlich die reinste Tortur waren. Sie musste höflich am Tisch sitzen, umgeben von eingeborenen Knaben, während ihr Vater sich über die kulturellen Mysterien der weißen Rasse erging. Die Nachbarn dürften von der Vorstellung schwarzer Jungs, die nebenan von Porzellantellern aßen, ebenfalls nicht gerade erbaut sein.
»Warum, glaubst du, haben sie es getan?«, fragte Emmanuel.
»Wer?«
»Die Jungs. Wenn Nkhato und Shabalala doch wussten, dass kein Geld im Haus war, was glaubst du, warum haben sie all das hier getan?« Er zeigte auf die Verwüstung ringsum.
»Ach so …« Cassies Blick flog über die Trümmer, und ihre Schultern krümmten sich. Sie dachte einen Augenblick nach und sagte dann: »Sie haben das Auto genommen. Vielleicht war es das, was sie wollten.«
»Was für ein Auto?« Masons Stimme war wie ein Eimer Eiswasser, den man ins Feuer schüttet. Cassie zuckte zusammen.
»Sag mir mehr über das Auto.« Emmanuel übertönte das leise Knirschen von Masons Zähnen. Sie können gut mit Frauen. Er musste herausfinden, woher der Mann, der bei der Sicherheitspolizei gewesen war, diese Idee hatte.
»Es ist ein Mercedes-Benz Kabriolett«, sagte Cassie. »Rot, mit schwarzen Ledersitzen.«
»Schick …« Dryer stieß einen leisen Pfiff aus und nickte anerkennend. Eine Bewegung von Masons Zeigefinger, und er zog sich hastig in den Flur zurück.
»Gehen Sie die Garage überprüfen, Cooper.« Mason stieß mit dem Daumen Richtung Hintertür. »Sehen Sie nach, ob das Auto weg ist.«
»Die Jungs sind hier eingebrochen, haben den Schlüssel gefunden und den Mercedes gestohlen. Ich hab den Motor gehört«, sagte Cassie.
»Machen Sie schnell, Sergeant.« Cassies Äußerung schien Mason mehr aus der Ruhe zu bringen als der Überfall auf ihre Eltern. Sein Kiefer mahlte an einem unsichtbaren Stück Knorpel zwischen seinen Zähnen. »Man muss doch ein Idiot sein, um einen solchen Wagen zu stehlen und zu glauben, man würde damit nicht auffallen.«
Emmanuel stand auf, schaltete den Herd aus und ging zur Hintertür. Mason hatte völlig recht. Zwei schwarze Jungs in einem roten Luxuswagen. Die Idee war absolut lächerlich. Sie würden an der ersten Straßenkontrolle scheitern.
Eine Porzellanscherbe knackte unter seinem Schuh, und er blickte nach unten. Der Abdruck eines nackten Fußes zeigte sich auf den mehlbestäubten Fliesen. Es war kein einzelner Abdruck, sondern eine ganze Spur, und sie führte von der Hintertür zu der Ecke der Küche, in der die Polizei Cassie versteckt gefunden hatte.
Emmanuel untersuchte die Tür. Das Schloss selbst war aufgestemmt, das im Türblatt eingelassene Rechteck aus Glas jedoch unversehrt. Hier waren sie ins Haus gekommen. Ein simpler Einbruch, der mit dem Aufbrechen dieses Schlosses begann und mit Chaos endete. Waren die Autoschlüssel so schwer zu finden gewesen?
»Machen Sie schon, Cooper. Wir müssen zu der Schule und diese Boys verhören. Falls sie überhaupt noch in der Stadt sind.«
Er warf einen letzten Blick durch die Küche. Cassie hockte gekrümmt auf ihrem Stuhl und nagte an ihren Fingernägeln. Die Spur der Fußtapfen schlängelte sich um zersplittertes Glas herum und übersprang Porzellanscherben. Trotz ihrer Todesangst hatte Cassie sich achtsam einen Weg durch den Raum gebahnt bis zu einer sicheren Ecke. Sie sah hoch und begegnete Emmanuels Blick.
Sein Blick sagte: Du lügst, Mädchen. Und ich weiß es.
Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen.
2
»Auto ist weg, Lieutenant.«
Der Geist eines Ölflecks auf dem Betonboden war der einzige Hinweis darauf, dass in der Garage der Brewers ein Fahrzeug gestanden hatte. Emmanuel ging zur Rückseite der Garage durch und trat hinaus ins Mondlicht. Der hintere Garten war ein Wildwuchs aus Obstbäumen und Kletterpflanzen. Gruppen von Feigenbäumen und ausladende Bananenstauden gaben Emmanuel das Gefühl, wieder in einer ländlichen Stadt zu sein, so wie Jacob’s Rest, wo er Davida kennengelernt hatte. Ein unsichtbares Tier, groß genug, um deutlich hörbare Kriechgeräusche zu machen, bewegte sich im Unterholz.
»Hier hinten ist etwas«, sagte er laut genug, dass Dryer und Mason ihn hören konnten. »Etwas Großes. Ich schaue mal nach.«
»Dryer, gehen Sie mit Cooper, sehen Sie nach, was da draußen ist«, sagte Mason, aber Emmanuel war schon dabei, den mondbeschienenen Garten zu durchsuchen. Hinter einer Wäscheleine stieß er auf einen schmalen Pfad und folgte ihm. Knorrige Äste und wilde Büsche unbeschnittener Rosen drängten sich von beiden Seiten heran und behinderten das Vorankommen. Das kriechende Geräusch wurde lauter.
»Polizei.« Er sprach gut hörbar und deutlich. »Kommen Sie heraus, wo ich Sie sehen kann.«
Keine Antwort. Er stieß tiefer in den verwilderten Garten vor, hielt sich an den schmalen Trampelpfad. Aus einem dichten Pflanzengestrüpp vor ihm drang ein Laut.
»Polizei«, sagte Emmanuel noch einmal und spähte in das Gewirr aus Ästen und Stämmen. Finsternis stierte zurück. Er knöpfte das Revolverholster auf und schlug sich geduckt ins Unterholz. Er orientierte sich wie ein Blinder, indem er mit ausgestreckter Hand vor sich her tastete. Ein scharfes Knacken ertönte rechts von ihm. Er fuhr zurück und stützte sich mit einer Hand am Boden ab, um das Gleichgewicht zu halten. Nasse Blätter klebten an seiner Handfläche fest, und der vertraute Geruch von Blut stieg vom Boden auf.
Emmanuel wischte sich das Laub ab und rückte vor, wie er es im Krieg getan hatte, als jeder Schritt vorwärts sein letzter sein konnte. Das Kriechgeräusch kam jetzt von direkt vor ihm. Er griff zu und berührte eine Armbeuge, dann ein knochiges Schulterblatt. Ein Körper erschauerte und brach unter dem Gewicht seiner Finger zusammen.
»Dryer!«, rief er. »Bringen Sie Licht. Schnell.«
«Wo sind Sie, Cooper?«, rief Dryer. »Ich kann Sie nicht sehen.«
»Nehmen Sie den Pfad hinter der Wäscheleine. Gehen Sie weiter in den Garten hinein. Ich bin rechts vom Pfad.« Jedes Stück Hautoberfläche, das er ertastete, war nass und glitschig von Blut. »Bringen Sie eine Lampe her, Dryer. Los jetzt.«
Ein Taschenlampenstrahl zuckte zwischen den Ästen. Emmanuels Augen stellten sich auf das Zwielicht ein. Ein schlanker schwarzer Mann lag auf der Seite im Laubwerk. Er blutete aus einer tiefen Kopfwunde und, wie Emmanuel erkennen konnte, aus mehreren kleinen Wunden am Rücken. Seine Fingernägel waren abgebrochen und dreckverkrustet, offenbar war er Hand über Hand den Boden entlanggerobbt auf der Suche nach Sicherheit oder vielleicht einem ruhigen Platz zum Sterben.
»Rufen Sie die Eingeborenenambulanz«, befahl er Dryer. »Und schicken Sie die Uniformierten her, mit Lampen und einer Decke. Zack, zack.«
Die Polizisten von der Veranda stürzten sich in den Garten, ihre Stimmen schrill vor Aufregung. Es waren junge Männer, und sie waren außer sich, Teil des sich entfaltenden Dramas zu sein. Der Schwarze lag jetzt reglos da, sein Atem ein tiefes Röcheln in der Kehle. Emmanuel ging in die Hocke und lauschte, wie Luft in die Lungen des Mannes und wieder heraus strömte.
»Hier drüben«, rief er, als die Polizisten näher kamen. Drei Taschenlampenstrahlen vereinten sich am zweiten Tatort. Der erste Polizist, der durch das Blattwerk herantrat, gab ein erschrockenes Ächzen von sich und blieb wie angewurzelt stehen. Er drückte eine Decke an seine Brust.
»Bleiben Sie, wo Sie sind«, sagte Emmanuel. »Der Rest hält sich zwei Schritt vom Opfer entfernt und bildet einen Kreis.«
Sie befolgten seine Instruktionen, jeder schlappte schüchtern an seinen Platz und hielt seine Taschenlampe hoch.
»Glaubst du, es ist der Gärtner?«, flüsterte einer.
»Vielleicht«, antwortete ein anderer. »Was sonst soll ein Kaffer nach Sonnenuntergang im Garten eines Weißen zu suchen haben?«
Emmanuel war sich da nicht so sicher. Der schwarze Mann, der jetzt zusammengerollt im Laub lag, trug ein langärmliges Hemd und blaue Baumwollhosen. Seine nackten Füße und die Hände waren schmutzverkrustet, doch es fehlten die Schwielen, die manuelle Arbeit verursacht. Und der Garten war völlig verwildert. Wenn dieser Mann der Gärtner war, hatte er seinen Beruf entsetzlich verfehlt. Emmanuel bückte sich und durchsuchte die Taschen des Opfers nach Papieren.
»Was haben Sie da?« Mason stieß durch die Äste und verschaffte sich Platz zwischen zwei der Polizisten.
»Einen noch nicht identifizierten Mann.« Emmanuel stöberte nach dem Passbuch, das stets bei sich zu tragen schwarze Männer gesetzlich verpflichtet waren. Ein Passbuch enthielt den Namen des Trägers, den Ort seiner Herkunft und jeden anschließenden Wohnsitz, eine Schwarzweißfotografie, alle registrierten Arbeitsverhältnisse sowie ein Protokoll bisheriger Begegnungen mit der Polizei: eine Lebensgeschichte in Stichpunkten.
»Kein Geld und kein Passbuch in den Hosentaschen.« Er zog aus der Brusttasche des Hemdes ein blutbeflecktes Stück Papier und blinzelte auf den handgeschriebenen Text.
»Die Adresse der Brewers«, sagte er.
»Was zur Hölle treibt ein nicht registrierter Schwarzer in einem Garten in Parkview?«, fragte Mason. »Selbst wenn er ein Passbuch hätte, müsste er vor Stunden den letzten Bus ins Kaffernviertel genommen haben.«
Emmanuel sagte: »Das gilt auch für Shabalala und Kibelo. Von Sophiatown nach Parkview und zurück mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist gar nicht so einfach.«
»Sie haben es irgendwie hingekriegt, vielleicht mit Hilfe von Komplizen. Sie haben doch das Mädchen gehört. Diese Jungs waren im Haus. Sie hat sie beim Namen genannt.«
Ja, das hatte sie. Und die Aussage eines traumatisierten weißen Mädchens war vor Gericht mit einer mitfühlenden weißen Jury auf der Geschworenenbank kaum angreifbar.
»Was Neues von der Eingeborenenambulanz?« Er rieb die Handflächen aneinander, um das getrocknete Blut loszuwerden.
»Das wird noch dauern.« Mason wandte sich zum Gehen. »Das nächste Eingeborenenhospital ist Baragwanath, und die haben nur eine Handvoll Wagen. Vielleicht weiß Dryer mehr. Vorausgesetzt, er hat im Krankenhaus nach einer Einschätzung gefragt.«
»Geben Sie mir die Decke, Constable«, sagte Emmanuel zu einem der Polizisten, einem hellhaarigen Knaben mit einem Gesicht so schlicht wie ein Glas Milch.
»Aber … Sir …«, stammelte der Constable. »Ich habe diese Decke aus dem Haus. Es ist reine Wolle. Aus dem Zimmer des Mädchens.«
»Und?«
»Die ist doch nicht für einen von denen gedacht«, sagte der Polizist. »Sein Blut wird überall drankommen.«
Emmanuel stand auf und riss dem Jungen die Decke aus den Händen. »Wenn die Brewers die Nacht überleben, können sie die Decke verbrennen und die Asche begraben. Blut ist Blut. Es macht die gleichen Flecken, egal wer blutet.«
»Ja, Sir.« Der Constable machte verlegen einen Schritt rückwärts. Er hatte den Detective Sergeant irgendwie zornig gemacht, aber er wusste nicht, womit.
»Halten Sie Wache, bis die Ambulanz kommt. Stellen Sie sicher, dass nichts verändert wird«, wies er die Polizisten an und breitete die Decke über den unbekannten Fremden. Ihn erfüllte blinde Wut bei der Vorstellung, Davida und Rebekah könnte in einer vergleichbaren Situation die benötigte Wärme versagt bleiben, weil ihre Haut braun und nicht weiß war.
Er wandte sich um und ging weg. Lieutenant Mason folgte ihm auf dem mondbeschienenen Pfad mit hintergründiger Miene. Emmanuel blieb still. Jedes Wort konnte den Zorn preisgeben, der ihm die Kehle zuschnürte. Und dann wüsste Mason ohne jeden Zweifel, dass seine Reaktion auf die Haltung des Constable etwas Persönliches war.
»Sie können Kaffersprachen«, sagte Mason, als sie das Haus erreichten. Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Ein bisschen.« Er hängte nicht gern an die große Glocke, dass er fließend Zulu und Afrikaans sprach sowie mittlerweile bruchstückhaftes Shangaan, was der Zeit mit Detective Constable Shabalala zu verdanken war, der halb Zulu, halb Shangaan war.
»Bleiben Sie hier bei den Uniformierten und dem Verwundeten. Wenn der Eingeborene zu sich kommt, notieren Sie alles, was erklären hilft, wie zwei Schuljungen diese Verwüstung anrichten konnten. Der Polizeichef wird Beweise brauchen, die die Aussage des Brewer-Mädels erhärten«, sagte Mason. »Negus und ich fahren die Jungs zur Befragung holen.«
»Ich komme danach noch auf dem Revier vorbei«, sagte Emmanuel. Er musste unbedingt auf dem Laufenden bleiben, was die Beweislage gegen Aaron und Nkhato anging. Was er mit den Informationen machen würde, wenn er sie erst hatte, das wusste er noch nicht.
»Bezahlte Überstunden sind für diesen Fall noch nicht bewilligt, also falls Sie nur auf ein paar Pfund extra aus sind, gehen Sie lieber nach Hause und schlafen sich aus.«
»Ich arbeite, bis die Arbeit getan ist«, sagte Emmanuel. Mason war monatelang durchgehend undercover im Einsatz gewesen, hatte seine Arbeit gelebt und geatmet, vierundzwanzig Stunden am Tag. In Masons Welt arbeiteten echte Polizisten aus Liebe zum Beruf.
Dryer trat aus der Hintertür und schwenkte den Daumen in Richtung Küche. »Die Sekretärin ist da, Lieutenant.«
»Cooper hat uns schon besorgt, was wir brauchen. Lassen Sie sie eine Weile die Hand des Mädchens halten und schicken Sie sie dann nach Benoni zurück. Die Nachbarin, Mrs. Lauda, hat sich bereit erklärt, Cassie zu nehmen, bis morgen ihre Tante kommt, die lebt irgendwo nördlich von Pretoria. Cooper, Sie bringen sie dann rüber, wenn es so weit ist.«
»Natürlich.« Es gab gute Gründe, die Verantwortung für den Tatort und für die Kronzeugin Cassie ihm zu übertragen. Der naheliegendste war Dryers Idiotie. Der weniger offensichtliche Grund war, dass Mason ihm nicht die Befragung der Hauptverdächtigen anvertrauen mochte.
Der Lieutenant verschwand im Haus der Brewers.
»Typisch, was?«, sagte Dryer, kaum dass die Hintertür sich geschlossen hatte. »Mason und Negus kriegen den interessanten Teil, und wir müssen uns um einen verprügelten Kaffer und ein Mädchen kümmern.«
»Was ist mit der Eingeborenenambulanz?«, fragte Emmanuel.
»Die Zentrale hat den Ruf angenommen, aber es wird noch dauern. Alle Wagen sind gerade im Einsatz bei einem Busunglück draußen bei Tembisa.«
»Dann kann es Morgen werden, ehe sie hier sind.« Ein Busunglück hatte höhere Priorität als ein einzelner schwarzer Mann, der Meilen vom Krankenhaus entfernt im Garten eines weißen Vorortviertels verblutete.
»Wie schlecht geht es denn dem Kaffer?«, fragte Dryer.
»Schlecht«, sagte Emmanuel.
»Scheiß Pech für ihn.« Der Afrikaanerpolizist gähnte und sah hoch zum Vollmond. Tot oder lebendig, ein verletzter Eingeborener zählte nicht viel. Cassie Brewers Zeugenaussage bedeutete, dass seine Urlaubspläne so gut wie gerettet waren – die Täter waren ja praktisch schon in Verwahrung. In einer Woche würde er im Indischen Ozean treiben und eine Dose gut gekühltes Bier trinken, während Fische an seinen Zehen knabberten.
Wäre an Aaron Shabalalas Stelle nur irgendein beliebiger schwarzer Junge gewesen, dem man Raub und Körperverletzung zur Last legte, so hätte Emmanuel, wie er sich eingestand, womöglich sogar die gleiche Erleichterung über den schnellen Abschluss des Falls verspürt.
»Ich seh mal nach der Sekretärin.« Er ging die Stufen hoch und öffnete die Küchentür. Ein Gang war von Trümmern freigeräumt, Reis und Mehl von der Tischplatte gewischt. Eine ältere weiße Frau mit blau getöntem Haarhelm und in aggressivem Purpurrot bemaltem Schmollmündchen fuhr mit einer Bürste durch Cassies krauses Haar. In einem grauwollenen Twinset mit passendem Rock und einer einzelnen Perlenreihe um den Hals verkörperte die Polizeisekretärin die Mustervorlage der Regierung für eine weiße Frau.
Cassie warf einen schnellen Blick auf Emmanuel und drehte ihr Gesicht weg.
»Scht … ist ja gut«, beschwichtigte die Polizeisekretärin. »Ich pass ja auf dich auf, Schätzchen. Keine Sorge.«
Cassie schmiegte sich in die Arme der Frau, suchte Trost. Sie schloss die Augen und schloss Emmanuel aus. Die Sekretärin hielt sie fest und flüsterte: »Lassen Sie sie, Detective, das arme Ding hat heute Nacht schon genug gelitten.«
Er zog sich zurück. Er hatte Cassie vorhin gewarnt mit seinem argwöhnischen Blick, jetzt war sie auf der Hut. Es wäre schon ein Wunder, wenn er es nochmals schaffte, sich ihr zu nähern, ohne dass Tränen flossen. Cassie schwelgte jetzt im Opfersein.
»Wo fahren Sie Weihnachten hin, Cooper?«, fragte Dryer von der mondbeschienenen Türschwelle aus.
»Ich bleibe in Johannesburg«, sagte Emmanuel. Das war eine Lüge, aber eine notwendige. Sein Privatleben war privat. »Und Sie?«
»Ich, meine Frau und die Kinder wollen rauf nach Kosi Bay. Zehn Tage in einer Hütte am Meer.« Dryer warf eine imaginäre Leine in den Garten. »Fischen, schwimmen, Garnelen essen. Das wird schön. Warum zum Teufel bleiben Sie denn in Jo’burg, guter Mann?«
»Ich bin gern hier«, sagte er. Dieses Gespräch, so wurde ihm bewusst, folgte dem Muster jedes einzelnen Gesprächs auf seiner Arbeitsstelle: Die anderen Detectives erzählten ihm Fakten und Familiengeschichten, und er antwortete irgendwelchen Mist.
»Sergeant.« Der milchgesichtige Polizist tauchte auf dem Gartenpfad auf und schwenkte panisch seine Taschenlampe. Noch weißer als zuvor, die blassen Augen riesig in seinem Gesicht, stammelte er: »Kommen Sie. Bitte. Es ist der Mann. Da kommt so ein Rasseln aus seiner Brust, nur feucht. Was sollen wir tun?«
»Es gibt nichts, was Sie tun könnten«, sagte Emmanuel. Der schwarze Mann brauchte augenblicklich ärztliche Hilfe. Nicht erst am Morgen oder wann immer die Eingeborenenambulanz kam. »Halten Sie Wache, bis ich Sie ablöse.«
»Jawohl, Sir.« Der Constable zog sich ins Dickicht der Obstbäume zurück.
Emmanuel trat auf die oberste Stufe, sein Mund war trocken, er brauchte einen Plan. Ian Brewer war wohl schon jenseits von Gut und Böse, aber Martha Brewer würde dank der gut ausgestatteten Notaufnahme ›nur für Weiße‹ die Nacht wahrscheinlich überleben. Der schwarze Mann im Garten durfte nichts dergleichen erhoffen. Er würde binnen weniger Stunden sterben und alles, was er wusste, mit ihm. Wenn Aaron Shabalala und sein Schulkamerad für die Zeit des Einbruchs ein Alibi liefern konnten, mochten sie vielleicht davonkommen. Wenn nicht, blieb Cassies Wort das Evangelium, und jeder Polizist mit Urlaubsanspruch würde begeistert nach ihrem Gesangbuch singen.
Ein Weg stand ihm noch offen. Ihn zu gehen bedeutete, die Welt zu betreten, in der die Polizei nach ihren eigenen Regeln spielte. Er durchdachte seine Situation. Als unablässig lügender weißer Detective Sergeant mit ›gemischtrassiger‹ Frau und Tochter, die er vor dem Blick der Öffentlichkeit verbarg, brach er tagtäglich das Gesetz. In Wirklichkeit hatte er die Linie längst überschritten, welche die unehrlichen Bullen von den ehrlichen Cops trennte.
Er sagte: »Fahren Sie ruhig nach Hause, wenn Sie mögen, Dryer. Hier ist ja alles ruhig. Ich bleibe da.«
»Auf keinen Fall, Mann«, sagte der Afrikaanerpolizist. »Mason reißt mir die Eingeweide raus, wenn ich mich verdrücke, bevor das hier zu Ende ist.«
»Mason braucht es nicht zu erfahren.« Emmanuel lächelte ermutigend. »Gehen Sie schon. Sie haben Frau und Kinder zu Hause. Ich habe niemanden.«
»Es wäre nicht richtig, Sie mit alldem allein zu lassen.« Dryer ließ eine Hand in die Jacketttasche gleiten, tastete nach dem Autoschlüssel, seine Beflissenheit längst untergraben.
»Ein zusammengeschlagener Kaffer und ein Mädchen … dafür zwei Detectives abzustellen, ist doch Verschwendung. Oder wollen Sie lieber bleiben und mir Gesellschaft leisten, bis die Eingeborenenambulanz auftaucht?«
»Sie brauchen mich ganz sicher nicht?«
»Ich komm klar«, sagte Emmanuel.
»Na schön.« Dryer fischte einen Schlüsselring heraus und ließ ihn um seinen Zeigefinger kreisen. »Sie sollten irgendwann mal zum Abendessen kommen, Cooper. Meine Brut kennenlernen.«
»Das wäre nett«, sagte Emmanuel. Er würde die Einladung annehmen, sobald er sich aus Jux und Dollerei eigenhändig den Kiefer operiert hatte.
»Ich schulde Ihnen was, Cooper.«
»Nicht der Rede wert.« Er klopfte Dryer auf die Schulter und schob ihn freundlich die Stufen hinunter. Es war schwer, weiter zu lächeln. Er wollte nur, dass der Afrikaanerpolizist schon seit fünf Minuten weg war.
»Ich seh Sie dann morgen.« Dryer drückte sich zwischen Haus und Garagenmauer hindurch zur Auffahrt. Emmanuel wartete, bis die roten Rücklichter seines Wagens in der Dunkelheit verschwunden waren, und schritt dann schnell hinter das Haus. Wenn er jetzt stehen blieb und darüber nachdachte, was er tat, überlegte er es sich womöglich doch noch anders.
3
Dr. Daniel Zweigman, das graue Haar zerzaust und die Lesebrille auf halber Höhe des Nasenrückens, nähte mit aller Präzision die Wunde und knotete den Baumwollfaden zu. Ein Kreis aus Polizisten hielt Fackeln hoch, um den Freiluft-Operationssaal zu erleuchten, einschließlich dem gefalteten Laken, auf dem Desinfektionsmittel, Verbände und Morphiuminjektionen lagen, die bei der Operation im Einsatz waren. Emmanuel hatte den deutschen Arzt gebeten, alles Nötige mitzubringen, und das hatte er getan.
»Die Wunden sind geschlossen und die Blutung ist gestillt«, sagte Zweigman. »Das ist alles, was ich jetzt und hier tun kann.« Er schob die Brille zurück auf die Nasenwurzel. »Es könnte genügen.«
Emmanuel stand auf und streckte sich. Der verletzte schwarze Mann hatte eine Überlebenschance. Das musste den Bruch des Schwurs wert sein, den er erst vor ein paar Monaten geleistet hatte, nämlich Zweigman keiner Gefahr mehr auszusetzen und ihn aus der Polizeiarbeit herauszuhalten.
Zweigman streifte seine blutigen Handschuhe ab und zog die Wolldecke fest um die Schultern des bewusstlosen Patienten. Die blauen Hosen und das karierte Hemd des Doktors waren zerknittert. Er hatte sich wahrscheinlich im Dunkeln angezogen, um seine Frau Lilliana und ihren Adoptivsohn Dimitri nicht zu stören, denn sie schliefen gemeinsam im Gästezimmer des Hauses von Davidas Vater. Ein paar Monate zuvor hatte Davida Rebekah in Zweigmans Klinik im Tal der tausend Hügel zur Welt gebracht, um den Komplikationen aus dem Weg zu gehen, die mit der Geburt eines unehelichen Mischlingskindes verbunden waren.
»Was jetzt?«, fragte Zweigman.
»Sie fahren zurück nach Houghton. Ich warte hier, bis die Eingeborenenambulanz eintrifft«, sagte Emmanuel.
»So, das war’s dann also. ›Danke, Doktor, auf Wiedersehen‹?« Der drahtige Arzt packte seine medizinische Ausrüstung zurück in seine Ledertasche und ließ das Schloss zuschnappen. »Es war mir wieder einmal ein Vergnügen, Ihnen zu Diensten zu sein, Sergeant Cooper.«
»Ich bringe Sie noch zu Ihrem Wagen«, sagte Emmanuel. Zweigmans Beteiligung im Fall Brewer musste hier und jetzt zu Ende sein. Es gab immer noch Nächte, in denen Emmanuel in heller Panik aus dem Schlaf schreckte, weil er so nahe daran gewesen war, Zweigman zu verlieren – das war vor wenigen Monaten auf einem Felshang in den Drakensbergen gewesen. In Emmanuels Träumen wollte die Speerwunde in Zweigmans Schulter nicht heilen, und er starb kalt und allein in einer Höhle, während Emmanuel zusah und nichts tun konnte.
»Nehmen Sie jetzt die Fackeln runter und machen Sie eine Pause«, wies Emmanuel die Polizisten an. »Ich verabschiede eben den Doktor.«
»Ich danke Ihnen für Ihre Assistenz, meine Herren«, sagte Zweigman zu den Constables und schlug sich durch das dichte Blattwerk. Zweige knackten unter seinen Füßen. Mondlicht beschien den Trampelpfad, der zur Hintertür des Brewer’schen Hauses führte.
»Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen«, sagte Emmanuel, als sie aus dem Vorstadtdschungel traten und über einen Flecken Wiese schritten. »Aber ich kann Sie nicht noch tiefer in die Ermittlungen hineinziehen. Nicht nach dem letzten Mal.«
»Was wollen Sie Shabalala sagen?« Zweigman ignorierte die Anspielung auf seine kürzliche Todesnähe-Erfahrung und duckte sich unter der Wäscheleine hindurch. Er akzeptierte, dass das Leben Verletzungen beibrachte und dass das Leben sie heilte. Den Krieg in einem Konzentrationslager zu überleben, hatte ihn diese Lektion gelehrt.
»Wenn dieser Aaron tatsächlich sein Sohn ist, sage ich Shabalala die Wahrheit«, sagte Emmanuel. »Ich habe nur noch nicht die richtigen Worte gefunden.«
»Es gibt nichts Richtiges an dieser Situation.« Zweigman schob seine goldgerahmte Brille auf dem Nasenrücken hoch und musterte den Garten. »Kein Sohn von Shabalala könnte eine so brutale Attacke ausführen.«
»Ich weiß nicht«, sagte Emmanuel. »Ich war in diesem Alter ziemlich wild und habe mir jede Menge Ärger eingehandelt.«
»Saufen und mit Mädchen in gestohlenen Autos herumfahren«, mutmaßte der Arzt. »Nichts, was mit Blut und gebrochenen Knochen zu tun hatte, da bin ich sicher.«
»Nein«, sagte Emmanuel. »Das kam erst später.«
Ein pulsierendes rotes Licht blinkte in der Einfahrt. Evans, der Polizist, der an der vorderen Grundstücksgrenze Wache stand, kam in den Garten gestürzt.
»Die Kaffernambulanz ist da, Sergeant«, meldete er. »Sie stehen in der Auffahrt.«