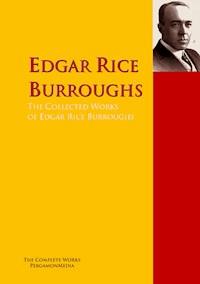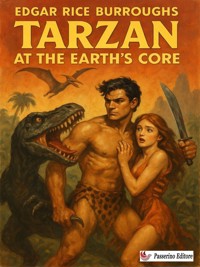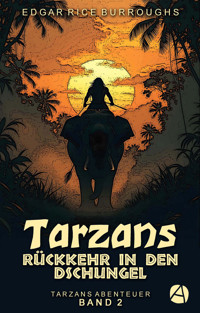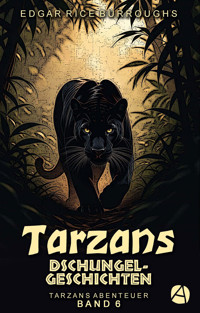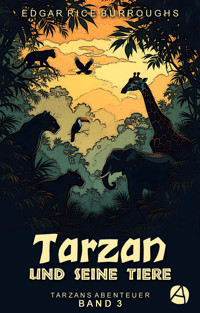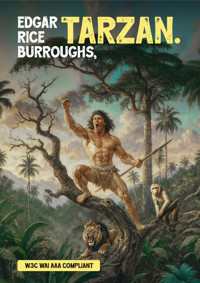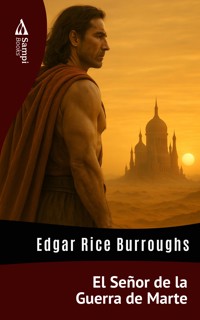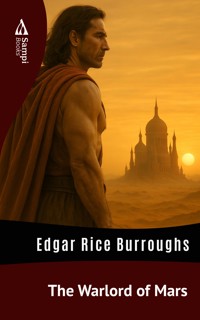Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tarzan bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Tarzan kehrt nach Opar zurück, wo sich eine verlorene Kolonie des sagenumwobenen Atlantis befinden soll. Während Atlantis selbst vor Tausenden von Jahren in den Fluten versank, bauten die Menschen von Opar weiterhin das Gold ab. Aber nur Tarzan weiß um den wahren Standort des Goldschatzes Natürlich weckt ein solcher Schatz die Gier der zwielichtigsten Gestalten. Ein desertierter belgischer Armeeoffizier, Albert Werper, der im Dienste eines kriminellen Arabers steht, folgt Tarzan heimlich nach Opar. Dort verliert Tarzan durch einen Unfall sein Gedächtnis. Die Orthografie wurde der heutigen Schreibweise behutsam angeglichen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edgar Rice Burroughs
Tarzan
Band 5 – Der Schatz von Opar
Edgar Rice Burroughs
Tarzan
Band 5 – Der Schatz von Opar
(Tarzan and the Jewels of Opar)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Tony Kellen, J. Schulze EV: Pegasus Verlag, Wetzlar, 1952 (224 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962818-10-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Belgier und Araber
Auf dem Wege nach Opar
Der Ruf des Dschungels
Prophezeiung und Erfüllung
Der Altar des Feuergottes
Der Überfall der Araber
Der Edelsteinhort von Opar
Das Entkommen aus Opar
Der Diebstahl der Edelsteine
Achmed Zek erblickt die Juwelen
Tarzan wird wieder zum Tier
La sucht sich zu rächen
Der Kampf mit Feuer, Sonnenanbetern und rasendem Elefanten
Trotz Priesteramt noch Weib
Der abessinische Jagdtrupp
Tarzan führt wieder die großen Affen
Zehn Traglasten Gold
Der Kampf um die Goldbarren
Jane unter Raubtieren
Jane ist wieder Gefangene
Die Flucht in den Dschungel
Tarzan findet sein Gedächtnis wieder
Der Löwenangriff
Daheim
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Tarzan bei Null Papier
Tarzan – Band 1 – Tarzan und die weiße Frau
Tarzan – Band 2 – Tarzans Rückkehr
Tarzan – Band 3 – Tarzans Tiere
Tarzan – Band 4 – Tarzans Sohn
Tarzan – Band 5 – Der Schatz von Opar
Tarzan – Band 6 – Tarzans Dschungelgeschichten
Belgier und Araber
Nur dem guten Namen, welchen er entehrte, hatte es Leutnant Albert Werper zu verdanken, dass er nicht schimpflich aus dem Dienste gestoßen wurde. Als man ihn nach dem gottverlassenen Posten am Kongo versetzt hatte, statt ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen, wie er es eigentlich verdient gehabt hätte, war er in seiner damaligen, geknickten Stimmung dafür dankbar gewesen. Aber sechs Monate der Langeweile in der furchtbaren Einöde und Verlassenheit hatten seine Gefühle geändert.
Der junge Mensch brütete beständig über seinem Geschick. Dass er die Tage mit krankhaftem Beklagen seines Loses hinbrachte, schuf allmählich in seinem charakterschwachen Gehirne Hass gegen eben die Leute, welche ihn hergesandt hatten, obgleich er ihnen erst innerlich so dankbar gewesen war, dass sie ihn vor schimpflicher Degradierung gerettet hatten.
Er beklagte den Verlust seines lustigen Brüsseler Lebens, aber nie die Verfehlungen, welche ihn aus jener lebensfrohesten aller Großstädte hinweggerissen hatten, und mit der Zeit fasste er sogar einen immer wachsenden Hass gegen den im Kongo anwesenden Vertreter jener Behörde, die ihn verbannt hatte – gegen seinen nächsten Vorgesetzten, den Hauptmann.
Besagter Offizier war ein kalter, schweigsamer Mensch, der seinen unmittelbaren Untergebenen wenig Zuneigung einflößte, obgleich ihn die schwarzen Soldaten seines kleinen Kommandos verehrten, wenn auch fürchteten.
Wenn die beiden auf der Veranda ihres gemeinsamen Quartiers saßen, stierte Werper gewöhnlich stundenlang seinen Vorgesetzten an, während sie ihre Zigaretten rauchten, ohne dass einer von beiden Lust zu haben schien, das Schweigen zu brechen.
Der sinnlose Hass des Leutnants wuchs sich endlich zu einer Art Verfolgungswahn aus. Des Hauptmanns angeborene Schweigsamkeit wurde in Werpers Empfinden zum gesuchten Bestreben, ihn wegen seiner vergangenen Entgleisung zu demütigen. Er bildete sich ein, dass ihn sein Vorgesetzter verachte und stachelte sich selbst innerlich so lange auf, bis seine Narrheit eines Abends plötzlich mordlustig wurde.
Seine Finger suchten den Griff des Revolvers in der Hüftentasche, seine Augenbrauen zogen sich zusammen, und schließlich sprang er auf und schrie:
Jetzt haben Sie mich die längste Zeit beleidigt! Ich bin ein Ehrenmann und lasse mir das nicht länger gefallen, ohne Rechenschaft zu fordern! Du verdammter Kerl!!
Der Hauptmann drehte sich überrascht nach seinem Leutnant um. Da er schon öfter Leute mit dem Tropenkoller gesehen hatte – eine Gehirnerkrankung, welche durch Einsamkeit, langes Grübeln, vielleicht auch durch Fieberanfälle entsteht – erhob er sich, wollte dem anderen beruhigend die Hand auf die Schulter legen und ihm gütlich zureden, aber er kam nicht mehr dazu. Werper legte die Bewegung seines Vorgesetzten als Versuch aus, ihn anzufassen. Er zielte mit dem Revolver nach des Hauptmanns Herz und, als dieser einen Schritt machte, drückte er ab.
Ohne einen Laut von sich zu geben, sank der Getroffene auf die rohen Dielen der Veranda und mit seinem Fall verzog sich der Nebel, welcher das Gehirn des unglücklichen Werper umhüllt hatte. Er sah, was er angerichtet hatte, und sah seine Tat im gleichen Lichte, in dem sie seinen künftigen Richtern erscheinen musste.
Aus der Unterkunft der Mannschaften vernahm er erregte Rufe und hörte, wie Leute auf ihn zurannten. Sie würden ihn ergreifen, und selbst wenn sie ihn nicht gleich umbrachten, würden sie ihn den Kongo hinunterbringen, wo das Kriegsgericht das ebenso gründlich, wenn auch etwas formgerechter besorgen würde.
Werper hatte keine Lust zu sterben. Nie hatte er sich so nach dem Leben gesehnt als jetzt, da er das seine gründlich verwirkt hatte.
Die Leute kamen gelaufen. Was tun? Er sah sich nach irgendeiner Tatsache um, die sein Verbrechen berechtigt erscheinen lassen könnte, aber er sah nur die Leiche des grundlos erschossenen Mannes.
Verzweifelt vor den herannahenden Soldaten fliehend, rannte er quer über das Kampong, das Wohnlager, immer noch mit dem Revolver in der Hand, aber der Wachtposten am Tore rief ihn an. Werper hielt sich nicht mit Reden auf, noch wartete er ab, ob ihm sein Dienstgrad vorbeihelfen würde; er hob die Waffe und schoss den armen Schwarzen nieder. In einem Augenblick riss er Gewehr und Patronengurt des getöteten Wachtpostens an sich, stieß das Tor auf und verschwand in den finsteren Dschungel.
Werper floh die ganze Nacht, weiter, immer weiter in das Herz der Wildnis. Dann und wann brachte ihn das Brüllen eines Löwen zu einem kurzen Lauschen; aber er fürchtete die menschlichen Verfolger mehr als die Raubtiere vor sich und mit schussbereit gehaltenem Gewehr hetzte er wieder vorwärts.
Die Dämmerung kam herauf, aber immer noch quälte sich der Mann fürbass. Die Angst vor Festnahme verscheuchte Hunger und Müdigkeit. Er konnte nur an Flucht denken. Ehe er nicht vor weiterer Verfolgung sicher war, wagte er nicht zum Ruhen oder zum Essen zu rasten, und so stolperte er vorwärts, bis er endlich fiel und das Aufstehen vergaß. Er wusste nicht, wie weit er gekommen war und machte sich keine Gedanken mehr darüber. Eine Ohnmacht infolge äußerster Erschöpfung verbarg ihm die Erkenntnis, dass er am Ende seiner Kräfte und seiner Flucht angelangt sei.
So fand ihn der Araber Achmed Zek. Achmeds Leute waren dafür, ihrem Erbfeind einfach einen Speer durch den Leib zu treiben, aber er hatte andere Gedanken. Er wünschte den Belgier zu befragen, und es war leichter, den Mann erst auszufragen und dann zu töten als umgekehrt.
Er ließ daher den Leutnant Albert Werper in sein eigenes Zelt bringen, wo seine Sklaven dem Gefangenen so lange Palmwein und feste Nahrung in kleinen Mengen eingaben, bis er wieder zu sich kam. Als er endlich die Augen aufschlug, sah er schwarze Gesichter um sich und einen Araber im Zelteingang stehen, aber nirgends war eine Uniform seiner Soldaten.
Der Araber drehte sich um und trat ins Zelt, als er in die geöffneten Augen des Gefangenen blickte:
Ich bin Achmed Zek, belehrte er ihn. Wer bist du und was bringt dich in mein Gebiet? Wo sind deine Soldaten?
Achmed Zek! Werper riss die Augen weit auf und fühlte seinen Mut sinken. Er war in den Krallen des berüchtigten Banditen, welcher alle Europäer und besonders solche in belgischer Uniform hasste. Seit Jahren führte die Militärmacht von Belgisch-Kongo einen erfolglosen Krieg gegen diesen Mann und seine Spießgesellen, einen Krieg, in welchem von keiner Seite Pardon gegeben oder auch nur um Gnade gebeten wurde.
Und doch, gerade in dem Hass dieses Mannes gegen alles, was belgisch war, erblickte Werper für sich einen Hoffnungsschimmer. Auch er war ja ein Ausgestoßener, ein Verbrecher. Insoweit wenigstens hatten sie gemeinsame Interessen, und Werper war sofort entschlossen, diese Tatsache bis zum Äußersten auszunützen.
Ich habe von dir gehört, erwiderte er, und ich suchte nach dir. Meine Landsleute haben sich wider mich gekehrt. Ich hasse sie. Eben jetzt suchen ihre Soldaten nach mir, um mich zu töten. Ich weiß, dass du mich vor ihnen schützen wirst, denn auch du hassest sie. Ich bin ein tüchtiger Soldat, ich weiß zu kämpfen und deine Feinde seien meine Feinde!
Achmed Zek betrachtete schweigend den Europäer. Er überlegte hin und her und war im Inneren, überzeugt, dass dieser Ungläubige log. Immerhin war es möglich, dass er doch nicht log, und wenn er wirklich die Wahrheit gesprochen hatte, war sein Vorschlag wohl der Betrachtung wert, denn streitbare Männer konnte man nie genug bekommen, besonders nicht Weiße mit der Schulung und Erfahrung, welche ein europäischer Offizier in militärischer Beziehung notwendig besitzt.
Achmed Zek machte ein finsteres Gesicht, und Werper bekam es bereits mit der Angst zu tun. Aber er kannte eben Achmed Zek nicht, der immer da, wo andere Leute lächelten, finster blickte und da lächelte, wo andere mit Blicken drohten.
Wenn du mich belogen hast, sagte er, kann ich dich jederzeit töten. Welchen weiteren Lohn außer deinem Leben verlangst du für deine Dienste?
Vorerst nur deinen Schutz, erwiderte Werper. Später, wenn ich dir mehr wert bin, können wir wieder darüber reden. Werper hatte ja im Augenblick nur den Wunsch, sein Leben zu retten. So einigten sie sich zunächst, und Leutnant Albert Werper ward Mitglied einer Bande von Elfenbein- und Sklavenjägern unter dem berüchtigten Achmed Zek.
Monate ritt der abtrünnige Belgier mit den wilden Kerlen. Er focht mit wilder Hingabe. Achmed Zek überwachte seinen Rekruten mit Adleraugen und sich steigernder Genugtuung, die schließlich in höherem Vertrauen zum Ausdruck kam und dahin führte, dass Werper größere Handlungsfreiheit bekam.
Achmed Zek zog den Belgier in hohem Maße in sein Vertrauen und enthüllte ihm endlich einen lange gehegten Lieblingsplan, zu dessen Ausführung sich aber nie eine Gelegenheit geboten hatte. Mit Hilfe eines Weißen würde sich die Sache indessen leicht ermöglichen lassen. Nun fühlte er bei Werper vor:
Hast du von einem Manne gehört, den die Leute Tarzan nennen? fragte er.
Werper nickte. Ich hörte von ihm, aber ich kenne ihn nicht.
Wenn er nicht wäre, begann der Araber wieder, könnten wir unser »Geschäft« in Sicherheit und mit hohem Gewinn betreiben. Aber er bekämpft uns seit Jahren, vertreibt uns aus den besten Landstrichen, beunruhigt uns und bewaffnet die Eingeborenen, damit sie uns zurückschlagen können, wenn wir in unseren »Geschäften« kommen. Nun ist er sehr reich. Könnten wir ihn daher irgendwie zwingen, uns viele Goldstücke zu zahlen, so würden wir uns nicht allein an ihm rächen, wir würden uns auch an ihm für alles das bezahlt machen, was wir an den Schwarzen unter seinem Schutze nicht verdienen konnten.
Werper nahm eine Zigarette aus seiner brillantengeschmückten Dose und zündete sie an.
Hast du einen Plan, der ihn zum Zahlen bringt? fragte er. Er hat ein Weib, erwiderte Achmed Zek. Die Leute sagen, sie sei sehr schön. Weiter droben im Norden würde sie uns ein schönes Stück Geld bringen, falls es zu schwierig ist, von diesem Tarzan Lösegeld zu erhalten.
Werper ließ gedankenvoll den Kopf sinken, während Achmed Zek vor ihm stand und auf seine Entgegnung wartete. Das Gute, welches noch in Albert Werper geblieben war, empörte sich bei dem Gedanken, eine weiße Frau in die Sklaverei und Entwürdigung eines moslemitischen Harems zu verschachern. Aber als er aufsah und in die zusammengekniffenen Augen des Arabers blickte, da wusste er, dass der andere seine Abneigung gegen diesen Plan herausfühlte. Was hatte er, Werper, davon, wenn er sich weigerte? Sein Leben hatte dieser Halbwilde in der Hand, dem stand das Leben eines Ungläubigen kaum so hoch wie das eines Hundes. Und Werper hing am Leben. Was galt ihm überhaupt dieses Weib! Als Weiße war sie zweifellos ein Mitglied der zivilisierten Gesellschaft, er aber war ein Ausgestoßener. Jedes Weißen Hand war gegen ihn erhoben. Sie war also seine natürliche Feindin. Wenn er sich weigerte, die Hand zu ihrer Entführung zu bieten, würde ihn Achmed Zek einfach töten lassen.
Du zögerst, murmelte der Araber.
Ich erwog nur die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges, log Werper. Und meine Belohnung? Ich als Europäer kann leicht Zutritt zu ihrem Heim finden und Einblick in ihre Lebensgewohnheiten bekommen. Du hast keinen anderen, der so viel tun kann. Aber das Wagnis ist groß. Ich müsste also gut bezahlt werden, Achmed Zek!
Ein beruhigtes Lächeln glitt über das Gesicht des Räubers.
Wohl gesprochen, Werper, sagte Achmed Zek und klopfte seinem Leutnant auf die Schulter. Du verdienst gute Bezahlung und du sollst sie haben. Komm, lasse uns zusammen einen Plan entwerfen, wie wir das Unternehmen am besten durchführen.
Die ganze Nacht hockten die zwei Männer miteinander in leiser Unterhaltung in Achmeds verschossenem, einst so prächtigem Seidenzelt. Sie waren beide groß und bärtig, und Sonne und Wind hatten dem Gesicht des Europäers ein fast arabisches Aussehen verliehen. Da dieser außerdem bis ins kleinste in der Bekleidung die Tracht seines Führers nachahmte, war er äußerlich ein ebenso echter Araber wie der andere. Als er sich endlich erhob, um in sein Zelt zu gehen, war es spät geworden.
Werper sah den ganzen folgenden Tag seine alte belgische Uniform nach und entfernte jede Kleinigkeit an ihr, welche die frühere militärische Bestimmung hätte verraten können.
Achmed Zek seinerseits suchte unter einem kunterbunten Haufen von Beute einen Korkhelm und einen europäischen Sattel heraus. Dann stellte er aus einigen seiner schwarzen Sklaven und Gefolgsmannen eine Abteilung von Trägern, Asakern und Dienern auf, sodass sie eine bescheidene Safari wie für einen Jagdzug auf schweres Hochwild bildete. An der Spitze dieser Jagdtruppe brach Werper aus dem Lager auf.
Auf dem Wege nach Opar
Zwei Wochen später, als er gerade auf dem Heimritt von einer Besichtigungsreise über seine weitläufigen afrikanischen Besitzungen war, erblickte John Clayton, Lord Greystoke, die Spitze einer Karawane, welche die Ebene überschritt, die zwischen seinem Bungalow, seiner Dschungelbehausung, und dem Walde im Norden und Westen lag.
Er zügelte sein Pferd und bewachte die kleine Truppe bei ihrem Auftauchen aus einem sie verbergenden Stück Tiefland. Als seine scharfen Augen die Sonne auf dem weißen Helm eines Reiters leuchten sahen, war er überzeugt, dass ein wandernder europäischer Jäger seine Gastfreundschaft suche, und lenkte langsam sein Reittier dorthin, um den Ankömmling zu begrüßen.
Eine halbe Stunde darauf stieg er die Stufen zur Veranda seines Bungalows hinan und stellte der Lady Greystoke einen Monsieur Jules Frecoult vor.
Ich habe mich vollständig verirrt, erzählte M. Frecoult. Der Häuptling meiner Träger war noch nie in diesem Landstrich und die Führer, welche mich vom letzten Dorfe her begleiten sollten, wussten noch weniger von der Gegend als wir selbst. Vor zwei Tagen sind sie mir schließlich weggelaufen und ich bin froh, dass die Vorsehung Sie zu meiner Hilfe hingeführt hat. Ich weiß wirklich nicht, was ich hätte anfangen sollen, wenn ich Sie nicht gefunden hätte.
Es wurde nun ausgemacht, dass Frecoult und seine Leute einige Tage bleiben sollten, bis sie sich völlig ausgeruht hätten, dann wollte Lord Greystoke ihnen Führer besorgen und sie sicher bis in eine Gegend bringen lassen, in der sich Frecoults Häuptling wieder auskannte.
In seiner Verkleidung als Franzose aus guten Kreisen, der seinem Vergnügen lebte, fand es Werper leicht, seinen Wirt zu täuschen und sich bei Tarzan und seiner Frau beliebt zu machen. Aber je länger er blieb, desto weniger Hoffnung machte er sich auf eine leichte Durchführung seines Planes.
Allein ritt Lady Greystoke niemals weit vom Bungalow fort und die wilde Ergebenheit der trotzigen Wazirikrieger, welche einen großen Teil von Tarzans Gefolge bildeten, machte schon den Versuch einer gewaltsamen Entführung unmöglich. An etwaige Bestechung der Waziri war gar nicht zu denken.
Eine Woche verging, und Werper sah sich nach eigenem Eingeständnis seinem Ziele nicht näher als bei der Ankunft. Aber zu diesem Zeitpunkte gab ihm ein Vorfall erneute Hoffnung und ließ ihn sogar an noch größeren Gewinn als nur an das Lösegeld für die Frau denken.
Ein Bote mit der wöchentlich ankommenden Post traf im Bungalow ein, und Lord Greystoke verbrachte den Nachmittag in seinem Arbeitszimmer mit Lesen und Briefschreiben. Beim Abendessen schien er zerstreut und zog sich frühzeitig mit einer Entschuldigung zurück. Lady Greystoke folgte ihm bald nach.
Werper saß auf der Veranda allein und konnte an ihren Stimmen hören, dass sie in erregter Diskussion waren. Er dachte sich, dass etwas Außergewöhnliches los sei, deshalb erhob er sich und schlich im Schatten der üppig das Bungalow umwuchernden Sträucher unter das Schlafzimmerfenster seiner Gastgeber.
Er lauschte nicht ohne Erfolg, denn schon die ersten erhaschten Worte füllten ihn mit Erregung. Als Werper in Hörweite kam, war gerade Lady Greystoke am Sprechen:
Ich hatte immer meine Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit jener Aktiengesellschaft, hörte er sie sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einer solch enormen Schuld in Konkurs geraten sein soll! – es müsste denn gerade sein, dass unsaubere Machenschaften vorliegen.
Das vermute ich auch, erwiderte Tarzan, aber wie die Sache auch sein mag, Tatsache ist, dass ich all mein Geld verloren habe, und es bleibt mir nichts weiter übrig, als nach Opar zu gehen und neues zu holen. Oh, John! rief Lady Greystoke, und Werper merkte an ihrer Stimme, wie sie schauderte, gibt es keinen anderen Weg? Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du noch einmal nach jener schrecklichen Stadt willst. Lieber möchte ich in Armut weiterleben, als dass du dich in die grauenvollen Gefahren von Opar wagst.
Du brauchst keine Angst zu haben, erwiderte Tarzan lachend. Ich kann ganz gut auf mich aufpassen, und selbst wenn ich es nicht könnte, habe ich immer noch die Begleitung meiner Waziri, die mich schon vor Unfällen schützen würden.
Sie liefen aber schon einmal in Opar weg und überließen dich deinem Schicksal, erinnerte sie ihn.
Das werden sie nicht wieder tun, entgegnete er. Sie schämten sich sehr vor sich selbst und waren schon wieder auf dem Rückweg zu mir, als ich sie traf. Aber es muss doch auch einen anderen Weg geben, beharrte die Frau in ihr.
Kein anderer Weg ist auch nur halb so leicht, ein neues Vermögen zu erlangen, als der zu den Schatzkammern von Opar, antwortete er. Ich werde sehr vorsichtig sein, Jane, und wahrscheinlich werden die Bewohner von Opar es nie gewahr werden, dass ich wieder dort war, um ihnen noch einen Teil ihrer Schätze zu entführen, von deren Vorhandensein wie von deren Wert sie gleich wenig ahnen.
Das Endgültige in seinem Tone schien Lady Greystoke zu überzeugen, dass weitere Erörterungen nutzlos seien, denn sie verließen diesen Gesprächsgegenstand. Werper lauschte noch kurze Zeit weiter. Da er aber sicher war, alles Nötige gehört zu haben und Entdeckung fürchtete, kehrte er zur Veranda zurück, rauchte noch eine große Anzahl Zigaretten hintereinander weg und ging dann zur Ruhe.
Am nächsten Morgen sprach Werper beim Frühstück die Absicht aus, nunmehr bald wieder aufzubrechen und erbat Tarzans Erlaubnis zur Jagd auf Großwild während seines Weges durch das Waziriland, eine Erlaubnis, die Lord Greystoke bereitwillig erteilte.
Der Belgier verbrachte zwei volle Tage mit nötigen Vorbereitungen, aber endlich rückte er mit seiner Safari ab. Ein von Lord Greystoke geliehener Führer begleitete ihn. Die Truppe hatte erst einen einzigen kurzen Tagesmarsch hinter sich, als sich Werper krank stellte und erklärte, er wolle bleiben, wo er sei, bis er sich wieder völlig erholt hätte. Da sie noch nicht weit vom Bungalow der Greystokes entfernt waren, entließ Werper den Waziriführer mit der Erklärung, er werde ihn holen lassen, wenn er wieder imstande sei, weiterzuziehen.
Als der Waziri gegangen war, rief der Belgier einen von Achmed Zeks schwarzen Vertrauten in sein Zelt und entsandte ihn, um aufzupassen, wann Tarzan aufbreche. Dann sollte er Werper davon Nachricht geben und die von dem Engländer eingeschlagene Richtung anzeigen.
Der Belgier brauchte nicht lange zu warten, denn schon am nächsten Tage kam sein Spion mit der Kunde, dass Tarzan mit einem Trupp von fünfzig Wazirikriegern früh am Morgen in südöstlicher Richtung ausgezogen sei. Werper schrieb einen langen Brief an Achmed Zek, rief seinen Safariführer zu sich und gab ihm das Schreiben.
Schicke sofort einen Läufer mit diesem zu Achmed Zek, befahl er dem Manne. Du wartest hier im Lager auf weitere Anweisungen von ihm oder mir. Sollte jemand aus dem Bungalow des Engländers hierherkommen, so sage, ich liege schwerkrank in meinem Zelte und könne niemand vorlassen. Jetzt gib nur noch sechs Träger und sechs Asaker – die kräftigsten und mutigsten der Karawane – denn ich will selbst hinter dem Engländer her und sehen, wo sein Gold verborgen ist.
So kam es, dass Tarzan, nackt bis auf das Lendentuch und in der primitiven Bewaffnung, die ihm am liebsten war, seine ergebenen Waziri nach der toten Stadt Opar führte, während der abtrünnige Werper seiner Spur den ganzen glühendheißen Tag folgte und nachts dicht hinter ihm lagerte.
Und während sie so weiterzogen, ritt Achmed Zek mit seiner ganzen Bande nach Süden auf die Greystoke-Farm zu.
*
Für den Affentarzan war dieses Unternehmen eine Art Sonntagsausflug. Seine Zivilisierung war bestenfalls ein Firnis, den er froh genug war, mitsamt seinen unbequemen europäischen Kleidern abstreifen zu können, sobald sich nur irgendein vernünftiger Vorwand dazu fand. Nur eines Weibes Liebe hielt Tarzan an einen Anschein von Zivilisation gefesselt, weil besseres Vertrautwerden mit der sogenannten Kultur ihn gelehrt hatte, sie zu verachten. Er hasste ihre Lüge und Heuchelei, denn mit der klaren Einsicht eines unbefleckten Geistes hatte er den faulen Kern in deren Herzen erkannt – die feige Sucht nach Frieden, nach Behaglichkeit und nach Sicherstellung des Besitzes. Er leugnete hartnäckig, dass die edlen Seiten des Lebens – Kunst, Musik, Literatur – auf solch entwertetem Gedankenboden entsprossen sein sollten und behauptete lieber, sie hätten sich trotz der Zivilisation erhalten. Zeigt mir doch den fetten, wohlhabenden Feigling, pflegte er zu sagen, welcher je ein hohes Ideal geschaffen hat! Im Klirren der Waffen, im Kampf um das Dasein, unter Hunger, Tod und Gefahr, im Angesicht Gottes, wie es sich in der schreckvollsten Entfesselung der Naturkräfte zeigt, da wird all das geboren, was edel und gut ist im menschlichen Herz und Gemüt.
Darum kam Tarzan immer wieder zur Natur zurück, wie ein treuer Liebhaber sich nach langer Haft hinter Kerkermauern wieder zum lange verzögerten Stelldichein einfindet. Im innersten Mark waren seine Waziri zivilisierter als er. Sie kochten ihr Fleisch, ehe sie es aßen, und sie verabscheuten viele Nahrungsmittel als unrein, die Tarzan sein Leben lang mit Genuss verzehrt hatte, und so wirksam ist das Gift der Heuchelei, dass selbst der trotzige Affenmensch sich scheute, vor ihnen seinen natürlichen Empfindungen nachzugeben. So aß er gebratenes Fleisch, obgleich er es lieber roh und unverdorben genossen hätte und er brachte seine Jagdbeute mit Pfeil und Speer zur Strecke, während er doch viel lieber aus der Lauer darauf gesprungen wäre, um ihr die Zähne in die Halsadern zu schlagen. Aber der Trieb, welchen er als Kind mit der Milch seiner wilden Nährmutter eingesogen hatte, wurde zuletzt doch unüberwindlich – er musste das warme Blut einer frischen Beute haben und seine Muskeln sehnten sich danach, in jenem Kampf um das Dasein gegen das wilde Dschungelleben eingesetzt zu werden, wie es während der ersten zwanzig Jahre seines Lebens sein einziges Geburtsrecht gewesen war.
Der Ruf des Dschungels
An der kleinen Boma aus Dorngestrüpp, das seine Leute einigermaßen vor den Angriffen der großen Fleischfresser schützte, lag der Affenmensch während einer der nächsten Nächte unter dem Eindruck dieser unklaren aber allgewaltigen Triebe wach. Neben dem Feuer, welches gelbe Augen draußen in der Dunkelheit vor dem Lager nötig machten, hielt schläfrig ein einzelner Krieger Wache. Das Heulen und Fauchen der großen Katzen vermengte sich mit den Myriaden anderer Geräusche von den kleineren Bewohnern des Dschungels, um die wilde Flamme in der Brust dieses grimmen englischen Lords noch zu entfachen. Eine Stunde lang wälzte er sich ruhelos auf seinem Graslager umher, dann erhob er sich geräuschlos wie ein Gespenst und, als der Waziri den Rücken drehte, sprang er vor den glitzernden Augen über die Hecke der Boma, schwang sich in einen großen Baum und war verschwunden.
Eine Zeit lang jagte er nur so durch die mittlere Terrasse der Zweige dahin, um seine animalische Stimmung auszutoben, wobei er sich über gefahrvoll weite Lücken zwischen den Dschungelriesen hinüberschwang; dann kletterte er höher in die federnden schwächeren Zweige der oberen Terrasse, wo der Mond voll auf ihn schien, wo ein leichter Windhauch wehte und griffbereiter Tod in jedem gebrechlichen Zweige lauerte. Hier machte er halt und erhob sein Antlitz zu Goro, dem Mond. Mit erhobenem Arm stand er, der Schrei des Affenbullen zitterte schon auf seinen Lippen, aber er blieb ruhig, um seine treuen Waziri nicht zu wecken, welchen der grauenvolle Kampfruf ihres Gebieters nur zu bekannt war.
Von hier ab ging er langsamer und mit größerer Vorsicht und Verstohlenheit weiter, denn jetzt suchte der Affentarzan Beute. Herunter auf den Boden in den rabenschwarzen Schatten der engstehenden Baumstämme und des überhängenden Grüns des Dschungels stieg er. Von Zeit zu Zeit bückte er sich und näherte seine Nase dem Boden. Er suchte und fand eine breite Wildspur und endlich belohnte die Witterung einer frischen Spur von Bara, dem Hirsch, seine Nüstern. Tarzan lief das Wasser im Munde zusammen und ein leises Knurren entwich seinen Lippen. Die letzte Spur von erkünsteltem Standesbewusstsein war abgestreift – er war wieder ganz der Urwaldjäger – der Urmensch – der reinste Vertreter der menschlichen Rasse. Sein Wahrnehmungsvermögen, mit dem er der trügerischen Spur unter Wind folgte, übertraf das eines gewöhnlichen Menschen in einem uns unbegreiflichen Maße. Durch alle Gegenströmungen des schweren Geruchs der Fleischfresser hindurch verfolgte er die Spur von Bara; der süßliche, ekle Geruch von Horta, dem Eber, konnte die Witterung seiner Beute nicht übertäuben – den durchdringenden, weichen Bisamduft vom Huf des Hirsches.
Da! jetzt zeigte schon der körperliche Geruch des Hirsches Tarzan die Nähe seiner Beute an. Also wieder hinauf in die Bäume – auf die untere Terrasse, von wo er den Boden übersah und mit Ohr und Nase die ersten Anzeichen der greifbaren Nähe seiner Beute wahrnehmen konnte. Der Affenmensch brauchte nicht mehr weit zu streifen; da stand Bara wachsam an der Ecke der in Mondschein gebadeten Lichtung. Geräuschlos kroch Tarzan durch die Zweige, bis er gerade über dem Hirsch war. In der Rechten hielt er das lange Jagdmesser seines Vaters, im Herzen kochte die Blutlust des Raubtiers. Nur einen Augenblick schwebte er über dem ahnungslosen Tier, dann stürzte er sich auf den schlanken Rücken. Die Wucht seines Körpers brachte den Hirsch auf seine Knie, und ehe er sich wieder erheben konnte, fand das Messer den Weg zum Herzen. Als sich Tarzan auf dem Rücken seines Opfers aufrichtete, um dem Mond seinen schauerlichen Siegesruf entgegenzusenden, trug der Wind seinen Nüstern etwas zu, das ihn stumm und starr wie eine Bildsäule machte. Seine wilden Augen funkelten nach der Richtung, aus welcher ihm der Wind die Warnung zugetragen hatte, und eben jetzt teilten sich die Gräser am Rande der Lichtung: Numa, der Löwe, schritt majestätisch heraus in das Gesichtsfeld. Mitten auf der Lichtung hielt er, heftete seine gelbgrünen Augen auf Tarzan und blickte neidisch auf seinen Jagderfolg, denn Numa hatte diese Nacht nur Misserfolge gehabt.
Von den Lippen des Affenmenschen kam ein rollendes Warnungsknurren. Numa antwortete ohne vorzurücken; langsam mit seinem Schweif hin und her peitschend blieb er stehen. Tarzan hockte sich auf seine Beute nieder und schnitt ein ordentliches Stück aus der Keule. Während der Affenmensch zwischen einzelnen Bissen sein warnendes Knurren ausstieß, beäugte ihn Numa mit zunehmender Verachtung und Wut. Da gerade dieser Löwe noch nie bisher mit dem Affentarzan in Berührung gekommen war, kam er sich gänzlich angeführt vor. Dies Ding da war doch nach Aussehen und Witterung ein Menschlein, und Numa hatte Menschenfleisch gekostet und festgestellt, dass es zwar nicht am besten schmeckte, aber dafür sicher am leichtesten zu haben war. Allerdings lag in dem tierischen Knurren des merkwürdigen Geschöpfes etwas, das ihn an irgendwelchen gefährlichen Gegner erinnerte. Er wartete daher noch ab, während ihn der Hunger und der Duft von Baras warmem Fleisch fast toll machten. Tarzan erriet, was in dem kleinen Gehirn des Raubtieres vor sich ging und war ständig auf der Hut. Es war sein Glück, dass er das tat, denn Numa konnte es endlich nicht mehr aushalten. Als der Schweif senkrecht in die Höhe schoss, wusste der vorsichtige Affenmensch nur zu gut, was das Zeichen bedeutete. Er packte den Rest der Hirschkeule mit den Zähnen und sprang gerade auf den nächsten Baum, als sich Numa mit schnellzugsähnlicher Gewalt und sausendem Schwung auf ihn stürzte.
Tarzans Rückzug war kein Zeichen von Furcht. Das Leben im Dschungel hat andere Gesichtspunkte wie wir, und andere Regeln gelten dort. Hätte Tarzan Hunger gehabt, er hätte zweifellos seine Stellung behauptet und wäre Numas Angriff begegnet. Er hatte das schon bei mehr als einer Gelegenheit getan, genau so wie er früher selbst auf Löwen losgegangen war. Aber heute Nacht war er keineswegs sehr hungrig und die mitgenommene Keule hatte mehr Fleisch, als er essen konnte. Aber er sah doch nicht gleichgültig von oben zu, wie Numa sich das Fleisch von Tarzans Beute riss. Die Anmaßung dieses fremden Numa verlangte Strafe. Und Tarzan ging denn auch gleich daran, der großen Katze das Dasein zu verleiden.
Zahlreiche Bäume in der Nähe trugen große, harte Früchte und auf einen solchen schwang sich der Affenmensch mit der Gewandtheit eines Eichhörnchens. Und nun begann eine Beschießung, auf welche Numa mit markerschütterndem Gebrüll antwortete. Eine nach der anderen, so schnell er sie pflücken und schleudern konnte, sausten die harten Früchte hinab auf den Löwen. Unter diesem Hagel von Wurfgeschossen war es der gelben Katze unmöglich, zu fressen – sie konnte nur immer brüllen, knurren und beiseitespringen, und manchmal wurde sie gänzlich von Baras, des Hirsches, Körper weggetrieben. Brüllend und wutschnaubend wich der Löwe. Aber plötzlich erstarb seine Stimme mitten auf der Lichtung. Tarzan sah, wie sich der Kopf senkte und die Ohren sich breit stellten, wie der Körper sich duckte und der lange Schweif zitterte, als das Tier vorsichtig auf der anderen Seite drüben durch die Bäume schlich.
Sofort war Tarzans Aufmerksamkeit geweckt. Er hob den Kopf und zog das leichte Dschungellüftchen ein. Was hatte wohl Numas Spannung erregt und ihn auf so sanften Pfoten vom Schauplatz seiner Empörung weggebracht? Gerade als der Löwe jenseits der Lichtung unter den Bäumen verschwand, bekam Tarzan durch den Wind die Erklärung seiner neuen Absichten. Die Witterung eines Menschen wehte deutlich in seine empfindlichen Nasenflügel.
Der Affenmensch packte den Rest seiner Hirschkeule in eine Baumgabel, wischte die fettigen Handflächen an den nackten Schenkeln ab und schwang sich zur Verfolgung Numas davon. Von der Lichtung aus führte eine breite, stark ausgetretene Elefantenfährte in den Wald. Parallel zu ihr schlich Numa und über ihm zog Tarzan wie ein Schattengespenst durch die Bäume. Die wilde Katze und der wilde Mann sahen fast gleichzeitig Numas Beute, obgleich beide, schon ehe sie ihnen zu Gesicht kam, wussten, dass es ein Neger war. Ihr empfindlicher Geruch hatte ihnen so viel gesagt, aber Tarzan wusste außerdem, dass es die Witterung eines Fremden war und zwar eines alten Mannes, denn sowohl Rasse wie Geschlecht und Alter haben ihre unterschiedliche Witterung.
Es war ein alter Mann, der sich allein seinen Weg durch den düsteren Dschungel brach, ein verschrumpeltes, ausgetrocknetes, altes Männchen mit hässlichen Schmarren und Tätowierungen. Dazu trug er einen merkwürdigen Aufputz, ein Hyänenfell hing ihm um die Schultern und der getrocknete Kopf davon war über seinen grauen Schädel gestülpt. Tarzan erkannte ihn an seinen Abzeichen als Zauberer und wartete mit befriedigtem Vorgefühl auf Numas Angriff, denn der Affenmensch hatte für die Zauberer nicht viel übrig. Aber eben als Numa vorsprang, fiel dem Weißen plötzlich ein, dass der Löwe ihm vor einigen Minuten seine Beute gestohlen hatte und Rache ist süß. Erst als Numa kaum zwanzig Schritte hinter ihm krachend durch die Büsche auf den Wildpfad herausbrach, merkte der Neger, dass er in Gefahr war. Als er sich herumdrehte, konnte er gerade noch bemerken, dass ein mächtiger, schwarzmähniger Löwe auf ihn losschnellte, aber noch im Herumdrehen packte ihn Numa auch schon. Gleichzeitig fiel der Affenmensch von einem überhängenden Zweig genau auf des Löwen Rücken. Als sich der Löwe aufrichtete, stieß er ihm sein Messer hinter dem linken Schulterblatt in das braune Fell, wühlte die Finger der rechten Hand in die lange Mähne, grub die Zähne in Numas Nacken und schlang seine kräftigen Beine um des Tieres Rumpf. Unter Schmerz- und Wutgebrüll stieg Numa hoch und fiel nach hinten über auf den Affenmenschen. Aber das mächtige menschliche Wesen hielt fest und tauchte wiederholt blitzschnell das lange Messer in seine Flanke. Numa, der Löwe, überkollerte sich, kratzte, biss in die Luft und versuchte unter schrecklichem Geheul das Ding auf seinem Rücken zu fassen. Tarzan fühlte sich mehr als einmal beinahe von seinem Griff losgerissen. Aber so zerbeult und gequetscht er war, mit Numas Blut und dem Schmutz der Wildfährte beschmiert, nicht für einen Augenblick ließ die Wildheit seines tollkühnen Angriffs oder das grimme Haften am Rücken seines Gegners nach. Wenn er auch nur einen Augenblick den Griff gelockert hätte, wäre er in den Bereich jener reißenden, schlagenden Fänge gekommen und die wilde Laufbahn des im Dschungel aufgewachsenen englischen Lords hätte für immer ihr Ende gefunden.
Der Zauberer lag noch an derselben Stelle, wo er unter dem Löwen niedergestürzt war. Zerfleischt und blutend, war er nicht mehr imstande, sich wegzuschleppen und musste bei dem schrecklichen Kampfe der zwei Dschungelbeherrscher Augenzeuge sein. Mit glänzenden Augen starrend murmelte er wirre Anrufungen der Teufel seiner religiösen Bräuche zwischen runzeligen Lippen und zahnlosen Kiefern.
Eine Zeit lang war er nicht im Zweifel über den Ausgang – der fremde weiße Mann musste sicher dem schrecklichen Simba erliegen – wer hörte je, dass ein einzelner Mann nur mit einem Messer ein so mächtiges Tier erlegt hätte! Aber bald riss der Schwarze die Augen auf und bekam Zweifel und Besorgnis. Was war das für ein wunderbares Geschöpf, das Simba bekämpfte und sich gegen die riesigen Muskeln des Tieres behauptete? Langsam dämmerte in den eingefallenen Augen, die so hell aus dem runzeligen, vernarbten Gesicht hervorleuchteten, die Erkenntnis. Die Hand der Erinnerung griff zurück in die Vergangenheit, bis sie ein mit den Jahren verblasstes und vergilbtes Bild fasste: Ein geschmeidiger, weißhäutiger Jüngling schwang sich in Gesellschaft einer Horde von Riesenaffen durch die Bäume. In die alten Augen trat große Angst, die abergläubische Angst des Menschen, welcher an Gespenster, an Geister und Dämonen glaubt. Und als dann der Zauberer über den Ausgang des Zweikampfes nicht mehr zweifelhaft war, denn entgegen seiner vorherigen Überzeugung wusste er nun, dass der Dschungelgott Simba töten würde, da hatte der alte Neger noch mehr Angst um sein bevorstehendes Geschick aus der Hand des Siegers als vorher vor dem sicheren und schnellen Tod, welchen ihm der Löwe bereitet hätte. Er sah, wie matt der Löwe vom Blutverlust wurde, wie die mächtigen Glieder zitterten und wankten und er sah zuletzt das Tier niedersinken, um sich nicht mehr zu erheben. Und dann sah er, wie der Waldgott oder Teufel sich Von dem besiegten Gegner erhob: er setzte einen Fuß auf den noch zuckenden Körper, hob das Antlitz zum Mond und stieß einen schauerlichen Schrei aus, dass dem Zauberer das klopfende Blut in den Pulsen gefror.
Prophezeiung und Erfüllung
Tarzans Aufmerksamkeit wendete sich nun dem Manne zu. Er hatte keineswegs Numa erschlagen, um den Neger zu retten – er wollte sich nur an dem Löwen rächen. Aber als er den alten Mann hilflos und sterbend vor sich liegen sah, rührte so etwas wie Mitleid sein raues Herz. In der Jugend hätte er den Zauberer ohne die geringsten Bedenken getötet. Aber die Zivilisation hatte ihre besänftigende Wirkung auf ihn so wenig wie auf von ihr berührte Rassen und Nationen verfehlt, obgleich sie noch nicht so weit gekommen war, ihn feige oder weichlich zu machen.
Er sah einen alten Mann unter Schmerzen sterben und er bückte sich, untersuchte dessen Wunden und hemmte das strömende Blut.
Wer bist du? fragte der Greis mit zitternder Stimme. Ich bin Tarzan, der Affentarzan! erwiderte der Affenmensch mit vielleicht größerem Stolz als er gesagt haben würde: Ich bin John Clayton, Lord Greystoke. Der Zauberer schüttelte sich krampfhaft und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, zeigten sie Ergebung in das wenn auch noch so schreckliche Geschick, das ihn aus der Hand dieses gefürchteten Teufels der Wälder erwartete. Warum tötest du mich nicht? fragte er.
Weshalb sollte ich dich töten? forschte Tarzan. Du hast mir nichts getan und außerdem liegst du schon im Sterben. Numa, der Löwe, hat dich getötet.
Du würdest mich nicht töten?! Überraschung und Zweifel lagen im Tone der zittrigen, alten Stimme.
Wenn ich könnte, würde ich dich retten, erwiderte Tarzan. Aber das geht nicht mehr. Warum dachtest du, ich würde dich töten?
Der alte Mann schwieg einen Augenblick. Als er wieder sprach, hatte er anscheinend erst seinen Mut zusammengenommen: Ich kenne dich von früher, sagte er, von damals, als du in des Häuptlings Mbonga Gebiet im Dschungel haustest. Ich war schon Zauberer, als du Kulonga und die anderen erschlugst und unsere Hütten und unseren Gifttopf beraubtest. Ich erkannte dich erst nicht. Aber jetzt weiß ich es – du bist der weißhäutige Affe, der unter den haarigen Affen lebte und das Leben in Mbongas Dorf zur Hölle machte, der Herr – der Waldgott – der Munango-Kiwati, welchem wir immer Opfer an Nahrung vor das Tor setzten und der dann kam und es aß. Sage mir, ehe ich sterbe – bist du Mensch oder Teufel? Tarzan lachte: Ich bin ein Mensch!
Der Alte seufzte und schüttelte den Kopf. Du suchtest mich vor Simba zu retten. Ich will dich dafür belohnen. Ich bin ein großer Zauberer. Höre auf mich, weißer Mann! Ich sehe, dass dir böse Tage bevorstehen. In meinem eigenen Blut, das mir über die Hand läuft, steht es geschrieben. Ein Größerer als du selbst wird erstehen und dich niederschlagen. Kehre um, Munango-Kiwati! Kehre um, ehe es zu spät ist. Gefahr liegt vor dir, Gefahr lauert hinter dir; aber größer ist die Gefahr vor dir. Ich sehe … Er machte eine Pause, und atmete lang und röchelnd. Dann krümmte er sich zu einem kleinen, schrumpeligen Haufen zusammen und starb. Tarzan hätte gerne gewusst, was er noch weiter gesehen hatte.
Als der Affenmensch die Boma wieder betrat und sich zwischen seinen schwarzen Kriegern niederlegte, war es ziemlich spät geworden. Keiner hatte bemerkt, dass er gegangen war und keiner sah seine Rückkehr. Im Einschlafen dachte er noch an die Worte des Zauberers und beim Erwachen waren sie sein erster Gedanke. Aber er hatte deswegen keine Absicht, umzukehren, denn er kannte keine Furcht. Hätte er allerdings geahnt, was der Frau bevorstand, welche er über alles in der Welt liebte, er würde wie auf Flügeln durch die Bäume an ihre Seite geeilt sein und das Gold von Opar hätte für immer verborgen und vergessen in seinem Schatzhause liegenbleiben können.