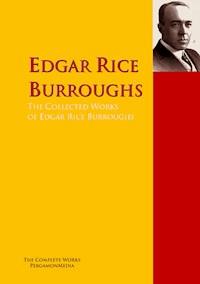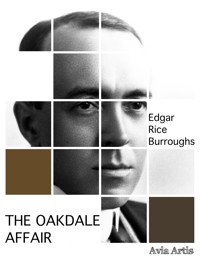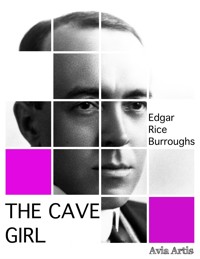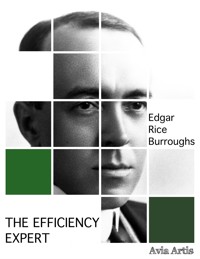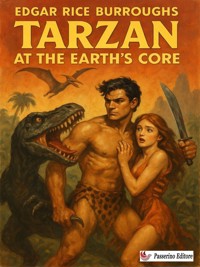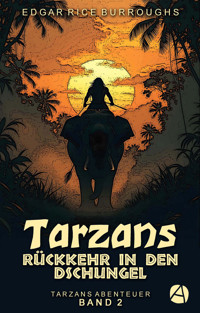6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tarzan findet bei dem Skelett eines weißen Mannes einen rätselhaften Brief, in dem von einem geheimnisvollen, schrecklichen Land die Rede ist, in das dieser Mann und seine kleine Tochter verschleppt worden sind. Tarzan macht sich auf die Suche, aber er wird immer wieder gewarnt: Unheimliche Wesen jagen den Fremden maßlosen Schrecken ein! Gibt es Gespenster, Wesen ohne Fleisch und Blut, die doch Macht über die Menschen haben und die Gewalt auf grausame Weise spüren lassen? Wer ist Mafka, den alle fürchten? Warum fliehen auch die Eingeborenen aus diesem verrufenen Land, aus dem Land des Schreckens? Tarzans Stärke und seine Intelligenz sind die kleine aber starke Streitmacht gegen einen unbekannten Gegner, gegen die Geheimnisse im Lande des Schreckens... Der Roman TARZAN IM LAND DES SCHRECKENS erschien erstmals von September bis Oktober 1936 im ARGOSY-Magazin. Eine erste Buchveröffentlichung folgte im Jahr 1939. Der Apex-Verlag veröffentlicht TARZAN IM LAND DES SCHRECKENS in der deutschen Übersetzung von Helmut H. Lundberg und Christian Dörge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EDGAR RICE BURROUGHS
Tarzan im Land des Schreckens
Dreizehnter Band des TARZAN-Zyklus
Roman
Apex-Verlag
Impressum
Copyright 1936 © by Edgar Rice Burroughs.
Der Roman Tarzan The Magnificent ist gemeinfrei.
Copyright dieser Ausgabe © by Apex-Verlag.
Übersetzung: Helmut H. Lundberg und Christian Dörge.
(OT: Tarzan The Magnificent).
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg.
Cover: G. P. Micklewright/Christian Dörge/Apex-Graphixx.
Satz: Apex-Verlag.
Verlag: Apex-Verlag, Winthirstraße 11, 80639 München.
Verlags-Homepage: www.apex-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Autor
TARZAN IM LAND DES SCHRECKENS
Aus der Vergangenheit
Eine seltsame Geschichte
Geheimnisvolle Nächte
Zum Tode verurteilt
Der schwarze Panther
Gefangen
Grüne Magie
In der Leopardengrube
Am Ende des Geheimganges
Der Freiheit entgegen
Verrat
Wieder vereint
Unter Kannibalen
Auf der Spur
Tantor – der Elefant
Seltsame Begegnung
Undankbarkeit
Vergeltung
In der Stadt Athne
Phoros
Menofra
Verurteilt
Kampf auf Leben und Tod
Die Entscheidungsschlacht
Das Buch
Tarzan findet bei dem Skelett eines weißen Mannes einen rätselhaften Brief, in dem von einem geheimnisvollen, schrecklichen Land die Rede ist, in das dieser Mann und seine kleine Tochter verschleppt worden sind. Tarzan macht sich auf die Suche, aber er wird immer wieder gewarnt: Unheimliche Wesen jagen den Fremden maßlosen Schrecken ein! Gibt es Gespenster, Wesen ohne Fleisch und Blut, die doch Macht über die Menschen haben und die Gewalt auf grausame Weise spüren lassen? Wer ist Mafka, den alle fürchten? Warum fliehen auch die Eingeborenen aus diesem verrufenen Land, aus dem Land des Schreckens? Tarzans Stärke und seine Intelligenz sind die kleine aber starke Streitmacht gegen einen unbekannten Gegner, gegen die Geheimnisse im Lande des Schreckens...
Der Roman Tarzan im Land des Schreckens erschien erstmals von September bis Oktober 1936 im Argosy-Magazin. Eine erste Buchveröffentlichung folgte im Jahr 1939.
Der Apex-Verlag veröffentlicht Tarzan im Land des Schreckens in der deutschen Übersetzung von Helmut H. Lundberg und Christian Dörge.
Der Autor
Edgar Rice Burroughs - * 01. September 1875, † 19. März 1950.
Edgar Rice Burroughs war ein US-amerikanischer Schriftsteller, der bekannt wurde als Erzähler diverser Abenteuergeschichten, die sich vor allem dem frühen Fantasy- und Science-Fiction-Genre zuordnen lassen. Die bekanntesten von ihm eingeführten - und in der Folge von anderen in zahlreichen Filmen und Comics etablierten - Heldencharaktere sind Tarzan, John Carter, Carson Napier.
Der Sohn des Fabrikanten und Bürgerkriegsveteranen Major George Tyler Burroughs (1833–1913) und der Lehrerin Mary Evaline Zieger (1840–1920) verlebte nach dem Besuch mehrerer Privatschulen den Großteil seiner Jugend auf der Ranch seiner Brüder in Idaho.
Nach seinem Abschluss auf der Michigan Military Academy im Jahr 1895 trat Burroughs in die 7. US-Kavallerie ein. Als ein Armeearzt bei ihm einen Herzfehler diagnostizierte und er deshalb nicht Offizier werden konnte, verließ Burroughs die Armee vorzeitig im Jahr 1897 und arbeitete bis 1899 wieder auf der Ranch seines Bruders. Danach ging er zurück nach Chicago und arbeitete in der Firma seines Vaters.
Am 1. Januar 1900 heiratete Burroughs seine Jugendliebe Emma Centennia Hulbert. Das Paar bekam drei Kinder: Joan Burroughs Pierce (1908–1972), Hulbert Burroughs (1909–1991) und John Coleman Burroughs (1913–1979). Da die tägliche Routine in der Fabrik seines Vaters Burroughs nicht zufriedenstellte, verließ das Ehepaar 1904 Chicago, um abermals in Idaho zu leben. Mit seinen Brüdern, die inzwischen ihre Ranch aufgegeben hatten, versuchte er sich erfolglos als Goldgräber. Kurze Zeit später arbeitete er als Eisenbahnpolizist in Salt Lake City. Auch diesen Job gab Burroughs auf und zog mit seiner Frau wieder zurück nach Chicago, wo er eine Reihe Jobs annahm, unter anderem als Vertreter. 1911 investierte er sein letztes Geld in einer Handelsagentur für Bleistiftanspitzer und scheiterte.
Burroughs, der zu dieser Zeit an schweren Depressionen litt und, nach einigen seiner Biographen, an Selbstmord dachte, kam auf die Idee, eine Geschichte für ein Magazin zu schreiben, in dem er zuvor Anzeigen für seine Bleistiftanspitzer geschaltet hatte. Seine erste Erzählung Dejah Thoris, Princess of Mars (unter dem Pseudonym Normal Bean für das All-Story-Magazin von Thomas Metcalf geschrieben) wurde zwischen Februar und Juli 1912 als Fortsetzung veröffentlicht.
Metcalf hatte sein Pseudonym in Norman Bean geändert, und auch der Titel seiner Geschichte wurde zu Under the Moon of Mars abgewandelt. Auf Burroughs Beschwerde bezüglich der Änderungen, lenkte Metcalf ein und bot an, Burroughs nächste Geschichte unter seinem richtigen Namen zu drucken. Eine weitere Beschwerde Burroughs betraf den Zusatz For all Rights auf seinem Honorarscheck. Nach längerem Briefwechsel erreichte er, dass die 400 Dollar nur für den Erstabdruck galten.
Burroughs zweite Geschichte, The Outlaw of Torn, wurde jedoch von All-Story abgelehnt. Der große Erfolg kam mit Burroughs drittem Anlauf, Tarzan of the Apes.
Die Geschichte von Tarzan wurde ebenfalls 1912 von All-Story veröffentlicht. Burroughs schrieb in der Folgezeit immer wieder neue Tarzan-Geschichten und konnte sich - kaum zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Tarzan of the Apes - ein riesiges Stück Land in der Nähe von Los Angeles kaufen. Selbst nach Burroughs Tod im Jahr 1950 erschienen weitere Tarzan-Geschichten. Das Landstück bei Los Angeles ist heute die Gemeinde Tarzana.
In den frühen 1930er Jahren wurde sein schriftstellerischer Erfolg allerdings immer mehr von privaten Problemen überschattet. 1934 ließ er sich scheiden und heiratete ein Jahr später Florence Dearholt. Doch schon 1942 wurde auch diese Ehe geschieden. Nach der Bombardierung von Pearl Harbor begab sich Burroughs 1941 als Kriegsreporter nach Hawaii. Nach dem Krieg kehrte er nach Kalifornien zurück, wo er, nach vielen gesundheitlichen Problemen, 1950 einem Herzanfall erlag.
In Burroughs Werk vermischen sich Science Fiction und Fantasy. Er etablierte Geschichten vor einem planetarischen Hintergrund in der Science Fiction. Dabei war Burroughs bewusst, dass seine Literatur bei den Kritikern nicht ankam. Er machte auch nie ein Hehl daraus, dass er schrieb, um Geld zu verdienen.
Die Helden seiner Romane und Erzählungen haben keine Alltagsprobleme. Bei den Charakterzeichnungen schwach, sprudeln Burroughs Geschichten über vor Ideen und Action. Die Helden seiner Romane haben verschiedene Merkmale gemeinsam, beispielsweise das Geheimnis um ihre Herkunft. Entweder haben die Helden nie eine Kindheit erlebt, oder können sich nicht daran erinnern, oder aber sie sind wie Tarzan und The Cave Girl Waisen. Ein weiteres Merkmal von Burroughs Geschichten ist der, wie Brian W. Aldiss es nennt, ausgeprägte sexuelle Dimorphismus. Das jeweils dominante Geschlecht ist hässlich.
Obwohl es in den Romanen und Geschichten Burroughs von schönen, nackten Frauen nur so wimmelt, werden sexuelle Beziehungen weder angedeutet noch erwähnt. Burroughs Welt scheint eine präpubertäre zu sein. Doch ist die Jungfräulichkeit immer in Gefahr (vgl. Aldiss). Fast schon zwanghaft mutet an, dass es in den Geschichten Burroughs, die zwischen 1911 und 1915 geschrieben wurden, nicht weniger als 76 Mal zu Vergewaltigungsdrohungen kommt, die natürlich alle abgewendet werden können. Zu den Bedrohern der weiblichen Unschuld gehören verschiedene Marsianer, Sultane, Höhlenmenschen, japanische Kopfjäger und Affen.
E. F. Bleiler schreibt über Burroughs, seine Texte seien „Fantasien von Erotik und Macht.“
Der Apex-Verlag veröffentlicht Burroughs' Venus-Romane (in der deutschen Übersetzung von Thomas Schlück), Neu-Übersetzungen des Tarzan- und des John Carter-Zyklus sowie als deutsche Erstveröffentlichung die Pellucidar-Serie.
TARZAN IM LAND DES SCHRECKENS
Aus der Vergangenheit
Über einer dürren Ebene, knapp fünf Breitengrade nördlich des Äquators, brennt erbarmungslos die glühende Sonne. Ein Mann taumelt dahin. Auf seinem zerrissenen Hemd und den abgetragenen Hosen zeigen sich die rostbraunen Flecken vertrockneten Blutes. Er stolpert, vermag sich nicht mehr auf den Beinen zu halten und bricht zusammen.
Ein großer Löwe beobachtet den Vorgang aus einiger Entfernung. Er liegt auf einem felsigen Vorsprung, wo sich einige verdorrte Büsche verzweifelt festgesetzt haben und ein wenig Schatten auf das Lager des Löwen werfen. Denn wir befinden uns in Afrika.
Ska, der Aasgeier, kreist und kurvt unter dem blauen Himmel und scheint eine Todesbotschaft in den Äther zu schreiben. Er hält sich immer hoch über der Stelle, wo regungslos der einsame Mensch liegt.
Nicht weit davon entfernt, strebt am Rande der trockenen Ebene ein zweiter Mann mit kräftigem Schritt nach Norden. Ihm ist nichts von Schwäche oder Erschöpfung anzumerken. Seine bronzene Haut spricht von bester Gesundheit. Schön geschwungene Muskeln bewegen sich im Gleichmaß des Schrittes. Die aufrechte Haltung, der geräuschlose Schritt, das leise Schwingen der Arme verraten etwas von der kraftvollen Anmut, die Sheeta, dem Panther, nachgesagt wird. Diese Gestalt aber hat nichts Schleichendes an sich. Der Mann zeigt die Haltung eines Wesens, dem Unsicherheit und Furcht unbekannte Begriffe sind. Er bewegt sich wie ein König in seinem Reich.
Er trägt nur ein einziges Kleidungsstück, einen Lendenschurz aus Rehfell. Ein Grasseil ist mehrfach über die eine Schulter geschlungen, während über der anderen ein Köcher voller Pfeile hängt. Ein Jagdmesser in schwerer Lederscheide schwingt an der Hüfte. Ein Bogen und ein kurzer Speer vervollständigen die Ausrüstung. Über ernsten, grauen Augen und einer hohen Stirn wallt eine Mähne ungekämmten schwarzen Haares. Das Besondere an diesem Manne sind die Augen. Sie können die Ruhe eines Sees in der Sommersonne aber auch den stählernen Blitz des geschwungenen Degens widerspiegeln.
Der König des Dschungels ist unterwegs.
Er hat seine herkömmlichen Jagdgründe verlassen und ist weit nach Norden gewandert. Dennoch befindet er sich nicht in unbekanntem Gelände. Er ist früher oft bis hierher vorgedrungen. Ihm ist wohlbekannt, wo man Wasser graben kann. Er weiß auch, wo das nächste Wasserloch liegt, an dem er leicht ein Tier erlegen und seinen Hunger stillen kann.
Er ist auf Wunsch einer hohen Regierungsstelle derart weit nach Norden gewandert, um einem Gerücht nachzuspüren, wonach eine fremde Macht versucht haben soll, einen eingeborenen Häuptling zu bestechen und Unruhe im Lande hervorzurufen. Gerüchte von Krieg und Aufstand hängen in der Luft.
Als Tarzan mit leichtem Schritt über die Ebene dahinging, waren wie immer alle seine Sinne wach und gespannt. Kein Laut entging seinem scharfen Ohr, keine Bewegung seinen Augen. Und keine Witterung, die Usha, der Wind, ihm zutrug, blieb ungeklärt. In weiter Ferne sah er Numa, den Löwen, der jetzt am Rande eines Felsenbandes stand. Er erblickte auch Ska, den Aasgeier, der über irgendetwas seine Kreise zog, das Tarzan noch nicht zu erkennen vermochte. In allen diesen Dingen sah, hörte und witterte er eine ganze Geschichte. Denn für ihn war diese wilde Welt wie ein offenes Buch. In ihm las er die stets wiederkehrende, manchmal aufregende, stets interessante Geschichte vom Lieben und Hassen, von Leben und Tod.
Ein Stück vor ihm glänzte etwas Weißes im Sonnenlicht. Es war ein menschlicher Schädel. Im Näherkommen entdeckte er das ganze Skelett eines Mannes, dessen Knochenteile nur wenig aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht waren. Aus dem Brustkorb wuchs ein niedriger Wüstenbusch hervor und wies nach, dass das Skelett seit langer Zeit hier liegen musste.
Tarzan blieb stehen, um den Fund zu untersuchen. Für ihn und in seiner Welt ist nichts zu gering, als dass man ohne Prüfung daran vorübergehen dürfte. Er fand heraus, dass er die sterblichen Überreste eines Negers vor sich hatte. Viele Jahre mussten seit dem Tode des Mannes vergangen sein. Das war in dieser heißen, trockenen Ebene durchaus möglich. Es ließ sich nicht sagen, woran der Mann gestorben war. Wahrscheinlich aber an Durst.
Den scharfen Augen des Waldmenschen entging nicht, dass ein kleiner Gegenstand neben den Knochen der einen Hand lag, halb verdeckt von Sand und Staub. Er kniete nieder und nahm das Fundstück auf, indem er es sorgfältig aus der Erde zog. Es war ein gespaltenes Stück Hartholz. Und in den Spalt war ein dünnes Päckchen aus Ölseide gezwängt.
Die Seide war fleckig, brüchig und trocken. Man hatte den Eindruck, dass sie bei der ersten Berührung zu Staub zerfallen würde. Das galt aber nur für die äußere Umhüllung. Tarzan entfernte sie vorsichtig und stellte fest, dass sich darunter weitere, recht gut erhaltene Seidenhüllen befanden, aus denen sich schließlich herausschälen ließ, was er erwartet hatte – ein Brief.
Er war in Englisch abgefasst. Die Zeilen zeigten eine kleine, aber außerordentlich leicht lesbare Handschrift. Tarzan las den Brief mit Interesse, das noch erhöht wurde durch das Datum am Briefkopf. Zwanzig Jahre waren vergangen, seit dieser Brief geschrieben wurde. Seit zwanzig Jahren hatte das Schriftstück hier neben dem Skelett seines Überbringers in der tödlichen Einsamkeit der nackten Ebene gelegen.
Tarzan las:
An den Finder dieses Briefes:
Ich sende dieses Lebenszeichen aus ohne viel Hoffnung, dass es jemals aus diesem verdammten Land herauskommen wird. Und hoffe doch, dass es in die Hände eines Weißen gelangen möge. Wenn dieser Fall eintreten sollte, bitte, lasst diesen Brief oder eine entsprechende Nachricht dem nächsten Regierungskommissar oder einer anderen Stelle zugehen, die uns schnelle Hilfe zu bringen vermag.
Meine Frau und ich befanden uns auf einer Forschungsfahrt nördlich des Rudolph-Sees. Wir gingen zu weit vor. Es war die alte Geschichte. Unsere Boys wurden durch Gerüchte in Schrecken versetzt, dass wir uns angeblich im Bereich eines sehr wilden Stammes befänden. Sie verließen uns.
Wo der Fluss Mafa in den Neubari einmündet, zogen wir, wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben, den Lauf des zuerst genannten Flusses hinauf. Als wir die Schlucht hinter uns hatten und die Ebene erreichten, fielen wir in die Hände der wilden Frauen vom Stamme der Kaji. Ein Jahr später kam unsere Tochter zur Welt und meine Frau starb. Die Teufelinnen vom Kaji-Stamme brachten sie um, weil sie nicht einen Sohn geboren hatte. Sie brauchen weiße Männer. Deswegen haben sie mich nicht getötet wie das Dutzend anderer Weißer, die sie gefangen halten.
Das Land der Kaji liegt auf einer Hochebene oberhalb der Fälle des Mafa. Es ist fast unzugänglich außer durch die Schlucht, die der Fluss Mafa, ausgehend von der Einmündung in den Neubari, gebildet hat.
Man wird eine starke Expedition weißer Männer zusammenstellen müssen, um mich und meine kleine Tochter zu retten. Ich bezweifle, dass man Schwarze dazu überreden könnte, dieses Land überhaupt zu betreten. Diese Kaji-Weiber kämpfen wie die Teufel. Sie besitzen seltsame, okkulte Kräfte unerklärlicher Art. Ich habe hier Dinge erlebt, die – mm, die man ohne Erklärung hinnehmen muss, weil sie sich nicht erklären lassen.
In der Umgebung dieses geheimnisvollen, übel beleumdeten Landes gibt es keine anderen Eingeborenenstämme. Deshalb weiß man fast nichts über die Kaji. Immerhin sind unter den nächsten Nachbarn Erzählungen und Gerüchte über die schrecklichen Vorkommnisse bei den Kaji im Schwange. Die Verbreitung wildester Gerüchte erschreckt die Träger einer jeden Karawane, die sich bis in die Nähe ihres Bannkreises und Einflusses vorwagt.
Weiße würden niemals den Grund für das Entsetzen ihrer Träger erfahren. Denn die Schwarzen scheuen sich, ihren Herren davon zu erzählen, weil sie die weitreichende Macht der schwarzen Magie der Kaji fürchten. Das Ergebnis ist immer das gleiche – wenn eine Karawane zu nahe ans Land der Kaji vorstößt, laufen die schwarzen Träger einfach davon.
Danach geschieht stets, was auch meiner Frau und mir zustieß. Die Weißen werden durch eine geheimnisvolle Macht zur Hochebene hinaufgelockt und dort gefangen genommen.
Vielleicht würde sogar eine größere Streitmacht überwältigt werden, denn die Weißen würden sich übernatürlichen Kräften gegenüber sehen. Sollten sie indessen siegen, würde ihnen riesiger Lohn winken. Und diesen Lohn setze ich gegen die Gefahren, denen man sich aussetzen müsste.
Die Kaji besitzen einen riesigen Diamanten. Ich habe nie erfahren können, wo er gefunden wurde und wo er hergekommen ist. Ich kann nur vermuten, dass er aus ihrem eigenen Lande stammt.
Ich habe den Cullinan-Diamanten gesehen und in Händen gehalten, der über dreitausend Karat schwer ist. Und ich bin dessen gewiss, dass der Diamant der Kaji volle sechstausend Karat wiegt. Wie hoch sein Wert sein mag, lässt sich schwer sagen. Wenn man zum Vergleich den bekannten Stein Stern des Südens nimmt, würde sich für den Kaji-Diamanten ein Wert von zwei Millionen Pfund Sterling errechnen – eine Belohnung, für die man schon etwas riskieren kann.
Es ist mir unmöglich, mit Sicherheit anzunehmen, dass ich jemals diesen Brief aus dem Land der Kaji hinausbefördern lassen kann. Ich hoffe aber, dass es mir gelingen wird, einen ihrer schwarzen Sklaven zu bestechen, die gelegentlich die Hochebene verlassen, um im Unterland zu spionieren.
Gott gebe, dass dieser Brief zur rechten Zeit in die rechten Hände gelangt!
- Mountford
Tarzan, der Affenmensch, las den Brief zweimal durch. Mountford! Beinahe so lange er sich zu erinnern vermochte, so schien es, waren seit dem unerklärlichen Verschwinden von Lord und Lady Mountford immer wieder Gerüchte aufgetaucht, dass das Ehepaar noch am Leben sei. Schließlich waren sie zu einer Art Legende der Wildnis, geworden.
Niemand mochte mehr daran glauben, dass die Verschwundenen noch am Leben seien. Dennoch tauchten von Zeit zu Zeit immer wieder Waldläufer und Wüstengänger auf, die neue Gerüchte mitbrachten und mehr oder weniger glaubwürdige Beweise aufzählten. Manchmal sollten die Einzelheiten von dem Häuptling eines entfernt lebenden Stammes kommen, manchmal auch direkt von den Lippen eines sterbenden Weißen. Niemals aber ließen sich wirkliche Spuren finden, die einen Hinweis auf den tatsächlichen Aufenthaltsort der Mountfords gaben. Man wollte dem Ehepaar an einer ganzen Reihe von Orten begegnet sein, die sich fast auf die ganze Strecke von Rhodesien bis zum Sudan verteilten.
Nun kam endlich die Wahrheit ans Tageslicht – aber zu spät. Lady Mountford war bereits seit zwanzig Jahren tot, und es war kaum anzunehmen, dass ihr Gatte noch am Leben sei. Das Kind musste wohl auch schon tot sein, vermutlich umgebracht von den wilden Kriegerinnen der Kaji. Es konnte unter diesen wilden Menschen kaum die Kindheitsjahre überstanden haben. Für den im Dschungel aufgewachsenen Affenmenschen war der Tod ein ganz gewöhnliches Vorkommnis, das ihm viel weniger bemerkenswert als manches andere Naturereignis erschien. Denn früher oder später starben alle Lebewesen. So gab ihm die Wahrscheinlichkeit, dass auch Vater und Tochter längst hinüber seien, wenig Anlass zu traurigen Gedanken. Es bedeutete ihm einfach nichts. Er beschloss, den Brief bei der ersten sich bietenden Gelegenheit den Behörden zu übergeben. Das war alles, was zu tun übrig blieb. So dachte Tarzan jedenfalls. Er setzte seinen Weg fort und strich das Erlebnis aus seinen Gedanken. Ihn interessierte viel mehr das Verhalten von Ska, dem Aasgeier, denn es zeigte ihm an, dass der Riesenvogel über dem Lager irgendeiner Kreatur schwebte, die noch nicht ganz tot war, andererseits aber so groß sein musste, dass Ska mit seinem Angriff noch zögerte.
Tarzan näherte sich der Stelle, über welcher der Aasvogel auf ruhigen Schwingen kreiste. Zugleich sah er, wie Numa, der Löwe, von der Felsenkante heruntersprang, auf der er bis jetzt gestanden hatte. Auch er näherte sich dem unbekannten Etwas, das die Neugier des Menschen erweckt hatte. Obwohl er Tarzan längst gesehen haben musste, nahm der Löwe von ihm keine Notiz. Aber auch Tarzan ließ sich durch den näherkommenden Löwen nicht von seinem Wege abbringen. Wenn keiner von beiden seine Richtung und Geschwindigkeit veränderte, mussten sich beide direkt an jenem Fleck treffen, über dem Ska noch immer kreiste.
Beim Näherkommen erkannte der Affenmensch den Körper eines Menschen, der In einer kleinen, von der Natur gebildeten Mulde lag. Es war der Körper eines weißen Mannes.
Etwas zur Rechten, keine hundert Schritt entfernt, erschien Numa, der Löwe. Der Mann bewegte sich ein wenig. Er war nicht tot. Er hob den Kopf und erblickte den Löwen. Daraufhin bemühte er sich, auf die Beine zu kommen. Aber er war zu sehr geschwächt und vermochte nur, sich auf ein Knie zu erheben. Hinter ihm stand Tarzan, den er noch nicht gesehen hatte.
Während der Mann sich so bewegte, stieß der Löwe ein grollendes Knurren aus. Es war nur eine Warnung, die keine unmittelbare Drohung darstellte. Tarzan erkannte das sofort. Ihm war klar, dass Numa, von Neugier angelockt, nicht vom Hunger hergetrieben worden war. Das Tier hatte einen vollen Magen. Der Mann aber wusste das nicht. Er sah sein Ende nahen, denn er war hilflos und ohne Waffen. Und die Riesenkatze, der König aller Tiere, war fast über ihm.
Dann hörte er ein zweites, tiefes Knurren hinter sich. Schnell in diese Richtung blickend, gewahrte er, dass ein fast nackter Mensch sich ihm näherte. Im ersten Augenblick begriff er nicht, woher der zweite Laut kam. Denn er sah kein anderes Tier. Dann vernahm er das Knurren abermals und erkannte, dass der Laut aus der Kehle des bronzehäutigen Riesen kam.
Auch Numa hörte das Knurren und verhielt den Schritt. Er schüttelte den Kopf und fauchte. Tarzan ging weiter auf den Mann zu. Es gab keinen Fluchtweg, sollte der Löwe angreifen. Kein Baum war in der Nähe, dessen Zweige Zuflucht geboten hätten. Tarzan hatte nur seine Waffen, seine Riesenkräfte und seine Klugheit. Noch stärker aber war seine Überzeugung, dass Numa keine Angriffsabsichten habe.
Der König des Dschungels kannte alle Kniffe des Bluffs und ihren Wert. Plötzlich hob er den Kopf und ließ den schreckerregenden Warnschrei des Affenbullen ertönen. Der fremde Weiße erschauerte, als er den tierischen Schrei von den Lippen eines menschlichen Wesens vernahm. Numa, der Löwe, knurrte noch einmal zum Abschied und stelzte davon.
Tarzan trat heran und beugte sich über den Mann. »Sind Sie verletzt?«, fragte er. »Oder nur geschwächt vor Hunger und Durst?«
Tierische Laute von den Lippen dieses fremden weißen Riesen zu vernehmen hatte den Kranken kaum mehr in Erstaunen versetzt als diese Anrede in fließendem Englisch. Er wusste nicht, ob er sich zu fürchten habe oder nicht. Mit einem schnellen Blick zum Löwen hinüber überzeugte er sich davon, dass die Bestie tatsächlich dorthin zurücklief, woher sie gekommen war. Ein seltsames Gefühl beschlich ihn beim Anblick dieses Menschen, der den König der Tiere von einer sicheren Beute fortzuschicken vermochte.
»Nun, wie ist es«, fuhr der Affenmensch fort, »verstehen Sie Englisch?«
»Ja – ich bin Amerikaner«, erwiderte der andere. »Ich bin nicht verletzt. Aber ich habe seit Tagen nichts gegessen und heute den ganzen Tag kein Wasser gefunden.«
Tarzan bückte sich und legte den Mann über seine Schulter. »Wir werden bald Wasser finden, und auch für Nahrung wird gesorgt sein«, sagte er. »Dann können Sie mir berichten, was Sie allein in diesem Lande wollen.«
Eine seltsame Geschichte
Während Tarzan den Mann in Sicherheit brachte, verriet ihm die schlaffe Bürde auf seiner Schulter, dass der vom Hunger Geschwächte die Besinnung verloren hatte. Hin und wieder murmelte der Fremde unzusammenhängende Worte. Auf dem größten Teil des Weges aber war er still wie ein Toter.
Schließlich fanden sie Wasser. Tarzan legte den Mann in den Schatten eines kleinen Baumes. Indem er Kopf und Schultern des Fremden anhob, zwang er ihm einige Tropfen Flüssigkeit zwischen die Zähne. Allmählich vermochte die ausgedörrte Kehle mehr zu schlucken. Die Lebensgeister kehrten zurück, aber noch nicht das volle Bewusstsein. Der Ohnmächtige begann wieder zu murmeln – abgerissene, oft unterbrochene Bruchstücke von Sätzen, einzelne Worte, so wie jemand im Delirium spricht oder wenn er aus einer Bewusstlosigkeit langsam zu sich kommt.
»Teufelin«, murmelte er. »Wunderschön... Göttin! Wie wunderbar.« Dann war er wieder eine Weile still, während ihm Tarzan das kühle Wasser über Gesicht und Handgelenke rinnen ließ.
Endlich öffnete er die Augen, schaute den Affenmenschen an, und seine Augenbrauen zogen sich fragend und verwundert in die Höhe. »Der Diamant!«, gurgelte er hervor. »Haben Sie den Diamanten? Riesig... sie muss vom Satan besessen gewesen sein... wunderschön... riesengroß, wie... was? Es kann nicht sein... aber ich hab’s gesehen – mit meinen eigenen Augen – Augen! Augen! Was für Augen! Aber wie ein böser Geist... zehn Millionen Dollar... alles zusammen... groß, so groß wie der Kopf einer Frau.«
»Still sein und ausruhen«, befahl der Affenmensch. »Ich gehe, um etwas zum Essen zu besorgen.«
Zurückkehrend fand er den Mann in friedlichem Schlaf vor. Die Nacht war nicht mehr fern. Tarzan machte ein Feuer an und ging daran, die Wachtel und den Hasen zuzubereiten, die er mit seinen Pfeilen erlegt hatte. Der Vogel wurde mit feuchtem Lehm umhüllt und in die glühende Asche gelegt, während er den Hasen abzog, ausnahm und die einzelnen Stücke an spitzen Stöcken über dem Feuer briet.
Gerade als er damit fertig war, bemerkte er, dass der Schläfer erwachte. Der Mann starrte ihn aus weit offenen Augen an. Sein Blick wirkte jetzt ganz normal. Sein Augenausdruck verriet höchste Verwirrung.
»Wer sind Sie?«, fragte er. »Was ist geschehen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern.«
»Ich habe Sie draußen in der Ebene gefunden – völlig erschöpft«, erklärte Tarzan.
»Oh!«, rief der Fremde aus, »Sie sind der – der Mann, vor dem der Löwe davonlief. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und Sie haben mich hierher gebracht. Da ist etwas zu essen! Und auch Wasser!«
»Ja – Sie haben bereits etwas davon bekommen. Von mir aus können Sie jetzt mehr trinken. Hinter Ihnen ist die Quelle. Sind Sie stark genug, bis dorthin zu gehen?«
Der Mann drehte sich um und erblickte das Wasser. Er kroch hin. Seine Kräfte schienen nur langsam zurückzukehren.
»Trinken Sie nicht zu viel auf einmal«, warnte ihn der Affenmensch.
Nachdem der Fremde den ersten Durst gelöscht hatte, wandte er sich wieder an Tarzan. »Wer sind Sie?«, wollte er wissen. »Warum haben Sie mich gerettet?«
»Sie haben Fragen zu beantworten – nicht ich«, gab der Herr des Dschungels zurück. »Wer sind Sie? Und was tun Sie allein in diesem Land? Wie kommen Sie überhaupt hierher?«
Seine Stimme war tief und leise. Die Fragen klangen wie Befehl. Der Fremde fühlte das. Es war die wohlklingende, sichere Stimme eines Mannes, dem man Gehorsam schuldig war. Er wunderte sich, wer dieser fast nackte weiße Riese wohl sein mochte. Wie ein richtiger Tarzan, dachte er. Wenn er sich diesen Menschen ansah, konnte er beinahe glauben, dass es eine solche Kreatur wirklich und nicht nur im Roman gab. So müsste jener Tarzan aus den Erzählungen aussehen, dachte der Fremde.
»Vielleicht ist es besser, wenn Sie zunächst etwas essen«, sagte der Affenmensch. »Danach können Sie meine Fragen beantworten.« Er zog einen Klumpen hartgebackenen Lehm aus dem Feuer, den er mit einem Stock abkratzte. Mit dem Messerknauf zertrümmerte er die Kugel. Der gebackene Lehm zerbrach, bröckelte vom Körper der Wachtel los und nahm zugleich die Federn mit. Er steckte den Vogel auf einen Stab und reichte ihn dem Fremden hin. »Vorsicht, er ist sehr heiß«, sagte er dazu.
Das war zweifellos richtig – aber der halb verhungerte Mann riskierte eine verbrannte Zunge, um nur recht schnell einen ersten Bissen zwischen die Zähne zu bekommen. Obwohl das Mahl ungewürzt war, hatte ihm niemals zuvor etwas besser geschmeckt. Nur die Hitze hielt ihn davon ab, den Vogel in großen Brocken hinunter zu schlingen. Er aß die ganze Wachtel und den halben Hasen, ehe er sich, wenigstens halbwegs gesättigt, zurücklehnte.
»Um nun Ihre Fragen zu beantworten«, begann er, »mein Name ist Wood. Ich bin Schriftsteller – Reiseberichte. Damit schlage ich Kapital aus meiner naturgegebenen Nutzlosigkeit, die so oft ihren Ausdruck und zugleich eine Entschuldigung in einem Wandertrieb findet. Ich finde damit mehr als ein gutes Auskommen. Daher bin ich jetzt in der Lage Forschungsreisen zu finanzieren, für die man etwas mehr braucht als eine Schiffskarte und ein Paar kräftiger Stiefel.«
Der Fremde legte eine Pause ein, ehe er fortfuhr. »Wegen dieses verhältnismäßigen Reichtums haben Sie mich nun allein gefunden und dem Tode nahe in einer einsamen Wildnis. Aber obwohl sie mich einsam und verlassen vorfanden, nicht einmal mit einem Kanten Brot in meinem Besitz, trage ich doch hier in meinem Schädel ein Vermögen mit mir herum. Nämlich den Stoff für ein Reisebuch, wie es von keinem lebenden Schriftsteller je geschrieben wurde. Ich habe Dinge gesehen, von denen man sich in der Zivilisation nicht träumen lässt, so unglaublich sind sie. Ich habe auch den größten Diamanten gesehen, den es in der Welt gibt. Ich hatte sogar die Vermessenheit zu glauben, dass ich ihn mitnehmen könnte.«
Ein schwermütiger Ausdruck trat in die Augen des Erzählers. Sein Atem ging keuchend.
»Ich habe außerdem die schönste Frau der Welt gesehen – und zugleich die grausamste. Und ich hatte gleichfalls die Vermessenheit zu glauben, dass ich sie mit mir in die Welt dort draußen nehmen könnte. Denn ich liebte sie. Ich liebe sie noch immer, obwohl ich sie in meinen Träumen verfluche. So nahe liegen Liebe und Hass beieinander, die zwei mächtigsten und verderblichsten Kräfte, welche die Menschen, Völker, das ganze Leben beherrschen. So sehr sind sie fast eins, dass die sich nur durch einen Blick, eine Geste, eine Silbe voneinander unterscheiden.«
Abermals unterbrach sich der Fremde und starrte eine Weile sinnend ins Feuer.
»Nun will ich aber versuchen, mehr im Zusammenhang und der Reihe nach zu berichten.
Um damit zu beginnen: Haben Sie jemals etwas über das unerklärliche Verschwinden von Lord und Lady Mountford gehört?«
Tarzan nickte. »Wer sollte davon nicht gehört haben?«
»Sie kennen demnach auch die immer noch kursierenden Gerüchte, dass sich das Ehepaar noch am Leben befinden soll, obwohl seit jener Zeit, da sie aus dem Blickfeld der zivilisierten Menschheit verschwanden, mehr als zwanzig Jahre vergingen? Nun denn, dieses seltsame Ereignis hielt mich so gepackt mit seiner Romantik und seinem Geheimnis, dass ich mehrere Jahre mit der Idee spielte, eine Expedition auszurüsten und jenem Gerücht über die Mountfords nachzuspüren, bis es sich als falsch oder richtig erwies. Ich wollte Lord und Lady Mountford finden oder mir Gewissheit über ihr Schicksal verschaffen.
Ich hatte einen sehr guten Freund, einen jungen Mann, der durch eine Erbschaft über beträchtliche Mittel verfügte. Robert van Eyck hatte schon einige meiner früheren abenteuerlichen Reisen finanziell unterstützt. Er stammt von der alten New Yorker Familie der van Eycks ab. Aber davon wissen Sie natürlich nichts, wie? Tarzan äußerte sich nicht dazu. Er lauschte nur. Kein Schatten von Interesse oder Erregung zeichnete sich in seinem Gesicht ab. Er gehörte nicht zu den Menschen, denen man sich leicht anvertrauen kann. Aber Stanley Wood war so angefüllt mit lange gestauter Mitteilsamkeit, dass er vor den tauben Ohren eines steinernen Buddhas geredet haben würde, wenn sich ihm kein anderes Zuhörerohr geboten hätte.
Nun, ich sprach so viel mit Bob van Eyck über meine Pläne, dass er schließlich selbst von meiner Idee angesteckt wurde und darauf bestand, mit mir zu reisen und die Ausgaben mit mir zu teilen. Das bedeutete natürlich, dass wir uns wesentlich besser auszurüsten vermochten, als ich ursprünglich vorgesehen hatte. Desto größer erschien indessen die Möglichkeit, dass unserem Unternehmen Erfolg beschieden sein könnte.
Wir brachten ein ganzes Jahr damit zu, in England und Afrika eingehende Nachforschungen anzustellen. Wir kamen ziemlich sicher zu der Überzeugung, dass Lord und Lady Mountford irgendwo am Neubari verschwunden sein mussten, etwas nördlich vom Rudolph-See. Alles schien darauf hinzudeuten, obwohl sich alle Annahmen nur auf Gerüchte stützen konnten.
Wir stellten eine große Expedition zusammen und verpflichteten ein paar weiße Jäger, die sich in Innerafrika gut auskannten. Gleichwohl war keiner von ihnen bislang in diesem Teil des Landes gewesen.
Alles ging gut, bis wir eine kurze Strecke den Neubari hinauf kamen. Das Land war ganz dünn besiedelt. Je weiter wir vordrangen, desto weniger Eingeborene trafen wir. Die Stämme dort waren wild und furchtsam. Von ihnen war einfach nichts darüber zu erfahren, was uns weiter voraus erwartete. Aber sie sprachen darüber zu unseren Boys. Damit verbreiteten sie eine entsetzliche Furcht unter unseren Leuten.
Bald darauf desertierten die ersten Träger. Vergeblich versuchten wir von den letzten Getreuen zu erfahren, was eigentlich los war. Sie sagten einfach nichts. Sie erstarrten nur, wurden unzugänglich, gaben anfangs nicht einmal zu, dass sie sich vor etwas Unbekanntem fürchteten. Aber immer mehr Schwarze verließen uns. Die Situation wurde mächtig ernst. Wir befanden uns in einem völlig unbekannten Land – in einer wahrscheinlich feindlichen Umgebung – mit einer Menge Ausrüstung und Vorräten, für die wir bald nicht mehr genug Träger bei uns hatten.
Endlich gelang es mir, einem der Vormänner zu entlocken, was die seltsame Furcht unter den Schwarzen hervorrief. Die Eingeborenen hatten ihnen erzählt, dass es ein Stück weiter hinauf am Neubari einen Stamm geben sollte, der jeden Schwarzen tötete oder in die Sklaverei führte, der das Gebiet zu betreten wagte. Jener Stamm sollte über eine mysteriöse Art von schwarzer Magie verfügen, die ein Entkommen unmöglich mache. Man wurde von geheimnisvollen Kräften festgehalten oder – falls der Ansatz zu einer Flucht glückte – unterwegs getötet, manchmal noch, wenn man bereits viele Tagesreisen zurückgelegt hatte. Es hieß, dass man diese Leute nicht zu töten vermöge, weil sie nicht menschliche Wesen seien. Angeblich wären es Dämonen, die Weibsgestalt angenommen haben.
Ich sprach mit Spike und Troll, den weißen Jägern, über diese Dinge. Sie glaubten natürlich nicht daran und meinten, das alles wäre nur eine Ausrede der Schwarzen, um uns zur Umkehr zu bewegen. Die Träger wollten nach Meinung der beiden Jäger ganz einfach nicht noch weiter von ihrem Stammesland und damit ihren Familien fortgehen. Einfach Heimweh wäre es und sonst nichts.
Deshalb gingen sie mit den Boys grob und streng um. Sie benahmen sich wie die Sklaventreiber. Spike sagte dazu, er würde ihnen die Hirngespinste schon austreiben. Mit dem Ergebnis, dass die Träger in der nächsten Nacht allesamt verschwanden.
Als wir am Morgen aufwachten, waren wir vier, Bob van Eyck, Spike, Troll und ich ganz allein. Vier weiße Männer und eine Riesenmenge Gepäck, für das man fünfzig Träger brauchte. Auch unsere Leibboys, die Gewehrträger und Askaris waren desertiert.
Spike und Troll verfolgten ihre Spuren in der Hoffnung, wenigstens einige Leute einzufangen. Wir wussten, dass wir ohne Hilfe von Trägern aufgeworfen waren. Aber die Jäger kehrten nach zwei Tagen allein zurück. Die Schwarzen waren verschwunden.
Bob und ich waren schon entschlossen, allein loszuziehen, als die beiden endlich zurückkehrten. Glauben Sie mir, es gab mit den Schwarzen genug Schwierigkeiten, als sie bei uns waren. Aber nun, nachdem sie fortgelaufen waren, wurde unsere Lage doppelt so schlimm.
Ich kann nicht beschreiben, was es war. Etwas Geheimnisvolles war um uns her, obwohl wir niemals jemanden sahen. Vielleicht hatten wir einfach Angst. Doch glaube ich nicht, dass damit alles erklärt wäre. Van Eyck hat sehr gute Nerven, und ich selbst bin oft genug vorher in schlimme Situationen geraten. Ich war allein und verlassen unter den Kopfjägern von Ekuador, war Gefangener der Kannibalen von Neuguinea, stand als zum Tode Verurteilter vor dem Exekutionskommando während einer Revolution in Mittelamerika. Das alles waren Erlebnisse, wie sie einem Reiseberichterstatter beschert werden, wenn er auf der Jagd nach' Sensationen und dabei nicht vernünftig genug ist, sich beizeiten aus dem Staube zu machen, wenn es ernst wird.
Nein, dieses Mal war es etwas anderes. Es war einfach so ein Gefühl – die quälende Gewissheit, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden, Tag und Nacht hindurch. Wir hörten auch Geräusche, die sich nicht beschreiben lassen. Sie waren nicht menschlichen Ursprungs, stammten aber auch nicht von Tieren. Es waren einfach Geräusche, die einem eine Gänsehaut über den Rücken jagten und die Haare zu Berge stehen ließen.
An dem Abend, als Spike und Troll zurückkehrten, hielten wir Kriegsrat. Zuerst lachten uns die Jäger aus. Aber sehr bald begannen auch sie, diese unheimlichen Dinge zu fühlen und zu hören. Danach waren sie mit uns einig darüber, dass uns nur der schnelle Rückzug übrig blieb.
Wir beschlossen, jeder nur den Revolver und ein Gewehr mitzunehmen, dazu Munition und Lebensmittel. Alles Übrige musste zurückgelassen werden. Gleich am nächsten Morgen wollten wir aufbrechen.
Die Sonne war kaum aufgegangen, da aßen wir bereits in Hast unser Frühstück. Danach schulterten wir unsere Packen und marschierten ohne ein Wort der Verständigung den Neubari hinauf. Verstehen Sie? Wir gingen den Fluss hinauf und taten damit gerade das Gegenteil von dem, was wir vorgenommen hatten. Wir schauten einander kaum an. Ich weiß nicht, wie meinen Begleitern zumute war. Ich schämte mich jedenfalls.
Es war einfach so, dass wir darauf losmarschierten – tiefer und tiefer in die Gefahr hinein, der wir doch entrinnen wollten. Und keiner vermochte zu sagen, warum wir es taten. Ich versuchte mit großer Willensanspannung meine Füße in die von mir gewünschte Richtung zu zwingen. Aber es ging nicht. Eine Macht, die viel stärker war als mein Wille, zwang mich vorwärts. Es war schrecklich.
Wir hatten noch keine fünf Kilometer zurückgelegt, als wir auf einen Mann stießen, der quer über den Pfad hingestreckt lag. Es war ein Europäer. Kopfhaar und Bart waren weiß, obwohl er keineswegs sehr alt sein konnte. Ich schätzte ihn auf knapp fünfzig Jahre. Es schien mit ihm zu Ende zu gehen. Dabei wirkte er keineswegs krank. Auch von Hunger geschwächt konnte er nicht sein. Und der Durst konnte ihn ebenfalls nicht niedergezwungen haben, denn er lag keine fünfzig Meter vom Ufer des Neubari entfernt.
Als wir bei ihm stehenblieben, öffnete er die Augen und schaute uns an.
Kehrt um!, flüsterte er. Der Mann machte einen todkranken Eindruck. Das Sprechen bereitete ihm offenbar Müh.
Ich trug eine kleine Flasche Branntwein bei mir, die ich für Notfälle mitgenommen hatte. Davon flößte ich ihm ein wenig ein. Das schien ihn etwas zu beleben. Um Gottes willen – kehrt um, sagt er. Ihr seid zu wenige. Sie werden euch fangen, wie sie mich fingen. Das ist zwanzig Jahre her – und keine Möglichkeit zur Flucht. Kein Entkommen. Nach, all diesen Jahren glaubte ich jetzt endlich, eine Fluchtmöglichkeit gefunden zu haben. Ich hab’s gewagt. Aber ihr seht, was geschah. Sie haben mich gekriegt. Ich muss sterben. Seine Macht! Er schickt sie hinter einem her und man wird gepackt davon. Kehrt zurück und holt eine starke Streitmacht weißer Männer herbei. Neger dringen nicht bis in dieses Land vor. Holt Verstärkung und erobert das Land der Kaji. Wenn es euch gelingt, ihn zu töten, wird das Unternehmen gelingen. Er ist die Macht – er allein.
Wen meinen Sie mit er?, fragte ich.
Mafka, gab er zur Antwort.
Es ist der Name des Häuptlings?, fragte ich weiter.
Nein – ich weiß nicht, wie man ihn bezeichnen soll.
Er ist nicht der Häuptling und dennoch allmächtig. Er ist mehr eine Art Medizinmann oder Hexenmeister. Im dunklen Mittelalter würde man ihn als Magier bezeichnet haben. Ihm gelingen Dinge, von denen ein gewöhnlicher Zauberpriester kaum zu träumen wagt.
Er ist ein Teufel. Manchmal habe ich schon gedacht, er sei überhaupt der Teufel in Person. Und er hat sie in die Schule genommen – bringt ihr seine höllischen Zauberkünste bei.
Wer sind Sie?
Ich bin Mountford, antwortete er.
Lord Mountford?, rief ich erstaunt aus.
Er nickte nur.«
»Hat er Ihnen etwas von dem Diamanten erzählt?«, warf Tarzan ein.
Wood sah überrascht zu dem Affenmenschen auf. »Woher wissen Sie etwas davon?«
»Während Sie im Delirium lagen, haben Sie etwas von einem Diamanten gemurmelt. Aber ich wusste auch schon vorher davon. Ist er wirklich zweimal so groß wie der Cullinan?«
»Ich habe niemals den Cullinan gesehen. Aber der Kaji-Diamant ist auf jeden Fall von enormer Größe. Er muss mindestens zehn Millionen Dollar wert sein – vielleicht noch mehr. Troll hat eine Zeit lang in Kimberley gearbeitet und behauptet, dass der Stein der Kaji zwischen zehn und fünfzehn Millionen wert sein dürfte.«
»Ja – Mountford berichtete davon. Danach wollten Troll und Spike geradenwegs ins Kaji-Land ziehen, in der Hoffnung, dass sie den Riesendiamanten erbeuten könnten. So viel Mountford auch warnte und redete – sie waren nicht abzuhalten. Es hätte übrigens so oder so keinen Zweck gehabt. Wir hätten nicht mehr umkehren können, selbst wenn wir es versucht hätten.«
»Was geschah mit Mountford?«, fragte Tarzan. »Was wurde aus ihm?«
»Er wollte uns noch etwas über ein Mädchen erzählen. Aber sein Flüstern war nicht mehr zu verstehen. Seine letzten Worte lauteten: Rettet Sie – und tötet Mafka! Dann starb er.
Wir haben niemals herausbekommen, wen er meinte – nicht einmal, nachdem wir ins Land der Kaji gekommen waren. Wir haben nirgendwo eine weibliche Gefangene gefunden. Wenn sie überhaupt vorhanden war, wurde sie verborgen gehalten. Hinzu kam, dass wir auch Mafka niemals zu Gesicht bekamen. Er haust in einer richtigen Burg, die schon vor Jahrhunderten erbaut worden sein muss. Vielleicht von portugiesischen Eroberern. Obwohl ich sicher bin, dass diese Burg schon vor dem Zug der Portugiesen nach Abessinien entstanden sein muss. Van Eyck neigte zu der Ansicht, dass das Gebäude während der Kreuzzüge errichtet wurde.
Allerdings fanden wir keine Erklärung dafür, was die Kreuzfahrer in diesem Teil der Wildnis gesucht haben mögen. Jedenfalls ist das Kastell nicht von den Kaji errichtet worden. Sie haben aber viel Arbeit aufgewendet, um die Burg zu erhalten und auszubessern.
Der Diamant wird in dieser Burg aufbewahrt. Der Stein, Mafka und die Königin stehen unter ständiger Bewachung von Kaji-Kriegerinnen, die den einzigen Zugang besetzt halten.