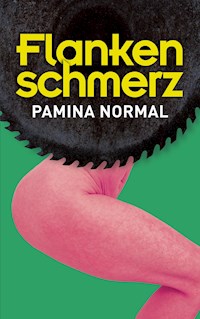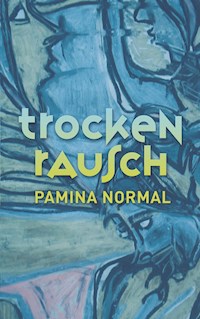Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
arbeitslos - süchtig - allein Dazu hartnäckig wiederkehrende Depressionen und ständig auf der Suche nach jemandem, der sie so aushält, wie sie wirklich ist. Die große Liebe ist dahin. Jetzt muss ein Wunder passieren, das eine Internet-Kontaktbörse vollbringen soll. Was da alles daherkommt, spottet jeder Beschreibung. Resigniert stellt die Erzählerin fest: You can't repeat the past. Reinsteigern und Hoffnungen schüren zählen zu ihren Passionen. Stundenlang hinterm Küchentisch sitzen bei einem überquellenden Aschenbecher und etlichen Dosen Bier. "Nur der, der nicht sucht, der findet auch", lautet das zermürbende Resümee ihres Psychologen nach jahrzehntelanger Therapie. Wieder so eine Arschloch-Meldung aus der langen Liste der Ratgeber? Ob vielleicht doch etwas dran ist? Eine Frau in prekären Verhältnissen trifft Männer aus dem Internet und taumelt von einer Enttäuschung in die nächste. Ein kompromissloses, rabenschwarzes Loserbuch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Präliminarien
Der Inder
Ich
Different36
Wizard34
Günther Uecker
Scheiß-Motto
Der Luxuspenner
Hirnwichsen vor dem Date
Immer wieder Sonntag
Retter Alkohol
Bildung und Fortbildung
Musik
Literatur
Kommunikation
Rendezvous
Teil II
Initiator und Usurpator
Profilprobleme
Psycho-Treffen
Gilberts Foto
Ein ganz normales Date
Die Causa Ewald Cotter
Alkoholprobleme
Tablettenprobleme
Downburst
Teil III
Der Englischlehrer
Ostereier suchen
Mirella
Rockland
Bekanntschaft mit einem Alien
Yusuf und der Tiroler
Lucky
Tino
Die Enthundung
Jiri
Der Nachbar
Nachwort und Ausblick
Für J. K.
Es war Zeit, und was für eine Zeit es war
Es war die Zeit der Unschuld
Die Zeit des Urvertrauens
Es muss lange her sein
Ich habe eine Fotografie
Erhalte deine Erinnerungen
Sie sind alles, was dir bleibt
(Simon & Garfunkel: „Bookends Theme“, auf „Bookends“, Columbia Records 1968)
Teil I
Den größten Teil von dem, was meine Mitbürger gut nennen, halte ich innerlich für schlecht und wenn ich irgendetwas bereue, so ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen.
(Henry David Thoreau: „Walden“ 1854)
Präliminarien
Was ist das Ergebnis jeder langen Suche? Man findet Dinge, nach denen man niemals gesucht hat und die man dann mühevoll loswerden muss. Es ist wie mit der Popper-Matrix: In dem Moment, in dem sich der Mensch einlässt, eine Lösung für ein Problem zu finden, entstehen sofort hunderte andere. Tatsächlich kann die Zahl der Probleme nahezu exponentiell ansteigen. So haben sich im Laufe der Geschichte der Wissenschaft viel mehr Probleme angehäuft, als gelöst worden sind. Und ich wurde bei meiner Suche immer verrückter und verrückter.
Kontaktbörsen ernst zu nehmen, bedeutet in aller Regel nicht den Auftakt zu einer erfolgreichen Partnerbeziehung, sondern den Beginn einer persönlichen Tragödie. Das Erschreckende daran ist, dass es schnell zur Routine wird und deswegen prognostizierbar. Es gibt Leute, die man gar nie zu Gesicht bekommt in der Realität, weil das ihren Vorstellungen einer Kontaktanbahnung merkwürdigerweise widerspricht. Manche, die man irgendwann zu Gesicht bekommt und es dann bitter bereut, nicht doch die Variante der Brieffreundschaft gewählt zu haben. Schlussendlich diejenigen, die im entscheidenden Moment nicht auftauchen. Letzteres ist mir heute passiert und ich wette, dass dies nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Der letzte Fall ist also noch nicht zur Routine geworden, vorhersehbar war er allemal.
Wer glaubt, seinen Traumpartner im Internet zu finden, ist dumm wie ein Sack Weißmehl. Die Männer und Frauen in den vielen Partnerbörsen sind ja nicht umsonst im Netz auf der Suche, falls sie überhaupt auf der Suche sind und sich nicht einfach nur ganz entsetzlich langweilen. Die besten Zeiten unwiederbringlich hinter sich gelassen, stranden sie im Netz, wo sie oft jahrelang vor sich hin rotten, im Kreis rotieren, ständig wartend auf etwas Besseres, auf etwas Passenderes. Mir blieb ja nichts anderes übrig, wollte ich nicht als alte verhärmte Mumie unter all dem immer jünger werdenden Frischfleisch versauern. Außerdem war ich den Großteil des Jahres nicht gesellschaftstauglich. Zu meinen narkoleptischen Stimmungstiefs gesellten sich spätestens im Oktober übelste Depressionen, die nur im Vollrausch zu ertragen waren. Aber ich wollte wirklich einen Partner. Meine einzige echte Liebesbeziehung hatte ich genauso spontan und unmotiviert beendet wie ich später meine einzige sinnvolle Arbeit kündigte. Was folgte war ein nie mehr enden wollender Irrsinn aus manischen Krisen, depressiven Dämmerphasen und einem Spießrutenlauf aus wahllosen Affären, frustrierenden Jobs, vergeblichen Bewerbungstrainings und Schulungsmaßnahmen, begleitet von Therapeutensitzungen und Aufenthalten im Irrenhaus.
Leider1 werden meine Aufzeichnungen nicht chronologisch sein. Ich neige nämlich zu ausgeprägtem Alkoholkonsum. Es existieren daher Tage, über deren Verlauf ich nicht Bescheid weiß. Die Antidepressiva regen eine intensive Traumtätigkeit an. Ein Großteil meines Lebens verlief derart ereignislos, dass ich zu Mittag nach dem Aufstehen der festen Überzeugung war, das Geträumte tatsächlich erlebt zu haben. Meine Nerven sind so strapaziert, dass mich ein abgerissener Schnürsenkel an den Rand des Wahnsinns treibt. Mit der paranoiden Gereiztheit einer Süchtigen verfiel ich der Vorstellung, dass ich das Opfer einer riesengroßen Weltverschwörung wäre, die nichts anderes im Sinn hatte, als mich qualvoll zu zermürben. Ich musste mich mit allen Mitteln dagegen wehren.
Im Alter von sechzehn hörte ich damit auf, mich von den Kadavern meiner Mitgeschöpfe zu ernähren. Ich schaffe es nicht mehr, in den Leichen von Tieren zu fleddern, die ich im Gegensatz zu den Menschen für die intelligenteren Kreaturen auf dieser Welt hielt. In den frühen Neunzigern kamen Vegetarier den Ketzern des dreizehnten Jahrhunderts gleich; der Verzicht auf Fleisch wurde als Pervertierung der gottgegebenen Natur gedeutet, was mich nur noch deutlicher aufs soziale Abstellgleis manövrierte. Zu faul, um vielseitig zu kochen, befiel mich ein lächerlicher Proteinmangel, der es mir verbat, meinen Verpflichtungen als Plasmaspenderin nachzukommen. Nach Jahren exzessiven Zapfens hatte ich mir ein Vermögen von einigen Tausend Euro angespart und meine Venen waren endlich so auftrainiert, dass ich nur mehr fünfunddreißig Minuten pro Sitzung benötigte. Eine Spitzenarbeit. Und dann spuckte mich die Pharmaindustrie aus, ließ mich mit meinen ausgemergelten Einstichstellen einfach fallen. Für Monate hatte ich keinen Termin in der Außenwelt mehr.
Die Partnerbörsen präsentieren sich so ausdifferenziert, dass man unweigerlich der Wahnvorstellung verfällt, in den nächsten Sekunden Superman und die Krone der Schöpfung geliefert zu bekommen, hat man erst einmal die richtige gefunden. Auf allen Seiten sind die, die nur gratis ficken wollen, naturgemäß in der Überzahl. Die wirkliche Katastrophe sind aber jene, die sich nur virtuell austauschen möchten, die auf den Vorschlag für ein Treffen mit dem Ausruf: „Was, aber ich kenne dich doch gar nicht!“ antworten. Ihre nichtsnutzige Dahinschreiberei, falls man ihre verhunzte Aneckerei überhaupt als schreiben bezeichnen konnte, fiel mir unsäglich auf die Nerven. Nur wenige Kontaktseiten steuern den ausufernden Zusatzfeatures wie Chats, Forum, Kuschel- und Gruschelfunktion entgegen, um ein reales Kennenlernen zu beschleunigen; am liebsten hätten die stressgeplagten Singles aber, dass ihre Avatare das für sie erledigen. Kennt man eine von diesen Vertrottelungsmaschinerien, kennt man alle. Der Markt ist mit zirka fünfhundert Kontaktbörsen mehr als gesättigt.
In der Ernüchterungsphase meines letzten manischen Stimmungshochs registrierte ich mich in einer Online-Partnervermittlung für Vegetarier. Man möchte also meinen, einer Kontaktbörse, bei der sich Leute mit vegetarischem oder veganem Lebensstil näherkommen möchten und damit basta. Ohnehin ein schwieriges Unterfangen, wenn man sich das statistische Vorkommen von Fleisch-verweigerern in der Bevölkerung ansieht. In der eigentlich verzichtbaren Rubrik „Ernährungsgewohnheiten“ reihten sich sonderbare Auswüchse dieser Lebensform, darunter fast vegetarisch (!) gleich zu Beginn, Rohköstler – vegetarisch, vegan und instincto (?) oder Frutarier und Freeganer. Selbstverständlich hatte ich nicht die geringste Ahnung, was Freeganer bedeutete, aber ich wusste mit Sicherheit, dass mir in Graz nichts Derartiges über den Weg laufen würde. Nichtsdestotrotz musste ich mir eingestehen, dass sich mein latent-postalternativer Habitus davon berührt zeigte und so erledigte ich meine Registrierung. Hier ein Klick, da eine Zustimmung: I agree, I agree, yes, I agreed. Als Nächstes wurden die politische Ansichten, von extrem-konservativ bis hin zu ultralinks, abgefragt. Auch hier gab es welche, die vor Mehrfachnennungen nicht zurückschreckten und sich schlussendlich als Anarchisten deklarierten. Den Menschen war nichts zu blöd.
In meiner Stadt fand ich bei der Probesuche Mutzi, eine Fast-Vegetarierin und DummerBub, einen 53-jährigen polyamourösen, temporär veganen Libertarian. Das alles las sich nicht sehr erfolgversprechend, immerhin war die Registrierung kostenlos. Ich vollendete mein Profil, füllte mehr oder weniger lustlos die obligaten Fragen zu Wünschen, Vorlieben, Abneigungen und Hobbys aus und ging zur Belohnung in das Feinkostgeschäft, um reichlich Bier zu holen.
1 Ich möchte nie wieder „leider“ sagen.
Der Inder
Trotz der tristen Ausgangslage behielt ich Interesse am weiteren Verlauf der Geschichte. Ich spekulierte mit der Möglichkeit, dass sich auch nicht registrierte Benutzer über die Suchfunktion auf meine Fährte locken lassen würden. Vierzehn Tage hindurch öffnete ich voller Erwartung täglich, dann begrenzt auf das Wochenende, meinen eigens für die Kontaktaufnahme geschaffenen Webmail-Account. Was kam, war der übliche Freischaltcode, eine Begrüßungsnachricht der Singleseite, die eine oder andere Werbemail, sonst gähnende Leere. Aber was hatte ich mir erwartet? Mit Mitte dreißig einen Mann zu finden war kein Honigschlecken. “Lesson number one that you learn while you’re young: Life just goes on and on getting harder and harder.”2 Völlig richtig. Aber was hatte Mick Jagger zu lamentieren? Er musste in meinem Alter gewesen sein, als er diesen Song schrieb, stinkreich, all seine Träume verwirklicht, jede Menge Bräute, Drogen und Spaß. Ich hatte rein gar nichts, außer die Resopalplatte meines Küchentisches, in die ich stundenlang hineinsinnierte, meinen Tagträumen ausgeliefert, in denen ich selbst auf der Bühne stand, umjubelt von den Massen. Mick hatte Recht. „Lose your dreams and you will lose your mind!“3
Auf allen anderen Seiten wurde Frischfleisch sofort bemerkt. Selbst nach Jahrzehnten der erfolglosen Internetpräsenz konnte man sein Profil nach vorne reihen. Irgendein Idiot schrieb dir in jedem Fall, auch wenn er nur eine bissige Bemerkung loswerden wollte. Ich versuchte es mit Trick siebzehn, fuhr den Computer hoch und lud Browser und die Singleseite. Dann erledigte ich den Berg Bügelwäsche, um den Online-Status möglichst lange beizubehalten. Nichts. Keine Nachrichten. Nicht das Mindeste. Scheiße und erst drei. Beginn der Sauregurkenzeit. Ich hatte bereits fünf Kaffee intus und mir geschworen, kein Bier vor vier zu trinken. Also zog ich mir Musik vom Netz, um den Ort des Geschehens nicht verlassen zu müssen und so war für alle erkennbar, dass ich online und verfügbar war. Während ich mir die „Emotional Rescue“ von den Stones runterlud und gerade nach „Tanz der Lemminge“ von Amon Düül suchte, kam die ersehnte Nachricht. Was war denn jetzt los? Seit wann standen wasserstoffblonde Mädchen auf mich? Geschminkt wie Tante Erna. Cristella hatte keine Kosten und Mühen gescheut, Buntheit in ihre trostlose Erscheinung zu bringen. Von ihrem farbenfrohen Outfit bekam man Augenkrebs. Ihr Torso klemmte in einem sogenannten Rollschinken-Oberteil. Pink. Pink mit Grellgrün und Strass.
„Ich würde so froh einen lieben Mann haben, mit dem ich den Rest meines Lebens aufwenden kann. Meine Eltern starben, aber ich bin noch Junge und kann den ganzen Tag arbeiten und mich für den Haushalt interessieren. Ich bin neunzehn und mein befreunden Sie erklärte mir, dass ich hübsch bin und eine wütende Abbildung habe …“, schrieb mir Cristella, die nie und nimmer neunzehn Jahre alt war. Wenn ich etwas auf den Tod nicht ausstehen konnte, war das Kinderprostitution. Und noch immer sieben Minuten mit dem Nullerpegel.
Ich lauerte vor dem Kühlschrank. Countdown: drei Minuten. Beckenbodengymnastik! Zeit für Beckenbodentraining! Nur einfach so warten war nicht mehr. Beckenbodenmuskeln anspannen, nach oben und innen, zehn Wiederholungen, Anspannungsdauer sechs bis acht Sekunden. Bei jedem Anspannen ausatmen. Ich öffnete die Kühlschranktür. Die Batterie Dosenbier teilte sich den Kühlschrank mit einer Tube Ketchup, einem Glas Artischocken und einem angebissenen Baguette. Hilfe, einen Bäcker! Jemand muss einen Bäcker rufen! Ich nahm das Brot und schmiss es in den Abfalleimer. Mit Wiederbelebung war da nichts mehr zu machen. Dann nahm ich eine Dose, rauchte mir eine an und setzte mich hinter den Bildschirm.
Laut Monitor war es Punkt 16:00 Uhr. „Liebe Zosi, ich möchte dich gerne kennenlernen“, las ich im Betreff und überflog die Zeilen. Ein Inder suchte eine heiratswillige Kandidatin. Super, ein Inder! Seine Darbietungen stilistisch und grammatikalisch tadellos. War mir aber völlig gleichgültig. Einzig und allein das Foto zählte. Barumani grinste schief. Die Schwarzweißaufnahme wirkte antiquarisch. Vielleicht diente sie schon mehreren Generationen als Vorzeigeabbildung. Durchschnittlicher konnte ein Durchschnittstyp nicht sein: Kurzes Haar, Allerweltsgesicht, mittlere Statur, mittleres Alter. Barumani personifizierte die bislang konsequenteste Umsetzung von Mittelmäßigkeit. Ein Dreiviertelporträt in sitzender Position, weißes Hemd, schwarze Bundfaltenhose, ein Paradebeispiel an Charakterlosigkeit. Die Aufnahme schien aus Zeiten zu datieren, als man noch nicht auf Schritt und Tritt mit der idiotischen Knipserei mittels digitaler Fotografie belästigt wurde und als das Posieren vor der Kamera ein sensationelles Ereignis darstellte. Es sah aus, als hätte sich Barumanis Urgroßvater im neunzehnten Jahrhundert auf einen langen Weg durch die Wüste gemacht, um in einem abgeschiedenen Dorf in der Nähe von Jaipur bei einem Wanderfotografen ein Lichtbild anfertigen zu lassen. Sein Sonntagsgrinsen – eine Zumutung. Es entstellte ihn regelrecht. Fazialislähmung. Gesichtslähmung wie bei Mona Lisa. Dieser stupide, zahnlose, noch dazu schiefe Grinser. Kein Wunder, dass ich Tabletten nehmen musste.
Ich holte mir ein weiteres Bier. Der Text, zwar ein langatmiger, konventioneller Ausfluss an Nichtigkeiten, aber gut strukturiert, ließ auf äußerste Professionalität schließen; die Kenntnis der AIDA-Formel4 ein Bestandteil der Konstruktion. Sein Dauergegrinse musste seine Familie wahnsinnig machen. Womöglich hatte das seine Mutter für ihn arrangiert. Barumani war ja seit Jahrzehnten nicht rauszubringen aus seinem Kinderzimmer. Barumani, der indische Bamboccione. Dann dieses gottlose Lächeln: gleich am Morgen nach dem Aufstehen; bei jedem Unglück in der Nachbarschaft, auf Begräbnissen musste man ihn verstecken. Ich überlegte mir, ob er aufgrund des Frauenmangels in Indien eine Ausländerin suchte, die er importieren wollte? „Ich trinke und rauche nicht“, zitierte ich fassungslos, „und arbeite im gehobenen Management eines internationalen Konzerns.“ Ja wo denn? In Graz bestimmt nicht. Dass ich nicht zu seiner Kaste gehörte, sah ein Blinder mit Krückstock. Wieso hatte Barumani keine langen Haare? Inder hatten die schönsten Haare überhaupt. Ganz im Gegensatz zu den scheußlichen europäischen Eierschädeln.
Singh, der Löwe, hatte tiefschwarzes Haar. Vor einem Jahr gehörten wir zu den Übriggebliebenen in der Disco Q und fuhren nach der Sperrstunde zu ihm. Im Sikhismus heißen alle Singh und für mich klang es wunderbar exotisch. Die Sikhs lassen Ihre Haare von Geburt an wachsen, ohne sie zu schneiden, denn die Haare sind etwas von Gott Gegebenes. Wer sich die Haare schneidet, gilt als Abtrünniger. Endlich eine vernünftige Religion. Singh trug einen eisernen Armreif, das Haar im Nacken gebändigt, nur Turban und Dolch fehlten. Yoni und Lingam waren keine Fremdworte für ihn, das Kamasutra kein spirituelles Sanskrit-Gewäsch. Im Bett zeigte er mir Stellungen, die ich danach vergeblich zu rekonstruieren versuchte und er verfügte über ein sagenhaftes Durchhaltevermögen. Ich schrie mir die Seele aus dem Leib.
Singh vermisste seine Heimat. Graz musste die Hölle für ihn sein. In dieser reizlosen Ansammlung aus Kuhdörfern gab es maximal vier Inder. Außerhalb der indischen Restaurants hatte ich bis auf Singh noch keinen gesehen. Singhs Arbeit war beschissen und seine Wohnung zu klein. Er sprach kein Deutsch, wenig Englisch, war kein Vegetarier und ich wollte ihn nach dem dritten Mal nicht mehr sehen. Ich hielt es nicht aus, dass er meine Gary Larson-Cartoons nicht witzig fand, nicht einmal die von Perscheid.
2 The Rolling Stones: „Indian Girl“, auf „Emotional Rescue“, Virgin 1980.
3 The Rolling Stones: „Ruby Tuesday“, auf „Flowers“, London Records 1967.
4 Im Arbeitslosen-Kurs mussten wir diese Formel, eigentlich ein Werbemodell (Akronym für Attention, Interest, Desire und Action), in unsere Bewerbungsunterlagen einbauen. Im Marketing-Modul hingegen habe ich den unvergesslichen Satz „Online-Direktmarketing wird in der Lage sein, eine dauerhafte und wertschöpfende Penetration von Endkunden zu erreichen“ gelernt, an den vielleicht auch der Inder gedacht hat.
Ich
Normalerweise nahm ich alle. Weil ich mich selbst nicht liebte, mussten das andere für mich erledigen. Bei jedem kam ich früher oder später zur Ansicht, dass er mich zu wenig liebte und die Beziehung fand ein jähes Ende.
Als Kind sprach ich wenig. Die meisten Menschen widerten mich an, insbesondere meine Volksschullehrerin, die dauergewellte, kreuzbrave Frau Evelyn, was für ein sagenhaft scheußlicher Name. Am allerschlimmsten ihr Dankeslied für diesen schönen Morgen. „Danke, oh Herr, oh lass mich danken, dass ich danken darf“, frömmelte sie völlig unbeeindruckt von ihrer Bigotterie, genauso wie bei „The Answer is blowin’ in the Wind“ von Bob Dylan. „Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein nur Gott“, sang sie stattdessen, zu vernagelt von ihrem Glaubenseifer, um diese Zeile aus dem Englischen richtig zu übersetzen. Ja, wenn Gott die Antwort wusste, wieso tat er dann nichts gegen all diesen Irrsinn? Dazu ihre Katzenmusik auf der Gitarre, diese viel zu leise Fieselei an den schlecht gespannten Saiten. Ich brachte kein einziges Wort über die Lippen, brodelte nur stumm vor mich her, aus Sorge um mein gutes Benehmen, kopfnickend im Duckmäuschentum festgefangen. Meine Kochlehrerin beschimpfte mich ab meinem sechzehnten Lebensjahr drei Jahre als Mimose. Ich versteckte mich in der Vorratskammer der Betriebsküche vor ihr, wo ich herausfand, dass sich Rum, Likör und Weinbrand nicht nur zum Flambieren eigneten. Seitdem trank ich regelmäßig.
Der fortdauernde Zustand sozialer Phobie bildete den idealen Nährboden für Hass, Neid und Eifersucht, die Dreifaltigkeit jeder depressiven Alkoholikerin, was den immensen Vorteil bedeutete, dass mir nichts größeres Vergnügen bereitete als der Schaden anderer. Zudem war ich eine Versagerin. Darüber waren sich auch meine Eltern einig. Ständig arbeitslos, knapp bei Kasse und dem Alkohol verfallen. Die Attribute meiner Namenspatroninnen waren Turm, Kamm und Schweißtuch. Mich sah man häufiger mit Flasche und Zigarette. Das Leben war für mich eine Abfolge von Depressionsschüben und permanenten Zukunftsängsten, sinnlos obendrein, gemein und verkehrt.
Ein Dutzend Mal pro Tag suchten mich meine Suizidgedanken auf. Ich ärgerte mich über den schlechten Status, den der Selbstmord in unserer Kultur hatte. Der Passionsfanatismus und die Versündigungsangst des Christentums hatten für diese Misere gesorgt. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und holte mir in angemessenem Abstand nach meiner Firmung den Taufschein, um bei Gelegenheit aus der Kirche auszutreten. Der fette Dorfpfarrer schäumte vor Wut. Des Slowenischen nicht mächtig, konnte ich nur erahnen, welchen Bannfluch er verkündete. Ich habe die Urkunde für den Austritt nicht benötigt, wusste aber nun, dass ich zur Brut einer erzkatholischen Familie gehörte.
Nach der Matura ging ich ins Ausland, kehrte nach langen Monaten wieder zurück in mein Dorf und stellte fest, dass alle halbwegs vernünftigen Menschen die Flucht ergriffen hatten. Ich ging erneut weg, schaffte es aber nur über den Packsattel, wo ich mich völlig erschöpft in der nächstbesten Stadt niederließ, um irgendwas zu studieren. Eine grausame Zeit begann: Ängste, Depressionen und das ewige Alleinsein. Den Machenschaften der Psychiatrie ausgeliefert, überlebte ich wie durch ein Wunder Jahr für Jahr.
An der Realisierung meines Suizid-Vorhabens hinderte mich meine Trägheit. Bedingt durch den Umstand, dass man ohnehin von alleine stirbt, erschien mir die Aktion widersinnig. Dann waren da noch meine unerschütterliche Feigheit und der Umstand, dass mich auf alle Fälle irgendjemand mit Befremden in meiner Wohnung finden würde. Kein schöner Anblick, so eine Selbstmordsauerei. Dann doch lieber der klassische Schienen-Suizid, aber inkognito. Meine Selbstmordphantastereien besänftigten mich und gaben mir Mut. Ich beschriftete den gelben Sack für die Leichtfraktion mit: „Vorsicht Leiche, bitte nicht öffnen und kein Mitleid. Darf nicht in Kinderhände geraten! PS: Entschuldigung.“ Verdammte Drecksmüllgedanken. Eitriger Mumpitz. Der Scheißsack war auch viel zu klein. Ich musste den Sack für die Leichtfraktion in einen Sack für die Leichtfraktion stopfen, um ihn zu entsorgen. Die Absurdität zur Potenz.
Ich hatte von einem Selbstmörder gelesen, der die Geo-Koordinaten für seine Leiche als Geocache im Internet veröffentlicht hatte. Als sich die gierigen Schnitzeljäger mit Hilfe ihres GPS-Gerätes an die verfallene Blockhütte pirschten, worin sie den versteckten Schatz und die Urkunde für Erstlingsfinder vermuteten, baumelte ihnen der Erhängte entgegen. Wahrscheinlich wollte er rasch bemerkt werden, damit er noch halbwegs passabel roch.
Auf keinen Fall beabsichtigte ich, dem Lokomotivführer mit meinen Teilen um die Ohren zu spritzen. Deswegen fand ich die Idee mit dem verschließbaren, wasserfesten Sack äußerst klug. Warum durfte man einfach nicht in Würde sterben? Tiere schläferte man ein, ohne sie zu fragen. Menschen wurden in die Geschlossene geführt und mit überteuerten Medikamenten am Leben erhalten. Eine Menschenquälerei, wo man nur hinsah. Depressionen gingen gar nicht. Das Leben hatte gefälligst lebenswert zu sein. Warum, wusste zwar niemand, aber über Selbstmordgedanken, das Allernatürlichste, das sich in einem Hirn abspielen konnte, zu sprechen, war ein Affront für die Menschenwelt. Dabei würden ohnehin alle sterben. Die meisten früher als ihnen lieb war. Deswegen hielt ich meine Klappe. Ich tat so, als wenn es das Normalste auf diesem Erdenrund wäre, unter Einsamkeit und Irrsinn zu Grunde zu gehen. Am meisten hasste ich diese Spinner, die meinten, dass es für jeden von uns eine erfüllende Arbeit geben könnte. Ja, wenn wir uns nur bemühten. Für jeden von uns Wohlstand, wenn wir nur wollten. Für jeden von uns Glück und Liebe, wenn wir nur Geduld hatten. Meine achte Todsünde war die Aggression. Ob es helfen würde, einem Menschen das Gesicht zu brechen, weil er es nicht anders verdient hatte? Langfristig helfen?
„Was, Depressionen? Was ist denn das für ein Scheiß? Du bist noch so jung. Du bist gesund. Warum denn das? Warum hast du Depressionen?“ Bei völlig grundloser Traurigkeit eine Zumutung. Wenn einem da nicht die Faust ausfährt, dann nie mehr. Mit dem Schädel voraus in den Dummschwätzer. Von einem Irrenhaus-Kollegen erfuhr ich, dass man beim Aufprall den eigenen Kopf in Bewegung halten müsste, um für sich selbst völlig schmerzfrei den anderen in die Bewusstlosigkeit zu katapultieren. Verstand ich nicht. Wie sollte man einen Schädelreiber üben? Ich ärgerte mich über das konsequente Ausbleiben jeglicher krimineller Energie. Ich verfügte nicht über ein Mindestmaß an Delinquenz.
Quälten mich meine Zukunftsängste, beruhigte ich mich mit dem festen Entschluss, vor drohender Verwahrlosung in das Gefängnis zu wechseln. Anders als in der Gosse, brauchte man dazu kein Geld. Schlechtes Essen, Einsamkeit und Eisenstäbe5, die sich in das Fleisch bohrten. Die obsessive Orientierung am Ich in seiner eingesperrten Einzigkeit – herrlich, wie depressiv sein zu Hause.
Ich schaute nie, wenn ich über die Straße ging. Aber nichts passierte. Obwohl ich von jeher trank und rauchte, bis die Lunge brannte, erfreute ich mich allerbester Gesundheit. Ich war niemals obstipiert, hatte nichts mit der Wirbelsäule, schon gar nichts mit den Bandscheiben, keine Krusten in der Nase, überhaupt nichts was mir körperliche Schmerzen verursachte. Permanent starben Leute, die gar nicht beabsichtigten zu sterben. Ich schämte mich, weil ich noch immer auf der Welt war und prokrastinierte, was das Zeug hergab. Beachy Head im verregneten England? Nein danke. Niemals würde ich mich von diesem Kalkfelsen ins raue Meer stürzen. Jungfernsprung in Gösting bei Minusgraden und schlottrigen Knien? Mit Sicherheit nicht. Zabriskie Point im Tal des Todes und den Klängen von Pink Floyd ging wegen der Hitze nicht.
Jeden Sommer brannte sich die Sonne unerbittlich in meine schwarzgalligen Sehnsüchte, dörrte meine mühevoll konstruierten Vorhaben unwiderruflich aus. Wie ein Wüstenleguan kam ich morgens erst spät aus dem Bau, fuhr in der Mittagshitze an den See um zu baden. Im Sommer liebte ich das Leben und mich noch mehr. Je heißer es war, umso verrückter liebte ich dieses verhasste Leben. Ich ertrug sogar die Menschen, einige wenigstens. Die Sonne war meine Freiheit, mein größtes Glück und die unerlässliche Bedingung für meine Existenzüberbrückungen. Ich verliebte mich jeden Sommer. Wenn ich die Augen schloss, freute ich mich auf den nächsten Tag. Auf mich, auf meinen Geliebten, auf meinen Mut, meine Zuversicht und das Wasser. Und wenn der Herbst ins Land zog und meine anfangs harmlos erscheinende Tagesschlaflethargie von einem infernalischen Stimmungssturz überrumpelt wurde, hatte ich es wieder verabsäumt zu sterben.
Jeder, der meint, dass Depressionen mit Medikamenten und ein paar Kalendersprüchen geheilt werden können, ist ein Arschloch. Depressionen sind der absolute Nullpunkt, der Marianengraben der Vorstellungskraft, das Epizentrum der Hoffnungslosigkeit. Man kann daran verzweifeln oder sie aussitzen. Auf keinen Fall sollte man über sie sprechen. Zu niemandem und zu ausnahmslos niemanden ein Sterbewörtchen über Selbstmord. Verstanden? Schon gar nicht Psychiatern gegenüber. Selbst nicht nach hartnäckigster Fragerei. Die sind die Ersten, die sich in den Pelz gacken. Aus reinem Selbstschutz natürlich. Es gibt nichts Peinlicheres, als mit der Polizei in die Geschlossene transportiert zu werden, weil man für den Bruchteil einer Sekunde seine Zunge nicht unter Kontrolle hatte. Diese infame, vor gespielter Belanglosigkeit strotzende Frage: „Haben Sie schon an Selbstmord gedacht?“ – „Um Gottes Willen! Nein, Herr Doktor.“ Na also, ist ja nicht so schwer und damit habe ich das letzte Mal das Wort peinlich gebraucht. Alles was ich wollte, war irgendwo dazuzugehören und jemanden, der mich gern hatte. Und ich Schwachkopf glaubte, so jemanden über das Internet bestellen zu können.
5 Scheiß-Alliteration!
Different36
Freitagabend, allein in der Wohnung. Seit zweiundsiebzig Stunden hatte ich mit keiner Menschenseele mehr gesprochen. Ich probierte „Hallo, du“ aus und las eine Schlagzeile aus der Zeitung laut vor mich hin: „Schafe warnten Hirten per SMS vor Wölfen.“ Nach anfänglichem Krächzen hatte ich meine Stimme wieder. Mein früherer Studienkollege, meistens einziger Bestandteil meines sogenannten Freundeskreises, hatte mir geschrieben, dass unser Freitagsbesäufnis ausfallen würde. Mangels Alternative kam das einer existenziellen Bedrohung gleich. Ich würde also wieder alleine saufen müssen.
Da bei den Vegetariern nichts zu holen war, hatte ich mir auf einer unspezialisierten Singlebörse einen Probeaccount zugelegt. Ich holte mir eine Dose Bier und loggte mich ein.
Besenkammer52 fand, dass ich so pessimistisch klänge, weil mich wahrscheinlich schon zu lange keiner mehr durchgevögelt hatte.
Sickboy1978 hatte einen Eintrag in meinem Gästebuch hinterlassen: „Ich finde deinen Musikgeschmack außergewöhnlich, aber prima.“ Prima! – Schwachsinn. Außergewöhnlich! – für ihn vielleicht.
Mirnixdirnix, Trompe8 und Kantenschoner erkundigten sich – zu blöd um zu googeln – was mein Nickname Opisthodom bedeutete. Ja genau: Oh bist du dumm auf Althochdeutsch. Ach Scheiße. Einfach zum Nachschenken.
Dann der Anhang von RainerZufall. Er hatte sein Motorrad fotografiert. Daneben stand ein pissender Gartenzwerg. Betreff: „Ich bin heiß wie mein Ofen.“
InspektorWu, ebenfalls mit der Intelligenz eines Schuhlöffels gesegnet, fand, dass wir perfekt zusammenpassen würden, da er schon einmal „Smoke on the Water“ von Deep Purple gehört hatte. Aktionsgemeinschaft Trotteln hinter Computern. Immer dasselbe Geschwafel.
Gerade kam was Neues rein. Ja, Freitag, da zeigten sich die Singles sprachgewaltig: „Recht nettes Profil. Lust auf ein Treffen?“ von Different36. Foto hatte er keines. Hobbys: „Lesen und Kochen.“ Sein Motto: „Nimm mich so wie ich bin.“ – Wie denn sonst, du Langeweiler? Ich schrieb ihm zurück, dass wir uns in einer Stunde treffen könnten. Das hatte er nun davon. Den Ort der Übereinkunft gab ich ihm auch gleich bekannt. Wozu die lange Schreibe? Tatsächlich sagte er zu. Ich leerte noch ein Bier und schlurfte die paar Meter zum vereinbarten Treffpunkt, einem kontrolliert eintönigen Studentenlokal im neuen Technikviertel.
Different36 saß schon am Tisch und stand auf, als ich mich ihm näherte. Mittlere Größe, auffällig unmuskulöse Statur, schütteres dunkelblondes Haar, Brille, tief sitzende Augen, verkniffene dünne Lippen. Insgesamt sehr blasser Teint. Ich konnte es fast nicht erwarten bis der Kellner kam.
„Ach, du auch ein Bier. Du trinkst Bier?“
Ich wusste nicht, ob das als Frage oder als besonders scharfsinnige Beobachtung gedacht war. Different36 rauchte in kurzen, schnellen Zügen. Seine Finger waren dünn, die Nägel abgebissen. Nervös hantierte er an der Zigarettenpackung und an seinem Glas herum. Er hatte einen Tick.
„Ach, du rauchst auch. Was sind denn deine Lieblingszigaretten?“
„Scheißegal, ich rauch’ alles, deine?“
„Ja Chesterfield, siehst eh. Leider ganz schön viel. Na ja, hab’ eh schon des Öfteren aufgehört, weißt eh.“
„Hm.“ Woher sollte ich das wissen?
Ich bemerkte, wie sich mein aufgesetztes Grinsen zur Grimasse verzog. Die Lippen in der entsprechenden Position zu halten, tat richtig weh.
„Was liest du so?“, fragte ich unmotiviert.
„Na ja, eher Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazine und so. Hab’ sehr viel mit Computern zu tun und so.“
„Hm.“
„Und was arbeitest du?“, erkundigte sich Different36 wissbegierig.
Ich tat als hätte ich nichts gehört und fragte ihn einfach weiter: „Und sonst, außer Arbeiten, Kochen und Zeitungen lesen, was taugt dir denn?“
„Na ja, is’ ja immer viel zu tun, immer viel Arbeit, danach ein bisschen ausspannen. Faulenzen mit Petzi. Das ist meine Katze. Am schönsten ist es mit Petzi im Bett fernzusehen.“
Sympathieträger Haustier. Ich bemerkte, wie er die Katze zum Thema einer netten Plauderei machen wollte.
„Übrigens, ich hab’ mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Herbert.“
Oh nein, Herbert. Wie konnte man bloß in diesem Alter Herbert heißen? Nur Heribert wäre schlimmer gewesen. Ich erinnerte mich, dass ich gerne einen frechen, orangen Kater gehabt hätte, den ich Bertl taufen wollte. Niemand würde je darauf kommen den Namen Herbert mit Bertl zu verkürzen. Herbert, der Langeweiler. Herbert, der Fernseher. Herbert, der schon als Kind wegen seiner großen Füße gehänselt wurde. Herbert, dessen größtes Besitztum sieben Kunstlederalben mit Briefmarken seiner verstorbenen Großtante waren. Herbert vor seinem TV-Gerät an einer Fischgräte erstickt. Leiche blieb drei Wochen unbemerkt. Herbert, der fade Datenbankadministrator und Toupetträger. Herbert, der stille Eigenbrötler, der schon mal seine Popeln beim Spielfilmgucken aus der Nase kitzelte. Herbert, der seit Menschengedenken seine Zigarettenmarke nicht mehr gewechselt hatte. Mutti wusste gar nicht, dass ihr Bub rauchte.
„Nein, ich wohne nicht weit weg von hier, und du?“, wollte er wissen.
Anscheinend hatte ich ihn etwas gefragt.
„Hä? Ach so, äh ja, ebenfalls.“
„Ganz nette Bar. Bist du öfters hier?“
Oh Gott! Ich hatte nicht einmal mehr Lust auf ein zweites Bier.
„Äh, Entschuldigung. Ich hab’ gerade den vollen Einbruch. Bin urplötzlich saumüde. Schlecht ist mir auch. Kommt wohl von den vielen Tabletten, die ich mir massenweise reinziehen muss, wegen der verdammten bipolaren Störung. Ich glaub’, ich muss auf der Stelle gehen. Nichts für ungut.“
Herbert blickte irritiert in sein Glas.
„Ist schon gut. Passt schon. Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder.“
Fluchtartig stand ich auf. Jetzt oder nie. Ich musste sofort von hier verschwinden. Unverzüglich diesen Ort verlassen. Augenblicklich. Schnurstracks zurück nach Hause und alles vergessen. Ich reichte ihm meine schwitzende Hand. Seine fühlte sich an wie ein toter Fisch. Daheim speicherte ich mir seine Nummer unter Heribert ein. Sicherheitshalber. Falls er sich noch einmal melden sollte. Nicht, dass ich vielleicht abheben würde.
Wizard34
Ich fand, dass es an der Zeit war, Nägel mit Köpfen zu machen und zu investieren. Also meldete ich mich bei der Singlebörse con-te.at an, für deren dreimonatige Benutzung ich einen ordentlichen Batzen Geld überwies. Auf Nichtmehrallein war ich ohnehin. Hier sind alle, waren alle oder werden demnächst sein. Gratis und umsonst. Beim Geld hört sich der Spaß auf, dachte ich mir und ich würde von den Schwachköpfen, wie es sie auf Nichtmehrallein gab, die sich beinahe ausnahmslos einen Spaß daraus machten, verschont bleiben. Schon bald kommunizierte ich mit Wizard, mal per E-Mail, dann mit SMS. Er schien völlig normal. Mario suchte wirklich eine Partnerin. Er war jung, hatte einen guten Job als Techniker und sehnte sich nach einer verlässlichen Frau, mit der er eine ruhige Zweisamkeit genießen konnte. Lange schaute ich mir seine Fotos mit den ernsten Gesichtszügen und den blassblauen Augen an. Plötzlich bemerkte ich, dass er Ähnlichkeit mit Rippe besaß. Marios’ Körpergröße und die schlanke Statur passten auch. Vielleicht war er wie Rippe. Möglicherweise war er sogar besser als Rippe: schöner, humorvoller, zärtlicher. Notfalls könnte er sich die Haare wachsen lassen. Die Farbe stimmte überein.
Es war bereits November, Allerheiligenzeit, und nur das fiebrige Erwarten auf unser Date ließ mich mit Freude das Haus verlassen. Am späten Nachmittag trafen wir uns in einem unscheinbaren Lokal am Dietrichsteinplatz. Mario war zurückhaltend und sehr zuvorkommend, wirkte intelligent. Ich war traurig, weil er in keinster Weise mit Rippe vergleichbar war. Er wollte mich wiedersehen, aber ich dachte an Rippe und dass ich nirgends jemanden finden würde, der so sein würde wie er. Ich löschte Marios’ Daten und beantworte seine Nachrichten nicht mehr. Er stöberte mein Profil auf Nichtmehrallein auf. Ich teilte ihm mit, dass ich bereits mit einem anderen ausging. Später bereute ich diese Entscheidung und suchte vergebens nach ihm. Es tat mir leid, dass ich ihn damals nicht mehr treffen wollte, nur weil meine illusorischen Erwartungen nicht erfüllt wurden.
Das ist der Unterschied zwischen dem Kennenlernen in der Realität und der Kontaktaufnahme im Internet. Beim ersten vereinbarten Treffen stellt sich unweigerlich Enttäuschung ein, weil man sich zuvor ein Wunschbild konstruiert hat, das der Wirklichkeit nicht standhält, nicht standhalten kann. Dann setzt man sich erneut an den Computer und die Optimierungsfalle des weltweiten Netzes schnappt zu. Schließlich suggeriert es, dass Unmengen potentieller Partner existieren.
Ganz anders beim zufälligen Treffen: Da plaudert man dahin, ohne sich viel zu denken, trifft sich wieder, wenn es halbwegs passt und zeigt sich bei Gefallen von der besten Seite. Erst viel später kristallisiert sich heraus, dass man sich gar nicht viel zu sagen hat. Sprachlosigkeit macht sich breit, aber man macht trotzdem weiter. Wochenlang, monatelang. Oft werden selbst Jahre und Jahrzehnte daraus, manchmal aus purer Bequemlichkeit, da man sich ohnehin schon vertraut ist. Insgeheim wünscht man sich stets Besseres. Prince hatte es auf den Punkt gebracht: Auch ich konnte nicht zufrieden sein.
How can u just leave me standing?
Alone in a world that’s so cold? (so cold)
Maybe I’m just 2 demanding
Maybe I’m just like my father 2 bold
Maybe you’re just like my mother
She’s never satisfied (she’s never satisfied)
Why do we scream at each other
This is what it sounds like
When doves cry6
6 Prince: „When Doves Cry“, auf „Purple Rain“, Warner Bros 1984.
Günther Uecker
Es summte. Ich öffnete die Tür. Wahnsinn. Sauber war es hier. Nicht so eine Drecksbude wie bei mir. Das Stiegenhaus blitzblank. Auf den Böden konnte man operieren, garantiert keimfrei. Es roch nach Chlor wie in einem Schwimmbad. Eigentlich konnte ich mich – bis auf das Aussehen meiner Onlinebekanntschaft – an nichts mehr erinnern. Babyface Gabriel. Hatten wir derart über die Stränge geschlagen? Schmusen war noch drin, aber genau wusste ich es auch nicht. Mumpsgesicht Gabriel. Ziegenpeter führt bei dreißig Prozent der Erkrankten zu einer schmerzhaften Entzündung der Hoden. Der Sack läuft blutrot an und glänzt wie Klarlack. Äußerst schmerzhaft. Nicht zu unterschätzen.
Gabriel und ich hatten uns Freitag im Tick Tack getroffen, wo er mit einer ordentlichen Schlagseite auf mich zugetorkelt war, als ich eintraf, und mich mit einer degoutant-jovialen Art umarmte. Eigentlich grässlich, aber ich hatte zu Hause vorgeglüht und so hielt ich es für den großartigsten Einstand überhaupt. Die Krügerl Bier wanderten im Viertelstundentakt über die Theke. Nicht nur bei uns, bei sämtlichen Gästen. Bier, wo immer man hinschaute. Eher würde die nächste Eiszeit ausbrechen, als dass im Tick Tack das Bier ausginge. Herrlich.
Disturbed dröhnte aus den Boxen. Gabriel studierte irgendwas abartig Langweiliges: Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, etwas, das nur die absolut Interesselosesten zu studieren imstande sind. Sein Aussehen war leicht zu erklären: eher klein und wabblig, nicht fett, nein, noch lange nicht richtig korpulent, aber schon etwas aus der Kontur geraten, dichtes kurzgeschnittenes Haar, Babyspeck, Hamsterbacken, Typ Pacey Witter von Dawson’s Creek, nur hässlicher.
Gabriels Apartment hatte die Qualitäten eines White Cube. Frisch ausgetünchte Wände, sparsames Mobiliar, strenge Klarheit und kein Schnörkel zu viel. Auf zwei Tellern war Spargelrisotto angerichtet, das er hastig in sich schlang, währenddessen er nicht das geringste Interesse an mir bekundete und ich in aller Ruhe, sozusagen ohne den mindesten Beobachtungsstress, wie eine Normale essen konnte. Ich war begeistert. Ausnahmsweise zitterten die Hände nicht. Ob das nur bei Spargelrisotto funktionierte? War ich geheilt? Würde ich in Zukunft Nudelsuppe ohne Tremor essen? Vor aller Augen? Kaum hatte Gabriel alles aufgegessen stand er auch schon auf und schob mich Richtung Bett. Da war meine gute Laune dahin. Ich näherte mich einem der Bilder an der Wand. War das ein weiblicher Akt ohne Kopf oder ein zerdrückter Käfer? Schwer zu sagen.
„Die Radierung ist von Beuys“, erklärte Gabriel ungeduldig.
„Vom echten?“ Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
„Ja, natürlich vom echten“, antwortete Gabriel bierernst. Außerdem sah ich, dass ihm die Unterhaltung überhaupt nicht ins Konzept passte. Betrunken war er mir wesentlich sympathischer gewesen.
„Was hast du gedacht? Dass Beuys immer Fett und Filz sein muss?“
„Oder Hut oder Hase“, führte ich aus. „Gehört das auch zu seinem hochgelobten erweiterten Kunstbegriff oder was? Soziale Plastik! Jeder Mensch ein Künstler! Wenn man solche Theorie predigt, ist es naturgemäß ein Leichtes, jeden Krempel in Kunst zu verwandeln. Deswegen auch Tausendsassa Beuys, Multitalent Beuys. Wie willst mit einer verrosteten Blechdose und einem Stück Holz die Gesellschaft verändern? Bitte erklär mir das!“ An sich fand ich Beuys gar nicht so ungenießbar, aber dass mich Gabriel auf diesem direkten Weg Richtung Bett schieben wollte, wurde mir jetzt durch und durch bewusst und es begann mich fürchterlich anzuwidern.
„Im Grunde waren Fett und Filz das bei weitem Interessanteste, das er der Nachwelt hinterlassen konnte“, schloss ich meine Expertise.
Gabriels Ausdruck nach zu urteilen, war er in höchstem Maße gereizt. Seine wie bei Descartes angehobene Augenbraue zuckte nervös.
Ein anderes Bild begann mich zu interessieren.
„Ein Uecker ist das“, kommentierte er kurz und schob schon wieder. Wahrscheinlich hatte er gedacht, dass ich mich so leicht abfertigen ließe. Nicht bei Uecker. Nicht bei Günther Uecker. Uecker daselbst! Ein weiß bemaltes Nagelrelief, spärlichst ausgeführt.
„Günther Uecker“, wiederholte ich. „Unfassbar“. Hatte klein Gabriel doch tatsächlich einen Uecker in seiner Studentenbude hängen. Ich geriet nahezu aus der Fassung.
„Das ist wirklich von Uecker, vom echten Uecker?“
„Ja was glaubst du? Dass ich das selbst gemacht hab’?“, fragte Gabriel, wieder völlig humorlos und zunehmend gereizter.
So abwegig fand ich das gar nicht. Ich hatte mir einen Lucio Fontana gebastelt. Leinwand mit roter Ölfarbe bepinselt und Schlitz mit dem Messer: fertige Arbeit. Ich liebte die Leinwandschlitzer, die Werksdurchlöcherer, die Schießer, aber zuallererst die Minimalisten, die Puristen, die Monochromisten am allermeisten.
„Hast du gewusst, dass Ueckers Schwester mit Yves Klein verheiratet gewesen ist?“
„Nein, mir egal.“ Gabriel rollte seine Augen nach oben. Dann begann er seine Hemdsärmel aufzuknöpfen.
„Mit Yves Klein! Blaue Schwammreliefs! International Klein Blue“, rief ich entzückt.
„Ja und kurze Zeit später ist er gestorben“, knurrte jetzt Gabriel, schon wieder deutlich ungeduldiger.
„Weißt du, ganz zufrieden bin ich mit Kleins Blau nicht. Da fehlen mir das Grau und das Grün, sogar das Violette. Taubenblau oder Rauchblau ist am schönsten, aber schwer zu bekommen.
„Blau ist Blau und nicht Grün oder Violett.“ Er streifte sich das Hemd ab.
„Vespa hat so eine Lackierung. Aber die Farbe hat keinen richtigen Namen. Meine Recherchen ergaben Berliner Blau, Preußischblau und schlussendlich Stahlblau und da glaubte ich, es endlich gefunden zu haben. Ist es aber nicht. Am Monitor auch komplett schwer darzustellen. Mit RGB 45,92,108 bekommt man wenigstens eine leise Ahnung. Beim Vespablau ist der Rotanteil aber wesentlich geringer.“
Es half nichts. Gabriel hatte keine Lust, sich mit mir zu unterhalten. Wir landeten im Bett. Am wenigsten stressen die weißen Leinwände, sagte ich mir und ich dachte an Uecker, das ganze langweilige Prozedere hindurch, die ganze sinnlose Schrauberei hindurch nur an Uecker, während dieser freudlosen, durch und durch verzichtbaren Herumfuhrwerkerei, diesem vermaledeiten Bettdesaster an Günther Uecker und dass ich keine zwei Meter von einem echten Uecker entfernt war.
Als ich das nächste Mal zu ihm kam, hatte Gabriel nichts für mich gekocht. Außerdem hatte er darauf verzichtet, seine Kontaktlinsen einzulegen. Stattdessen hockte er mit aschenbecherdicken Brillen auf dem Bettrand. Er musste blind wie ein Maulwurf sein. Die wohl ödeste Nummer in Missionarsstellung vollzog sich in minutiöser Wiederholung ganz wie beim zuletzt im Bett Erduldeten. Gabriel erklärte mir ohne Umschweife, dass ich bald zu gehen hätte, da er zu einer Party eingeladen war. Ich frisierte mich in seinem Badezimmer, Gabriel putzte sich die Zähne. Den Knäuel ausgefallener Haare beabsichtige ich im Klo zu entsorgen, damit sich ja keines auf seinem glattgewischten Boden verflüchtigen würde.
„Lass das mal“, kläffte er und schmiss sein gebrauchtes Handtuch auf den Boden. „Da wird morgen ohnehin zusammengeräumt.“
„Ja genau. Schrubb endlich den Boden sauber. Ist ja nicht auszuhalten dieser Dreck.“ Gabriel blieb todernst. Geradezu stumpfsinnig blähte er seine angeschwollenen Backen. Erst beim Anblick seiner Hamstervisage im Spiegel bemerkte ich, mit welch dreister und primitiver Schamlosigkeit er meine Präsenz leugnete.
„Nein, ich mach’ da gar nichts“, sagte er richtiggehend gekränkt. „Einmal wöchentlich wird die ganze Wohnung durchgeputzt.“
„Echt, du hast eine eigene Putzfrau?“
„Der Vermieter will das so. Alle seine Wohnungen werden professionell gereinigt. Der hat Schiss, dass ihm wieder einer von den Studenten die Wohnung versaut. Die Wäsche wird auch gewaschen und gebügelt.“ Demonstrativ zerknüllte er sein altes Hemd, stopfte es in einen großen Sack und nahm sich ein frisches, das feinsäuberlich an einem Kleiderhaken an der Tür hing. Wir gingen nach draußen auf seinen Balkon, weil ich rauchen musste. Statt sich mit mir zu unterhalten, fieselte er – wie eine fünfzehnjährige Berufsschülerin – an seinem Mobiltelefon herum.
„Ich muss jetzt“, drängte er. „Am Wochenende hab’ ich auch keine Zeit, da bin ich bei meinen Eltern. Sonntag am späten Abend frühestens.“
Nach der Bettaktion am Sonntagabend erzählte mir Gabriel hochdramatisch von seinen vielen Prüfungen, die er in nächster Zeit zu absolvieren hätte. Außerdem wollte ein Freund aus Japan zu ihm kommen. So ging es in einer Tour. Er hatte nicht das mindeste Verlangen, etwas mit mir zu unternehmen, mit Ausnahme dieser nervtötenden Vögelei, die ihm sichtlich selbst keinen Spaß mehr bereitete. Ungeniert erzählte er mir von seinen Partys, seinen Studienkolleginnen, den lustigen Unifesten.
„Gehen wir wenigstens einmal ins Kino, okay?“
„Ehrlich gesagt muss ich Geld sparen. Hab’ in letzter Zeit zu viel ausgegeben.“
Nanu? Der Kerl hatte eine Wohnung, ein Auto, einen Beuys, einen Uecker, vielleicht sogar mehrere.
„Ja, aber du hast mir ja erzählt, dass du einiges auf dem Konto hast und außerdem ein paar aktiengebunden Fonds und eine Eigentumswohnung in Wien.“
„Stimmt, aber das sind in erster Linie Sparformen. Für die Zukunft. Verstehst?“