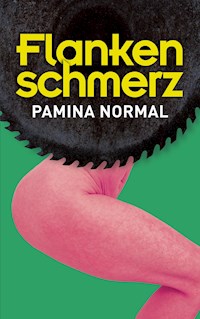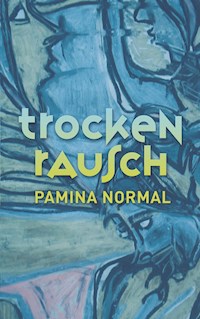
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nüchtern werden ist schon schwer, nüchtern bleiben noch viel mehr ... Diesmal beschließt Loibl nicht trost- und tatenlos im Irrenhaus abzuhängen, sondern endlich ihr Alkoholproblem unter Kontrolle zu bringen. Ein paar trockene Tage sind bald absolviert, dann setzt die Suchtverschiebung und das Nachholsyndrom ein; neue Räusche und Ersatzbefriedigungen müssen her. Ganz ohne den Bewältigungshelfer Alkohol sägen auch die Kollegen mächtig an den Nerven. Als Loibl erkennt, dass es sich hier mehr als um ein Spiel handelt, begibt sie sich auf eine niederschmetternde Suche nach einer alternativen Lebensorientierung. Drogen und Alkohol sind was für Anfänger. Wer richtig cool ist, zieht sich die Realität rein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TROCKENRAUSCH
Teil 1: Hotel California
Prolog
Fallnummer: 2029176
Langeweile
Baba Jaga
Gerontophobie
Dies domini
Bilowitzki rückt ab
Fonso, Don Alonso
Torsten
Stress
Der Korporal et al.
Wish you were beer
Kopfstand
Insektenkunde
Goldmund gibt alles
Das Maximum rausholen
Sick of doubt
Plänkelei
Downburst
Moribund I
Moribund II
Moribund III
Teil 2: Good Times
Wiederbelebt
Rauchen
Ärger
Therapie I
»Zinke« Zinkovsky
Lobotomie
Für den Arsch
Duo infernale
Abstinenz
Therapie II
Gedankenschärfe
Perturbatio Mentis
Ronnie Superstar
Pink Floyd
Geburtstag
Rupert
Das große Fressen
5000 Kelvin
Xanthomania
Teil 3: Dancing in the Dark
Feiertag
Illuminiert
Verkatert
Der große Stumpfsinn
I can do anything
Hass
Veni Sancte Spiritus
Ausgecheckt
Siebeneinhalb Wochen
Es geht weiter
Fête Blanche
Ertrinken
Kapitulation
Aufbruch
Epilog
Für NIKITA
TEIL 1
Hotel California
You can check out any time you like But you can never leave
(Eagles: »Hotel California«, 1977)
PROLOG
»Es ist ein Haufen verkommener Menschen, die sich durch ein erlerntes Verhalten in die Isolation getrieben haben und dadurch zum Strandgut unserer Gesellschaft wurden und in ihrem Selbsthaß, in ihrer maßlosen, völlig wirklichkeitsfremden Ansprüchlichkeit, mit ihren sinnlosen, kindhaften Wunschphantasien, ihrem Selbstmitleid, ihren Agressionen [sic!], dem ohnmächtigen Protest, den Unterlegenheitsgefühlen, mit der Last ihrer Schuldgefühle, Kritiklosigkeit in der Einschätzung ihrer Lage, mit dem Mißtrauen und Haß, falschem Stolz, der inneren Leere, Neid, mit ihrer Selbstbezogenheit, mit ihrer Abwehr und Selbsttäuschung in Form des Verniedlichens, mit ihren ›Charaktermängeln und Unzulänglichkeiten‹, ihrer Unfähigkeit, Konflikte zu lösen und zu bestehen, ihre Standfläche als Mensch derart verschmälerten, daß ihnen nur noch der Selbstmord auf Zeit mit Spiritus oder der Selbstmord selbst übrigbleibt.«1
1 Walter H. Lechler: »Alkoholismus – eine Krankheit?« Deutsche AA-Kontaktstelle, München [1977?].
Mittwoch, 19. September: FALLNUMMER: 2029176
Zum Teufel! Mein Gott: Wie oft habe ich meine läppische Geschichte schon erzählt? Oft verwechsle ich die ärztliche Anamnese mit einem Bewerbungsgespräch. Dann stehe ich dankend auf und reiche allen Beteiligten die Hand. Bei meinen Bewerbungsgesprächen hingegen muss ich mich zusammenreißen, damit ich nicht von meinen Aufenthalten in psychiatrischen Einrichtungen plaudere. Wie soll ich die Lücken im Lebenslauf jemals erklären? Gibt es dafür schon eine plausible Notlüge? Ständig produziere ich neue Fragen. Wie bei der Popper-Matrix: Finde die Lösung für EIN Problem und TAUSEND neue tun sich auf!
Ich sollte meine Krankheiten auslagern. Ab nun habe ich mich zwei Jahre meines erwerbslosen Lebens um meine pflegebedürftige Mutter gekümmert, nach einem kurzen Intermezzo der beruflichen Neuorientierung drei Jahre um meinen dementen Vater. Leider musste ich auch die letzte Betätigung kündigen, da sich bei meiner Schwester Drillinge ankündigten.
Wieder unter die Käseglocke, diesmal für acht Wochen. Was wird das? Ein ernstgemeinter Versuch das Biest meiner Sucht in den Griff zu bekommen oder eine weitere substanzlose Auszeit von meiner Lebensuntüchtigkeit? Beinahe zwei Jahrzehnte ist es her, dass ich – anlässlich der österlichen Fastenzeit – eine unfassbar lange alkoholfreie Phase beschritt, endlos erscheinende Wochen, die einem dauerhysterischen Veitstanz gleichkamen. Mir blieb nichts anderes übrig, als wieder damit anzufangen und bis jetzt weiterzutrinken.
Ich zelebriere meinen letzten Rausch auf der Besuchertoilette im Gebäude der Neurologie. Obwohl ich seit Jahren nur mehr Bier trinke, habe ich mir zum Abschluss drei Flachmänner aus der Quengelzone eines Lebensmittelgeschäfts akquiriert: ein Fläschchen Wodka Taiga, einen Marillenschnaps und einen Metaxa: dreimal Hitze, dreimal Fieber, dreimal ein Hoch auf die Zukunft! Erleichtert gehe ich in Flammen auf.
Und ich schwimme zurück in die Ursuppe der Unwissenheit, der totalen Ahnungslosigkeit. Zurück zu meinem Ursprung. Ich lerne und lerne Schicksale kennen, mache meine Erfahrungen, bewege mich voran mit der Trägheit eines Reptils, wie eine Mauereidechse in der glimmenden Mittagssonne, eine Felsen-Schildechse auf 50 Grad heißem Granit. Bald bin ich wieder da, wo ich herkomme: Ab in den Frieden der totalen Ideenleere und weg mit dem schwarzen Schatten meines hoffenden Herzens.
Donnerstag, 20. September: LANGEWEILE
Landesnervenklinik Sigmund Freud (LSF Graz), Wagner-Jauregg-Platz 1, 8053 Graz, Österreich, Gebäude B, 1. Stock, Station 3, Zimmer 007:
Es ist 19 Uhr 35 und sterbenslangweilig. Glück gehabt: Das zweite Bett ist wie durch ein Wunder noch frei und niemand stört mich. Es ist alles erledigt: zweimal ausreichend gegessen, dazwischen geschlafen, Zähne geputzt. Aufgebahrt liege ich kerzengerade und missmutig auf der viel zu weichen Matratze und hoffe, dass mich die Nacht in ihre Fluten reißt. Ich fühle mich ausgeschlafen, betont wach, aufdringlich an die Realität gekettet.
Als ich das letzte Mal in stationärer Behandlung gewesen bin, musste ich die lähmende Langeweile zwischen Abendessen und Nachtruhe mit Marihuanarauchen überbrücken; eine strapaziöse Vorstellung! Illegale Drogen sind noch anstrengender als der handelsübliche Dünger, den man sich zwangsläufig einverleiben muss, wenn es sonst nichts gibt. Vom Allerschlimmsten: die von den Ärzten verschriebenen synthetischen Weichmacher in Form von Antidepressiva. Das allmonatliche Aufsalutieren in den rappelvoll-verseuchten Wartesälen beim Irrenarzt, der dir zwischen zwei Patienten jovial lächelnd seinen Sanktus aufs Rezept kritzelt und dir mit einem feuchten Händedruck die Legitimation zur Selbstvergiftung erteilt, zu deinem Untergang, zu deinem sukzessiven Abschied von Freiheit und Selbstbestimmung.
Gerade habe ich es wieder geschafft, fünf Menschen zu grüßen. Irgendwas surrt im Zimmer: die Heizung, der Strom, das Licht; was weiß ich. Seit meiner Ankunft habe ich bestimmt hundertmal gegrüßt, nichts weiter als einen »Guten Tag« gewünscht oder bloß »Hallo«, ein trostloses Leben als Grüßaugust geführt. Außerdem wurde an einer vorsintflutlichen Säulenwaage mein Gewicht vermessen.
Heute standen noch keine Therapien auf der Tagesordnung, genauso wenig wie morgen. »Ankommen« lautet die Devise. Das habe ich bereits am Vormittag zur Genüge erledigt. Für uns Neulinge soll es erst Montag richtig losgehen. Jetzt heißt es warten, warten, warten. Ein stumpfsinniges Wochenende steht mir bevor.
19 Uhr 41: Ich habe sechs Minuten mit Schreiben verbracht. Es ist noch langweiliger geworden!
19 Uhr 55: Zeit zum Schlafengehen und für mein Gute-Nacht-Pulver. Ich hole mir eine sedierende Trittico vom Pfleger und esse das obligate 20-Uhr-Joghurt in der Geschmacksrichtung Himbeere. Eine kleine Gedankenverwehung und ich bin hinüber – hoffentlich. Gleich wird mein Bewusstsein wie ein Pixelhaufen zerfallen. Noch zeigen die Tabletten ein bisschen Wirkung, zumindest ab und zu.
Wie ich das alles jetzt schon satt habe: dieses viel zu helle Zimmer, den kahlen Fensterausblick in die ungeschönte Realität, dieses stocksteife, widerborstige Leintuch, die klammen Stäbe des Bettes, das ewige Schweigen der gekalkten Wände, die klinikalltagsvertrottelten Pfleger und Schwestern mitsamt ihren unausgesprochenen Verboten, die blöde vor sich hin glotzenden Mitpatienten und der schale Geruch nach Desinfektionsmitteln und abgestandenem Apfelkompott.
It must be nice to disappear
To have a vanishing act
To always be looking forward
And never looking back
How nice it is to disappear
Float into a mist ...2
2 Lou Reed: »Vanishing Act«, auf »The Raven«, 2003.
Freitag, 21 .September: BABA JAGA
Um 6 Uhr geht die Tür auf und der Pfleger weckt mich. Ich stelle den Wecker, den ich beim Waschbecken positioniert habe, zuerst auf 6 Uhr 20, dann auf 6 Uhr 30 und zum Schluss auf 6 Uhr 40. So kann ich mich immer wieder auf den Tauchgang ins Bett freuen. Um 6 Uhr 45 stehe ich übelgelaunt auf und schlüpfe in den Bademantel, verlasse das Zimmer Nr. 007 Richtung Klo, dann zum Frühstückstisch. »Guten Morgen, Morgen, Gun Moagn, G’ Morgen, Morgen, Morgn, Mogn ...« – Uääh!
Ein neuer Pfleger stellt sich vor: Gerry Schablas mit schwarzer Nerdbrille und einer Höckernase wie Serge Gainsbourg. »Wir wollen uns bitte richtig anziehen«, deutet er auf mich und Olivia, die mir gegenübersitzt.
»Sagt der, der sich seit Tagen nicht mehr den Bart rasiert hat«, keift Olivia. Ihre orangen Haare am grauen Ansatz stehen gorgonenhaft in alle Richtungen. Sie trägt ein cremefarbenes Seidennachthemd, darüber einen knielangen Cardigan in Grobstrick. Olivia war das letzte Mal vor zwei Jahren auf Entzug. Bei der knapp Vierzigjährigen, die sich bereits in ihre Fünfziger gesoffen hat, handelt es sich um eine Dauerpatientin, die oft und gerne auch tageweise die Akutstation frequentiert. Ihrer fahlen Gesichtsfarbe nach hat sie seit Äonen kein Sonnenlicht mehr gesehen. Sie sieht aus, als hätte man sie ausgekocht.
Nach dem Frühstück lahme ich nach draußen, um mir eine durchzuziehen, immer noch in meinem schwarzen Morgenmantel mit den weißen Totenschädeln. Fast alle von der Station quarzen wie die Kümmeltürken. Wandelnde Rauchsäulen winden sich auf Trampelpfaden zu den diversen Therapien. Erst bei genauem Hinsehen kann man erkennen, wer sich unter den Brandwolken verbirgt.
Ich stapfe nach oben, stelle mich in die Dusche und wasche mir die Haare – mit Sicherheit die ereignisreichste Begebenheit seit meiner Ankunft. Schwester Sonja bringt mir meinen Therapieplan ins Zimmer: Gruppentherapie, Einzel-, Beschäftigungs-, Bewegungstherapie, Visite etc. Die herkömmlichen, altbekannten Geschichten.
Rauchpause vor Gebäude B: ausnahmslos immer klotzt ein kleines Grüppchen im Freien, diesmal nicht in der Pergola, sondern rechts und links vom Eingang, wo es sich vortrefflich über jene maulen lässt, die den Zugang frequentieren. Ähnliches Setting wie in jeder Dorftankstelle, wo sich die Säufer nach jeder Kundschaft den Hals verrenken und sie mit ihren trüben Glotzaugen solange inspizieren, bis ihnen irgendein gehirnamputierter Kommentar einfällt.
»Hey du da, auch hier, na?«, bemerkt ein Glatzköpfiger und mustert mich so durchbohrend und erwartungsvoll, als hätte ich ihm versprochen, etwas vorzusingen.
»Was ist? Soll ich dir ein Gedicht aufsagen?«
Er grinst mich kernig an. Um den Zahnbestand einiger Insassen sieht es traurig aus. Beim einen fehlt quasi jeder zweite Hauer, beim anderen gleich das ganze Klavier, bis auf ein paar traurige Restposten. Wahrscheinlich des Öfteren aufs Zähneputzen vergessen im Suff. Schnauzbärte möchten die Katastrophe verbergen, doch das weißgelbe Gestrüpp über den Lippen macht alles nur noch schlimmer.
Kaum zurück im Zimmer möchte ich schon wieder rauchen. Laut Auskunft meiner Trafikantin enthalten meine schwarzen John Player Special am meisten Nikotin von allen österreichischen Zigaretten. Erstens glaube ich ihr das nicht und zweitens sind 0,9 mg lächerlich wenig. Kein Wunder, dass ich rauche wie ein Esel. Auf Dauer werde ich auf Filterlose umsteigen müssen.
Ich lese »Narziß und Goldmund3« von Hermann Hesse, bis jetzt fünf Kapitel, ein manieriertes, allzu sittensprödes Buch, in dem es vermutlich um Geilheit versus Keuschheit in der Adoleszenz geht: Ein hübscher Halbwaise verliebt sich im Kloster in einen ebenso hübschen Novizen; ein Traumpärchen, wäre der Ältere nur nicht so hoffnungslos verkorkst. Goldmund, ein blonder, in der Blüte seiner Geschlechtsreife stehender Jüngling mit dem vertrotteltsten Namen aller Zeiten, und Narziß – nomen est omen –, ein arroganter, vergeistigter Wichtigtuer, der seinen neuen Intimus mit gelehrtem Hochmut blendet. Narziß ist Denker und Asket, ihm ist alles Geist, auch die Liebe. Er spürt Goldmunds kochende Eier und bewahrt Contenance. Klassischer Gegensatz: Geistmensch versus Liebesmensch. So weit, so langweilig. Beiden ist die andere Seite nicht zuwider, aber jeder entscheidet sich für seine Bestimmung. Das würde so in der Realität nie stattfinden, aber egal. In der Realität existieren nur Mischtypen, doch das ignoriert Hesse! Eines Abends verdrückt sich Goldmund verbotenerweise mit ein paar weiteren Zöglingen ins Dorf, wo er sich mit starkem Apfelmost verräumt und ihn zum ersten Mal ein Mädchen küsst, was den Grünschnabel derart aus der Bahn wirft, dass er von Narziß gesund gepflegt werden muss!
Leider muss ich mittendrin aufhören und fortgehen, um einen Konzentrationstest zu absolvieren. Kurz vor zehn stapfe ich zu Magister Gombitz ins Gebäude G, Diagnostik, wo er schon am Computer auf mich wartet. Unter Zeitdruck soll ich alle Buchstaben »d«, die unten und oben mit zwei Punkten markiert wurden, anklicken. Vor lauter Freude über diese geistige Herausforderung klicke ich auch viele »ds« mit drei Punkten oder nur einem Punkt an. Erst in der letzten Reihe bemerke ich, dass ich fälschlicherweise sogar kleine »ps« mit zwei Punkten angeklickt habe. Also ist der erste Test verschissen. Es folgt ein Fragebogen zu den Trinkgewohnheiten und ein Fragebogen die Trinkresistenz betreffend: »Wie gut können Sie in folgenden Situationen dem Alkohol widerstehen?«
»Sie feiern mit Freunden«: Antwort »gar nicht«.
»Ein Freund lädt Sie auf Ihr Lieblingsgetränk ein«: Antwort wieder »gar nicht«, null Prozent Trinkresistenz.
»Sie gehen in Ihr Lieblingslokal«: schon wieder null.
»Sie sind mit Ihrem Leben zufrieden«: Hä? Achtung, Moment! Gibt’s ja gar nicht: wie viel Prozent Trinkresistenz, wenn ich mit meinem Leben zufrieden bin? Ist das eine Fangfrage? Würde ich trinken, wenn ich wunschlos glücklich wäre? Eigentlich schon, denn schließlich heißt es doch immer, man möge Drogen bevorzugt bei stabiler und ausgeglichener Gemütsverfassung konsumieren. Wäre ich allerdings schon besoffen, was den Umstand erklären würde, warum ich zufrieden bin, würde ich natürlich mehr wollen. Und wieder null. Unheimlich ...
Dann wieder: »Sie reden mit Freunden über alte Zeiten und Ihre Saufgelage«: null Punkte, keine Chance, einfach zum Nachschenken.
»Sie fühlen sich unerwartet ausgezeichnet und freuen sich über einen Riesenerfolg«: wieder null Prozent Trinkresistenz. So geht das in einer Tour weiter. Die Fragen provozieren geradezu einen Rückfall; sie befeuern das Biest der Sucht, reizen und piesacken es, bis es zum Gegenschlag ausholt. Ich denke an eine gut gekühlte Herrenhandtasche meines Lieblingsbiers. Sechs Flaschen, so kalt, dass man sie lutschen kann und die Welt darf sich weiterdrehen, die Welt darf sich wieder Welt nennen; die Welt als Welt wiederentdecken, was definitiv nur im Rausch denkbar ist, die Welt als solche zulassen und annehmen, die Welt Welt sein lassen …
»Bitte beeilen Sie sich, Frau Loibl«, flüstert Magister Gombitz, »Ihre Kollegen sollen auch am Vormittag drankommen.« Magister Gabriel Gombitz respektive Magister Magister Gabriel Gombitz muss seine Diplome in der Krabbelstube erlangt haben. Der Jungtherapeut und klinische Psychologe sitzt mir unbeholfen, schweinchenrosa, pausbäckig und mit einem ausgeprägten Kindchenschema versehen gegenüber: dominante, gewölbte Stirn, Mininäschen, runde Wangen, keinerlei Geschlechtsdimorphismus.
»Jawohl, Herr Magister«, lächle ich ihn an. Er sieht aus, als würde er gerne gestreichelt werden.
»Ein Freund bestellt sich beim gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant ein Bier«: na ja, schon besser, glatte zehn Prozent Chance auf Resistenz. Er könnte sich ja auch ein alkoholfreies bestellt haben.
Bei der Visite um halb zwölf erklärt mir Dr. Petrovic, der Boss der achtwöchigen Entwöhnungsbehandlung, dass ich erst in einer Woche Tagesausgang beanspruchen könnte. Bis dahin dürfte ich mich ohne Erlaubnis nur auf dem Krankenhaus-Areal bewegen. Draußen glitzert die Sonne wie Mitte August. Ein Prachtwetter, wie geschaffen für den Sitzgarten. Ich denke an den lauen Abend und an ein kühles Belohnungsbier im Freien. Der Oberarzt beschränkt sich auf das Allernotwendigste, einen Kurzabriss meiner Trinkerkarriere sowie auf mein zweites psychopathologisches Standbein der Depression und meinen Medikamentenplan. Sein Strichmund öffnet sich unwillig, seine Gestik, seine Mimik, ja sein ganzer Habitus verhalten, distanziert, als würde ihm jedes preisgegebene Krankendetail einen Hieb ins Fleisch versetzen. Hoffentlich muss er sich nach der Anamnese nicht übergeben. Jeder Handwerker, ob Estrichleger oder Pferdefleischer, hätte ein höheres Maß an Interesse und Empathie verströmt.
»Don’t place too much trust in experts.«
»You must disagree with authority figures.«
»People who don’t work with their hands are parasites.« Gleich mehrere Truismen oder Aphorismen der Konzeptkünstlerin Jenny Holzer passen auf den ignoranten Alten. »A lot of professionals are crackpots!«
Wenigstens lässt mich der Weißkittel in Ruhe, aber trotzdem erfasst mich zusehends eine Wut hier, weil auch nichts, rein gar nichts weitergeht an diesem Ort, diesem Abstellgleis, diesem Nicht-Ort, weil man den ganzen verdammten Tag nichts anderes tut, als auf das nächste Gelage zu warten. Vor dem Essen ist nach dem Essen! Ich verspüre immense Lust dem Nächstbesten, der mir abartig entgegengrinst, ein paar frontale Komahaken in die Fresse zu betonieren. »Expressing anger is necessary.«
Ein abgeschleckter Jungspund mit brillantinierten, schwarzen Haaren lehnt lässig vor Petrovics Zimmer.
»Pfoah, du siehst aber fertig aus!«, lacht er überlegen. »Nüchtern werden ist nicht schwer, nüchtern sein dagegen sehr«, feixt er mir nach.
»Das kannst jetzt deinem Arzt erzählen, Trottel.«
»Wieso? Ich hab ja kein Problem.«
Ich hasse ihn jetzt schon. Wenigstens der Kaffee fließt in Strömen. Gleich nach dem Mittagessen fallen alle über die vollen Kannen her. Kolimprein, ein dem irischen Whiskey höriger, totalrelaxierter Mitpatient aus meiner Sechsergruppe, gekleidet in smaragdrotes Polohemd mit akkurat sitzendem Kent-Kragen und passender Basecap, erzählt mir auf dem Weg zum Minigolfplatz von der berüchtigten Station C5. Der fünfzigjährige Vermessungstechniker, der seine gute Laune direkt aus seinem prächtigen Ranzen bezieht, lächelt erleichtert über seine kürzlichen Erlebnisse. Mangels freiem Platz in Objekt B, ließ er sich interimistisch auf C5 in einem Achtbettzimmer stationieren, wo – seiner festen Überzeugung nach – niemand mehr ans Aufhören denke. Eineinhalb Wochen hielt es Kolimprein dort aus, seines Zeichens süchtig bis zum Letzten – er stamme aus einer veritablen Trinkerfamilie, Alkohol sei eine Familienkrankheit, sein jüngerer Bruder nach zwölf Entzügen erstmals wieder länger abstinent, das wäre auch seine letzte Chance gewesen, denn nach dem zwölften Rückfall trete unweigerlich Hirnmasse aus dem Schädel –; dann allerdings trat er die Flucht an, hauptsächlich weil er sich kulinarisch unterversorgt fühlte. Inklusive der Unterwäsche wurde ihm dort alles gestohlen. Seinem Bettnachbarn Smirtek fehlten die Extremitäten, weil ihm die Körperteile vom Schnaps ausgefallen waren.
»Zur Gänze kaputt gesoffen«, reflektiert Kolimprein mit einem Seufzer. Kolimprein gehört zu dem Typus Mensch, der auch bei aktiven Betätigungen nur so viele Kalorien verbrennt, wie ihm beim Sitzen vor dem Fernseher verlorengingen. Außerdem zählt er zu den sogenannten Zwischen- oder Intertrinkern, also jenen kreativen Anlassgeneratoren, die die restriktiven gesellschaftlichen Trinkvorgaben mit adäquaten Ergänzungen in den Pausen zu erweitern imstande sind. Dazu zählt der Verdauungslikör bei Bauchweh, der Rumtee bei Verkühlung, Wodka zur Zahnhygiene, Whiskey bei Halsschmerzen, das Hefeweizen bei Vitaminmangel, Rotwein zur Herzattacken-Prophylaxe, Weißwein als Muntermacher, Bier zur fremdsprachlichen Verständigung, Tequila zur Gewichtsreduktion, das Schwangeren-Guinness ebenso wie jegliche Form des Zwischentrinkens, um die verheerenden Auswirkungen der Toleranzentwicklung zu kompensieren.
»Dass sich mindestens einer am Mittagstisch in die Hosen schiss, stand an der Tagesordnung. Keiner duscht, niemand wäscht sich. Mit Fetzen am Körper und einem Plastiksack tauchen sie plötzlich auf, mit den gleichen dreckigen Lumpen hauen die allermeisten wieder ab, wenn sie sich genug angefressen haben, um wieder einige Zeit auf der Straße zu überleben.«
Für Kolimprein blieb bei der Essensausgabe zu wenig übrig. Selbst die Einbeinigen und die Rollstuhlfahrer bewegten sich schneller als er.
»Sogar mein Pitralon Pitrell hat mir der Smirtek ausgesoffen«, schüttelt Kolimprein den Kopf.
Auch wenn ihm sein Bauch die Sicht auf den Boden zur Gänze versperrt, versenkt Kolimprein beim Minigolf den Ball mit herausragender Feinkoordination. Ob Tunnel oder Buckelbahn, ein Ass folgt dem anderen. Breitbeinig nestelt er den Ball mit seinem Putter aus jeder Versenkung und befördert ihn bewegungsökonomisch von Abschlag zu Abschlag, sodass er sich bis zum Schluss nicht ein einziges Mal bücken muss.
»Riecht man dann fein?«, frag ich.
»Normal schon«, antwortet Kolimprein, »nur der Smirtek nicht, der bestimmt nicht. Der wird sicher nie wieder gut riechen.«
Sechstes Kapitel:
Goldmund erhält von Pater Anselm den Auftrag, ein Bündel Johanniskraut zu pflücken. Als er auf einem Feld einschläft, weckt ihn die Zigeunerin Lise, die ihn an Ort und Stelle verknattert. »Die holde kurze Seligkeit der Liebe wölbte sich über ihm, glühte golden und brennend auf, neigte sich und erlosch.« (S. 74) Noch in derselben Nacht will Goldmund das Kloster Mariabronn verlassen und verabschiedet sich von Narziß, den er in seiner Büßerzelle findet, wo er abgemagert und in Kutten gewickelt auf einer schmalen Pritsche liegt und sich auf seine nächtlichen Vigilien vorbereitet. Liebesberauscht schwärmt er ihm von dem genialen Gefühl vor, sich ganz und gar von einer Frau einhüllen zu lassen. Der vergeistigte Narziß ist von seinen Exerzitien bereits so vernebelt, dass er sich das beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Großer Schock nach dem abendlichen Auslüften: Fünf Kollegen aus der Gruppe der Zahnlosen sitzen in der Pergola und unterhalten sich über einen Neuzugang, sensationeller Höhepunkt des faden Tagesgeschehens. Sie erkundigen sich nach meiner Zimmernummer.
»007 – James Bond«, antworte ich vertrauensselig.
»Dann liegt die alte Schneehenne jetzt bei dir!«
Mir klappt das Gesicht nach unten.
»Viel Spaß bei der Schnarcherei. Die ist mit dem Sauerstoffgerät eingerückt.«
»Wie alt wird die sein?«, schreit einer in die Runde. »Sechzig vielleicht?«
»Ach wo, siebzig, achtzig«, meint ein anderer.
»Neunzig mindestens!«, wird dazwischengejohlt. »Die musste mit dem Lift rauf. Gehen kann die nicht mehr.«
»Am besten du rollst sie zur Tür raus und dann die Stufen runter zusammen mit dem Bett«, prustet einer grunzend. Die Alkis lachen wie eine Horde meckernder Ziegen. »Erspart dem Staat einen Batzen Geld!«
Wohl zu früh über das Einzelzimmer gefreut! Immer freue ich mich zu früh. Erschüttert haste ich zum Eingang. Die grölende Meute jault hinter mir her. Vor meiner Zimmertür halte ich aufs Schlimmste gefasst inne. Was erwartet mich jetzt? Ich stelle mir meine Hausmeisterin vor, die allmonatlich an meiner Wohnung Sturm läutet, um mich um Geld anzupumpen, fett, monströs, durch wulstige Ödeme auf das Zehnfache angeschwollen wie ein Ballon kurz vorm Zerplatzen, mit trüben, himmelwärts gerichteten Linsen oder Baba Jaga, die zahnlose Hexe, einen schwartigen Fleischklumpen, der sich mit seinen eitrigen Gedärmen ins Koma flatuliert.
Nur Mut! Mit einem tiefen Atemzug reiße ich die Tür auf. Zwei Litschis im Kompottsaft schwimmen hinter einer burgunderfarbenen Brille, die sich mit dem kupferroten Haar sticht, besser gesagt mit dem, was davon übrig ist, ein Schummelscheitel auf den zweiten Blick, die Stirnfransen mit Taft auf die kahlen Stellen fixiert. Sie reicht mir ihre Hand, die sich anfühlt wie ein Kluppensack, als wären alle Knochen durcheinandergeraten, in der Küchenmaschine womöglich, im Mixer, in der Salatschleuder ...
Sie hieße Bilowitzki, unterbricht sie meine Gedanken, Meinhild Bilowitzki. Ich erwidere ihren Gruß mit einem martialischen Händedruck. Sie erträgt ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Sonst sieht sie aus wie alle Mumien in ihrem Alter: in beige Tracht gewickelt, orthopädische Latschen, Muffeltuch aus Polyester mit abstrusen Mustern um den Hals drapiert, Flecken am durchscheinenden Pergament, dieses mit Goldschmuck notdürftig aufgeputzt, auch damit man sie nicht mit einem Mann verwechselt, denn die bauchbetonte Apfelform und der Haarausfall deuten auf eine eklatante Testosteron-Dominanz. Hauptsache sie ist kein Pflegefall!
Gegen Abend begegnen wir uns im Frauenklo. Um Gottes willen! Zum Glück sind ihre Hosen wieder raufgezogen. Sie fieselt gerade hochkonzentriert am Knopf des Bundes und bemerkt mich gar nicht. Ich verstecke mich in der zweiten Kabine, wo ich – dankbar für den ersparten Anblick – zwei Vaterunser herunterbete. Nie wieder will ich mich über irgendjemanden beschweren, wenn nur dieser Kelch an mir vorüberginge!
Ticktack, ticktack. Bilowitzkis riesiger Doppelglockenwecker tickt mit steigender Lautstärke in die Stille der Nacht. Sie unternimmt keinerlei Anstalten, mit dem Lesen aufzuhören. Der Schein ihrer Nachttischlampe leuchtet die Ablage über dem Waschbecken aus: wie eine Skyline prangt eine Armada von Produkten zur Pflege der Zahnprothesen inklusive kiloweiser Haftcremes, dutzender Hautlotionen, Ampullen, Tropfen und allerlei Tinkturen. Rücksichtlos, mit dieser allen Greisen innewohnenden Rüpelhaftigkeit, verdrängt sie mich vom gemeinsamen Nassbereich. Meine Zahnbürste liegt nun beleidigt in ihrem Reiseetui in meiner Nachttischlade. Vom Standpunkt der Psychohygiene aus wäre es angebracht, mich dazuzulegen.
Ticktack. Exakt alle sechs Minuten blättert Bilowitzki, begleitet von einem schmatzenden Schluckgeräusch, die Seite um. Immer ist irgendwas. Jeder Tag ein Hürdensprint, ein Eierlauf, ein Wandelnder Pflock. Soll ich mich etwa im Gemeinschaftsbad installieren oder in den Aufzug stellen, ein bisschen rauf- und runterfahren? Im Garten strolchen und am finstren Himmel nach dem Herbstquadrat suchen oder nach Andromeda? Am Firmament das Haar der Berenike finden? Die Schwester um ein Sedativum anbetteln? Ticktack. Alles, alles würde ich dem Terror hier vorziehen, meinetwegen die kahle, klamme Pritsche von Narziß draußen auf dem Gang. Hauptsache allein. Früher oder später nervt dich jeder. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du jemanden am liebsten töten würdest, um ihn nicht mehr ertragen zu müssen. Es ist 22 Uhr 36. Ticktack, Scheiß-Krankenhaus, Scheiß-Anstalt!
3 Hermann Hesse: »Narziß und Goldmund«, Frankfurt am Main 2007, suhrkamp taschenbuch 3854.
Samstag, 22. September: GERONTOPHOBIE
Wie durch ein Wunder kann ich bis 8 Uhr 35 schlafen und sogar eine Stunde nachdämmern. Nach vier Tassen Kaffee verräume ich zu Mittag ohne den geringsten Appetit ein dreigängiges Menü: Fritattensuppe, Schwammerlgulasch, Semmelrolle, Salat, Topfenschnitte; alles marschiert zielgerade in den Häcksler. Daraufhin begleite ich Kolimprein und eine hübsche, ätherische Erscheinung aus der Gruppe der Zahnlosen zum Minigolf. Kolimprein stellt mir die seltsam wirbellose, fadenwurmige Frau als Patrizia Sabine vor und ich wiederhole mechanisch die beiden Vornamen in Erwartung, sie möge mir mitteilen, welchen der beiden sie favorisiere, aber sie beabsichtigt in keinster Weise, eine Kommunikation mit mir zu starten. Nicht eine Silbe dringt während unserer Begegnung über ihre blutleeren Lippen. Als ich zurückkehre, fällt mir auf, dass ich bereits eine ganze Schachtel John Player intus habe und am liebsten die Wände hochklettern würde.
Die Bilowitzki geht mir unsäglich auf die Nerven! Seitdem sie da ist, kehrt einfach keine Ruhe mehr ein. Ihr Ultraschallreiniger für den Zahnersatz surrt in einer Tour, immerfort hantiert sie an den Fenstern herum – es will ihr partout nicht in den Schädel, dass sich diese nicht zur Gänze öffnen lassen –, einmal Fenster kippen, drei Minuten später schließen, dann fingert sie an den Jalousien herum oder scheint die Vorhänge zu begradigen; am allerliebsten knistert sie mit Verpackungen herum. Richtig leise sein funktioniert gar nicht. Selbst wenn sie bewegungslos verharrt, stört sie durch ihre Lebens-Geräusche. Entweder rasselt ihr Atem, sie räuspert sich oder hüstelt. Am ärgsten nerven kaum wahrnehmbare Klicklaute. Weil die Prothesen nicht richtig sitzen und alle Gefäße verkalkt sind, sondern alte Menschen ununterbrochen diese fremdartigen Töne ab. Wenn sie nachdenkt, mit krummem Rücken über das Kreuzworträtsel ihrer Zeitung gebeugt, fängt sie – als befände sie sich in Gärung – zum Blubbern an. Bestimmt eine akute Azidose – durch viel zu hohe Blutgaswerte ist sie krankhaft übersäuert und droht aufzuschäumen. Beim Schreiben und Lesen schmatzt sie und wenn sie gar nichts tut, beginnt sie zu schlucken. Sie schluckt mehrmals hintereinander, manchmal locker zehn-, zwanzigmal, eigentlich so lange, bis sie wieder zu brodeln oder mit einem anderen Geräusch beginnt. Ich halte mein Ohr an die Heizung, aber es ist eindeutig die Bilowitzki. Als sie auch noch Schluckauf bekommt, absentiere ich mich mit meinem Buch ins Klo.
Siebentes Kapitel:
Goldmund entwickelt sich zum Womanizer. Er schiebt locker zehn Nummern mit Lise in einer einzigen Nacht. Danach verlässt sie ihn, um zu ihrem Mann heimzukehren, der sie wie immer mit einer Tracht Prügel erwartet. Goldmund – kein Kind von Traurigkeit – überlegt sich allen Ernstes, es mit einer Bärin zu treiben, als er für kurze Zeit nicht mehr aus dem Wald findet. Das Klosterleben muss ihn total versaut haben. Nach zwei Tagen trifft er auf einen Bauernhof – und wie könnte es auch anders sein? – das verrohte Bauernweib traut ihren Augen nicht, als sie den süßen Blondschopf erblickt. Während es ihr wie verrückt zwischen den Schenkeln juckt, kredenzt sie ihm das beste Essen. Darauf vernascht sie den süßen Stecher so gierig im Heu, dass sie ihm beinahe den Hals bricht. Goldmund ist entzückt, findet es aber bedauerlich, dass sie weniger erfahren als Lise ist. »Sie wußte wenig Spiele, weniger als Lise, aber sie war wunderbar kräftig […]« (S. 98) In der Klosterschule nicht gerade ein Blitzkneißer, lernt er jetzt mit der Geschwindigkeit Casanovas’.
Sonntag, 23. September: DIES DOMINI
In aller Herrgottsfrühe startet die Bilowitzki mit frenetischem Gekreische ihre elektrische Kaffeemühle, dass ich kerzengerade zum Plafond fahre. Als ich wieder in die Federn sinke, nimmt sie mit lautem und hektischem Gebaren die Espressomaschine in Betrieb. Danach herrscht für kurze Zeit tatsächlich Frieden und ich träume von kühlen Bierflaschen und dem goldenen Inhalt, der aalglatt die Kehle hinunterrinnt, als plötzlich der Intercity-Express der Deutschen Bahn einfährt.
»Spinnst du? Es ist Sonntag, Tag der Ruhe, dies domini, der siebte Tag. Haltet ihn heilig!«, herrsche ich sie an. »Was ist das?«
»Der Milchschäumer«, antwortet sie knapp.
»Wieso kannst du nicht auf den Stationskaffee warten? Wie spät ist es überhaupt?«
»Fiele mir im Traum nicht ein, diesen seichten, dünnen Sud zu saufen«, empört sie sich. »Ich war schon drüben«, fährt sie hochnäsig fort, »die Semmeln zäh wie Gummisohle, das Brot hart wie Stein, der Kaffee schwach und lauwarm, keine Butter, nur Margarine ...«
»Ja, passt schon«, murmle ich und rolle mich wieder ein. Durch Sehschlitze nehme ich wahr, wie sie allerlei Nippes auf dem Fensterbrett verteilt.
»Am Nachmittag bringt mir meine Cousine Blumen vorbei«, erzählt sie mir, »Gladiolen wären schön, vielleicht erwischt sie noch ein paar Sonnenblumen. Dann sieht es hier gleich freundlicher aus.« Mit dummen Kuhaugen blickt sie sich im Raum um. »Hast du vielleicht eine Vase?«
»Nein!«, schreie ich. »Wozu brauche ich eine Vase? Um mir so einen Heuchlerbesen, verlaustes und verwesendes Gesträuch anzusehen? Ich bin ja nicht geistesgestört. Genauso gut kann ich mir einen Container mit halbverfaultem Biomüll auf den Tisch stellen ...«
»Du weißt nicht was schön ist, Mädchen!«
Jetzt nennt sie mich auch noch Mädchen. Gleich koch ich auf. Um einen spontanen Tobsuchtsanfall zu vereiteln, zähle ich gedanklich bis zehn und zurück. In der Zwischenzeit legt sie ihre Brille in den Ultraschallreiniger und steckt ihn an. Es surrt, es rasselt, das Räderwerk dreht sich ohne Unterlass. Als ich vom Mittagessen komme, herrscht ausnahmsweise Lärmpause von ihren Apparaturen, dafür blubbert sie höchstpersönlich vor sich hin.
Zaghaft klopft es an der Tür. Statt Meinhilds Cousine steht unvermutet mein Wohnungsnachbar Bertil von Zuhause vor mir: in voller Breite, quergestreift, mit Sandalen und offenem Kragen, seine hellen, grünblauen Husky-Augen schief gestellt. Meinhild begrüßt ihn mit übertriebener Freundlichkeit.
Ich sage zögernd »Hallo« und hoffe, dass er kein Bier mitgebracht hat. Ob ich ihm überhaupt erzählt habe, was ich hier mache? Er küsst mich auf den Mund! Gleich kippe ich rücklings um.
»Wie geht’s? Ich hab die Karten dabei. Zum Watten, mein ich. Hast du deine Mailbox nicht abgehört?«
»Welche Mailbox? Die ist schon längst deaktiviert«, schüttle ich den Kopf und dränge ihn aus dem Zimmer. Damit ständig jemand was drauf redet oder wie? Seh ich doch sowieso, wenn jemand angerufen hat; das braucht mir niemand in ermüdender Ausführlichkeit zu erklären. Ich bin ja nicht komplett weg von der Schüssel. Mein Herz klopft wie verrückt.
»Gehen wir einen Kaffee trinken«, fragt er mich, »oder eine Kleinigkeit essen?«
Um Gottes willen! Ich habe keine Ahnung, ob schon Besuchszeit ist, wie er mich gefunden hat, warum er überhaupt weiß, dass ich hier bin, ob ich ihm das womöglich im Suff erzählt habe, ihn vielleicht sogar darum gebeten habe, mich zu besuchen. Verwirrt leite ich ihn Richtung Minigolfanlage. Das fehlte mir gerade noch, stocknüchtern und zitternd im Kaffeehaus zu sitzen mit einem fremden Mann, der mich unmotiviert niederschmust und mit mir Karten spielen will. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr nüchtern Karten gespielt: Schwarzer Peter mit fünf Jahren das letzte Mal; seit zwanzig Jahren nicht mehr nüchtern in einem Kaffeehaus gesessen, meistens bin ich nicht einmal nüchtern dorthin gelangt. In Gegenwart anderer gegessen wurde nur, wenn ich bis obenhin abgefüllt vor Hunger fast gestorben wäre. Annäherungsversuche jeglicher Art wurden selbstverständlich im halb-komatösen Vollrausch unternommen, sämtliche prekären Handlungen im Besäufnis getätigt, jegliche Form von Sozialkontakten zumindest im dezenten Dusel.
Je nüchterner ich werde, umso mehr verschwinden auch die während der nassen Zeit gespeicherten Daten. Als würde man eine Festplatte zuerst neu formatieren müssen, bevor man ein neues Betriebssystem darauf installiert. Wahrscheinlich werde ich alles neu lernen müssen, von der Pike auf wie ein kleines Baby.
Ich traue mich fast nicht, ihn anzusehen. Hoffentlich fragt er keine komischen Sachen. Bertil sieht absolut harmlos aus. Das irritiert mich noch mehr. Da bemerke ich, dass er anscheinend geistesabwesend in eine andere Richtung abgebogen ist. Kurz überlege ich, sang- und klanglos in die Anstalt zu entschwinden, da hat er sein Missgeschick auch schon überrissen und folgt mir wieder. Als er beim Minigolfen in die letzte Bahn einlocht, fuhrwerke ich noch immer bei Station vier herum. Bertil setzt sich auf die Bank und überdreht einstweilen seine Augen, als hätte er Kammerflimmern. Bei Spiel zwei unterhalten wir uns kurzzeitig über Fußball, ein deutliches Zeichen, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, bei Spiel drei über Jausenbrote für die Arbeit, genau genommen über am Vorabend in Tupperware und Kühlschrank bereitgelegte, fix fertige Doppeldecker aus Schwarzbrot, wo wir auf eine erstaunliche Übereinstimmung unserer Lebenswelten treffen. Spiel vier überstehen wir in einer Art Schreckstarre bei fortdauerndem Schweigen und steigen erstmalig unentschieden aus. Während des fünften Spiels erblüht unsere Kommunikation zu ungeahnten Höhen dank einer Auseinandersetzung zum Film »Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts«, wonach Bertil als Freilufthobbyläufer eindeutig mit der naturharten Trainingsweise Rocky Balboas im verschneiten Sibirien sympathisiert, während ich mich auf die Seite Ivan Dragos schlage, vorwiegend seines Aussehens wegen, aber dies würde Bertil nicht verstehen. Nach Spiel sechs muss sich Bertil erneut hinsetzen, weil er zugegebenermaßen unterzuckert ist.
»Ich glaub, ich mag was essen. Ich muss leider gehen, tut mir leid.« Sein Schläger fällt ihm aus der Faust in das Gras. Bertil entfernt sich mit einem hingehauchten Miniküsschen auf die Wange.
Er wirkt plötzlich klein, nicht richtig klein, aber auch nicht richtig groß, wahrscheinlich so wie Rocky, eher größer, eigentlich gar nicht klein, sondern mittel … Ich kann selber nicht mehr! Es ist alles zu anstrengend. Ich bin total im Arsch, gleich deliriere ich mich in die Ohnmacht und stürze in den Rasen oder mit der Breitseite in den Geräteschuppen – man soll nicht nur Sätze fertig sprechen, sondern auch Gedanken zu Ende denken – also, so als hätte sich Dolph Lundgren oder jeder x-beliebige andere, nein jemand mit Locken wie Rainer Langhans, dämmert es mir endlich, mit einer superkleinen, winzigen Mini-Kirgisin gepaart und das Ergebnis mit den schiefen Augen Bertil genannt. O lass mich noch einmal die Bottiche fluten, schenk mir einen letzten Rausch, lieber, lieber Gott! Bertil ist der Hammer: dieser Name, die schiefen Schlitze, auch die Frisur, diese kompromisslose Banalität.
Auf dem Rückweg sehe ich wie Kolimprein und Patrizia Sabine aus der Tür wanken und verstecke mich hinter der Pergola. Wenn jetzt noch einer etwas von mir will, drehe ich durch.
Bei der Medikamentenausgabe im Pflegestützpunkt erkundigt sich ein grobschlächtiger Wärter mit rundem Stoppelbartgesicht – Typ: übellauniger, pyknomorpher Bierwirt – nach meinem Pfeiferl. Pfeiferl? Pfeife? Ich verstehe nicht das Geringste. Außerdem muss ich intensiv über Bertil brüten. Natürlich steht er auf mich – weil er sonst keine bekommt – wegen seiner Frisur – wegen seiner schlecht sitzenden Wischmopp-Frisur – wie eine frisch geerntete Steckrübe – Pfeiferl? – lächerlich – Bertil hätte ein hübsches Gesicht, würden ihm nicht diese komischen Locken, diese Pudelfrisur – Christoper Atkins im Film »Die blaue Lagune« – ja genau! – welches Pfeiferl? Endlich dämmert es mir. Die Scheißpfeife. Nach einem Ausgang kann es passieren, dass man auf Alkohol getestet wird!
»Ach den Mist! Hab ich weggepfeffert. Wusste ja nicht, dass man das auf ewig behalten muss. Pfeiferl? Mundstück heißt das.« Ich blase kräftig und lange in den Alkomaten.
»Also, Sie nehmen jetzt das Pfeiferl mit und schmeißen das nicht wieder weg«, ermahnt mich der Wärter, »und wenn Sie dann positiv sind, bekommen Sie ein neues Pfeiferl.«
»Kommt das öfters vor auf der Station, dass jemand positiv wird?« Roland Treiber, so steht es auf seinem Schild, ignoriert mich.
»HIV-positiv?«, hake ich nach. Nichts. Auf seinem roten Stiernacken perlt Schweiß.
Plötzlich er: »Bis Sie einen Rückfall bekommen! Dann gibt es ein neues Pfeiferl«, entfährt es ihm mit forschem Unterton. Seine dünnen Schnittlauchhaare sind noch alle brünett, die Barthaare dafür schon grau durchwachsen, ein des öfteren beobachtetes Phänomen. Geschieht ihm recht. Er reicht mir einen Dispenser mit Tabletten. Ich hätte mir Kohlenschaufeln bei seiner plumpen Gestalt erwartet, doch er bedient mich mit zarten Geigenhänden.
Achtes Kapitel:
Goldmund, spitz wie Nachbars Lumpi, gelangt auf die Burg eines reichen Ritters, Vater zweier blutjunger Töchter. Doch die beiden bleiben spröde und unterkühlt, zu sehr auf ihr hohes Prestige bedacht, vor allem die ältere Tochter namens Lydia, mit der Goldmund – zum Zerreißen gespannt – eine biedere Kuschelbeziehung unterhält. Die Jüngere namens Julie entdeckt ihre verbotene Liebschaft und der Traum Goldmunds wird wahr. Schlagartig findet er sich mit allen beiden im Bett! Aber die Ältere will noch immer nicht. Dafür entpuppt sich die kindliche, nonnenhafte Julie als rattenscharfes Luder, willfährig, fügsam und reif, endlich gepflückt zu werden. Ehe es richtig losgeht, zerrt die sittsame Lydia ihre kleine Schwester aus den Federn und verpetzt Goldmund an ihren Vater, der den samengestauten Verführer im Wald aussetzt.
Neuntes Kapitel:
Im nächsten Bauernhof liegt die Bäuerin gerade in den Wehen und Goldmund kann sich sein Schäferstündchen aufzeichnen. Im schmerzverzerrten Gesicht der Gebärenden sieht er die Züge einer Frau auf dem Höhepunkt ihrer Lust. Letztendlich fungiert er sogar als Hebamme. Goldmund, der Mann, dem die Frauen vertrauen. Wie immer lässt Goldmund nichts anbrennen. Am darauffolgenden Tag nimmt er die Nachbarin in die Mangel und liefert ordentlich ab.
Montag, 24. September: BILOWITZKI RÜCKT AB
Tagwache um 6 Uhr 45, um 6 Uhr 55 Frühstück, von 7 Uhr 30 bis 8 Uhr 15 auf dem Crosstrainer mit Jimmy Cliffs »The Harder They Come« in den Ohren. Ich bin hundemüde. Solange die Bilowitzki nicht da ist und kein Spektakel machen kann, muss ich das ausnutzen. Also dreh ich mich für zwei Stunden in die Matratze.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Meinhild Bilowitzki, meine Zimmerkollegin, packt unverhofft die Koffer! Trotz ihrer wortwörtlich ausgezeichneten Beziehungen zur Ärzteschaft, namentlich zu Primarius Dr. Plotzmann, darf sie die Therapie erst Ende Oktober fortsetzen. Falls sie mich dann wieder belästigt, schieb ich sie zu Patrizia Sabine, die aufgrund ihres totalen Mutismus garantiert nichts daran auszusetzen haben wird. Den körperlichen Entzug habe sie auf der Akutstation erledigt, vertraut mir die Bilowitzki an – ich will es garantiert nicht wissen –, doch sie weiht mich vertrauensvoll ein: nicht nur Alkohol, sondern auch Tabletten! Das ist bedauerlich. Trotzdem kann sie hier nicht ohne Wartezeit einmarschieren. Wenn jemand jahrzehntelang bechern kann, wird er wohl noch zwei Wochen warten können.
»Das mit dem Medikamentenentzug hat wieder nicht geklappt«, murmelt die Bilowitzki geistesabwesend. »Ich weiß nicht mehr weiter. Das wird nie funktionieren!«
Um sie aufzumuntern, erzähle ich ihr, dass ich nur deswegen rauche, damit ich früher sterbe. Schwerer Ausnahmefehler. Sie ist geschockt, richtiggehend brüskiert. Natürlich fühlt sich die alte Muhme gleich persönlich angegriffen. Wutentbrannt schnappt sie ihren Psychoratgeber und hält ihn mir anklagend unter die Augen: »Wir sterben nicht! Es gibt ein Jenseits.« Dazu befiehlt sie mir: »Das musst du lesen. Es ist so tröstend!«
»Ich brauch keinen Gott, auch nicht die Weisheiten aus dem fernen Osten und am allerwenigsten ein Leben nach dem Tod. Wie sinnlos ist das denn? Nach dem Tod weiterzuleben? Wozu stirbt man dann?« Sie ist noch mehr geschockt. Anscheinend hat sie trotz ihres Alters noch nie eine andere Meinung gehört.
»Das Buch ist einsame Spitze, wenn du auf der Suche bist«, nervt sie weiter.
La fraternité ou la mort! Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. »Ich bin nicht auf der Suche«, präzisiere ich für ihre vertrottelten Ohren. »Ich hab schon alles.«
»Du bist ein armer Mensch«, hält mir Bilowitzki vor.
Spielt sich die alte Zwicke als Wohltäterin der Menschheit auf! Das Einzige, was mir fehlt, ist ein halbwegs vernünftiger Job und das wird mir ihr beschissenes Buch nicht liefern. Wie abgedreht ist denn die? Bin ich froh, dass die knorrige Betschwester, diese selbsternannte Hüterin der Wahrheit, das Feld räumt. Auf Dauer wäre das nichts geworden mit uns. Diese Besserwisserin, die einen so großmütig an ihrem reichen Wissensschatz teilhaben lässt und dich mit ihren profunden Erfahrungen und ihren Ratschlägen zum Idioten abstempelt. Wie generös und selbstlos von ihr. Und wie sie einen daraufhin behandelt mit ihrem herablassenden Mitleid, wenn man es vorzieht, sich ihrer unfehlbaren Lehre nicht in aller Dankbarkeit anzuschließen, so als hätte man sich die allerletzte Chance auf Erlösung verbaut. Hat sie denn keine Kinder oder andere Opfer dafür? Altkluge Mumienweisheiten: schulmeisternd, doktrinär, selbstgefällig und – in Kürze tot. Deswegen muss sie ihre Erbauungsmoral auch nicht an jedem Nächstbesten absondern.
Sie blubbert wieder, denke ich, doch sie weint. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich jetzt tun soll. Hoffentlich blubbert sie bald wieder. Statistisch gesehen weinen mehr Menschen vor Freude als vor Kummer. Was soll ich nur sagen? Ich knabbere ein bisschen an den Nägeln, dann trolle ich mich rückwärts aus der Schusslinie und entfleuche ins Klo am Gang.
Neuntes Kapitel:
Goldmund trifft einen abgebrühten, verschlagenen Vaganten namens Viktor, der ihn anfänglich mit seinen Lügengeschichten und seiner hartgesottenen Bauernschläue beeindruckt und entschließt sich, mit ihm zu vagabundieren. Bald aber geht ihm der joviale Humor und die Unverschämtheit des langen Flegels, sich in sein Leben einzumischen, gehörig auf den Ranzen. Als ihn Viktor in der Nacht ausrauben will, kommt es zum Kampf und Goldmund stößt ihm sein Messer in die Kehle, woraufhin Viktor stirbt. Danach irrt Goldmund durch die verschneiten Wälder und fällt vor lauter Erschöpfung beinahe ins Delirium, als ihn – wie könnte es anders sein? – ein rolliges Bauernweib rettet. Mütterlich päppelt sie ihn wieder auf und Goldmund dankt es ihr auf seine obligate Weise.
Zehntes Kapitel:
Das Frühjahr bereitet Goldmund ein heiteres und unbeschwertes Leben. Wo immer er auftaucht, bekommen die Damen feuchte Höschen und er jobbt mal da, mal dort, bis er in einer Klosterkirche seine Laster und die Bluttat an dem Landstreicher einem Pater beichtet, der ihn anstandslos von seinen Sünden befreit. So schnell geht das bei den Pfaffen. Ein kurzes Gebet am Altar des Herrn und Goldmund hat das reine Gewissen eines Säuglings – in saecula saeculorum, amen. Das irritiert sogar den frischgebackenen Mörder. Vor lauter Verwirrung verguckt er sich in das umstrittene Standbild einer Madonna, das er so betörend findet, dass er sich unverzüglich auf den Weg zum Meisterschnitzer in die benachbarte Bischofsstadt macht.
Ist Lesen eine Form der Weltflucht?
Dienstag, 25. September: FONSO, DON ALONSO
Von den frühen Morgenstunden weg hockt die quarzende Meute auf Holzbänken um zwei konische Riesenaschenbecher, wo sie ihre Expertisen zum Lauf der Welt erstellt. Insgesamt befinden sich stets drei Gruppen zu sechs Patienten auf der Station B. Um zwei Wochen zeitversetzt absolvieren wir den achtwöchigen Entzug, die einen zum ersten Mal, der Großteil der anderen jedoch schon des Öfteren, entweder hier in der Steiermark oder in anderen Bundesländern. Geraucht wird andauernd, sozusagen rund um die Uhr. Kaffeebecher in der einen, Lunte in der anderen, wartet man auf die nächste Veranstaltung, das nächste Essen, die nächste Einzel- oder Gruppentherapie, den Sport, den Schlaf, den Sonnenuntergang. Warten, warten, warten ... Und das alles unnatürlich nüchtern. Jeder noch so geringfügige und geräuschlose Spaziergänger wird kommentiert und abgeurteilt oder es kursieren Geschichten von den anderen Stationen. Torsten, der ostdeutsche Kasten von der Gruppe, die am längsten hier ist, verbreitet wieder Brandaktuelles. Er sieht aus wie ein mit Anabolika zugedröhnter Nachtwächter.
»Diese Alkoholiker sind alle Irre«, verkündet er so, als wenn ihn das nicht im Mindesten beträfe. »Auf der letzten Station hat es welche gegeben, die sich mit Weingeist vollgesogene Tampons in den Arsch gesteckt haben!«
»Sicher Mördergefühl im Hintereingang«, sekundiert Helmut Ohnezahn im dezenten Unterton.
»Die bekommen mit Anal-Shots den Superflash! Über die Schleimhäute wirkt der Fusel viel schneller«, führt Torsten aus. Angeblich hockte er davor im Bau. Zwischen Zeigefinger und Daumen trägt er drei schwarze Punkte: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Hat bei ihm zu hundert Prozent nicht funktioniert. Nach der Geschlossenen verbrachte er fünf Wochen auf C5. C5 ist anscheinend der absolute Downburst. Nur wer schon einmal auf C5 war, weiß wie der Hase läuft.
Dr. Petrovic findet meine Einstellung den Alkohol betreffend zu positiv. Was soll ich darauf sagen? Schließlich hat er mir hervorragende Dienste geleistet: als Antidepressivum, gegen Ängste jeder erdenklichen Art, zur Muskelrelaxierung, als sozialer Puffer, gegen Gedankenkreisen und Obsessionen, ganz besonders aber der anderen Menschen wegen: kurzum, einfach um die Welt als solche zu ertragen! Ohne Alkohol hätte ich weder mündliche Vorträge in der Schule, Klassenfahrten, Wandertage, Skikurse noch die Ausbildung zum Führerschein geschafft, nicht einmal die Fahrstunden an sich, genauso wenig wie die Theoriestunden, den Gang dorthin oder auch nur die Vorstellung daran, rein gar nichts! Ich bin hier, weil ich in wenigen Jahren zu fertig sein werde, um mir Hilfe zu holen.
Alfons, der abgeschleckte Schwarzhaarige von neulich, verziert mit bunten Schlangen, Glückswürfeln, Spruchbändern, gehörnten Tieren und ornamentierten Totenköpfen – man muss ihm zugutehalten, dass er nichts, wirklich nichts ausgelassen hat –, und sicher der Jüngste aller Gruppen, verdankt seinen Aufenthalt einem vermeintlichen Suizidversuch, den er bedenkenlos seiner damaligen Freundin via SMS angedroht hatte. Die daraufhin verständigte Polizei spürte Alfonso in einem Autobahnhotel an der A2 beim Schäferstündchen mit einer Sechzehnjährigen auf: pudelnackt, besoffen, quietschvergnügt. Seine verschreckte Gespielin habe angesichts der voll adjustierten Truppe und ihren lüsternen Blicken das Ereignis bis heute nicht verkraftet, will Alfonso wissen.
»Bei dem Gestell von der Puppen bringt sich niemand um«, pflichteten ihm die Bullen bei. Dennoch führten sie ihn dem Amtsarzt vor, der ihn mit dem Ambulanzwagen in die Psychiatrie einweisen ließ, wo man ihn am nächsten Morgen entließ.
»Schwerer Ausnahmefehler, viel zu früh!«, seufzt Kolimprein und sondiert die verfärbten Blätter der Kletterhortensie, die er, wie manch einer seine ersten grauen Kopfhaare, energisch an der Wurzel ausreißt, um sie für lange Zeit aus seinem Exterieur zu verbannen.
Nach seiner Entlassung schwor Alfonso seiner Mutter, mit einer Therapie zu beginnen, so die offizielle Version. Jedenfalls setzt ihm das Stationsleben aufgrund der eintönigen Rahmenbedingungen gehörig zu. Während die anderen einerseits Stammgäste sind oder sich in irgendeiner Form mit stationären Langzeitaufenthalten auskennen, scheint es Alfonso kalt erwischt zu haben.
»Reden, reden, reden«, jammert er, »jetzt muss ich wieder reden gehen. Wie viele Einführungsgespräche und Tests kommen denn noch?«
»Wenn du einen Urlaub machen willst, bist falsch hier«, so Helmut Ohnezahns sachkundiger Einwand.
»Der meint es wirklich so, der kleine Spinner; das ist nicht theatralisch inszeniert«, schwätzt Kolimprein aufdringlich in mein Ohr. »Natürlich braucht er Beifall und Aufmerksamkeit, aber Problem mit Alkohol – nein, noch lange nicht! Mich wundert, dass sie so einen nehmen. Klein-Fonsi sollte parieren und in die Fußstapfen seines Vaters treten. Diesem Druck hält er nicht mehr stand.«
Woher will Kolimprein das wissen? Die letzten Worte haucht er mir verschwörerisch ins Ohr: »Fonsi-Fonso, unsere kleine Lusche hatte weder jemals Sex noch einen richtigen Rausch, schon gar nicht beides zusammen!« Hoffentlich Ende der Durchsage. Auch das wollte ich garantiert nicht wissen.
Von der Heizungsluft halb erschlagen, sitzen wir unmotiviert im Gesprächskreis bei Frau Evelyn, die uns krampfhaft positiv auf die erste Einheit einstimmt. Ihr Name hält alles, was er verspricht: konventionelle Routine trifft auf eine triviale, ungeschminkte Erscheinung, die man sofort wieder vergisst. Ihre stumpfen, langen Locken liegen auf einem weißen Krageneinsatz aus Tüll. Das alles wirkt leicht und luftig, auch wie sie ihr Haar nach hinten wirft. In Wirklichkeit ist sie eine verklemmte Pedantin, die schon vor Jahren beschlossen hat, sich nicht mehr als absolut notwendig um ihre Patienten zu kümmern. Lediglich ihre irritierende Sprechweise verunglimpft auf skandalöse Weise diese Banalität. Sie hört sich an wie die Synchronsprecherin von Pinocchio!
Auf eine peinliche Kennenlernrunde, bei der keiner mehr als seinen Vor- und Zunamen preisgibt, folgt die erste Achtsamkeitsübung in die Tiefen unseres Körpers. Weil keiner mitmachen will, sollen wir uns Rosinen aus einer selbst-getöpferten Schale schnappen und daran riechen, drehen, knautschen, intensiv spüren sozusagen.
»Welche Oberflächenstruktur hat der Gegenstand? Wonach riecht er? Schließen Sie Ihre Augen!«, beschwört uns die Ergotherapeutin. »Achten Sie auf die Konsistenz!«
Fonso bekommt einen Koller. Fassungslos quetscht er seine Rosine und wälzt sie am Tisch, bis sie eine schleimige Spur hinterlässt. Kolimprein stößt ihm in die Flanke und verleibt sich die Rosine demonstrativ schmatzend ein.
»Das glaubt mir keiner, was ich hier mache. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Niemandem darf ich das erzählen«, wiederholt sich Fonso in einem fort. »Die halten mich für psychisch verrückt, für komplett geistesgestört!«
»Wer sagt, dass du das nicht bist?«, erkundigt sich Kolimprein, woraufhin Fonso schmollend über sein Telefon wischt und wie ein Esel drauflostippt.
»Na, musst du andauernd an deinem Handy fieseln und Nachrichten klopfen. Traust dich noch immer nicht, richtig zu telefonieren?«
Schwester Evelyn legt mit großen Augen den Finger auf den Mund und verlässt den Raum in einer dienstlichen Angelegenheit. Sofort machen Kolimprein und ich uns auf den Weg zur Rauchpause.
»Ein paar Mädchen wird er schon haben. Die stehen auf sein mutmaßliches Geld, besser auf das seines Vaters, selber hat er ja nichts.« Kolimprein hält ihn für einen hyperaktiven Blender, harmlos, aber anstrengend. »Bestimmt lief während der Trotzphase einiges schief«, fährt er fort. »Vermutlich wurde das Trotzen unterbunden. So etwas rächt sich später. Die Mutter, eine hysterische Glucke, die es nur gut gemeint hat und ein nicht präsenter Vater, außerdem Einzelkind. Andere Menschen unterlagen einem Tabu. Irmgard, meine Schwägerin, wohnt neben der Stani-Villa. Berta Stani, seine Mutter, eine Art Inzuchtopfer aus dem ubriakischen Kleinadel und Kunsthistorikerin, hat ihn neun Jahre lang zu Hause unterrichtet! Seitdem holt er sein Leben nach, aber die Alte liest ihm nach wie vor die Weisheiten aus den pietistischen Erziehungsratgebern vor, teilweise zitiert sie die Bibel, die einzige Domäne, in der sie sich halbwegs auskennt, sonst ist sie zur duldenden Untätigkeit verdammt. Der Vater, ein chronisch kranker Wurstfabrikant, hat nie eine Frau gebraucht, lediglich einen Hoferben, der das Familienunternehmen übernimmt. An den Wänden hängen noch immer Cedrics Babyfotos in monumentaler Größe, ein paar richtige Gemälde des Kleinen, mannshoch mit Augen, die einen in die letzte Ecke verfolgen ...«
»Cedric?«, frage ich.
»Unter anderem Cedric, wie der kleine Lord. Insgesamt soll er sieben Vornamen haben, seine Mutter hat sich ordentlich ausgetobt. Dem Alten war das peinlich und er rief ihn bloß Junior oder Filius, niemals mit Namen.«
»Und das weißt du alles von deiner Schwägerin?«
»Natürlich, die hat ihr Leben lang bei denen geputzt, die Wäsche gebügelt, den Garten gepflegt. Am allerwenigsten vertrug sie es, wenn fremde Menschen ihren Sohn ansprachen, aus Angst, er könnte von schädlichen Meinungen infiltriert werden. Der einzige Grund, das Haus zu verlassen, stellten die Zusammenkünfte im Königreichsaal der Zeugen Jehovas dar.«