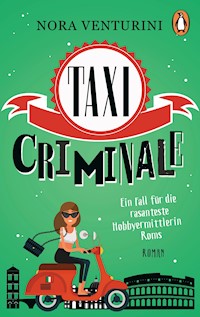
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Taxi für alle Fälle
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
So rasant und vergnüglich wie eine Taxifahrt durch Rom
Die Italienerin Debora lebt in Rom und wollte schon immer Polizistin werden. Aber nach dem Tod ihres Vaters muss sie die Familie als Taxifahrerin über Wasser halten. Eines Tages nimmt sie eine elegante Dame im Taxi mit. Als diese kurz darauf ermordet aufgefunden wird, ist Deboras Neugier geweckt. Sie will den Mörder dieser Frau fassen! Commissario Eugenio ist nicht gerade begeistert von der impulsiven Hobbyermittlerin, die ihm mit eigenwilligen Methoden immer wieder in die Ermittlungen pfuscht. Doch Debora lässt sich nicht abschütteln, denn sie will ihre Fähigkeiten endlich unter Beweis stellen – und den charmanten Commissario beeindrucken …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Ähnliche
NORA VENTURINI ist gebürtige Römerin und arbeitet als Regisseurin und Drehbuchautorin für Theater und Fernsehen. Mit Taxi criminale hat sie ihr Krimidebüt rund um die lebenslustige Hobbyermittlerin Debora Camilli geschrieben.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Nora Venturini
Taxi criminale
Ein Fall für die rasanteste Hobbyermittlerin Roms
Roman
Aus dem Italienischen von Barbara Neeb und Katharina Schmidt
Die italienische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »L’ora di punta« bei Mondadori, Mailand.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2017 by Nora Venturini
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by
Penguin Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: Avny/Moloko88/EKATERINArina/Shutterstock
Redaktion: Brigitte Lindecke
Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen
ISBN 978-3-641-23173-6 V002 www.penguin-verlag.de
Für Edoardo und Lucia
1
An diesem Morgen wäre Debora Camilli, von Beruf Taxifahrerin, am liebsten im Bett geblieben. Sie hatte eine beschissene Nacht hinter sich, die ganze Zeit war eine Stechmücke um sie herumgesirrt, dazu schweißtreibende Hitze und ein Albtraum nach dem anderen. In einem davon war ihr vor zwei Jahren verstorbener Vater mit seinem alten Taxi über die Küstenstraße von Ostia gebrettert, als wollte er den Großen Preis der Formel 1 gewinnen. Debora nahm gerade ein erfrischendes Bad im Meer, als er auftauchte. Cesare Camilli brachte seinen alten Fiat Multipla, auf dem das Taxischild leuchtete, mit quietschenden Reifen zum Stehen und rief ihr zu: »Ich muss einen Kunden vom Flughafen abholen! Willst du mit?« Noch während ihr Vater mit ihr sprach, begann das Auto in den Fluten zu versinken. Debora versuchte die Tür des Fiats zu öffnen, aber es gelang ihr nicht mehr. Ihr Vater, den nie etwas erschüttern konnte, lachte nur, während das Wasser ihm bis zum Hals stieg. »Na gut, dann eben ein anderes Mal …«
Debora war schweißgebadet aufgewacht, ihr war übel, und sie hatte einen unangenehmen, sauren Geschmack im Mund. Sie war in die Küche gegangen, um ein Glas Wasser zu trinken: Am Vorabend hatte sie reichlich Bier gehabt, dazu eine Riesenportion Chips, und jetzt rächte sich ihr Magen dafür. Sie war am Küchenfenster stehen geblieben und hatte reglos in die Dunkelheit hinausgestarrt. Die trübe Mondsichel hatte kaum Licht in die dichte Finsternis gebracht. In der Stille der Nacht war nichts zu hören gewesen als das dumpfe Grollen des Meeres. Ihr Traum hatte eine merkwürdige Sehnsucht in ihr geweckt. Eine Mischung aus Hunger und Wehmut. Halbherzig hatte sie zunächst den Kühlschrank geöffnet, kurz hineingeschaut und ihn schließlich doch wieder geschlossen. Sie hatte sich auf ihr Bett geworfen, aber wegen dieser verdammten Mücke und weil ihr so viele Gedanken durch den Kopf gingen, schlief sie erst ein, als es hell wurde.
Als ihre Mutter sie wie üblich um acht Uhr wecken wollte, hatte Debora sich die Decke über den Kopf gezogen und ihr den Rücken zugewandt.
»Komm schon, Kleines, es ist Zeit. Ich muss los, ich hab um halb neun Dienst. Dein Bruder sitzt bereits beim Frühstück. Steh auf, sonst kommt er noch zu spät …«
Marina, Deboras Mutter, war um die fünfzig. Früher hatte sie als äußerst attraktive Frau gegolten, eine von diesen dunklen Schönheiten mit bernsteinfarbenem Teint und pechschwarzen Locken. Nun hatte sie dunkle Ringe unter den Augen, und nach dem Tod ihres Mannes, mit dem sie ihr halbes Leben lang nur gestritten hatte, hatten sich links und rechts vom Mund zwei tiefe Furchen gebildet. Sie arbeitete als Krankenschwester im Krankenhaus von Ostia.
»Oh Mann, das nervt! Dann soll er eben mit dem Zug fahren! Soll ich ihn etwa bis zum Examen herumchauffieren?«
»Du musst ja sowieso mit dem Taxi ins Zentrum, oder? Das kostet dich doch nichts … Nun steh endlich auf, er hat um neun Vorlesung.«
Von der Küche her drang gedämpft Musik aus dem Radio zu ihr und vermischte sich mit den letzten Ausläufern ihres Traums und dem Duft nach Kaffee. Debora blieb noch ein wenig liegen, kuschelte sich in den Halbschlaf, diese wunderbare Zeit ohne Verantwortung oder Bewusstsein, vergleichbar nur mit der Betäubung durch Schmerzmittel oder ein paar Gläser Wein zu viel.
Als sie hörte, wie die Wohnungstür ins Schloss fiel, begriff sie, dass es höchste Zeit war. Sie rollte sich aus dem Bett und schleppte sich zum Spiegel. Beim Anblick ihres verquollenen Gesichts und der zerzausten Löwenmähne erschrak sie. Eigentlich konnte man das alles in die Tonne treten, dachte sie. Nur den Mund hätte sie behalten, ihr Glanzstück. Perfekte weiße Zähne und dazu üppige Lippen, die wie mit Silikon aufgespritzt wirkten, aber bei ihr war alles echt.
Ab heute beginne ich mit der Dukan-Diät. Hähnchenbrust und pochiertes Kabeljaufilet bis zum Erbrechen. Eine Woche lang, und schon purzeln die Pfunde. Dann kann ich mich allmählich wieder sehen lassen.
Als sie die Küche betrat, bekam sie gerade noch mit, wie ihr Bruder sich die letzte Nutellaschnitte in den Mund schob. Wie konnte er bloß so viel essen und dabei so ein dürrer Hungerhaken bleiben? Warum kam er nach der Mutter und sie nach ihrem Vater?
Giampiero, genannt Giampi, sah von seinem Milchkaffee auf. Rund um den Mund hatte er einen fetten Schokorand, der im Flaum seines kindlichen, noch etwas pausbäckigen Gesichts hängen blieb.
»Warum bist du noch nicht angezogen? Also ich muss in einer Viertelstunde los!«
»Dann nimmst du eben die Bahn, okay? Ich geh jetzt duschen.«
Ihr Bruder wollte schon protestieren, aber Debora drehte eine halbe Pirouette und blieb in Ballettpose stehen, die Hände hoch über dem Kopf zusammengeführt, so wie sie als kleines Mädchen mit Tutu auf dem gerahmten Foto im Esszimmer verewigt war, und sagte: »Los, mach mir einen Kaffee, dann können wir in einer Viertelstunde fahren. Einen großen Espressokocher voll, ohne Zucker.«
Sie hauchte ihm einen Kuss zu und verschwand dann im Flur.
2
Auf der Via del Mare, der Stadtautobahn, die aus dem Süden von Rom ins Zentrum führte, staute sich wie immer der Verkehr. Giampi hatte sich mit Ohrstöpseln von der Außenwelt abgekapselt und nutzte die Zeit, um seine Anatomieskripte durchzugehen. Debora hatte das Seitenfenster geöffnet und das Radio voll aufgedreht und sog die mit stinkenden Auspuffgasen vermischte salzige Luft in sich ein.
»Siena 23? Siena 23, bist du einsatzbereit?«
Eine näselnde Frauenstimme quäkte aus dem Funkgerät. Sie kam nicht vom Computer, auch wenn sie sich so anhörte. Sondern von einem Menschen aus Fleisch und Blut.
»Nein, ich bin noch auf der Via del Mare. Alles dicht hier. In etwa einer halben Stunde bin ich in der Gegend um die Poliklinik.«
»Du bist zu spät. Deine Schicht beginnt um halb neun.«
»Ja, ich weiß, aber meiner Mutter ging es nicht gut. Eine Art Lebensmittelvergiftung. Sie hat die ganze Nacht gekotzt.«
»Ja, ja, schon gut. Das kannst du deiner Großmutter erzählen.«
Die Angestellte der Taxikooperative klang plötzlich wie die strenge Hausmeisterin ihrer ehemaligen Schule.
»Nein, ernsthaft, ich hab echt einen Riesenschrecken bekommen … Ich hätte fast den Notarzt gerufen.«
»Pass auf, Siena 23. Du trittst deine Schicht schon zum dritten Mal in diesem Monat zu spät an. Melde dich sofort, wenn du in der Nähe bist.«
Damit brach das Gespräch abrupt ab.
Als ob nichts geschehen wäre, drehte Debora wieder RomaDimensioneSuono laut auf.
Giampiero sah von seinen Skripten hoch und zog sich einen Ohrstöpsel heraus.
»Lügst du wieder das Blaue vom Himmel herunter wie damals in der Schule?«
»Wie jetzt, du guckst in deine Skripte, lässt dich von deinem iPod zudröhnen, und dann kriegst du auch noch mit, was ich sage?« Debora schnappte sich einen Ohrstöpsel von ihrem Bruder und steckte ihn sich ins Ohr. »Was hörst du denn da gerade?«
»Eine irische Band.«
Die Ampel war grün, aber das Auto vor ihr fuhr nicht los. Die Frau am Steuer plapperte in aller Seelenruhe in ihr Handy. Debora hupte. Und fügte noch ein paar wüste Beschimpfungen hinzu. Die Frau machte eine beschwichtigende Handbewegung und fuhr dann ganz gemütlich los.
»Warum ist nie so ein beschissener Polizist da, wenn man ihn braucht, und verpasst Leuten wie der da ein saftiges Bußgeld!«
»Du telefonierst doch auch mit dem Handy, während du fährst.«
»Das ist was anderes, Autofahren ist mein Job.«
Ihr Bruder schüttelte nur den Kopf und steckte sich den Stöpsel wieder ins Ohr.
Okay, das war jetzt Unsinn, aber sie verbrachte nun mal acht Stunden am Tag hinterm Steuer, wenn sie da nicht ab und zu eine Freundin anrufen konnte … Sie hätte so gern die Nachtschicht übernommen. Roma by night war ein Traum. Alle Straßen frei. Sie würde die Touristen durchs Zentrum zu den Lokalen fahren und dabei wahnsinnig gut verdienen: Denn diese Leute tranken was und gaben ordentlich Trinkgeld. Aber ihre Mutter war strikt dagegen, ebenso die ehemaligen Kollegen ihres Vaters, die sich nach dem plötzlichen Tod Cesare Camillis, er hatte einen Herzinfarkt erlitten, unaufgefordert zu ihren Beschützern aufgeschwungen hatten.
»Spinnst du jetzt völlig, Kleines? Du hast ja keinen Schimmer, was für ein Pack nachts in Rom rumläuft …«
Und dann folgten irgendwelche Horrorgeschichten von Taxifahrern, die verprügelt, ausgeraubt, betäubt oder entführt worden waren …
Daher musste sie jetzt Stunden im Stau stehen und Einheimische befördern, die stets nur auf den Taxameter starrten, immer zu spät kamen und auf die gerade herrschende Regierung schimpften.
Sobald sie ihren Bruder vor der Medizinischen Fakultät abgesetzt hatte, krächzte das Funkgerät erneut: »Via degli Ausoni 8, Ecke Via Tiburtina.«
»Siena 23, Viale del Policlinico. Ich übernehme. Erreiche Via degli Ausoni 8 in etwa fünf Minuten.«
»Ach, Siena 23, deine Mutter hat angerufen. Sie sagt, sie hat ein Gewerkschaftstreffen heute Abend und es wird vielleicht spät werden.«
»Verstanden. Danke.«
»Anscheinend geht es ihr schon wieder besser …«, meinte die Stimme ironisch, dann brach das Gespräch ab.
3
Vor dem Eingang einer Mietskaserne im San-Lorenzo-Viertel wartete schon eine schlanke, elegante Blondine auf sie.
Deboras Wagen war noch nicht ganz zum Halten gekommen, da war die Signora schon eingestiegen. Sie musste es sehr eilig haben.
»Bringen Sie mich bitte in die Via Bartoloni.«
Debora hantierte an ihrem Navi. Sie war in Ostia aufgewachsen, und bevor sie die Taxilizenz vom Vater geerbt hatte, war sie nur am Samstagabend nach Rom ins Zentrum gekommen, um sich mit Freunden an stets denselben Orten zu treffen: Via del Corso, Campo de’ Fiori, Trastevere. Nun entdeckte sie neue Viertel und machte sich diese Stadt, die Grande Bellezza, Stück für Stück zu eigen.
Die Dame half ihr: »Das ist eine Querstraße vom Viale Parioli.«
Daraufhin ließ Debora das Navi außer Acht, das ohnehin noch nichts ausgespuckt hatte, und fuhr los.
Besorgt sah die Signora auf ihre Uhr, dann holte sie ihre Puderdose aus der Tasche. Sie richtete sich vor dem Spiegel die leicht derangierten Haare und zog ihren Lippenstift nach.
Bei jedem Ampelstopp beobachtete Debora sie heimlich im Rückspiegel. Das machte sie bei allen Kunden. Am Anfang eher schüchtern aus dem Augenwinkel, aber mit der Zeit war sie selbstsicherer geworden und tat es jetzt ziemlich unverblümt. Sie war neugierig, beobachtete gern ihre Fahrgäste und stellte sich dabei vor, wer sie wohl waren, was sie machten, wohin sie fuhren und aus welchem Grund. Das liebte sie an ihrem Beruf, den sie sich ja nicht ausgesucht hatte und zu dem sie der Zufall, oder besser gesagt ein Unglücksfall gebracht hatte. Manchmal, wenn Kunden sie allzu neugierig machten, versuchte sie auch, ein Gespräch anzufangen. Doch im Allgemeinen reichte es ihr, sie ausgiebig zu studieren.
Die Signora hatte ihren Lippenstift nachgezogen – ein Zyklamrot, das hervorragend zu ihrem hellen Teint und den grünen Augen passte – und legte nun Puder auf. Immer wieder unterbrach sie ihre Verschönerungsmaßnahmen, um einen nervösen Blick auf ihre Uhr zu werfen. Als sie ins Taxi gestiegen war, hatte Debora sie auf fünfunddreißig geschätzt. Groß und schlank, eine perfekte, noch mädchenhafte Figur. Doch während sie das Gesicht im Rückspiegel betrachtete, waren ein paar Jahre dazugekommen. Vierzig? Fünfundvierzig, aber gut gehalten? Oder fünfzig, aber dann wirklich fantastisch gehalten? Bei diesen Damen aus den wohlhabenden Vierteln konnte man das nie so genau sagen, wenn sie mit ihren Töchtern ins Fitnessstudio gingen, sahen sie wie deren ältere Schwestern aus. Sie musste an ihre Mutter denken: Seit sie verwitwet war, ging sie nicht einmal mehr zum Friseur.
Inzwischen hatte die Signora aus ihrer Gucci-Handtasche einen Parfümflakon hervorgeholt und besprühte sich damit ausgiebig. Ein intensiver, leicht pudriger Blumenduft erfüllte den Wagen.
»Mmh, riecht das gut! Was für ein Parfüm ist das?«
»Ein englisches. Ich benutze es seit zwanzig Jahren, aber mittlerweile wird es nicht mehr hergestellt, man bekommt es kaum noch.«
»Schade, ich hätte es gern meiner Mutter geschenkt …«
Die andere verzog den Mund zu einem Lächeln, doch es wurde eher eine Grimasse.
Aus ihrer Gucci-Tasche schrillte jetzt der Türkische Marsch von Mozart. Die Signora zuckte zusammen. Hastig holte sie ihr Smartphone hervor, sah dann aber zunächst aufs Display, ohne den Anruf anzunehmen. Unentschlossen hielt sie das Telefon in der Hand, doch dann ging sie schließlich dran.
»Ja, was gibt’s?«
»…«
»Warum bist du noch da?« Sie wirkte verärgert. »Jetzt kann ich nicht. Es ist zu spät.«
»…«
»Ich habe dir alles gesagt. Nun ist es genug.«
Obwohl sie leise sprach, konnte Debora alles verstehen. Sie bemerkte, dass die Stimme der Frau zitterte.
»Bitte dräng mich nicht weiter.«
Darauf schien ihr Gesprächspartner etwas zu sagen, das sie erschreckte.
»Was fällt dir ein! Bist du verrückt?«, wurde sie kurz laut, senkte die Stimme jedoch gleich wieder. »Na gut, ich komme zurück und dann reden wir darüber. Aber beruhige dich … Und tu es nicht. Bitte.«
Rasch beendete sie das Gespräch. Dann legte sie mit einer spontanen, beinahe vertraulichen Geste ihrer jungen Fahrerin die Hand auf die Schulter.
»Würden Sie mich bitte zurückbringen?«
Als Debora plötzlich diese knochigen Finger auf ihrer Schulter spürte, erschrak sie fast.
Sie bremste abrupt und fuhr an den Straßenrand, was ihr einen Stinkefinger von ihrem Hintermann eintrug, und drehte sich zu ihrem Fahrgast um.
Eine schöne Frau, ganz egal, wie alt sie nun wirklich war und wie gut oder weniger gut sie sich gehalten hatte. Schön und völlig durcheinander.
»Wohin wollen Sie zurück?«
»In die Via degli Ausoni. Ich habe dort etwas vergessen«, stammelte die Frau, als müsste sie sich vor Debora rechtfertigen.
Mit der für die Bewohner Roms typischen Nonchalance und Schicksalsergebenheit zuckte Debora nur mit den Schultern. »Kein Problem …«
Auf der Fahrt zurück nach San Lorenzo herrschte im Taxi Grabesstille. Die Signora starrte mit traurigen Augen verloren aus dem Fenster. Jetzt wirkte sie beinahe älter als ihre Mutter, dachte Debora, die sich inzwischen fühlte, als würde sie ihren Gast zu einer Beerdigung fahren. Mehr als einmal war sie drauf und dran, die Frau zu fragen, was vorgefallen war. Sie hatte sich schon öfter hemmungslos in die persönlichen Angelegenheiten ihrer Kunden eingemischt, wenn ihre Neugier sie zu sehr quälte. Aber in diesem besonderen Fall traute sie sich nicht, aus Angst, ihren Fahrgast aus ihrem ohnehin schon sichtlich wackligen Gleichgewicht zu bringen. Die Frau schien mit den Tränen zu kämpfen, ein falsches Wort hätte alle Schleusentore öffnen können.
Kaum hatten sie die Via degli Ausoni erreicht, kramte die Signora in ihrer Handtasche nach dem Portemonnaie. »Was macht das?«
Sie war so aufgeregt, dass sie in ihrer Hektik alles hervorholte: Schlüssel, Handy, Brille, Puderdose … Dabei zitterten ihr die Finger.
Debora sah auf den Taxameter. »Das sind dann fünfundzwanzig Euro …«
Inzwischen hatte die Signora ihr Portemonnaie gefunden, natürlich wie die Handtasche von einer Nobelmarke. Sie holte einen Fünfziger hervor und wollte ihn gerade nach vorn reichen, als sie in der Bewegung innehielt. Sie sah Debora an, als wollte sie ihr etwas sagen. Ihr Blick schien sie geradezu anzuflehen.
»Könnten Sie hier auf mich warten? Ich spring nur kurz hoch, hole das, was ich vergessen habe, und dann fahren Sie mich zurück ins Parioli-Viertel.«
Debora akzeptierte ihre Bitte mit demselben ergebenen Schulterzucken wie vorher.
»Kein Problem. Ich rauch dann mal eben eine.«
Die Dame sammelte ein, was sie in ihrer Hektik aus der Handtasche geholt hatte, und warf es einfach dorthin zurück. Kurz darauf war sie im Eingang des Wohnhauses verschwunden.
Debora schob ihren Sitz zurück, streckte die Beine aus, zog ein Päckchen Camel Blue aus ihrer Tasche, holte eine Zigarette heraus und zündete sie an. Genüsslich inhalierte sie den Rauch. Sie schloss die Augen und ließ sich von den lauten Geräuschen der Großstadt einlullen. Nichts entspannte sie mehr als Chaos. Der Lärm um sie herum erinnerte sie an ihre Kindheit, wenn sie vor dem dröhnenden Fernseher einschlief und ihr Vater sie dann wie eine Puppe auf seinen Armen ins Bett trug, während sie selig vor sich hin dämmerte und davon überhaupt nichts mitbekam. Diese Geräusche – die Motoren, das Geschrei, das Hupkonzert, ein bellender Hund irgendwo – waren das Leben, das um sie herum tobte und über sie wachte, während sie in aller Seelenruhe mit den Gedanken ganz woanders sein konnte. Stille dagegen jagte ihr Angst ein. Die erinnerte sie an den Tod. Wobei sie weniger an ihren eigenen Tod denken musste als an die Menschen, die nicht mehr waren. Ihre Großmutter, eine Lehrerin aus der Mittelstufe, einer ihrer Freunde, der mit dem Mofa verunglückt war. Und vor allem musste sie an ihren Vater denken.
Als Debora die Augen öffnete und auf ihren Taxameter sah, stellte sie fest, dass fast eine halbe Stunde vergangen war. Vielleicht war sie eingeschlafen, ohne es zu merken.
Sie hupte einmal laut, nur um die Dame daran zu erinnern, dass sie hier unten wartete und der Taxameter immer noch lief.
Es vergingen weitere zehn Minuten, aber von ihrem Fahrgast keine Spur. Debora stieg aus dem Taxi und trat in den Hauseingang.
Es handelte sich um einen großen Wohnblock mit weitläufigem Hof, um den sich weitere kleinere Häuser gruppierten. Gerade kam eine alte Frau mit einem Kinderwagen eine Treppe herunter. Debora fragte sie, ob sie eine elegante blonde Dame um die vierzig gesehen habe …
Die Frau schüttelte den Kopf. »Sind Sie sicher, dass die hier wohnt?«
Von draußen hörte man ein lautes Hupen.
»Entschuldigen Sie, ich muss mein Taxi woanders abstellen …«
Die alte Frau bückte sich, um den Schnuller aufzuheben, den ihr Enkel auf den Boden geworfen hatte. »Geh nur, Schätzchen, tut mir leid, ich kann dir nicht weiterhelfen. Also hier auf meiner Seite wohnt so eine bestimmt nicht …«
Das Taxi versperrte einem verbeulten Panda den Weg, dessen Fahrer, ein junger Mann mit Bart, bereits tobte und in einer Tour hupte und dabei brüllte:
»Verfluchte Scheiße, welches Arschloch lässt denn sein Taxi so bescheuert stehen?«
Debora packte ihr strahlendstes Lächeln aus und spielte das Dummchen. »Entschuuuldigung … Ich bin sofort weg.«
Der junge Mann, das Gesicht feuerrot und die Halsschlagader schon kurz vorm Platzen, stellte sein Gebrüll so schlagartig ein, wie ein Auto mit hundertachtzig Stundenkilometern eine Vollbremsung hinlegt. Sein wutverzerrtes Gesicht zeigte jetzt ein verlegenes Lächeln. Er stammelte ein »Tut mir leid … aber ich muss dringend was erledigen … bin schon spät dran …«.
Debora machte eine beschwichtigende Geste, um ihm zu zeigen, dass sie das Arschloch nicht persönlich genommen hatte.
Sie hatte gerade den Motor angelassen, als es an das Beifahrerfenster klopfte. Sie wandte den Kopf und blickte direkt in zwei schwarze Augen.
»Hör mal, darf ich dich auf einen Kaffee einladen, um mich zu entschuldigen?«
Dieses Gesicht, das sich an die Fensterscheibe quetschte, sah äußerst komisch aus. Debora musste an die Fische im Aquarium von Genua denken, die, angezogen vom Licht und den Besuchern, ihre Münder an die Glasscheiben pressten. Sie ließ das Fenster herunter.
»Danke, ich habe schon gefrühstückt. Außerdem bin ich gerade auf Diät. Und hast du nicht gesagt, du bist spät dran?«
Der Typ versuchte es auf die romantische Tour. »Ich bin superspät dran, aber es gibt Menschen, denen man nicht jeden Tag begegnet.«
Debora zögerte kurz. Im Grunde war dieser bärtige Kerl gar nicht mal so übel. Welchen Beruf er wohl hatte? Dem Tonfall nach konnte er nicht aus Rom sein, eher von viel weiter nördlich …
»Ich kann nicht, ich warte auf eine Kundin, die in das Haus hier gegangen ist … Seit heute Morgen fahre ich die schon durch die Gegend. Wenn ich die jetzt versetze, sind zwei Stunden Arbeit beim Teufel.«
Der junge Mann begriff, dass dieses »Jetzt« die vage Möglichkeit offen ließ, dass sie seinen Vorschlag irgendwann einmal in einer unbestimmten Zukunft annehmen könnte, und hakte schnell nach.
»Lass es uns so machen: Wenn du mal Lust auf eine Einladung zum Frühstück hast, ruf mich an …«, und mit diesen Worten zog er eine offensichtlich selbst gemachte Visitenkarte hervor und gab sie ihr.
»Okay. Ciao, man sieht sich …«, erwiderte Debora freundlich-unverbindlich, wie es in Rom üblich war und man sich in ihrer Generation alle Optionen offenhielt.
Als der Panda und sein Fahrer im Anmachmodus verschwunden waren, holte Debora das grüne Kärtchen, das sie eben mit gekonnt lässiger Geste eingesteckt hatte, hervor und las: »Fabrizio Comin. Zimmermann.«
Alle Zimmerleute, die sie bislang kennengelernt hatte, waren schon älter, was bei Debora Ü40 bedeutete. Junge Leute wie sie arbeiteten in Bars oder als Automechaniker, die mit Uniabschluss als Vermessungsingenieur, doch die meisten waren arbeitslos. Zimmermann jedenfalls war niemand. Noch dazu aus dem Norden. Dem Nachnamen nach kam er aus dem Veneto. Was wollte ein junger Schreiner von dort in Rom?
Die krächzende Stimme aus dem Funkgerät holte Debora wieder aus ihren Gedanken.
»Siena 23, wo steckst du denn? Seit heute Morgen neun Uhr nimmst du keine Aufträge mehr an.«
Debora seufzte tief und steckte die Visitenkarte ein.
»Wo ich stecke? Seit einer Stunde stehe ich in der Via degli Ausoni und warte auf meine Kundin, die in einem Haus verschwunden ist!«
»Du stehst da seit neun Uhr? Sag mal, tickst du noch richtig?« Die Angestellte der Kooperative war ziemlich direkt. »Willst du nicht mal da klingeln?«
»Bei wem denn? Es gibt acht Treppenaufgänge. Hat sie keine Telefonnummer hinterlassen, als sie bei euch angerufen hat?«
»Einen Augenblick, Siena 23. Bleib in der Leitung«, erwiderte die Stimme und klang plötzlich wieder ganz professionell.
Ein paar Minuten lang war die Verbindung unterbrochen. Debora nutzte die Zeit, um einige Male zu hupen. Nichts passierte.
Als die Stimme sich wieder meldete, dann nur, um ihr mitzuteilen, dass sich unter der Handynummer, die die Kundin hinterlassen hatte, niemand meldete, und um Debora zu raten, dass sie das Ganze am besten vergaß, wenn sie nicht nur einen Vormittag Arbeit, sondern gleich den ganzen Tag in den Wind schreiben wollte.
»Und lass dich nicht noch mal von Kunden aus dem Parioli-Viertel bescheißen. Das sind die Schlimmsten«, fügte sie noch hinzu, wie eine, die wusste, wovon sie sprach.
Deboras Laune war im Keller. Der Morgen war bisher eine einzige Katastrophe gewesen, wenn man mal von der Begegnung mit dem Heiligen Josef aus Padanien absah, den sie sowieso nicht anrufen würde, teils aus Faulheit, teils aus Schüchternheit, und weil sie, um es mit den Worten ihrer Mutter auszudrücken, die eine von Leopardi geprägte Weltsicht hatte, »ja doch nichts verpasste«.
Jetzt war es beinahe Mittag, und seit heute früh hatte sie außer einem schwarzen Kaffee nichts zu sich genommen. Debora beschloss, ihre Freundin Jessica anzurufen, die seit Neuestem als Verkäuferin im Dessousladen Intimissimi in der Via Nazionale arbeitete, um ihr vorzuschlagen, gemeinsam etwas zu essen. Nur eine Kleinigkeit natürlich, ein paar Scheiben Bresaola mit Rucola. Oder besser Bresaola und sonst nichts, weil ihr Schlankheitspapst seinen Jüngern predigte, dass sie nur Proteine essen sollten.
Debora und Jessica hatten gemeinsam die Schule besucht – von der Grundschule bis zum Gymnasium. Nach dem Abitur wollte Debora zur Polizei, und Jessica wollte Modedesignerin werden. Jetzt fuhr die eine Taxi, während die andere für tausend Euro im Monat in einer Wäscheboutique Slips und BHs verkaufte.
Als Jessica durchs Schaufenster Deboras Taxi entdeckte, winkte sie ihr, sie solle warten. Hinter den Schaufensterpuppen, die Babydolls und Höschen präsentierten, sah Debora ihre Freundin heftig mit ihrer Vorgesetzten diskutieren, einer korpulenten Frau um die fünfzig.
Einen Augenblick lang beglückwünschte sich Debora zu ihrer Arbeit, bei der sie niemanden um Erlaubnis fragen musste, wenn sie sich mal ein Brötchen holen wollte.
Schließlich kam Jessica mit triumphierendem Gesicht aus dem Laden. Sie hakte sich bei Debora unter und lief rasch los, um so schnell wie möglich ihrer Gefängniswärterin zu entkommen.
»Stell dir vor, die Buzzicona wollte mir nur eine halbe Stunde Pause geben. Soll ich mein Essen etwa runterschlingen? Die hat was zu hören bekommen! ›Also wenn in den heutigen Zeiten in der Stunde mal drei Kunden kommen, kann man sich das schon im Kalender anstreichen‹, hab ich zu ihr gesagt. Was meinst du, gehen wir zu McDonald’s?«
Debora stimmte zu, nahm sich jedoch vor, getreu ihrem heiligen Eid im Kampf gegen die Kohlenhydrate nur einen Hamburger ohne Brötchen zu bestellen. Tatsächlich stopften sich die beiden Freundinnen mit Cheeseburgern und Pommes mit Ketchup voll.
»Ach egal, fang ich eben Montag mit der Diät an.«
Das fand Jessica prima, und sie stießen mit zwei Maxibechern Cola darauf an.
»Was machen wir morgen? Du hast keine Schicht, oder?«, fragte Jessica mit leuchtenden Augen.
Debora schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin frei wie ein Vogel.«
»Dann lass uns ans Meer fahren!«
Jessica konnte es gar nicht erwarten, sich in einem Bikini aus der neuen Kollektion zu präsentieren, den sie sich mit dreißig Prozent Personalrabatt gekauft hatte. Debora war weniger darauf aus, sich in Badekleidung zu werfen. Sich aus den vielen Hüllen zu schälen, mit denen sie im Winter ihre Rundungen kaschierte, war ihr unangenehm, sie hätte das gern auf die Zeit nach ihrer Diät verschoben. Sie würde sich in den langen Cardigan wickeln müssen, der Hüften und Po bedeckte, ihre vermeintlichen Problemzonen, die sie mindestens genauso verachtete wie all die Männer, die sie gerade deswegen wohlwollend taxierten. Sie war noch nicht bereit, sich halb nackt vor aller Augen zu zeigen. Ach ja, und ihre Beine hatte sie auch nicht enthaart … Sie versuchte einen schwachen Protest.
»Also ich denke, es ist noch zu kalt für den Bikini …«
»Ach komm! Ich habe schon die Wettervorhersage gecheckt, morgen scheint den ganzen Tag die Sonne. Kein Wölkchen am Himmel.« Jessica klang nun fast wie die Wetterfee im Fernsehen. »Heiter und sonnig an der gesamten Küste des Lazio und am Wochenende steigende Temperaturen …«
Bei den Worten ihrer Freundin hatte Debora gleich den Duft von Salzwasser, Kiefernnadeln und Sonnenöl in der Nase. Sie konnte förmlich die laue Meeresbrise auf ihrer Haut spüren, die all die Monate in der Winterkleidung wie in Folie eingeschweißt gewesen war, meinte fast zu fühlen, wie die Füße ins kühle Wasser eintauchten, das von der ersten Frühlingssonne erwärmt wurde …
Jessica hatte sich inzwischen ihr Handy geschnappt und setzte ihren Plan um, ohne sich darum zu kümmern, dass ihre Freundin noch zögerte.
»Ich habe Cristian auf WhatsApp geschrieben. Er sagt, dass sie heute das Strandbad aufgemacht haben! Ich kann ja wohl hellsehen, oder?«
Angesichts von Jessicas Begeisterung und voller Vorfreude auf den freien Sonntag beschloss Debora, ihre Bedenken wegen der paar Kilos zu viel, ihrer blassen Winterhaut und den störenden Härchen an den Beinen einfach über Bord zu werfen. Sie begleitete Jessica zum Laden zurück, wo deren Chefin sie bereits angriffslustig erwartete, weil sie fünf Minuten zu spät kam, und versprach ihr, dass sie sich am nächsten Tag Punkt elf Uhr im Sirena treffen würden, dem Strandbad mit angeschlossenem Restaurant, das die Familie ihres Freundes Cristian betrieb.
4
Es war Anfang April und die Tage wurden allmählich länger. Die meisten Strandbäder waren noch geschlossen, und am Strand hielten sich nur vereinzelte Mutige auf, die den Beginn der schönen Jahreszeit mit einem Ausflug ans Meer feiern wollten. Debora liebte diese Zeit. Es war eine gute Entscheidung gewesen, Jessicas Betteln nachzugeben, obwohl sie noch nicht sicher war, ob sie tatsächlich einen Bikini anziehen und die Speckröllchen, die zu allem Unglück durch ihre milchweiße Haut noch betont wurden, in aller Öffentlichkeit präsentieren sollte …
Als sie mit der üblichen Viertelstunde Verspätung eintraf, entdeckte sie sofort Cristian am Strand und winkte ihm, er antwortete mit einem gellenden Pfiff. Cristian hatte von der Mittelstufe bis zum ersten Jahr der Oberstufe die gleiche Klasse besucht wie sie. Dann war er sitzen geblieben, woraufhin sein Vater, der Betreiber des Strandbades, beschlossen hatte, dass es nun genug sei mit der Bildung, und ihm einen Job im Familienbetrieb gegeben hatte. Cristians Mutter arbeitete in der Küche, die Schwester bediente an den Tischen, und er stellte die Liegen und Sonnenschirme auf und räumte sie am Abend wieder weg.
Debora ging zu ihm. Jessica hatte es sich schon auf einer Liege bequem gemacht und sonnte sich. Sie trug einen türkisfarbenen Bikini, bestehend aus einem Push-up-Oberteil, das ihren kleinen Busen um zwei Nummern vergrößerte, und einem Tanga, der hinten etwa so breit war wie Zahnseide.
Cristian saß ihr zu Füßen und sah sie bewundernd an. Jessicas schlanke Figur weckte, trotz oder gerade wegen ihrer winterlichen Blässe, seit jeher sein leider unerwidertes Begehren. Er probierte es bei ihr, seit sie vierzehn war, eine Treue, die eigentlich Belohnung verdient hätte. Aber Jessica erhörte ihn nicht, weil sie Cristian für dumm und beschränkt hielt und er keine breiten, muskulösen Schultern vorweisen konnte. Von diesen drei Makeln war der letzte am unverzeihlichsten. Deswegen konnte Debora leider keine Lanze für ihn brechen, denn über die ersten beiden Fehler konnte man streiten, doch der dritte war eine Tatsache, die auch der beste Anwalt nicht hätte wegdiskutieren können.
»Hey, Prinzessin!«, begrüßte sie der junge Mann ohne Schultern, sobald Debora zu ihnen kam. »Wie geht’s?«
»Alles okay. Wie ist das Wasser?«
»Na ja, bestimmt eiskalt«, sagte Jessica. »Ich friere jetzt schon. Immerhin soll es wärmer werden.«
Doch gerade in dem Moment kam eine kühle Brise auf, die die Meeresoberfläche kräuselte. Jessica erschauerte, und Cristian nutzte die Gelegenheit, sie in ein großes weiches Handtuch zu hüllen.
Debora schlüpfte sofort aus ihren Supergas. Es fühlte sich einfach fantastisch an, mit nackten Füßen im Sand zu laufen. Manchmal kam sie auch im Winter an den Strand und zog Schuhe und Strümpfe aus, nur um zu spüren, wie sie in dem weichen Sandteppich versanken.
»Also, ich geh mal das Wasser checken. Ihr zwei stellt euch ja an wie alte Omas …«
Sie rollte sich die Jeans bis zu den Knien hoch und lief auf das Wasser zu. Der Strand war so gut wie menschenleer. Die Familien würden erst später zum sonntäglichen Picknick kommen. Auf diesem handtuchbreiten Strandabschnitt tummelten sich momentan: ein paar Damen im Jogginganzug, die am Wasser entlangtrabten in der Hoffnung, auf diese Weise etwas für ihre Bikinifigur zu tun; ein Pärchen, das, reglos ineinander verschlungen, dalag wie ein Marmordenkmal und heftig knutschte – zu alt, um verlobt, zu intim, um verheiratet zu sein; ein Rentner mit einer ausgebreiteten Zeitung auf den Knien, der vor sich hin döste. Debora sah sich alle eingehend an, und über jeden stellte sie tausend Überlegungen an, dachte sich Geschichten, Lebensläufe, Wohnsitze, Berufe, Liebesgeschichten aus …
Das Meer war leicht bewegt und trüb. Die Wellen trugen grüne Algen ans Ufer, auf der Oberfläche trieb ein bräunlicher Schaum. Plötzlich wühlte eine stärkere Windbö das Wasser auf. Debora sprang zurück, wurde aber dennoch kräftig nass gespritzt. Der ältere Herr war aufgewacht und jagte seiner davonfliegenden Zeitung hinterher. Die auseinandergerissenen Seiten trieben über den Sand, während der arme Mann keuchend, aber erfolglos versuchte, sie einzufangen. Ihm hing beim Laufen fast die Zunge heraus, und Debora dachte, dass er so enden könnte wie ihr Vater. Nur deswegen kam sie ihm trotz ihres klatschnassen T-Shirts zu Hilfe. Die Seiten wirbelten davon, doch Debora erreichte sie schließlich und begrub sie unter sich, bekam fast alle zu fassen. Doch was sie nun in den Händen hielt, war weniger eine Zeitung als ein unförmiges Papierknäuel. Sie versuchte, es wieder in etwas zu verwandeln, das den Namen Zeitung verdiente, ehe sie sie ihrem Besitzer übergeben würde. Dieser winkte ihr aus der Entfernung zu, um ihr schon mal zu danken, während er im Rentnertempo auf sie zutrottete. Debora fischte die erste Seite aus dem Papierknäuel, strich sie glatt und versuchte, auch die anderen zusammenzulegen, ohne sich lange mit der richtigen Reihenfolge aufzuhalten. Der Lokalteil war so zerknüllt, dass die Seiten eigentlich nur noch zum Einwickeln von Lupinen taugten. Doch als sie ihn neu falten und wieder in Form bringen wollte, erregte etwas ihre Aufmerksamkeit.
Eine Schlagzeile. Oder vielmehr das Foto, das den Artikel begleitete. Einen Moment lang stand sie wie versteinert da und hielt das Zeitungsblatt vor sich in die Luft.
Noch bevor sie sich aus ihrer Starre lösen konnte, drang die Stimme des Rentners zu ihr durch. »Signurì, das wäre doch nicht nötig gewesen!«
Er war nur noch wenige Meter entfernt und schien sich sogar über dieses unerwartete Ereignis zu freuen, das etwas Aufregung in seinen Tag brachte.
Debora wandte ihm rasch den Rücken zu, und während sie so tat, als würde sie noch immer die Zeitung zusammenlegen, riss sie die oberste Lokalseite heraus. Da ihr nichts Besseres einfiel, schob sie die Seite zusammengefaltet unter ihr T-Shirt, genauer gesagt, klemmte sie sich unter den Bikiniträger.
Inzwischen war der Mann herangekommen. Debora legte den Rest der Zeitung zusammen und reichte sie ihm.
»Danke, vielen Dank«, keuchte er völlig außer Atem. »Ich hatte gerade erst angefangen zu lesen.«
Er war nicht von hier. Seinem Akzent nach musste er aus der Ciociara, der Pontinischen Ebene oder den Castelli Romani kommen. Echte Römer machten da sowieso keinen Unterschied. Sie hatten nur ein einziges Wort für solche Leute: burino – Bauerntrampel. Der Unterschied zwischen den zahlreichen Dialekten der Region Lazio war für sie derselbe wie für einen Bewohner der westlichen Welt der zwischen einem Chinesen und einem Koreaner. Nämlich gar keiner.
Debora verabschiedete sich hastig und eilte davon, während der Rentner ihr noch immer atemlos hinterherrief: »Sie können aber schnell rennen, Signurì!«
Debora hatte es eilig, allein zu sein, um den Zeitungsartikel, den sie nun fest in der Hand hielt, in Ruhe zu lesen.
Sie faltete das Blatt rasch auseinander, gerade so weit, dass sie die Schlagzeile lesen konnte, und betrachtete ungläubig das Gesicht der blonden Frau, das ihr von dem Foto entgegenlächelte.
Debora hatte gehofft, sie habe sich getäuscht oder ihre Fantasie habe ihr einen Streich gespielt. Aber als sie das Bild genauer betrachtete, stand fest: Obwohl die Frau auf dem Foto lange, vom Wind zerzauste Haare hatte, war das eindeutig ihr Blick. Debora sah sie genau vor sich, hörte ihre ängstliche Stimme, spürte die knochige Hand, die ihre Schulter umklammerte. Die Erinnerung an die blonde Dame wurde so lebendig, als säße sie immer noch in ihrem Taxi. Sie schluckte schwer.
Debora las noch einmal die Überschrift des Artikels, ehe sie begriff, dass es keinen Zweifel gab.
DAMEDERGESELLSCHAFTERWÜRGTINWOHNUNGIMSAN-LORENZO-VIERTELAUFGEFUNDEN
Das war sie, die Signora, die von ihr in die Via degli Ausoni zurückgebracht werden wollte und dann nicht mehr wiedergekommen war. Nun wusste Debora, warum …
Sie durfte jetzt nicht in Panik geraten, sie musste den Artikel in Ruhe und mit klarem Verstand lesen, an einem Ort, wo das möglich war. Also riss sie sich zusammen, faltete das Zeitungsblatt zweimal und steckte es in die Tasche ihrer Jeans. Dann atmete sie einmal tief ein und wieder aus und ging zu ihrem »Basislager« zurück, als ob nichts geschehen wäre.
Jessica war inzwischen, in das Frotteehandtuch eingekuschelt, auf der Liege eingedöst. Verschlafen öffnete sie ein Auge. Debora schlüpfte in ihre Schuhe.
»Na, wie ist das Wasser?«
»Kalt und dreckig. Was ist mit Cristian?«
»Der muss seinem Vater im Restaurant helfen. Er fragt, ob wir zum Essen bleiben wollen.«
»Nein, ich fahr gleich nach Hause.«
Jessica hob den Kopf und sah sie traurig an wie ein Hund, der es sich in seinem Körbchen gemütlich gemacht hat und nun hört, dass sein Herrchen ohne ihn aus dem Haus will.
»Wie, du fährst schon? Was soll der Mist, du kannst mich doch jetzt nicht einfach hier sitzen lassen! Du hast mir versprochen, dass wir den Tag gemeinsam am Meer verbringen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich mit meinem Bruder und seinen Freunden ins Stadion gegangen …«
»Ja, ich weiß, aber mir geht’s nicht so gut. Mein T-Shirt ist klitschnass … ich hab Bauchschmerzen, vielleicht bekomme ich meine Tage.«
Jessica sah betrübt zu, wie ihre Freundin die Sachen packte. Dieser Tag, der so schön begonnen hatte, nahm eine unerfreuliche Wende.
»Toll, du lässt mich einfach mit Cristian allein, bestimmt klebt der gleich wieder wie eine Klette an mir …«, jammerte sie. »Aber später telefonieren wir noch mal, ja? Und wenn du dich besser fühlst, gehen wir dann ins Kino?«
»Okay. Schau schon mal nach, was im Multiplex läuft. Ich ruf dich nachher an«, sagte Debora, um ihre Freundin nicht zu verärgern.
Debora wusste, dass sie log, aber sie konnte nicht anders. In ihrem Kopf lief bereits ein Film ab, und den würde sie so schnell nicht loswerden.
5
Als sie nach Hause kam, saßen ihre Mutter und ihr Bruder vor dem eingeschalteten Fernseher beim Essen. Nudeln mit Hackfleischsoße, den Geruch hatte sie bereits im Treppenhaus bemerkt. Wie in allen Mietskasernen roch es am Sonntag in Deboras Wohnblock von allen Seiten. Der Duft von gegrillten Paprikaschoten, Braten, angedünsteten Zwiebeln, Nudelsoßen und frittiertem Gebäck vermischte sich und verteilte sich im ganzen Haus vom Eingangsbereich bis hoch zum fünften Stock.
Sobald ihre Mutter sie sah, versuchte sie, sie aufzuhalten.
»Bist du schon zurück vom Meer? Soll ich dir einen Teller Nudeln bringen?«
»Nein danke, Mama. Ich habe im Sirena schon ein Stück Pizza gegessen«, log Debora.
Auch jetzt schob sie wieder das nasse T-Shirt vor, sagte, dass sie sich sofort umziehen müsse, weil sie schon eine Erkältung aufkommen spüre. Damit gab ihre Mutter, die das Thema Gesundheit sehr ernst nahm, sich zufrieden.
Sobald sie sich im Bad eingeschlossen hatte, schlüpfte Debora aus dem T-Shirt, vor allem, um ihren Ausreden Taten folgen zu lassen. Dann zog sie den Zeitungsausschnitt hervor, setzte sich auf den Toilettendeckel und begann aufmerksam zu lesen.
Der Journalist schrieb, dass die Frau um fünf Uhr nachmittags vom Wohnungseigentümer aufgefunden worden war, einem einundfünfzigjährigen Fotografen und Freund des Opfers, der in Filmkreisen recht bekannt war. Der Mann war gerade aus Mailand zurückgekehrt, wo er sich wegen einer Reportage zwei Tage aufgehalten hatte, und hatte die Frau halb entkleidet auf seinem Bett vorgefunden. Er hatte zunächst versucht, Erste Hilfe zu leisten, doch nachdem er festgestellt hatte, dass seine Freundin tot war, hatte er die Polizei gerufen. Die »Signora« hieß Monica Costa, sie war die Frau eines bekannten Chirurgen und hatte eine einundzwanzigjährige Tochter. Niemand wusste genau, wie sie an die Schlüssel zur Wohnung des Fotografen gekommen war. Der Mann wurde derzeit noch zur weiteren Klärung des Vorfalls vernommen, obwohl sein Alibi anscheinend bestätigt worden war.
Mehr stand nicht in dem Artikel. Debora kehrte in Gedanken zu ihrer »Kundin« zurück, die sie jetzt allerdings nicht mehr nur als solche sehen konnte. Sie dachte an die elegante Signora, die erst vor einem Tag in ihrem Taxi gesessen und sich mit englischem Parfüm eingesprüht hatte. Sie erinnerte sich, wie sorgfältig sie sich gekämmt und Lippenstift aufgelegt hatte, wie sie versucht hatte, ihr Aussehen zu perfektionieren, nichts sollte nachlässig wirken, jedes einzelne Haar sitzen, die Haut makellos, kein Fleck auf dem Kleid zu sehen sein …
Sie stellte sich diesen halb nackten Körper auf dem Bett vor, die Strümpfe heruntergezogen, das bläulich angelaufene Gesicht im gewaltsamen Tod erstarrt, die Würgemale am Hals. Und ihr ging durch den Kopf, dass diese Frau vielleicht, wenn sie selbst hartnäckiger gewesen wäre, wenn sie alle Klingeln gedrückt, wenn sie nicht ihre Zeit mit der Oma und ihrem Enkel, dem flirtenden Zimmermann oder beim Herumstreiten mit der Angestellten der Taxikooperative vergeudet hätte, wenn sie stattdessen alle Treppenaufgänge abgesucht und an alle Türen geklopft hätte, um ihre »Kundin« wiederzufinden, die sie doch gebeten hatte, ihr zu helfen, auf sie zu warten, sie zu beschützen und nicht dort allein zu lassen mit jemandem, der ihr Angst machte, aber zu dem sie trotzdem zurückgekehrt war … also, wenn sie nicht weggefahren wäre, vielleicht wäre dann diese Frau, Monica Costa, eine Dame der Gesellschaft aus dem Parioli-Viertel, noch am Leben.
Debora blieb eine ganze Weile auf dem Toilettendeckel sitzen, bis ihre Mutter besorgt an die Tür klopfte.
»Debora, was ist los? Geht es dir nicht gut? Ist dir die Kälte auf den Magen geschlagen?«
»Nein, nein, Mama, alles in Ordnung. Ich habe mir nur die Haare gewaschen, die waren voller Sand.«
Sie wickelte sich ein Handtuch wie einen Turban um den Kopf, das nasse T-Shirt ließ sie zur Bestätigung ihrer Geschichte auf dem Boden liegen.
Ihre Mutter stand ausgehfertig vor ihr und erklärte: »Ich gehe zur Nachbarin im zweiten Stock, um ihr ihre Spritze zu geben. Falls du doch noch Hunger bekommst – ich habe dir ein paar Nudeln im Topf gelassen. Die sind noch warm. Und föhn dir die Haare, sonst erkältest du dich noch …«
Debora schlüpfte in ihr Zimmer und schloss schnell die Tür hinter sich. Sie warf sich aufs Bett und starrte die Decke an. So blieb sie liegen, bis es Zeit fürs Abendessen war.
6
Debora konnte nicht schlafen. Sie knipste mindestens dreißig Mal ihre Nachttischlampe in Form eines Leuchtturms an und wieder aus. Sobald sie versuchte, die Augen zu schließen, sah sie Monica Costa wieder vor sich. Nicht die Frau, die sie vor nicht einmal zwei Tagen kennengelernt hatte, lebendig und munter, sondern die Frau, die ihr von dem Foto in der Zeitung entgegengesehen hatte, mit den vom Wind zerzausten Haaren und dem anzüglichen Lächeln. Was wollte sie eigentlich von ihr? Im Grunde hatte sie sie doch nur zu ihrem gewünschten Ziel gefahren. Was hatte sie mit dieser Frau zu schaffen, die ihr vollkommen fremd war? Wenn ihr nicht rein zufällig diese Zeitung in die Hände gefallen wäre, hätte sie nie erfahren, was ihr zugestoßen war und welches Ende sie genommen hatte.
Debora sah auf den Wecker: vier Uhr morgens. Schluss jetzt mit den Grübeleien, sie musste schlafen. Sie schaltete das Licht aus, wälzte sich ein paarmal hin und her und schloss die Augen. Aber schon war sie wieder da. Warum? Warum konnte sie sie nicht vergessen, wie all die anderen traurigen Nachrichten aus aller Welt von verhungernden Kindern in Afrika oder vergewaltigten Frauen in Kriegsgebieten? Weil sie diese Frau, die gerade höchstwahrscheinlich auf einem Tisch im Leichenschauhaus lag, kennengelernt, mit ihr gesprochen hatte, weil diese Frau völlig aufgelöst in ihrem Taxi gesessen hatte. Debora hatte sie geradewegs bei ihrem Mörder abgeliefert und nicht nach ihr gesucht, als sie nicht mehr zurückkam. Debora wusste genau, was sie tun musste, in ihrem Inneren hatte sie es gewusst, seit sie am Strand die Schlagzeile gelesen hatte. Im Geiste fuhr sie noch einmal die Straßen von San Lorenzo bis zur Piazza del Verano ab, bis zu dem blau-weiß gestreiften Neonschild mit der Aufschrift Polizei. Erst leuchtete es ganz deutlich vor ihr auf, dann verschwamm es allmählich, bis es schließlich ganz im Nebel verschwand. Dann war alles dunkel.
7
Am nächsten Tag trat Debora Camilli um zehn Uhr morgens durch das große Eingangstor des Polizeireviers von San Lorenzo an der Piazza del Verano. Der Beamte an der Pforte hantierte versunken mit seinem Smartphone herum, allerdings vermutete Debora, dass er wohl eher eine Partie Ruzzle spielte, als dass er mit wichtigen dienstlichen Angelegenheiten beschäftigt war. Widerwillig sah der Polizist von seinem Handy auf und wandte sich ihr zu. Debora hatte für ihren Besuch eine großartige cremefarbene Vintage-Sonnenbrille gewählt, ein Dior-Modell, original made in Taiwan.
»Ich möchte eine Zeugenaussage im Mordfall Costa machen.«
Der Beamte, der ungefähr in ihrem Alter sein musste und ein Kollege von ihr hätte sein können, hätten die Wechselfälle des Lebens sie nicht für die kommenden Jahre an das Steuer eines Taxis gefesselt, sah sie vollkommen desinteressiert an. Etwas ungeduldig ergänzte Debora: »Die Frau, die man in der Via degli Ausoni tot aufgefunden hat.«
Nicht einmal diese Information konnte den Polizisten aus seiner Lethargie reißen. Er ließ sie in einem kleinen Raum im Eingangsbereich Platz nehmen und sagte, sie solle warten, bis ein Kollege sie aufrufen würde.
Der Raum wirkte wie das Wartezimmer eines Arztes der staatlichen Gesundheitsbehörde, hätte nicht an der vergilbten Wand ein Polizeikalender gehangen, auf dem deutlich das Wappen mit dem schwertschwingenden Löwen und dem Leitspruch Sub Lege Libertas prangte. Während Debora ihn betrachtete, musste sie daran denken, wie sie als kleines Mädchen in einem ähnlichen Raum für eine ihr endlos erscheinende Zeit neben ihrer Mutter gesessen hatte. Sie hatten auf dem Markt eingekauft, als plötzlich neben ihnen ein Kerl auf einem Moped aufgetaucht war, mit quietschenden Bremsen gestoppt und ihrer Mutter die Handtasche entrissen hatte. Diese hatte nicht loslassen wollen und war hingefallen, wobei sie sich die Strümpfe zerrissen und ein Knie aufgeschürft hatte. Im Grunde hatte Debora sich gar nicht einmal so sehr erschreckt. Woran sie sich jedoch ganz deutlich erinnerte, war ihre Wut. Wut darüber, dass der Kerl sie überfallen hatte, aber auch darüber, wie ungerecht es war, dass ihre Mutter gestürzt war und alle ihre Unterhose hatten sehen können, wo doch eigentlich der Dieb hätte stürzen und sich das Genick brechen sollen. Damals, während sie in einem Raum wie diesem hier an der Seite ihrer Mutter darauf gewartet hatte, dass sie Anzeige erstatten konnten, und die Mutter weinte, weil in der Handtasche Geld, Papiere und auch das sündhaft teure Handy gewesen waren, das ihr der Vater geschenkt hatte und das von ihren Kolleginnen noch keine besaß, genau da hatte Debora zum ersten Mal den Wunsch verspürt, eines Tages Polizistin zu werden. Und die amerikanischen Fernsehserien hatten sie darin bestärkt …
Inzwischen wartete Debora schon fast eine Stunde und wurde allmählich ungeduldig, als sich endlich die Tür öffnete und ein junger Beamter sie aufforderte, ihm zu folgen. Sie kamen durch einen Hof, wo sich eine kleine Gruppe Polizisten in Zivil unterhielt und rauchte. Die Männer waren so in eine Diskussion über Fußball vertieft, dass sie die Brünette mit Sonnenbrille, die ihr Kollege an ihnen vorbeiführte, zunächst gar nicht bemerkten. Erst als die zwei ganz nah an der Gruppe vorbeikamen, drehte sich einer von ihnen um, worauf sich auf einmal der ganze Trupp – wie die Spielerfiguren auf einer Stange beim Tischfußball – nach der Frau und ihrem Begleiter umdrehte. Einer stieß einen anerkennenden Pfiff aus.
»Alles fit, Calocero? Immer schön sauber bleiben, ja …«, sagte ein hochgewachsener Typ mit rasiertem Schädel und Lederjacke.
Agente Calocero warf seinen Kollegen einen bösen Blick zu, und ohne auf die provozierende Bemerkung einzugehen, beschleunigte er seinen Schritt. Erst als sie den Hof hinter sich gelassen und ein anderes Gebäude betreten hatten, murrte er kurz: »Die haben echt nix zu tun.«
Das hatte er so leise gesagt, dass Debora nicht klar war, ob er mit ihr oder mit sich selbst sprach. Deshalb erwiderte sie lieber nichts und folgte ihm weiter schweigend.
Nachdem sie einen langen Flur entlanggelaufen waren, blieb der Polizist vor einer Tür stehen, auf der COMMISSARIOCAPOEDOARDORAGGIO stand. Im Zimmer saß ein Mann um die vierzig mit kastanienbraunen, leicht angegrauten Haaren an einem Schreibtisch. Er trug keine Uniform, nicht mal eine Krawatte, die Ärmel hatte er hochgekrempelt, und der Kragen seines hellen Hemdes stand offen. Darunter schaute hervor, was Großmütter gern als »Unterleibchen« bezeichneten, inzwischen jedoch als das sexieste männliche Kleidungsstück galt, vor allem, wenn es von Filmstars, Fußballspielern oder männlichen Models mit göttlichen Körpern getragen wurde. Was allerdings auf Commissario Raggio nicht zutraf. Sein Anblick erinnerte Debora weniger an die knackigen Cops aus amerikanischen Serien, als an ihren unscheinbaren Mathelehrer am Gymnasium.
Raggio deutete stumm auf den Stuhl vor sich. Debora nahm Platz.
Agente Calocero war in Erwartung weiterer Anweisungen stehen geblieben, doch der Commissario schien ihn völlig vergessen zu haben.
»Brauchen Sie mich noch, Dottore?«, fragte er schließlich schüchtern.
»Nein, nein, geh nur, Calocero …«, sagte Raggio, ohne ihn anzusehen, dazu wedelte er mit der Hand, als wollte er Staub vom Tisch wischen.
»Sie sind also hier, um eine Zeugenaussage zum Fall Costa zu machen, richtig?« Er sprach langsam, als hätte er es nicht eilig, und mit einem leichten süditalienischen Einschlag.
Debora nahm die Sonnenbrille ab, und zwar mit einer theatralischen Geste, die sie sich bei den weiblichen Stars in Hollywoodfilmen abgeguckt hatte. »Genau.«
Falls er vorher noch daran gezweifelt hatte, so hatte der Commissario nun die Gewissheit, ein als femme fatale verkleidetes weibliches Wesen vor sich zu haben.
Hoffentlich ist das nicht wieder eine von diesen notorischen Lügnerinnen, mit denen wir hier bloß unsere Zeit verschwenden, dachte er bei sich. Er seufzte einmal tief und holte aus einer Schublade des Schreibtischs ein Notizbuch hervor.
»Also … Sie heißen …?«
»Debora Camilli.«
»Alter?«
»Fünfundzwanzig … im Juli.«
»Sie Glückliche …«, sagte Raggio leise, mehr zu sich selbst als zu der jungen Frau. »Also los, dann erzählen Sie mal, was Sie gesehen oder gehört haben.«
»Ich habe die arme Frau in die Via degli Ausoni gefahren.«
Den Stift in der Hand, erstarrte der Commissario. Er hatte jemanden erwartet, der in dem Fall nur eine Statistenrolle spielte. Mit einer derart wichtigen Zeugin hatte er nicht gerechnet. Er fragte nun ganz langsam, wobei er jedes Wort einzeln betonte, als spräche er mit einer Ausländerin:
»Dann kannten Sie Monica Costa?«
»Nein, ich fahre Taxi. Das ist mein Job.«
Raggio senkte die Lider. Debora konnte gerade noch erkennen, dass seine Augen deutlich schöner waren als die ihres Mathelehrers. Groß, hellblau, fast grau.
Der Commissario setzte sich etwas bequemer auf seinen Stuhl.
»Gut, dann erzählen Sie mir mal alles von Anfang an.«
»Darf ich hier rauchen?«
»Eigentlich nicht, aber …« Raggio stand auf und öffnete das Fenster.
Debora kramte in ihrer sackartigen Handtasche, doch der Commissario kam ihr zuvor und hielt ihr plötzlich ein Päckchen Zigaretten hin, das er von irgendwoher gezaubert hatte.
»Na gut, wenn wir schon mal dabei sind, genehmige ich mir auch eine.«
Zum ersten Mal, seit Debora den Raum betreten hatte, lächelte er. Ein kindliches Lächeln, ein Überbleibsel des Jungen, der er einmal gewesen war, der letzte Rest von Unbekümmertheit in einem stark vom Leben gezeichneten Gesicht. Er beugte sich über den Schreibtisch und gab ihr Feuer.
Bis zu diesem Moment war Debora ruhig geblieben, aber als sie sich nun vorneigte, um die Zigarette anzuzünden, bemerkte sie, dass ihre Hand zitterte. Das hatte sie schon als kleines Mädchen gehabt. Wenn sie aufgeregt war, begannen ihre Hände zu zittern, und je mehr sie es zu verbergen suchte, desto stärker zitterten sie. Zum Glück hielt es nur einen Augenblick an. Der erste Zug Nikotin entspannte sie. Debora konzentrierte sich auf ihren Bericht und die Rekonstruktion jenes Morgens.
Sie erzählte, ohne sich zu verhaspeln oder konfus zu werden, alles der Reihe nach: von ihrer ersten Begegnung mit Signora Costa in der Via degli Ausoni über die Fahrt von Parioli nach San Lorenzo und das Telefonat, nach dem die Dame es sich anders überlegt hatte, von dem Gespräch, das sie mitangehört hatte, dem langen Warten auf die Kundin, die nicht mehr zurückgekehrt war, das alles mit genauen Uhrzeitangaben und vielen Details versehen. Alles in allem eine Aussage, wie sie sich jeder Ermittler erträumte.
Als sie ihren Bericht beendet hatte, wandte der Commissario sich ihr sichtlich zufrieden zu.
»Ausgezeichnet, Signorina. Sie waren uns eine große Hilfe. Schreiben Sie mir hier noch auf, wie ich Sie telefonisch erreichen kann, falls wir Sie, was sehr wahrscheinlich ist, im Laufe der Ermittlungen noch einmal benötigen sollten.«
Dann stand er auf und schloss das Fenster. Er nahm den Aschenbecher und leerte ihn sorgfältig in den Papierkorb. Anschließend wischte er etwas Asche fort, die auf den Schreibtisch gefallen war, was schon beinahe etwas Zwanghaftes hatte.
Mit Stift und Zettel in der Hand, beobachtete Debora ihn dabei. Pingelig. Überkorrekt. Ein Sauberkeitsfetischist, urteilte sie. Dann legte sie den Zettel auf dem Schreibtisch ab und notierte darauf ihre Handynummer.
Raggio war inzwischen wieder an seinen Platz zurückgekehrt. Er streckte die Hand nach dem Blatt aus, als sie hochschaute und plötzlich fragte: »Wann hat dieser Fotograf sie gefunden?«
»Hm … am späten Nachmittag. Warum?«
Debora antwortete nicht. Sie gab ihm den Zettel zurück. Dann sagte sie leise, als würde sie einen Gedanken zu Ende führen: »Das bedeutet, dass sie noch nicht lange tot gewesen sein kann …«
Das Gehirn des Polizisten hatte bereits begonnen, die erhaltenen Informationen zu verarbeiten, zu ordnen und abzulegen. Seine vorherige Befangenheit war von ihm abgefallen. Vor ihm hätte der Staatspräsident höchstpersönlich sitzen können, er hätte nicht gezögert, auch ihn zu befragen, wenn es geholfen hätte, Licht in das Dunkel um den Tod von Monica Costa zu bringen.
Debora sah wieder zu Commissario Raggio.
»Was hat denn der Gerichtsmediziner gesagt? Hat er schon eine Vermutung hinsichtlich des Zeitpunkts ihres Todes?«
Der Commissario war verwirrt. »Noch nicht. Es ist noch zu früh … Nach der Autopsie werden wir mehr wissen.«
Er klappte das Notizbuch zu. Die Unterhaltung wurde allmählich unangenehm. Diese junge Frau beunruhigte ihn mit all ihren Fragen. Normalerweise stellte er die Fragen und nicht umgekehrt.
Doch Debora hatte nicht die Absicht, ihn in Ruhe zu lassen. Die freundliche Art von Commissario Raggio hatte sie annehmen lassen, dass er leicht um den Finger zu wickeln war, und sie war der Meinung, das wäre eine Art Freibrief für ihre Neugier, die nach vertraulichen Informationen hungerte, eine Idee natürlich, die ihr, wenn sie nur einmal einen Augenblick lang nachgedacht hätte, statt sich von ihrer Impulsivität leiten zu lassen, selbst unangemessen erschienen wäre. Doch wann immer in ihrem Inneren ein Kampf zwischen Impuls und Besonnenheit tobte, gewann Ersterer stets zehn zu null. Daher schob sie nun auch noch die entscheidende Frage hinterher: »Haben Sie bereits jemanden in Verdacht?«
»Also wirklich …« Der vermeintlich leicht um den Finger zu wickelnde Commissario wurde langsam ärgerlich. Dieses durchtriebene junge Ding war ja ganz hübsch und ihre Zeugenaussage konnte für die Ermittlungen durchaus von Bedeutung sein, aber jetzt ging sie wirklich zu weit.
Commissario Raggio lächelte nun nicht mehr freundlich, und etwas weniger höflich sagte er:
»Das sind interne Informationen. Die können wir doch nicht jedem erzählen.«
»Glauben Sie etwa, ich gebe alles, was Sie mir sagen, sofort an die Presse weiter, sobald ich aus der Tür raus bin?«
»Das wäre immerhin möglich. Während der Ermittlungen müssen wir die Vertraulichkeit wahren.«
Für wen hielt der sie? Dachte er, er hätte es mit einer Idiotin zu tun, die es auf die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abgesehen hatte und unbedingt in die Zeitung wollte? Hatte er denn noch nicht gemerkt, dass er eine verhinderte Kollegin vor sich hatte? Dann war doch er der Idiot! Und die arme Monica wäre längst verwest, ehe der Typ da ihren Mörder fand …
Debora sah ihm frech ins Gesicht: »Ohne mich würden Sie doch jetzt noch im Dunkeln tappen. So haben Sie wenigstens eine Spur.«
Diese junge Frau mit ihrer unverschämten Art raubte ihm wirklich den letzten Nerv. Am liebsten würde er sie jetzt am Arm packen und rausschmeißen. Vielleicht hätte er das auch getan, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Sie konnte von Glück sagen, dass sie eine Frau war.
Debora zündete sich eine weitere Zigarette an, diesmal, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ihre Hände zitterten wieder, aber jetzt war ihr das vollkommen egal.
»Bevor ich es Ihnen erzählt habe, hatten Sie doch keinen blassen Schimmer, was diese arme Frau den ganzen Vormittag über getan hat!«
Sie hatte vom Vater nicht nur den Beruf geerbt, sondern auch den aufbrausenden Charakter. Die Tatsache, dass der Commissario mit Informationen hinter dem Berg hielt, die schlaflose Nacht und ihre Gereiztheit wegen der langen Wartezeit genügten, um sie auf die Palme zu bringen.
»Hören Sie, Signorina …«, Raggio hielt ihr den Aschenbecher hin, um zu verhindern, dass sie die Kippe auf den Boden warf, »… Sie haben uns sehr geholfen, aber jetzt lassen Sie uns am besten unsere Arbeit tun.« Er zeigte zur Tür. »Bitte.«
Dann nahm er den Hörer der Sprechanlage und gab Calocero Bescheid, dass die Zeugin gehen konnte.
Debora drückte den Zigarettenstummel im Aschenbecher aus, schnappte sich ihre Sachen und ging beleidigt zur Tür. Sie wusste natürlich, dass sie übertrieben hatte, zumal der Commissario im Gegensatz zu ihr nicht ein Mal laut geworden war. Am liebsten hätte sie es ungeschehen gemacht, aber sie kam nun mal nicht gegen ihr Temperament an. Sie wandte sich noch ein letztes Mal zum Commissario um und schleuderte ihm mit einem unverschämten Grinsen entgegen: »Es war ein Mann. Eine Frau hätte sie nie und nimmer erwürgen können. Die Signora war dünn, aber durchtrainiert. Das werden Ihnen auch Ihre Freunde von der Gerichtsmedizin bestätigen.«
Als sie den Raum verließ, stieß sie mit Agente Calocero zusammen, der genau im gleichen Moment das Zimmer betreten wollte. Sie entschwand, ohne sich zu entschuldigen.
8
Den Rest des Tages kutschierte Debora Fahrgäste durch Rom.
Abgesehen von einem japanischen Pärchen auf Hochzeitsreise, das sich zum Park der Villa Borghese fahren ließ und sie dann bat, tausend Fotos von ihnen beiden in allen möglichen und unmöglichen Posen zu machen, hatte sie an diesem Tag keine außergewöhnlichen Begegnungen, die sie von ihrer fixen Idee ablenken konnten.
Sie hatte das Mittagessen ausfallen lassen, um die beiden Tage, an denen sie wenig gearbeitet hatte, wettzumachen und mit einem Beinahe-Fastentag optimal in ihre Diät zu starten.
Aber das bewirkte nur, dass sie am Abend, als sie nach Hause kam, vor Hunger einen ganzen Ochsen hätte verschlingen können; was sie theoretisch sogar gedurft hätte, schließlich war Rindfleisch pures Protein und damit nach den Vorschriften ihres Diät-Gurus erlaubt.
Leider hatte ihre Mutter, die montags Nachtschicht hatte, für sie und ihren Bruder keinen Ochsen zum Abendessen gebraten, sondern einen Auberginenauflauf mit Tomaten und Käse, gekochte Blattzichorie mit Öl, Knoblauch und Chili und einen wunderbaren Sauerkirschkuchen für das Frühstück am nächsten Morgen hingestellt.
Angesichts dieser ganzen Köstlichkeiten überlegte Debora, dass sie genau genommen den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte und daher die paar Kohlenhydrate mit dem bisschen Gemüse ihre Kalorienstatistik nicht groß beeinflussen würden.
Sie begann mit der Zichorie als Magenfüller; dann machte sie sich über den Auberginenauflauf her, von dem Giampi bereits die Hälfte verputzt hatte. Debora wärmte ihn nicht einmal auf – innerhalb von fünf Minuten hatte sie im Stehen vor dem Herd das Werk ihres Bruders vollendet.
Den Kuchen nahm sie mit in ihr Zimmer.
Sie schaltete den Computer ein und tat, was sie schon seit dem Morgen hatte tun wollen.
Debora öffnete eine Suchmaschine und gab den Namen MONICACOSTA ein.
Sofort erschienen mehrere Links. Einer hieß »Monica Costa Fotos«. Debora klickte ihn an. Ein Bild wurde geladen, auf dem die Frau, sie musste darauf um die dreißig oder ein bisschen jünger sein, posierte und ihre langen Haare kokett zurückwarf. Auf einem anderen, eins in amerikanischer Einstellung, hatte sie kurze Haare und trug Jeans und Tanktop. Eine richtige Schönheit, dachte Debora. Die Fotos waren etwa zwanzig Jahre alt und stammten aus einem Modelbook. Augenscheinlich war Monica Fotomodell oder Schauspielerin gewesen, bevor sie Signora Costa-verheiratete-Dingsbums wurde, äh, wie hieß eigentlich ihr Mann? Der Zeitungsartikel gab darüber keine Auskunft. Vermutlich hatte Commissario Raggio den Namen nicht an die Presse geben wollen. Doch wie lange würde das gut gehen? Arme Monica, Schönheit aus Parioli, maximal eine Woche, und dein Privatleben wird allen zum Fraß vorgeworfen.
Um ihre Laune zu heben, brach sich Debora ein Stück des Kuchens ab. Er war noch leicht warm. Schmeckte köstlich. Ihre Mutter hätte Köchin werden sollen, nicht Krankenschwester. Ein weniger anstrengender und bestimmt deutlich angenehmerer Job. Garantiert hätte sie eine eigene Kochshow im Fernsehen bekommen oder wäre als Kandidatin bei Masterchef gelandet, wo sie den Preis für die beste Hobbyköchin abgeräumt hätte.
Debora nahm sich ein zweites Stück Kuchen, mit der freien Hand klickte sie auf einen Link zu einem Artikel, in dem Monica Costa erwähnt wurde. Diesmal ging es nicht um ihre Modelkarriere als junge Frau, sondern um die Zeit nach ihrer Heirat. Der Artikel stammte aus dem römischen Lokalteil des Messaggero und berichtete über ein gesellschaftliches Ereignis, eine Ausstellungseröffnung in einer Kunstgalerie. Der Artikel war vom siebenundzwanzigsten November vor zwei Jahren. Monica Costa und ihr Mann, der Chirurg Eugenio Ercoli, waren unter den Mäzenen der Galerie aufgeführt.
Debora kehrte zur Suchmaschine zurück, diesmal gab sie den Namen EUGENIOERCOLI ein.





























