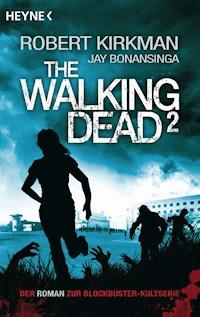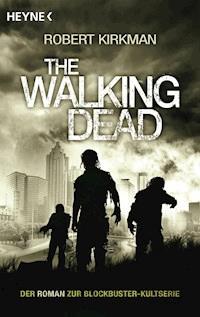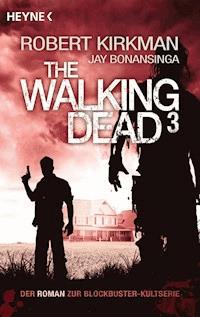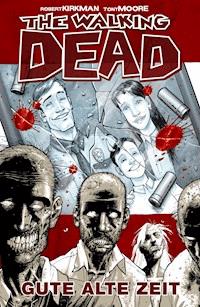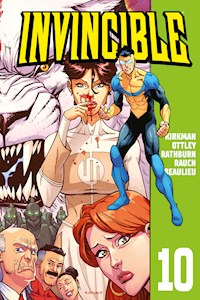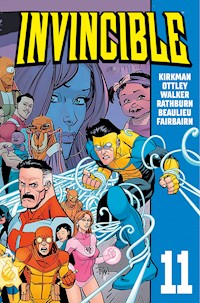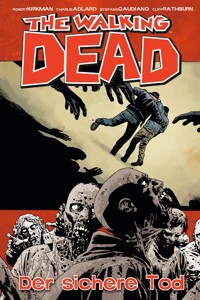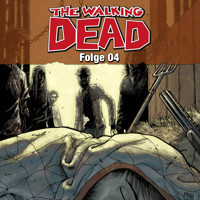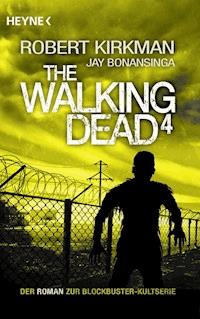
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: The Walking Dead-Romane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Monster in uns
Die Toten sind auferstanden und jagen die Lebenden, nichts und niemand ist vor ihnen sicher, und auf der ganzen Welt regiert das Chaos. Außer in dem kleinen Südstaatenstädtchen Woodbury: Dort regiert der Governor mit eiserner Hand über die wenigen Menschen, die die Apokalypse überlebt haben. Dafür bietet er ihnen Schutz vor den hungrigen Toten. Doch als die Menschen von Woodbury feststellen, dass das wahre Monster innerhalb der Stadtmauern wütet, kommt es zu einem blutigen Kampf – gegen die Lebenden und die Toten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Ähnliche
Das Buch
Die Toten sind auferstanden und jagen die Lebenden, nichts und niemand ist vor ihnen sicher, auf der ganzen Welt regiert das Chaos. Außer im Südstaatenstädtchen Woodbury. Dort regiert der Governor mit eiserner Hand über die wenigen Menschen, die die Apokalypse überlebt haben. Dafür bietet er ihnen Schutz vor den hungrigen Toten. Doch als sein brutales Regiment mehr und mehr Opfer fordert und eine Gruppe von Überlebenden – unter ihnen der ehemalige Polizist Rick und seine Begleiter Michonne und Glenn – sich gegen den Governor stellen, kommt es zum blutigen Showdown in Woodbury. Denn der Verlierer im Kampf um die letzten Lebenden wechselt ins Lager der Toten …
Die Autoren
Robert Kirkman ist der Schöpfer der mehrfach preisgekrönten und international erfolgreichen Comicserie The Walking Dead. Die gleichnamige TV-Serie wurde von ihm mit entwickelt und feierte weltweit Erfolge bei Kritikern und Genrefans gleichermaßen. Zusammen mit dem Krimiautor Jay Bonansinga hat er nun die Romanreihe aus der Welt von The Walking Dead veröffentlicht.
Mehr zu The Walking Dead und den Autoren auf:
www.diezukunft.de
Robert KirkmanJay Bonansinga
The Walking Dead 4
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der englischen Originalausgabe
THE WALKING DEAD – THE FALL OF THE GOVERNOR: PART ONE
Deutsche Übersetzung von Wally Anker
Verlagsgruppe Random House FSC® N001967Deutsche Erstausgabe 03/2014
Redaktion: Werner Bauer
Copyright © 2013 by Robert Kirkman, Jay Bonansinga
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN: 978-3-641-14452-4
Für Joey und Bill Bonansinga – in Liebe
Jay Bonansinga
TEIL 1
Schlachtfeld
Ich bin der Tod, Zerstörer der Welten.
J. Robert Oppenheimer
Eins
Das Feuer fängt im Parterre an zu lodern, schnell züngeln die Flammen an den Tapeten mit Kohlrosenmuster hinauf, erreichen die mit Trockenbauplatten abgehängte Decke und speien giftige schwarze Rauchwolken, die sich in hoher Geschwindigkeit über den Flur bis in das Schlafzimmer des Hauses an der Farrel Street erstrecken. Er kann nichts mehr sehen, kriegt kaum noch Luft. Er rennt durch das Esszimmer, sucht nach der kleinen Treppe, findet sie, stürzt die alten, wackeligen Holzstufen hinab in die moderige Dunkelheit des Kellers. »Philip?! – PHILIP!?! – PHILLLLLLLIP!!?!« Er eilt stolpernd über den dreckigen Estrich voller alter Wasserflecken, die Augen stets auf der Suche nach seinem Bruder. Über ihm lodert und prasselt es, die Feuersbrunst bullert durch die vollgestellten Zimmer des dürftigen Bungalows, verschlingt gierig alles, was ihr im Weg steht. Die Hitze scheint ihn erdrücken zu wollen. Schwach dreht er sich im Kreis, lässt den Blick durch die finsteren Ecken des sich mit Rauch füllenden Kellers schweifen und kämpft sich durch Spinnweben. Die dunklen, ätzenden Schwaden des nach Ammoniak stinkenden Dunstes aus verrottenden Rüben, Rattenkot und uralter Glaswolle machen sich in seinen Lungenflügeln breit. Er hört, wie sich die Balken über ihm biegen und krachend zu Boden fallen, wie das Flammenmeer außer Kontrolle gerät und das gesamte Haus zusammenbricht – was alles keinen Sinn macht, denn das kleine Häuschen seiner Kindheit in Waynesboro, Georgia, hat bisher allen Feuersbrünsten standgehalten, an die er sich erinnern konnte. Aber jetzt ist alles anders, das Inferno um ihn wird immer bedrohlicher, und er k Bruder nicht finden. Wie zum Teufel ist er eigentlich hierhergekommen? Und wo, verdammt noch mal, steckt Philip? Er braucht Philip. Mist, Philip wüsste schon, was zu tun ist! »PHILLLLLLLLLIIIP!« Der hysterische Schrei entfleucht ihm wie ein atemloses Zwitschern, das sterbende Radiosignal einer endenden Zivilisation. Plötzlich kann er eine Tür erkennen, nein, ein Portal in einer der Kellerwände – eine merkwürdige, ovale Öffnung, wie in einem U-Boot. Das Loch glüht verhalten, strahlt in einem merkwürdigen Grün, und erst jetzt merkt er, dass er es noch nie zuvor gesehen hat. In seinem Keller, in seinem Haus an der Farrel Street, hat es damals nie eine solche Öffnung gegeben. Jetzt aber ist es da, als ob es einfach hingezaubert worden wäre. Er stolpert auf das schwach strahlende grüne Loch inmitten der Finsternis zu, kämpft sich hindurch und steht plötzlich in einem muffigen Raum mit Porenbetonwänden. Er ist leer. An den Wänden sind Folterspuren zu erkennen – Schlieren dunklen, trocknenden Blutes und die ausgefransten Enden von Seilen, die noch immer an die Ösen gebunden sind, fest in der Wand verankert –, und der Ort strahlt etwas Böses aus: pures, reines, außergewöhnliches Übel. Er will weg von hier, kann nicht atmen. Die Nackenhaare stellen sich ihm auf. Er bringt keinen Ton außer einem schwachen Wimmern aus den Tiefen seiner verätzten Lungen über die Lippen. Plötzlich dringt ein Geräusch an seine Ohren. Er dreht sich um und sieht ein weiteres grün schimmerndes Portal. Er eilt darauf zu, drängt sich durch die Öffnung und schaut sich um. Plötzlich steht er inmitten eines Kiefernwaldes außerhalb von Woodbury. Er erkennt die Lichtung wieder. Die umgestürzten Bäume um ihn herum bilden eine Art natürliches Amphitheater. Der Boden ist mit Nadeln, Pilzen und Unkraut übersät. Sein Herz schlägt schneller. Dieser Ort ist noch schlimmer – ein Ort des Todes. Eine Gestalt kommt aus dem Wald und stellt sich in das fahle Licht. Sein alter Freund Nick Parsons, schlaksig und ungelenk wie immer, stolpert mit einer 12-Kaliber-Pumpgun auf die Lichtung zu. Seine verschwitzte Miene drückt pures Entsetzen aus. »Herrgott«, murmelt Nick mit merkwürdiger Stimme. »Erlöse uns von all dieser Ungerechtigkeit.« Nick hebt die Pumpgun. Die Mündung scheint riesig – wie ein gigantischer Planet, der die Sonne komplett verdeckt –, und sie ist direkt auf ihn gerichtet. »Ich kehre allen Sünden den Rücken«, dröhnt Nick mit Grabeskälte. »Vergib mir, o Herr … Vergib mir.« Nick drückt ab. Der Schlagbolzen schnellt nieder. Die Explosion des Mündungsfeuers umgibt den Lauf mit einem brillant gelben Strahlenkranz – die Strahlen einer sterbenden Sonne –, und er spürt, wie er vom Boden abhebt, durch Luft und Raum gewirbelt wird, schwerelos durch die Finsternis fliegt … auf einen kleinen Punkt grellen weißen Lichts zu. Das ist das Ende, das Ende der Welt – seiner Welt – das Ende von ALLEM. Er schreit auf, aber kein Ton entweicht ihm. Das ist der Tod – die erstickend magnesiumweiße grelle Leere des Nichts – und urplötzlich, als ob man einen Schalter umgelegt hätte, hört Brian Blake auf zu existieren.
Mit der Abruptheit eines Filmschnitts liegt er auf dem Boden seiner Wohnung in Woodbury – regungslos, erstarrt, auf kaltem Hartholz unter lähmenden Qualen leidend. Sein Atmen geht so schwerfällig, ist so eingeschränkt, dass jede einzelne seiner Zellen nach Luft zu schreien scheint. Er sieht nur die verschwommenen, schattigen Umrisse der dreckigen Wasserränder an der Decke – ein Auge ist komplett blind, die Augenhöhle kalt, als ob ein eisiger Wind hindurchweht. Panzerband klebt über einem Mundwinkel, und sein Atmen durch die mit Blut verschmierten Nasenlöcher ist kaum hörbar. Er versucht sich zu bewegen, schafft es aber nicht einmal, den Kopf zur Seite zu drehen. Die Stimmen im Hintergrund nimmt er durch seine um Gnade flehenden Ohren kaum wahr.
»Und was ist mit dem Mädchen?«, ertönt eine Stimme aus einer Ecke des Zimmers.
»Scheiß drauf, die ist mittlerweile über alle Berge, außerhalb der Sicherheitszone – die hat sowieso keine Chance.«
»Und was machen wir mit ihm? Ist er schon tot?«
Plötzlich ein neues Geräusch – ein wässriges, verzerrtes Knurren –, das seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er versucht hinzusehen. Durch die blutige Netzhaut seines noch funktionierenden Auges kann er gerade so eine kleine Gestalt ausmachen, die im Türrahmen steht. Ihr Gesicht ist von Verwesung gezeichnet, die komplett weißen, pupillenleeren Augen gleichen Spatzeneiern. Sie wirft sich nach vorn, sodass die Ketten, mit denen sie festgebunden ist, zu rasseln beginnen.
»BUH!«, schreit eine männliche Stimme, als das winzige Monster sich auf ihn zu werfen droht.
Philip versucht verzweifelt etwas zu sagen, aber die Worte bleiben ihm im Hals stecken, brennen und quälen ihn. Sein Schädel wiegt tausend Tonnen, aber er probiert es erneut. Seine geplatzten, geschundenen, blutenden Lippen beginnen sich zu bewegen, aber es kommen nur Fetzen von Worten aus ihnen hervor, die sich weigern, zu einem Ganzen zu verschmelzen. Dann hört er den tiefen Bariton von Bruce Cooper.
»Okay – drauf geschissen!« Der verräterische Ton der Entsicherung eines Schlagbolzens unterbricht die Stille. »Die Kleine kriegt gleich eine Kugel …«
»N-nnggh!« Philip reißt sich zusammen, gibt sein Bestes und stammelt: »N-nein – n-nicht!« Erneut ringt er nach Luft und zuckt vor Schmerzen zusammen. Er muss seine Tochter Penny beschützen – ganz gleich, ob sie bereits tot ist, und das schon seit über einem Jahr. Sie ist alles, was ihm in dieser Welt noch geblieben ist, das Einzige, was ihn noch am Leben hält. »Wehe, ihr tut ihr etwas an … LASST DAS BLOSS BLEIBEN!«
Die beiden Männer drehen sich zu dem auf dem Boden liegenden Philip um, und für den Bruchteil einer Sekunde erhascht er einen Blick in ihre Gesichter, wie sie schockiert auf ihn herunterschauen. Bruce, der Größere der beiden, ist ein Afroamerikaner mit einem Kahlkopf, das Gesicht jetzt vor Grauen und Ekel verzerrt. Der andere Kerl heißt Gabe. Er ist weiß und wie ein Schrank gebaut, hat einen Bürstenhaarschnitt und trägt einen schwarzen Rollkragenpullover. Auch an seinem Blick erkennt Philip, dass sie ihn für tot halten.
Wie er so auf der mit Blut besudelten Spanholzplatte liegt, hat er keine Vorstellung davon, welch erschreckenden Eindruck er macht – insbesondere sein Gesicht, das sich anfühlt, als ob man es mit einem Eispickel durchlöchert hat. Für einen kurzen Augenblick lösen die Mienen dieser beiden Männer, wie sie auf ihn herabstarren, ein Alarmsignal aus in Philips Kopf. Die Frau, die ihn »aufgemischt« hat – Michonne, so heißt sie, wenn er sich recht erinnert –, hat ganze Arbeit geleistet. Für all seine Sünden hat sie ihn so nahe an den Tod gebracht, wie es nur möglich ist, ohne die letzte Schwelle zu überschreiten.
In Sizilien heißt es, dass Rache am besten kalt serviert werden muss, diese Frau aber hat noch eine dampfende Portion Höllenqualen dazugereicht. Die Tatsache, dass sein rechter Arm kurz über dem Ellenbogen amputiert worden ist, macht Philip gerade am wenigsten aus. Sein linkes Auge hängt noch immer an blutigen Fäden und Nerven baumelnd über seiner Wange. Was aber noch viel schlimmer für Philip ist – viel, viel schlimmer –, sind die unglaublichen Höllenschmerzen, die sich eiskalt durch seine Eingeweide ziehen. Sie stammen von der Stelle, an der die Frau seinen Penis mit einer geschmeidigen Bewegung ihres Schwertes abgetrennt hat. Die Erinnerung an diesen Hieb – der Stich einer metallenen Wespe – reißt ihn auf einmal zurück in einen Zustand dämmriger halber Bewusstseinslosigkeit. Er nimmt die Stimmen kaum noch wahr.
»FUCK!« Bruce starrt entsetzt auf den für die Umstände einmal so fitten, hageren Mann mit Schnauzbart. »Er lebt!«
Gabe glotzt jetzt ebenfalls. »Scheiße, Bruce – der Doktor und Alice sind verschwunden! Was zum Teufel sollen wir denn jetzt machen?«
Kurz zuvor ist ein weiterer Mann zu ihnen gestoßen. Die Pumpgun schlägt gegen seine Beine, und er atmet schwer. Philip kann nicht sehen, wer es ist.
Bruces Stimme: »Jungs, sperrt das kleine Ungeheuer in das andere Zimmer. Ich geh mal schnell runter und hole Bob.«
Dann Gabe: »Bob?! Der verdammte Spritti, der hier immer vor der Tür liegt?«
Die Stimmen schwinden dahin, und ein kalter, dunkler Schleier legt sich über Philip.
»… zum Teufel, kann er schon …?«
»… wahrscheinlich nicht viel …«
»… warum also …?«
»… weiß mehr als wir zusammen …«
Im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung oder dem, was in Filmen oft fälschlicherweise verbreitet wird, ist der normale Stabssanitäter nicht einmal annähernd so geschult wie ein erfahrener, vernünftig qualifizierter Unfallchirurg oder gar ein normaler Arzt. Die meisten Sanitäter beim Militär absolvieren eine dreimonatige Ausbildung in einem Boot-Camp, und selbst die begabtesten unter ihnen erreichen kaum den Standard eines normalen Rettungs- oder Notfallsanitäters. Sie lernen die einfachsten Erste-Hilfe-Methoden, ein paar Wiederbelebungsmaßnahmen, Ansätze von Traumabehandlung, und das war es auch schon. So ausgerüstet, werden sie aufs Schlachtfeld geschickt und sollen verletzte Soldaten am Leben halten – soweit es geht –, bis die Opfer in ein mobiles chirurgisches Feldhospital transportiert werden können. Sie sind nichts weiter als menschliche Rettungsgeräte, abgehärtet durch die Front und die nicht enden wollende Flut des Leidens. Man erwartet von ihnen, die Verletzten mit Pflastern oder dem Richten von Knochen am Leben zu erhalten, nicht mehr und nicht weniger.
Stabssanitäter Bob Stookey hat einen einzigen Einsatz der achtundsechzigsten Alpha-Truppe vor dreizehn Jahren in Afghanistan erlebt. Damals hatte er gerade seinen sechsunddreißigsten Geburtstag hinter sich, kurz nach der Invasion. Er war einer der älteren Freiwilligen – der Grund dafür war eine Scheidung, bei der es böse zu enden drohte –, und er wurde zu einer Art Onkel für die Jüngeren in seinem Team. Bobs Karriere begann als Krankenwagenfahrer frisch aus Camp Dwyer, ehe er sich innerhalb weniger Monate zum Stabssanitäter hocharbeitete. Bob konnte die Mannschaft mit seinen fürchterlichen Witzen und Schlücken aus seinem stets präsenten, aber öffentlich nicht geduldeten Flachmann voll Jim Beam stets bei Laune halten. Zudem war er gutmütig, was ihm die Landser hoch anrechneten, und er besaß ein weiches Herz, was ihn jedes Mal, wenn er einen Soldaten in seinen Händen verlor, selbst ein wenig sterben ließ. Als er schließlich eine Woche nach seinem siebenunddreißigsten Geburtstag wieder abberufen wurde, war er hundertelfmal gestorben und verarztete sein Trauma mit einer Flasche Whiskey pro Tag.
Seine Sturm-und-Drang-Phase hatte längst dem Schrecken und Entsetzen der Plage Platz gemacht, aber genauso schlimm war der Verlust seiner geheimen Liebe – Megan Lafferty –, und der Schmerz hat ihn mit der Zeit so von innen aufgefressen, dass er jetzt – heute Nacht, in diesem Augenblick – völlig blind und taub gegenüber der Tatsache dasteht, dass er gleich wieder auf das Schlachtfeld gezerrt wird …
»BOB!«
Er liegt zusammengesackt und halb bewusstlos vor dem Haus des Governors. Auf seinem olivfarbenen Parka klebt getrockneter Speichel und Zigarettenasche. Bei dem Geräusch von Bruce Coopers dröhnender Stimme zuckt er zusammen. Die Finsternis der Nacht weicht langsam dem Morgengrauen, und Bob ist bereits von den eisigen Winden und einem unruhigen, von Fieberträumen geplagten Schlaf aufgewacht.
»Aufstehen!«, befiehlt der Schrank, als er aus dem Gebäude gestürmt kommt und auf Bobs Nest aus durchnässten Zeitungen, zerfetzten Decken und leeren Flaschen zueilt. »Wir brauchen dich – oben! JETZT!«
»W-was?« Bob reibt sich den grauen Bart und stößt sauer auf. »Warum?«
»Es geht um den Governor!« Bruce streckt ihm eine Hand entgegen und umfasst Bobs schlaffen Arm. »Du warst doch mal Sani bei der Armee, richtig?«
»Marines … Hospital Corps«, stammelt er und kommt sich vor, als ob er von einem Kran auf die Beine gerissen wird. Alles dreht sich. »Für ungefähr eine Viertelstunde … vor einer knappen Million Jahre. Ich kann nichts, weiß nichts mehr.«
Bruce stellt ihn wie ein Mannequin auf und schnappt sich Bob bei den Schultern. »Na und? Du wirst dein Bestes geben!« Er schüttelt ihn. »Der Governor hat sich immer um dich gekümmert – hat dich stets gefüttert, darauf geachtet, dass du dich nicht totsäufst – und jetzt wirst du dich bei ihm revanchieren.«
Bob schluckt die Gallenflüssigkeit und seine Übelkeit hinunter, wischt sich das Gesicht ab und nickt unsicher. »Okay, dann mal los.«
Auf dem Weg durch den Eingangsbereich, die Treppe hoch und den Flur entlang glaubt Bob, dass es schon nichts Größeres sein wird. Vielleicht hat der Governor eine Erkältung oder sich einen Zeh angeschlagen oder so was Ähnliches, und jetzt wird es wie immer an die große Glocke gehängt. Als sie zur letzten Tür auf der linken Seite zueilen, reißt Bruce so hart an Bobs Arm, dass er ihn beinahe auskugelt. Plötzlich steigt ein moderiger Kupfergeruch aus der angelehnten Tür in Bobs Nase, und die Alarmglocken fangen in Bob Stookeys Kopf an zu läuten. Kurz bevor Bruce ihn in die Wohnung zerrt – in dem grässlichen Moment, ehe Bob durch die Tür tritt und sieht, was drinnen auf ihn wartet –, glaubt Bob, dass er wieder im Krieg ist.
Die plötzliche und unwillkommene Erinnerung, die jetzt durch seinen Schädel schießt, lässt ihn zusammenzucken – der Geruch von Proteinen, der stets über dem notdürftig dahingestellten Feldlazarett in Parwan hing; der Haufen eitriger Verbände, der bald im Ofen landen sollte; der Abfluss, in dem sich Körperflüssigkeiten und Knorpel sammelten; die mit Blut besudelten Krankenbahren, die in der Glut der afghanischen Sonne standen – all das schießt Bob in dem Bruchteil von Sekunden durch den Kopf, ehe er etwas auf dem Boden der Wohnung liegen sieht. Der Gestank lässt ihm die Haare zu Berge stehen, und er muss sich am Türrahmen festhalten, ehe Bruce ihn schroff in die Wohnung schleppt. Endlich sieht er, was da auf dem Holzbrett vor ihm liegt – es ist der Governor. Oder zumindest das, was von ihm übrig geblieben ist.
»Ich habe das Mädchen eingesperrt und den Arm abgebunden«, sagt Gabe, aber Bob hört ihn kaum, schenkt auch dem anderen Mann keinerlei Aufmerksamkeit – einem Gorilla namens Jameson, der an der gegenüberliegenden Wand hockt, die Hände merkwürdig gefaltet und die Augen vor Panik brennend. Bob ist so schwindlig, dass es ihm vorkommt, als ob man ihm den Boden unter den Füßen wegreißen würde. Fassungslos starrt er auf den Governor. Gabes Stimme hört sich komisch an, als ob er unter Wasser spricht. »Der ist bewusstlos – atmet aber noch.«
»Heilige Schei… !« Bob kriegt die Worte kaum über die Lippen. Er fällt auf die Knie, starrt und starrt auf die verzerrten, verbrannten, blutbesudelten, gegeißelten Überreste des Mannes, der einmal wie ein Ritter der Tafelrunde durch die Straßen seines Königreichs von Woodbury geschritten ist. Jetzt aber verwandelt sich der verstümmelte Körper Philip Blakes in Bob Stookeys Kopf in einen jungen Mann aus Alabama – Master Sergeant Bobby McCullam, der junge Kerl, der Bob in seinen Albträumen heimsucht – derjenige, der seinen halben Körper bei einem Bombenanschlag kurz vor Kandahar verloren hat. Auf dem Gesicht des Governors, wie in einem grotesken Film, überlagert sich jetzt die Miene des Marine, diese Todesfratze unter einem Helm – halb gekochte Augen und eine blutige Grimasse umrahmt von dem Lederriemen unter dem Kinn – der fürchterliche Blick fixiert auf Bob, den Krankenwagenfahrer. Töte mich, hatte der Kleine Bob ins Ohr geflüstert, und Bob war wie gelähmt, konnte keinen Ton mehr sagen. Der junge Marine starrte Bob bis zu seinem letzten Atemzug an. All das fährt Bob wie ein Schlag durch den Kopf, zieht ihm jäh die Kehle zusammen, und ihm steigt Gallenflüssigkeit in den Rachen, brennt in Mund und Nasenhöhlen wie Anthrax.
Bob dreht sich um und kotzt in hohem Bogen auf den verdreckten Teppich.
Sein gesamter Mageninhalt – eine vierundzwanzigstündige Diät, bestehend aus billigstem Whiskey und dem einen oder anderen Happen Brennpaste – ergießt sich über den befleckten Vorleger. Kniend stützt er sich jetzt mit den Händen auf den Boden und würgt und würgt. Sein Körper schüttelt und verkrampft sich bei jedem Schub. Zwischen feucht klingenden Luftzügen versucht er etwas zu sagen: »I-ich er … – ertrage den Anblick ja nicht einmal.« Dann saugt er wieder Luft in seine Lungen und erbebt erneut. »Ich kann nicht – kann nichts mehr für ihn tun!«
Bob spürt, wie eine Hand sich wie ein Schraubstock um seinen Hals legt. Er wird so abrupt auf die Beine gezerrt, dass es ihm beinahe die Schuhe auszieht.
»Der Doc und Alice sind weg!«, bellt Bruce ihn an. Sein Gesicht ist dem von Bob so nahe, dass er ihn anspuckt. Bruce greift noch härter zu. »Wenn du jetzt aufgibst, wird er verfickt noch mal STERBEN!« Bruce schüttelt ihn. »WILLST DU ETWA, DASS ERSTIRBT?«
Bob hängt einfach nur noch schlaff da und stöhnt mühsam: »I-i-ich … nein.«
»DANN REISSDICH ZUSAMMEN UND TU ETWAS!!«
Bob nickt benebelt, dreht sich erneut zu dem geschundenen Körper um und spürt, wie sich die Finger um sein Genick lockern. Er hockt sich hin und starrt auf den Governor.
Blut rinnt den nackten Oberkörper hinab, formt klebrige, bereits vertrocknende Flecken in dem schummrigen Licht des Wohnzimmers. Dann untersucht Bob den verbrannten Stumpen des rechten Oberarms, richtet den Blick auf die mit Blut angefüllte Augenhöhle, den Augapfel, der noch am Sehnerv an der Wange des Governors hin und her baumelt. Er ist so glasig und gallertartig wie ein gekochtes Frühstücksei. Dann wandern seine Augen zu der Lache beinahe pechschwarzen Blutes, die sich vor der Lende des Verwundeten ausbreitet. Endlich bemerkt er das flache, schwere Atmen – die Brust des Mannes hebt und senkt sich minimal.
Dann legt sich bei Bob auf einmal ein Schalter um – er wird im Handumdrehen nüchtern. Es ist, als ob man ihm Riechsalz unter die Nase gehalten hätte. Vielleicht ist es der alte Soldat, der in ihm die Oberhand gewinnt. Schließlich kann man auf dem Schlachtfeld nicht zögern – da gibt es keinen Platz für Ekel oder Lähmungserscheinungen, da muss man immer auf Trab bleiben, schnell sein, wenn auch nicht perfekt. Hauptsache, es geht weiter. Triage geht über alles. Also: Zuerst die Blutungen stoppen, Atemwege freihalten, Puls nicht verlieren und dann herauskriegen, wie man den Patienten am besten transportieren kann. Plötzlich aber wird Bob von einer Welle der Emotionen gelähmt.
Er hatte nie Kinder gehabt, aber diese plötzliche Flut der Empathie, die er für diesen Mann empfindet, ähnelt dem Adrenalinschub, den ein Elternteil bei einem Verkehrsunfall erlebt, und sie oder ihn dazu befähigt, scheinbar Tausende von Kilo von Stahl zu heben, um das Kind zu retten. Dieser Mann hatte sich um Bob gekümmert. Der Governor war ihm stets mit Freundlichkeit, ja, sogar Zärtlichkeit entgegengetreten – hatte nie vergessen, nach Bob zu schauen, hatte sich immer vergewissert, dass er genug zu trinken, ausreichend Decken und einen Ort zum Schlafen hatte … Diese plötzliche Eingebung trifft ihn wie eine Offenbarung, wappnet ihn, verschafft ihm einen klaren Blick und hilft ihm dabei, sich auf die nötigen Schritte zu konzentrieren. Sein Herz hört auf, wie wild zu pochen, und er langt zu dem Governor hinunter, legt den Finger auf seine blutüberströmte Halsschlagader. Der Puls ist schwach, sehr schwach.
Bobs Stimme ist tief und ruhig, und Autorität klingt bei jedem Wort mit: »Ich brauche frische Bandagen, Klebeband – und ein wenig Peroxid.« Niemand sieht, wie sich Bobs Miene verändert. Er wischt sich die fettigen Strähnen aus dem Gesicht zurück über seinen beinahe kahlen Kopf. Er kneift die Augen zusammen, die tief in ihren Höhlen liegen und von Falten umgeben sind. Er runzelt die Stirn wie ein alter Pokerspieler, der gleich sein Blatt aufdeckt. »Und dann müssen wir ihn zur Krankenstation bringen.« Endlich blickt er zu den Männern in der Wohnung auf und sagt mit bleischwerer Stimme: »Ich werde tun, was ich kann.«
Zwei
Die Gerüchte an jenem Tag schwirren ähnlich wie die Kugel beim Flippern willkürlich in allerlei Richtungen. Während Bruce und Gabe den Zustand des Governors unbedingt geheim halten wollen, schürt die offenkundige Abwesenheit des Anführers von Woodbury die Fantasien seiner Einwohner, und sie flüstern und spekulieren, was das Zeug hält. Anfangs wird kolportiert, dass der Governor, Dr.Stevens, Martinez und Alice die Stadt noch vor Morgengrauen in geheimer Mission verlassen haben– wie genau diese Mission aussah oder welchem Zweck sie diente, blieb offen. Die Männer auf dem Verteidigungswall hatten ihre eigene Version der Geschehnisse– und doch glich keine der anderen. Einer von ihnen schwört, er hätte Martinez noch vor Morgengrauen zusammen mit einer Gruppe unidentifizierter Helfer in einem Truck gesehen. Sie haben angeblich die Stadt verlassen, um nach Proviant zu suchen. Die Geschichte hat am späten Morgen allerdings jegliche Glaubwürdigkeit verloren, weil kein einziger Truck fehlt. Eine andere Wache– ein junger Möchtegern-Gangster namens Curtis– behauptet, dass Martinez die Stadt alleine zu Fuß verlassen hat. Aber auch diese Version verliert seine Anhänger, als die Einwohner merken, dass der Doktor und Alice ebenfalls verschwunden sind. Außerdem ist der Governor nirgends zu sehen– genau wie der verwundete Fremde, der auf der Krankenstation war. Der stoische Mann, der mit seinem Maschinengewehr vor dem Gebäude des Governors Wache steht, ist so redselig wie ein Sack Reis und lässt niemanden hoch zur Wohnung. Das Gleiche gilt für die Männer an den Eingängen zu den Treppen zur Krankenstation, was natürlich die Gerüchteküche erst recht zum Brodeln bringt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!