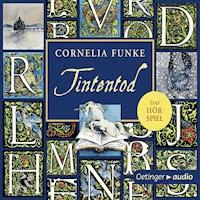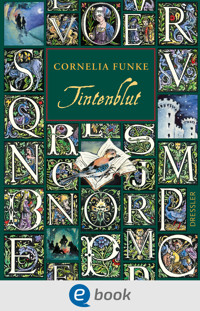
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Tintenwelt
- Sprache: Deutsch
Cornelia Funkes Tintenwelt steckt voller Zauber und Gefahren. Eigentlich könnte alles so friedlich sein. Doch der Zauber von "Tintenherz" lässt Meggie nicht los. Und eines Tages ist es so weit: Gemeinsam mit Farid geht Meggie in die Tintenwelt, denn sie will den Weglosen Wald sehen, den Speckfürsten, den Schönen Cosimo, den Schwarzen Prinzen und seine Bären. Sie möchte die Feen treffen und natürlich Fenoglio, der sie später zurückschreiben soll. Vor allem aber will sie Staubfinger warnen, denn auch der grausame Basta ist nicht weit. Millionen Fantasy-Fans weltweit feiern die legendären Tintenwelt-Abenteuer. - "Tintenblut" ist Band 2 der Tintenwelt-Reihe und die Fortsetzung des Welterfolgs "Tintenherz". - Tauche ein in den zweiten Teil der großen Saga, triff auf magische Fabelwesen und wundersame Geschöpfe. - Die fantastische Geschichte um Buchbinder Mo und seine Tochter Meggie ist längst ein Klassiker und weltweiter Bestseller, der auch viele Erwachsene begeistert. - Die Bücher von Cornelia Funke, der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin, wurden vielfach ausgezeichnet und verfilmt. Ihre Bücher sind Lieblingstitel, Wegbegleiter, Tröster und Gefährten für Generationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Über dieses Buch
»Meggie las zum hundertsten Mal den Abschiedsbrief an ihre Eltern:
Liebster Mo! Liebe Resa!
Bitte macht euch keine Sorgen. Farid muss Staubfinger finden, um ihn vor Basta zu warnen, und ich gehe mit ihm. Ich will gar nicht lange bleiben, ich will nur den Weglosen Wald sehen und den Speckfürsten, den Schönen Cosimo und vielleicht noch den Schwarzen Prinzen und seinen Bären. Ich will die Feen wiedersehen und die Glasmänner – und Fenoglio. Er wird mich zurückschreiben. Ihr wisst, dass er es kann. Macht euch keine Sorgen. Capricorn ist ja nicht mehr dort.
Bis bald, ich küsse euch tausendmal, Meggie«
Für Brendan Fraser,
dessen Stimme das Herz dieses Buches ist.
Thanks for inspiration and enchantment.
Mo hätte mein Schreibzimmer nicht betreten ohne dich –
und diese Geschichte wäre
nie erzählt worden.
Für Rainer Strecker,
Zauberzunge und Staubfinger zugleich.
Jedes Wort in diesem Buch wartet schon sehnsüchtig
darauf, von ihm gelesen zu werden.
Und natürlich, wie fast immer, last, but for sure not least,
für Anna, wunderwunderbare Anna,
die sich bei vielen Spaziergängen diese Geschichte
erzählen ließ, mich bestärkte und beriet und mich verstehen ließ, was gut und
noch zu verbessern war.
(Ich hoffe sehr, dass die Geschichte von Meggie
und Farid nun nicht mehr zu kurz kommt.)
Wüsste ich,
woher die Gedichte kommen,
ich würde dorthin gehen.
Michael Longley
Maßgeschneiderte Worte
Zeile für Zeile
Meine eigene Wüste
Zeile für Zeile
Mein Paradies
Marie Luise Kaschnitz, Ein Gedicht
Es dämmerte und Orpheus war immer noch nicht da.
Farids Herz schlug schneller, wie immer, wenn der Tag ihn mit der Dunkelheit allein ließ. Verfluchter Käsekopf! Wo blieb er nur? In den Bäumen verstummten schon die Vögel, wie erstickt von der aufziehenden Nacht, und die nahen Berge färbten sich schwarz, als hätte die untergehende Sonne sie versengt. Bald würde die ganze Welt so kohlrabenschwarz sein, selbst das Gras unter Farids nackten Füßen, und die Geister würden zu flüstern beginnen. Farid kannte nur einen Ort, an dem er sich vor ihnen sicher fühlte: dicht hinter Staubfinger, so dicht, dass er seine Wärme spürte. Staubfinger fürchtete die Nacht nicht, er liebte sie.
»Na, hörst du sie schon wieder?«, fragte er, als Farid sich an ihn drängte. »Wie oft soll ich es dir noch sagen? In dieser Welt gibt es keine Geister. Einer der wenigen Vorzüge, die sie hat.«
Gegen eine Steineiche gelehnt, so stand er da und blickte die einsame Straße hinauf. Weiter oben beschien eine Laterne den zersprungenen Asphalt, dort, wo die Häuser sich vor den dunklen Bergen duckten, kaum ein Dutzend, eng beisammenstehend, als fürchteten sie die Nacht ebenso wie Farid. Das Haus, in dem der Käsekopf wohnte, war das erste an der Straße. Hinter einem der Fenster brannte Licht. Seit mehr als einer Stunde starrte Staubfinger es nun schon an. Farid hatte oft versucht, ebenso reglos dazustehen, aber seine Glieder wollten einfach nicht so lange stillhalten.
»Ich geh jetzt hin und seh nach, wo er bleibt!«
»Tust du nicht!« Staubfingers Gesicht blieb ausdruckslos wie immer, doch seine Stimme verriet ihn. Farid hörte die Ungeduld heraus … und die Hoffnung, die einfach nicht sterben wollte, obwohl sie schon so oft enttäuscht worden war. »Du bist sicher, dass er ›Freitag‹ gesagt hat?«
»Ja! Und heute ist doch Freitag, oder?«
Staubfinger nickte nur und strich sich das schulterlange Haar aus dem Gesicht. Farid hatte versucht, das seine ebenso lang wachsen zu lassen, aber es lockte und kräuselte sich so widerspenstig, dass er es sich schließlich mit dem Messer wieder kurz geschoren hatte.
»›Freitag unterhalb des Dorfes, vier Uhr‹, das waren seine Worte. Während sein Köter mich angeknurrt hat, als hätte er auf nichts mehr Appetit als auf einen knackigen braunen Jungen!« Der Wind fuhr Farid unter den dünnen Pullover und er rieb sich fröstelnd die Arme. Ein schönes warmes Feuer, ja, das hätte ihm jetzt gefallen, aber bei dem Wind würde Staubfinger ihn nicht mal ein Streichholz anzünden lassen. Vier Uhr … Mit einem leisen Fluch blickte Farid zum Himmel hinauf. Dass es längst später war, wusste er auch ohne Uhr. »Ich sag dir, er lässt uns extra warten, der aufgeblasene Dummkopf!«
Staubfingers schmaler Mund verzog sich zu einem Lächeln. Es fiel Farid immer leichter, ihn zum Lächeln zu bringen. Vielleicht hatte er deshalb versprochen, ihn mitzunehmen, falls der Käsekopf ihn tatsächlich zurückbrachte. Zurück in seine Welt, erschaffen aus Papier und Druckerschwärze und den Worten eines alten Mannes.
Ach was!, dachte Farid. Warum soll ausgerechnet dieser Orpheus schaffen, was all den anderen nicht gelungen ist? So viele hatten es versucht … der Stotterer, der Goldblick, die Rabenzunge … Betrüger, die ihr Geld genommen hatten …
Hinter Orpheus’ Fenster erlosch das Licht und Staubfinger richtete sich abrupt auf. Eine Tür schlug zu. Schritte drangen durch die Dunkelheit, hastige, unregelmäßige Schritte. Dann erschien Orpheus im Licht der einsamen Laterne – der Käsekopf, wie Farid ihn heimlich getauft hatte, seiner blassen Haut wegen und weil er in der Sonne schwitzte wie ein Stück Käse. Kurzatmig kam er die steil abfallende Straße herunter, neben sich seinen Höllenhund, hässlich wie eine Hyäne. Als er Staubfinger am Straßenrand entdeckte, blieb er stehen und winkte ihm mit breitem Lächeln zu.
Farid griff nach Staubfingers Arm. »Sieh dir das dumme Grinsen an. Falsch wie Katzengold!«, flüsterte er ihm zu. »Wie kannst du ihm nur trauen!«
»Wer sagt denn, dass ich ihm traue? Was ist los mit dir? Du bist ja so zappelig. Willst du vielleicht doch lieber hierbleiben? Autos, laufende Bilder, Musik aus der Dose, Licht, das die Nacht vertreibt –« Staubfinger stieg über die kniehohe Mauer, die den Straßenrand säumte. »All das gefällt dir doch. Du wirst dich langweilen, dort, wo ich hinwill.«
Was redete er da? Als ob er nicht genau wusste, dass Farid sich nur eines wünschte: bei ihm zu bleiben. Ärgerlich wollte er ihm antworten, doch ein Knacken, scharf, als hätten Stiefel einen Zweig zertreten, ließ ihn herumfahren.
Auch Staubfinger hatte es gehört. Er war stehen geblieben und lauschte. Aber zwischen den Bäumen war nichts zu entdecken, nur die Zweige bewegten sich im Wind, und ein Nachtfalter, bleich wie ein Geist, flatterte Farid ins Gesicht.
»Entschuldigt! Es ist etwas später geworden!«, rief Orpheus ihnen entgegen.
Farid konnte immer noch nicht fassen, dass eine solche Stimme aus diesem Mund kommen konnte. Sie hatten von dieser Stimme gehört, in einigen Dörfern, und Staubfinger hatte sich sogleich auf die Suche gemacht, doch erst vor knapp einer Woche hatten sie Orpheus gefunden, in einer Bücherei, Märchen vorlesend für ein paar Kinder, von denen offenbar keins den Zwerg bemerkte, der plötzlich hinter einem der Regale voll zerlesener Bücher hervorschlüpfte. Aber Staubfinger hatte ihn gesehen, hatte Orpheus abgepasst, als er gerade wieder in sein Auto steigen wollte, und ihm schließlich das Buch gezeigt, das Buch, das Farid schon häufiger verflucht hatte als jeden anderen Gegenstand.
»O ja, dieses Buch kenne ich!«, hatte Orpheus gehaucht. »Und dich –«, hatte er fast andächtig hinzugesetzt und Staubfinger angesehen, als wollte er ihm die Narben von den Wangen starren, »– dich kenne ich auch. Du bist das Beste darin. Staubfinger! Der Feuertänzer! Wer hat dich nur hierher gelesen, in diese trübsinnigste aller Geschichten? Sag nichts! Du willst zurück, nicht wahr, aber du findest die Tür nicht, die Tür zwischen den Buchstaben! Das macht nichts. Ich kann dir eine neue zimmern, aus maßgeschneiderten Worten! Für einen Freundschaftspreis – falls du tatsächlich der bist, für den ich dich halte!«
Freundschaftspreis! Von wegen. Nahezu all ihr Geld hatten sie ihm versprechen müssen, um dann auch noch stundenlang auf ihn zu warten, an diesem gottverlassenen Ort, an diesem windigen Abend, der nach Geistern roch.
»Hast du den Marder dabei?« Orpheus richtete die Taschenlampe auf Staubfingers Rucksack. »Du weißt, mein Hund mag ihn nicht.«
»Nein, der besorgt sich gerade etwas zu fressen.« Staubfingers Blick wanderte zu dem Buch, das unter Orpheus’ Arm klemmte. »Was ist? Bist du … fertig?«
»Natürlich!« Der Höllenhund bleckte die Zähne und starrte Farid an. »Die Wörter waren zuerst etwas störrisch. Vielleicht, weil ich so aufgeregt war. Wie ich dir schon bei unserer ersten Begegnung sagte: Dieses Buch –«, Orpheus strich mit den Fingern über den Bund, »– war mein Lieblingsbuch, als ich ein Kind war. Mit elf habe ich es zum letzten Mal gesehen. Es wurde gestohlen aus der schäbigen Bücherei, aus der ich es immer wieder auslieh. Ich war zum Stehlen leider zu feige gewesen, aber ich habe das Buch nie vergessen. Es hat mich für alle Zeit gelehrt, dass man mit Worten dieser Welt so leicht entkommen kann! Dass man Freunde zwischen den Seiten findet, wunderbare Freunde! Freunde wie dich, Feuerspucker, Riesen, Feen …! Weißt du, wie sehr ich um dich geweint habe, als ich von deinem Tod las? Aber du lebst und alles wird gut werden! Du wirst die Geschichte neu erzählen –«
»Ich?«, unterbrach Staubfinger mit spöttischem Lächeln. »Nein, glaub mir, das tun ganz andere.«
»Nun ja, vielleicht!« Orpheus räusperte sich, als sei es ihm peinlich, so viel von seinen Gefühlen offenbart zu haben. »Wie dem auch sei, es ist zu ärgerlich, dass ich nicht mit dir gehen kann«, sagte er, während er mit seinem seltsam unbeholfenen Gang auf die Mauer am Straßenrand zusteuerte. »Der Vorleser muss bleiben, das ist die eiserne Regel. Ich habe alles versucht, um selbst in ein Buch zu schlüpfen, aber es geht einfach nicht.« Mit einem Seufzer blieb er stehen, schob die Hand unter die schlecht sitzende Jacke und zog ein Blatt Papier hervor. »Also – hier ist, was du bestellt hast«, sagte er zu Staubfinger. »Wunderbare Wörter, nur für dich, eine Straße aus Wörtern, die dich geradewegs zurückführen wird. Hier, lies!«
Zögernd nahm Staubfinger das Blatt entgegen. Feine, schräg stehende Buchstaben bedeckten es, verschlungen wie Nähgarn. Staubfinger fuhr mit dem Finger an den Wörtern entlang, als müsste er jedes einzelne seinen Augen erst zeigen, während Orpheus ihn beobachtete wie ein Schuljunge, der auf seine Note wartet.
Als Staubfinger endlich wieder den Kopf hob, klang seine Stimme überrascht. »Du schreibst sehr gut! Wunderschöne Worte …«
Der Käsekopf wurde so rot, als hätte ihm jemand Maulbeersaft ins Gesicht geschüttet. »Es freut mich, dass es dir gefällt!«
»Ja, es gefällt mir sehr! Alles so, wie ich es dir beschrieben habe. Es klingt nur ein bisschen besser.«
Mit verlegenem Lächeln nahm Orpheus Staubfinger das Blatt wieder aus der Hand. »Ich kann nicht versprechen, dass die Tageszeit die gleiche sein wird«, sagte er mit gedämpfter Stimme. »Die Gesetze meiner Kunst sind schwer zu ergründen, doch glaub mir, keiner weiß mehr über sie als ich! Beispielsweise sollte man ein Buch nur ändern oder fortspinnen, indem man Wörter benutzt, die darin schon zu finden sind. Bei zu viel fremden Wörtern passiert gar nichts oder etwas, das man nicht beabsichtigt hat! Vielleicht ist es anders, wenn man selbst der Autor …«
»Um aller Feen willen, in dir stecken ja mehr Wörter als in einer ganzen Bibliothek!«, unterbrach Staubfinger ihn ungeduldig. »Wie wäre es, wenn du jetzt einfach liest?«
Orpheus verstummte so abrupt, als hätte er seine Zunge verschluckt. »Sicher«, sagte er mit leicht gekränkter Stimme. »Du wirst sehen. Mit meiner Hilfe wird das Buch dich wieder aufnehmen wie einen verlorenen Sohn. Es wird dich aufsaugen wie Papier die Tinte!«
Staubfinger nickte nur und blickte die verlassene Straße hinauf. Farid spürte, wie gern er dem Käsekopf glauben wollte – und wie viel Angst er davor hatte, erneut enttäuscht zu werden.
»Was ist mit mir?« Farid trat dicht an seine Seite. »Er hat auch etwas über mich geschrieben, oder? Hast du nachgesehen?«
Orpheus warf ihm einen wenig wohlwollenden Blick zu. »Mein Gott!«, sagte er spöttisch zu Staubfinger. »Der Junge scheint ja wirklich sehr an dir zu hängen! Wo hast du ihn aufgelesen? Irgendwo am Straßenrand?«
»Nicht ganz«, antwortete Staubfinger. »Ihn hat derselbe Mann aus seiner Geschichte gepflückt, der auch mir diesen Gefallen tat.«
»Dieser … Zauberzunge?« Orpheus sprach den Namen so abfällig aus, als könnte er nicht glauben, dass irgendjemand ihn verdiente.
»Ja. So heißt er. Woher weißt du das?« Staubfingers Überraschung war nicht zu überhören.
Der Höllenhund beschnupperte Farids nackte Zehen – und Orpheus zuckte die Schultern. »Früher oder später hört man von jedem, der den Buchstaben das Atmen beibringen kann.«
»Ach ja?« Staubfingers Stimme klang ungläubig, aber er fragte nicht weiter nach. Er starrte nur auf das Blatt, das mit Orpheus’ feinen Buchstaben bedeckt war.
Der Käsekopf aber blickte immer noch Farid an. »Aus welchem Buch stammst du?«, fragte er. »Und warum willst du nicht in deine eigene Geschichte zurück statt in die seine, in der du nichts zu suchen hast?«
»Was geht dich das an?«, erwiderte Farid feindselig. Der Käsekopf gefiel ihm immer weniger. Er war zu neugierig – und viel zu schlau.
Staubfinger aber lachte nur leise. »Seine eigene Geschichte? Nein, nach der hat Farid nicht die Spur von Heimweh. Der Junge wechselt die Geschichten wie eine Schlange die Haut.« Farid hörte in seiner Stimme fast so etwas wie Bewunderung.
»So, tut er das?« Orpheus musterte Farid erneut auf so herablassende Weise, dass er ihm am liebsten gegen die plumpen Knie getreten hätte, wäre da nicht der Höllenhund gewesen, der ihn immer noch mit hungrigen Augen anstierte. »Nun, gut«, sagte Orpheus, während er sich auf der Mauer niederließ. »Ich warne dich trotzdem! Dich zurückzulesen ist eine Kleinigkeit, aber der Junge hat in der Geschichte nichts zu suchen! Ich darf seinen Namen nicht nennen. Es ist nur die Rede von einem Jungen, wie du gesehen hast, ich kann nicht garantieren, dass das funktioniert. Und selbst wenn, wird er vermutlich nichts als Verwirrung stiften. Vielleicht bringt er dir sogar Unglück!«
Wovon redete der verfluchte Kerl? Farid sah Staubfinger an. Bitte!, dachte er. O bitte! Hör nicht auf ihn! Nimm mich mit.
Staubfinger erwiderte seinen Blick. Und lächelte. »Unglück?«, sagte er, und seiner Stimme hörte man an, dass niemand ihm etwas über das Unglück erzählen musste. »Unsinn. Der Junge bringt mir Glück. Außerdem ist er ein ziemlich guter Feuerspucker. Er kommt mit mir. Und das hier auch.« Bevor Orpheus verstand, was gemeint war, griff Staubfinger nach dem Buch, das der Käsekopf neben sich auf die Mauer gelegt hatte. »Das brauchst du ja wohl nicht mehr, und ich werde wesentlich ruhiger schlafen, wenn es in meinem Besitz ist.«
»Aber …« Entgeistert sah Orpheus ihn an. »Ich hab dir doch gesagt, es ist mein Lieblingsbuch! Ich würde es wirklich gern behalten.«
»Nun, ich auch«, erwiderte Staubfinger nur und reichte das Buch Farid. »Hier. Pass gut darauf auf.«
Farid drückte es gegen die Brust und nickte. »Gwin«, sagte er. »Wir müssen Gwin noch rufen.« Aber als er etwas trockenes Brot aus der Hosentasche zog und Gwins Namen rufen wollte, presste Staubfinger ihm die Hand auf den Mund.
»Gwin bleibt hier!«, sagte er. Hätte er erklärt, er wollte seinen rechten Arm zurücklassen, Farid hätte ihn nicht ungläubiger angesehen. »Was starrst du mich so an? Wir fangen uns drüben einen anderen Marder, einen, der weniger bissig ist.«
»Nun, wenigstens bist du, was das betrifft, vernünftig«, sagte Orpheus.
Wovon redete er?
Aber Staubfinger wich Farids fragendem Blick aus. »Nun fang schon endlich an zu lesen!«, fuhr er Orpheus an. »Oder sollen wir hier noch stehen, wenn die Sonne aufgeht?«
Orpheus blickte ihn einen Moment lang an, als wollte er noch etwas sagen. Doch dann räusperte er sich. »Ja«, sagte er. »Ja, du hast recht. Zehn Jahre in der falschen Geschichte sind eine lange Zeit. Lesen wir.«
Wörter.
Wörter füllten die Nacht wie der Duft unsichtbarer Blüten. Maßgeschneiderte Wörter, geschöpft aus dem Buch, das Farid fest umklammert hielt, und zusammengefügt von Orpheus’ teigblassen Händen zu neuem Sinn. Von einer anderen Welt sprachen sie, von einer Welt voller Wunder und Schrecken. Und Farid lauschte und vergaß die Zeit. Er spürte nicht einmal mehr, dass es so etwas überhaupt gab. Es gab nur noch Orpheus’ Stimme, die so gar nicht zu dem Mund passen wollte, aus dem sie kam. Sie ließ alles verschwinden, die löchrige Straße und die ärmlichen Häuser an ihrem Ende, die Laterne, die Mauer, auf der Orpheus saß, ja, selbst den Mond über den schwarzen Bäumen. Und die Luft roch plötzlich fremd und süß …
Er kann es, dachte Farid, er kann es tatsächlich, während Orpheus’ Stimme ihn blind und taub machte für alles, was nicht aus Buchstaben bestand. Als der Käsekopf plötzlich schwieg, sah er sich verwirrt um, schwindlig vom Wohlklang der Wörter. Wieso waren die Häuser noch da und die Laterne, rostig von Wind und Regen? Auch Orpheus war noch da und sein Höllenhund.
Nur einer war fort. Staubfinger.
Farid aber stand immer noch auf derselben verlassenen Straße. In der falschen Welt.
Katzengold
So ein Bösewicht wie Joe musste sich ja – das war ihnen ganz klar – dem Teufel verschrieben haben, und es könnte doch allzu verhängnisvoll werden, sich mit einer solchen Macht in einen Kampf einzulassen.
Mark Twain, Die Abenteuer des Tom Sawyer
Nein!« Farid hörte das Entsetzen in seiner eigenen Stimme. »Nein! Was hast du getan? Wo ist er?«
Orpheus erhob sich umständlich von der Mauer, das verfluchte Blatt immer noch in der Hand, und lächelte. »Zu Hause. Wo sonst?«
»Und? Was ist mit mir? Lies weiter! Nun lies schon!« Alles verschwamm hinter dem Schleier seiner Tränen. Er war allein, wieder allein, so wie er es immer gewesen war, bevor er Staubfinger gefunden hatte. Farid begann zu zittern, so sehr, dass er gar nicht merkte, wie Orpheus ihm das Buch aus den Händen zog.
»Und erneut ist es bewiesen!«, hörte er ihn murmeln. »Ich trage meinen Namen zu Recht. Ich bin der Meister aller Worte, der geschriebenen wie der gesprochenen. Keiner kann sich messen mit mir.«
»Der Meister? Was redest du da?« Farid schrie so laut, dass selbst der Höllenhund sich duckte. »Wenn du so viel von deinem Handwerk verstehst, wieso bin ich dann noch hier? Los, lies noch mal! Und gib mir das Buch zurück!« Er griff danach, aber Orpheus wich mit erstaunlicher Geschmeidigkeit zurück.
»Das Buch? Warum sollte ich es dir geben? Du kannst doch vermutlich nicht mal lesen. Ich verrate dir etwas! Hätte ich gewollt, dass du mit ihm gehst, dann wärst du jetzt dort, aber du hast nichts in seiner Geschichte zu suchen, deshalb habe ich die Sätze über dich einfach nicht gelesen. Verstanden? Und jetzt mach, dass du fortkommst, bevor ich dir meinen Hund auf den Hals hetze. Jungen wie du haben ihn mit Steinen beworfen, als er ein Welpe war, seither jagt er deinesgleichen zu gern!«
»Du Sohn eines Hundes! Du Lügner! Betrüger!« Farids Stimme überschlug sich. Hatte er es nicht gewusst? Hatte er es Staubfinger nicht gesagt? Falsch wie Katzengold war der Käsekopf. Etwas drängte sich zwischen seinen Beinen hindurch, pelzig und rundnasig, mit winzigen Hörnern zwischen den Ohren. Der Marder. Er ist fort, Gwin!, dachte Farid. Staubfinger ist fort. Wir werden ihn nie wieder sehen!
Der Höllenhund senkte den klobigen Kopf und machte zögernd einen Schritt auf den Marder zu, aber Gwin entblößte die nadelspitzen Zähne, und der riesige Hund zog verblüfft die Nase zurück.
Seine Angst machte Farid Mut. »Gib es mir, na los!« Er stieß Orpheus die magere Faust vor die Brust. »Das Papier und das Buch! Oder ich schlitz dich auf wie einen Karpfen. Ja, das tue ich!« Dass er schluchzen musste, ließ die Sätze nicht halb so eindrucksvoll klingen, wie er es beabsichtigt hatte.
Orpheus tätschelte seinem Hund den Kopf, während er sich das Buch in den Hosenbund schob. »Oh, jetzt fürchten wir uns aber, nicht wahr, Cerberus?«
Gwin presste sich an Farids Beine. Sein Schwanz zuckte beunruhigt hin und her. Farid dachte, der Hund sei der Grund, selbst dann noch, als der Marder auf die Straße sprang und zwischen den Bäumen auf der anderen Seite verschwand. Blind und taub!, dachte er später immer wieder. Blind und taub, Farid.
Orpheus aber lächelte, wie jemand, der etwas mehr weiß als sein Gegenüber. »Weißt du, mein junger Freund«, sagte er. »Ich habe wirklich einen Höllenschreck bekommen, als Staubfinger das Buch zurückverlangte. Zum Glück hat er es dir gegeben, sonst hätte ich nichts für ihn tun können. Es war schwer genug, meinen Auftraggebern auszureden, ihn einfach umzubringen, aber sie mussten es mir versprechen. Nur unter der Bedingung habe ich den Köder gespielt … den Köder für das Buch, denn darum geht es hier, falls du das noch nicht begriffen hast. Es geht nur um das Buch, um nichts sonst. Ja, sie haben versprochen, Staubfinger kein Haar zu krümmen, aber von dir war leider nie die Rede.«
Bevor Farid begriff, wovon der Käsekopf sprach, spürte er das Messer an seinem Hals – scharf wie Schilfgras und kälter als der Dunst zwischen den Bäumen.
»Na, wen haben wir denn da?«, raunte ihm eine nie vergessene Stimme ins Ohr. »Hab ich dich nicht zuletzt bei Zauberzunge gesehen? Angeblich hast du Staubfinger trotzdem geholfen, ihm das Buch zu stehlen, nicht wahr? Tja, du bist schon ein nettes Bürschchen.« Das Messer schnitt Farid in die Haut und Pfefferminzatem strich ihm übers Gesicht. Hätte er Basta nicht an seiner Stimme erkannt, dann an seinem Atem. Sein Messer und ein paar Blätter Minze – Basta hatte beides immer dabei. Er kaute die Blätter und spuckte einem die Reste vor die Füße. Gefährlich wie ein tollwütiger Hund war er und nicht allzu klug, aber wie kam er hierher? Wie hatte er sie gefunden?
»Na, was hältst du von meinem neuen Messer?«, schnurrte er Farid ins Ohr. »Ich hätte den Feuerfresser ja zu gern auch damit bekannt gemacht, aber Orpheus hier hat eine Schwäche für ihn. Was soll’s, ich werde Staubfinger schon wiederfinden. Ihn und Zauberzunge und seine Hexentochter. Sie werden alle bezahlen …«
»Wofür?«, stieß Farid hervor. »Dafür, dass sie dich vor dem Schatten gerettet haben?«
Aber Basta presste ihm das Messer nur noch fester gegen den Hals. »Gerettet? Unglück haben sie mir gebracht, nichts als Unglück!«
»Um Himmels willen, steck das Messer weg!«, fuhr Orpheus mit angeekelter Stimme dazwischen. »Er ist bloß ein Junge. Lass ihn laufen. Ich habe das Buch, wie abgemacht, also –«
»Laufen lassen?« Basta lachte auf, aber das Lachen blieb ihm im Halse stecken. Ein Fauchen drang hinter ihnen aus dem Wald und der Höllenhund legte die Ohren an. Basta fuhr herum. »Was, zum Teufel? Verdammter Idiot! Was hast du da aus dem Buch kriechen lassen?«
Farid wollte es nicht wissen. Er spürte nur, wie Basta für einen Moment den Griff lockerte. Das reichte. Er biss ihn so fest in die Hand, dass er Blut schmeckte.
Basta schrie auf und ließ das Messer fallen.
Farid riss die Ellbogen zurück, stieß sie ihm gegen die hagere Brust – und rannte. Die Mauer am Straßenrand hatte er ganz vergessen. Er stolperte darüber und fiel so heftig auf die Knie, dass er nach Atem rang. Als er sich aufraffte, sah er das Papier auf dem Asphalt liegen, das Blatt Papier, das Staubfinger fortgebracht hatte. Der Wind musste es auf die Straße getrieben haben. Mit fliegenden Fingern griff er danach. Deshalb habe ich die Sätze über dich einfach nicht gelesen. Verstanden?, höhnte Orpheus’ Stimme in seinem Kopf. Farid presste das Blatt gegen die Brust und rannte weiter, über die Straße, auf die Bäume zu, die dunkel auf der anderen Seite warteten. Hinter ihm knurrte und bellte der Höllenhund, dann jaulte er auf. Wieder fauchte etwas, so wild, dass Farid nur noch schneller lief. Orpheus schrie auf, die Angst ließ seine Stimme schrill und hässlich werden. Basta fluchte, und dann war da wieder das Fauchen, wild wie das der großen Katzen, die es in Farids alter Welt gegeben hatte.
Nicht umsehen!, dachte er. Lauft, lauft!, befahl er seinen Beinen. Lasst die Katze den Höllenhund fressen, sie soll sie alle fressen, Basta und den Käsekopf dazu, nur lauft! Das welke Laub, das zwischen den Bäumen lag, war feucht und dämpfte das Geräusch seiner Schritte, aber es war glitschig und ließ ihn ausrutschen an dem steil abfallenden Hang. Verzweifelt suchte er Halt an einem Baumstamm, presste sich zitternd dagegen und lauschte in die Nacht. Was, wenn Basta ihn keuchen hörte?
Ein Schluchzen entrang sich seiner Brust. Er presste sich die Hände auf den Mund. Das Buch, Basta hatte das Buch! Hatte er nicht darauf aufpassen sollen – und wie sollte er Staubfinger nun jemals wiederfinden? Farid strich über das Blatt mit Orpheus’ Worten, das er immer noch gegen die Brust presste. Feucht und schmutzig war es – und seine ganze Hoffnung.
»Heee, du kleiner bissiger Bastard!« Bastas Stimme drang durch die stille Nacht. »Lauf nur, ich krieg dich doch, hörst du? Dich, den Feuerfresser, Zauberzunge und seine feine Tochter und den alten Mann, der die verfluchten Worte geschrieben hat! Ich werd euch alle töten. Einen nach dem anderen! So wie ich gerade das Biest aufgeschlitzt habe, das aus dem Buch gekommen ist.«
Farid wagte kaum zu atmen. Weiter!, dachte er. Los! Lauf weiter. Basta kann dich nicht sehen! Zitternd tastete er nach dem nächsten Baumstamm, suchte nach Halt und dankte dem Wind dafür, dass er über ihm an den Blättern riss und seine Schritte mit seinem Rauschen übertönte. Wie oft soll ich es dir noch sagen? In dieser Welt gibt es keine Geister. Einer der wenigen Vorzüge, die sie hat. Er hörte Staubfingers Stimme, als ginge er hinter ihm. Immer wieder wiederholte Farid sich die Worte, während die Tränen ihm übers Gesicht liefen und Dornen ihm die Füße zerschnitten. Es gibt keine Geister, gibt keine Geister!
Ein Zweig schlug ihm ins Gesicht, so heftig, dass er fast aufschrie. Folgten sie ihm? Er konnte nichts hören, nur den Wind. Wieder rutschte er aus, stolperte den Abhang hinunter. Nesseln verbrannten ihm die Beine, Kletten verfingen sich in seinem Haar. Und etwas sprang ihn an, pelzig und warm, stieß ihm die Nase ins Gesicht. »Gwin?« Farid tastete über den kleinen Kopf. Ja, da waren sie, die winzigen Hörner. Er presste das Gesicht gegen das weiche Marderfell. »Basta ist zurück, Gwin!«, flüsterte er. »Und er hat das Buch! Was, wenn Orpheus ihn nun hinüberliest? Irgendwann geht er bestimmt zurück, das denkst du doch auch, oder? Wie sollen wir Staubfinger jetzt nur vor ihm warnen?«
Zweimal noch stieß er auf die Straße, die sich den Berg hinunterwand, aber Farid wagte nicht, ihr zu folgen, schlug sich lieber weiter durch das stachlige Unterholz. Bald schmerzte jeder Atemzug, aber er blieb nicht stehen. Erst als die ersten Sonnenstrahlen sich durch die Bäume tasteten und Basta immer noch nicht hinter ihm aufgetaucht war, wusste Farid, dass er entkommen war.
Was nun?, dachte er, während er keuchend im trockenen Gras lag. Was nun? Und plötzlich erinnerte er sich an eine andere Stimme, die Stimme, die ihn in diese Welt gebracht hatte. Zauberzunge. Natürlich. Nur er konnte ihm jetzt helfen, er oder seine Tochter. Meggie. Bei der Bücherfresserin wohnten sie jetzt, Farid war mit Staubfinger einmal dort gewesen. Es war ein langer Weg, vor allem mit zerschnittenen Füßen. Aber er musste vor Basta dort sein …
Staubfingers Heimkehr
»Was ist das«, sagte der Leopard, »was so ausnehmend dunkel und doch so voller kleiner Lichtstücke ist?«
Rudyard Kipling, Wie der Leopard zu seinen Flecken kam
Für einen Moment schien es Staubfinger, als wäre er nie fort gewesen – als hätte er nur schlecht geträumt, die Erinnerung daran ein schaler Geschmack auf der Zunge, ein Schatten auf dem Herzen, nichts weiter … Alles war plötzlich wieder da, die Geräusche, so vertraut und nie vergessen, die Gerüche, die Stämme der Bäume, gescheckt vom Morgenlicht, die Schatten der Blätter auf seinem Gesicht. Einige färbten sich bunt, wie sie es in der anderen Welt getan hatten, auch hier nahte der Herbst, aber die Luft war immer noch mild. Sie roch nach überreifen Beeren, nach welkenden Blüten, tausend und mehr, deren Duft die Sinne betäubte – wachsblasse Blüten, leuchtend im Schatten der Bäume, blaue Sterne an hauchdünnen Stängeln, so zart, dass er seine Schritte zügelte, um sie nicht zu zertreten. Steineichen, Platanen, Tulpenbäume um ihn her … wie sie in den Himmel griffen! Er hatte fast vergessen, wie groß ein Baum sein konnte, wie breit und hoch sein Stamm, die Krone so ausladend, dass eine ganze Schar von Reitern darunter Schutz finden konnte. Die Wälder in der anderen Welt waren so jung. Sie hatten ihm immer das Gefühl gegeben, alt zu sein, so furchtbar alt, dass die Jahre ihn wie Ruß bedeckten. Hier war er wieder jung, kaum älter als die Pilze zwischen den Wurzeln, kaum größer als Disteln und Nesseln.
Aber wo war der Junge?
Suchend blickte Staubfinger sich um, rief seinen Namen, immer wieder. »Farid!« Der Name war ihm in den letzten Monaten fast so vertraut geworden wie der eigene. Aber niemand antwortete. Nur seine eigene Stimme hallte zwischen den Bäumen wider.
Also war es doch geschehen. Der Junge war dort geblieben. Was würde er nun anfangen, so ganz allein? Nun, was wohl?, dachte Staubfinger, während er sich ein letztes Mal vergebens umsah. Er wird besser zurechtkommen, als du es dort jemals zustande gebracht hast. Den Lärm, die Schnelligkeit, das Menschengedränge, das alles liebt er doch. Außerdem hast du ihm genug beigebracht, er spielt mit dem Feuer schon fast so geschickt wie du. Ja, der Junge würde bestens zurechtkommen. Dennoch, für einen Moment welkte die Freude in Staubfingers Brust wie eine der Blüten zu seinen Füßen, und das Morgenlicht, das ihn eben noch willkommen geheißen hatte, schien fahl und leblos. Die andere Welt hatte ihn erneut betrogen. Ja, sie hatte ihn tatsächlich freigelassen nach all den vielen Jahren, doch sie hatte das Einzige behalten, woran er dort drüben sein Herz gehängt hatte …
Nun, und was lernst du wieder mal daraus?, dachte er, während er sich ins taufeuchte Gras kniete. Behalte dein Herz besser für dich, Staubfinger. Er hob ein Blatt auf, das rot wie Feuer im dunklen Moos leuchtete. Solche Blätter hatte es in der anderen Welt nicht gegeben, oder? Was war nur los mit ihm? Ärgerlich richtete er sich wieder auf. He, Staubfinger! Du bist zurück! Zurück!, fuhr er sich an. Vergiss den Jungen, ja, er ist verloren gegangen, aber dafür hast du deine Welt zurück, eine ganze Welt. Du hast sie zurück. Glaub es! Glaub es endlich!
Wenn das nur nicht so schwer gewesen wäre. Es war so viel leichter, ans Unglück zu glauben als ans Glück. Jede Blume musste er anfassen, jeden Baum betasten, die Erde zwischen den Fingern zerreiben und den ersten Mückenstich auf der Haut spüren, bis er es endlich glaubte.
Ja, er war zurück. Er war tatsächlich zurück. Endlich. Und plötzlich stieg ihm das Glück zu Kopf wie ein Glas schwerer Wein. Selbst der Gedanke an Farid konnte es nicht länger trüben. Der Alptraum, der zehn Jahre gedauert hatte, war vorbei. Wie leicht er sich fühlte, leicht wie eins der Blätter, die wie Gold von den Bäumen regneten.
Glücklich.
Erinnre dich, Staubfinger, so fühlt es sich an. Das Glück.
Orpheus hatte ihn tatsächlich an genau den Ort gelesen, den er ihm beschrieben hatte. Dort war der Tümpel, schimmernd zwischen grauweißen Steinen, umrahmt von blühendem Oleander, und nur wenige Schritte entfernt vom Ufer stand die Platane, an der die Feuerelfen nisteten. Ihre Nester schienen noch dichter an dem hellen Stamm zu kleben, als sie es in seiner Erinnerung getan hatten. Ein ungeübteres Auge hätte sie für Bienennester gehalten, aber sie waren kleiner und etwas heller, fast so hell wie die Rinde, die sich von dem hohen Stamm schälte.
Staubfinger blickte sich um und atmete erneut die Luft, die er zehn Jahre lang vermisst hatte. Fast vergessene Düfte mischten sich mit solchen, die auch die andere Welt kannte. Die Bäume am Rand des Tümpels hatte man dort ebenso finden können, auch wenn sie kleiner und so viel jünger gewesen waren: Eukalyptus und Erle streckten Zweige übers Wasser, als wollten sie sich die Blätter kühlen. Staubfinger bahnte sich vorsichtig einen Weg hindurch, bis er am Ufer stand. Eine Schildkröte machte sich gemächlich davon, als sein Schatten auf ihren Panzer fiel. Auf einem Stein ließ eine Kröte die Zunge vorschnellen und verschlang eine Feuerelfe. In Schwärmen schwirrten sie über dem Wasser – mit ihrem feinen Gesumm, das immer so zornig klang.
Es wurde Zeit, sie zu bestehlen.
Staubfinger kniete sich auf einen der feuchten Steine. Hinter ihm raschelte es, und für einen Moment ertappte er sich dabei, dass er nach Farids dunklem Haar und Gwins gehörntem Kopf Ausschau hielt, aber es war nur eine Eidechse, die sich aus den Blättern schob und auf einen der Steine kroch, um sich dort in die herbstliche Sonne zu legen. »Dummkopf!«, murmelte er, während er sich vorbeugte. »Vergiss den Jungen, und was den Marder betrifft, der vermisst dich sicherlich nicht. Außerdem hattest du gute Gründe, ihn zurückzulassen. Die allerbesten.«
Sein Spiegelbild zitterte auf dem dunklen Wasser. Das Gesicht war noch das alte. Die Narben waren immer noch da, natürlich, aber es war wenigstens kein neuer Schaden entstanden, keine eingedrückte Nase, kein steifes Bein wie bei Cockerell, alles war an seinem Platz. Sogar seine Stimme hatte er noch … dieser Orpheus schien sein Handwerk wirklich zu verstehen.
Staubfinger beugte sich tiefer über das Wasser. Wo waren sie? Ob sie ihn vergessen hatten? Die blauen Feen vergaßen jedes Gesicht, oft schon nach Minuten. Wie war das bei ihnen? Zehn Jahre waren eine lange Zeit, aber zählten sie die Jahre?
Das Wasser bewegte sich und sein Spiegelbild mischte sich mit einem anderen Gesicht. Unkenaugen blickten ihn an aus einem fast menschlichen Antlitz, das lange Haar trieb im Wasser wie Gras, ebenso grün und fein. Staubfinger zog die Hand aus dem kühlen Wasser, und eine andere streckte sich heraus, schmal und fein, fast wie die eines Kindes, bedeckt mit so winzigen Schuppen, dass man sie kaum sah. Ein feuchter Finger, kühl wie das Wasser, aus dem er aufgetaucht war, berührte sein Gesicht, fuhr an den Narben entlang.
»Ja, mein Gesicht ist unvergesslich, nicht wahr?« Staubfinger sprach so leise, dass seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern war. Nixen mögen keine lauten Stimmen. »Du erinnerst dich also an die Narben. Erinnerst du dich auch an das, was ich immer von euch erbeten habe, wenn ich herkam?«
Die Unkenaugen blickten ihn an, Gold und Schwarz, dann verschwand die Nixe, versank, als wäre sie nichts als ein Trugbild gewesen. Ein paar Augenblicke später tauchten gleich drei von ihnen in dem dunklen Wasser auf. Schultern blass wie Lilienblätter schimmerten unter der Oberfläche, Fischschwänze, bunt geschuppt wie Barschbäuche, wanden sich, kaum sichtbar, in der Tiefe.
Die winzigen Mücken, die über dem Wasser tanzten, zerstachen Staubfinger Gesicht und Arme, als hätten sie nur auf ihn gewartet, aber er spürte es kaum. Die Nixen hatten ihn nicht vergessen, weder sein Gesicht noch das, was er von ihnen brauchte, um das Feuer zu rufen.
Sie streckten ihre Hände aus dem Wasser. Winzige Luftbläschen stiegen an die Oberfläche und brachten ihr Lachen mit, lautlos wie alles an ihnen. Sie nahmen seine Hände zwischen ihre, strichen ihm über die Arme, übers Gesicht und den nackten Hals, bis seine Haut fast so kühl war wie die ihre, bedeckt mit demselben feinen Schlick, der ihre Schuppen schützte.
Ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren, verschwanden sie auch wieder. Ihre Gesichter versanken im Dunkel des Teiches, und Staubfinger hätte wie jedes Mal geglaubt, er habe sie nur geträumt, wäre da nicht die Kühle auf seiner Haut gewesen, der Schimmer auf seinen Händen und Armen.
»Danke!«, flüsterte er, obwohl nur noch sein eigenes Spiegelbild auf dem Wasser zitterte, dann richtete er sich auf, schob sich durch die Oleanderbüsche am Ufer und schritt so lautlos wie möglich auf den Feuerbaum zu. Wäre Farid hier gewesen, er wäre vor Aufregung wie ein Fohlen durch das feuchte Gras gesprungen …
Spinnweben, feucht vom Tau, klebten an Staubfingers Kleidern, als er vor der Platane stehen blieb. Die untersten Nester hingen so tief, dass er bequem in eins der Einfluglöcher greifen konnte. Zornig schwirrten ihm die ersten Elfen entgegen, als er die von den Nixen benetzten Finger hineinschob, aber er besänftigte sie mit einem leisen Summen. Traf man den richtigen Ton, dann wurde ihr aufgeregtes Schwirren schon bald ein taumelnder Flug, ihr eigenes Summen und Schimpfen schläfrig, bis sie sich auf seinen Armen niederließen, mit ihren winzigen heißen Körpern, die ihm die Haut verbrannten. Auch wenn das noch so schmerzte, er durfte nicht zurückzucken, durfte sie nicht fortscheuchen, musste die Finger noch etwas tiefer hineinstecken in das Nest, bis er dort fand, was er suchte: ihren feurigen Honig. Bienen stachen, Feuerelfen brannten einem Löcher in die Haut, wenn die Nixen sie nicht vorher berührt hatten. Und selbst mit diesem Schutz war es ratsam, nicht zu gierig zu sein, wenn man sie bestahl. Nahm man zu viel, dann flogen sie einem ins Gesicht, verbrannten Haut und Haar und ließen den Räuber nicht ziehen, bevor er sich vor Schmerz zu Füßen ihres Baumes krümmte.
Aber Staubfinger war niemals so gierig, dass er sie verärgerte. Nur einen winzigen Klumpen klaubte er aus dem Nest, kaum größer als sein Daumennagel, mehr brauchte er fürs Erste nicht. Er summte weiter mit leiser Stimme, während er seine klebrige Beute in ein Blatt wickelte.
Die Feuerelfen wurden munter, sobald er aufhörte zu summen. Immer schneller umschwirrten sie ihn, schneller und schneller, während ihre Stimmen anschwollen wie zorniges Hummelgebrumm. Dennoch griffen sie ihn nicht an. Man durfte sie nicht ansehen, musste tun, als bemerkte man sie gar nicht, während man sich umwandte, ohne Hast, und davonging, langsam, ganz langsam.
Sie schwirrten Staubfinger noch eine ganze Weile nach, doch schließlich blieben sie zurück, und er folgte dem schmalen Bach, der dem Tümpel der Nixen entsprang und sich langsam zwischen Weiden, Erlen und schilfigem Gras davonschlängelte.
Er wusste, wohin der Bach ihn führen würde: hinaus aus dem Weglosen Wald, in dem man kaum je seinesgleichen begegnete, nach Norden, dorthin, wo der Wald den Menschen gehörte, wo sein Holz ihren Äxten so schnell zum Opfer fiel, dass die Bäume meist starben, bevor ihre Krone auch nur einem Reiter hätte Schutz bieten können. Der Bach würde ihn führen, durch das sich langsam weitende Tal, zwischen Hügeln hindurch, die kein Mensch je betreten hatte, weil dort Riesen und Bären hausten und Geschöpfe, denen noch niemand einen Namen gegeben hatte. Irgendwann würde an den Hängen die erste Köhlerhütte auftauchen, der erste kahle Fleck im dichten Grün, und Staubfinger würde nicht nur die Feen und Nixen wiedersehen, sondern hoffentlich auch ein paar lang vermisste Menschen.
Er duckte sich, als zwischen zwei fernen Bäumen ein schläfriger Wolf auftauchte. Reglos wartete er, bis die graue Schnauze wieder verschwunden war. Ja, Bären und Wölfe – er musste es wieder lernen, auf ihre Schritte zu lauschen, zu spüren, dass sie in der Nähe waren, bevor sie ihn sahen, nicht zu vergessen die großen wilden Katzen, gescheckt wie Baumstämme im Sonnenlicht, und die Schlangen, grün wie das Laub, in dem sie sich so gern versteckten. Sie ließen sich von den Ästen herab, lautloser, als seine Hand ein Blatt von der Schulter wischen konnte. Zum Glück blieben die Riesen meist auf ihren Hügeln, dort, wohin nicht einmal er sich traute. Nur im Winter stiegen sie manchmal herab. Doch es gab noch andere Geschöpfe, Wesen, die nicht so sanft wie die Nixen waren und nicht durch ein Summen zu besänftigen wie die Feuerelfen. Meist blieben sie unsichtbar, gut verborgen zwischen Holz und Grün, aber gefährlich nichtsdestotrotz: Borkenmänner, Lochgreifer, Schwarze Alben, Nachtmahre … Einige von ihnen trauten sich bisweilen bis zu den Hütten der Köhler.
»Also, etwas mehr Vorsicht!«, flüsterte Staubfinger. »Du willst doch nicht, dass dein erster Tag zu Hause auch dein letzter ist.«
Der Rausch über seine Rückkehr verflog langsam und ließ ihn wieder klarer denken. Das Glück aber blieb, weich und warm in seinem Herzen, wie der Flaum eines jungen Vogels.
An einem Bach zog er die Kleider aus, wusch sich den Nixenschlick vom Körper, den Ruß der Feuerelfen und den Schmutz der anderen Welt. Dann schlüpfte er in die Kleider, die er zehn Jahre lang nicht getragen hatte. Er hatte sie sorgsam gepflegt, aber ein paar Mottenlöcher waren doch in dem schwarzen Stoff, und die Ärmel waren schon zerschlissen gewesen, als er sie für die andere Welt ablegte. Schwarz und rot war alles, die Farben der Feuerspucker, so wie die Seiltänzer sich in das Blau des Himmels kleideten. Er strich über den rauen Stoff, streifte sich das Wams mit den weiten Ärmeln über und warf sich den dunklen Umhang über die Schultern. Zum Glück passte noch alles, es war ein teurer Spaß, sich neue Kleider schneidern zu lassen, selbst wenn man es wie die Spielleute hielt und dem Schneider die alten Kleider überließ, damit er sie neu zusammenstückelte.
Als es dämmerte, hielt er Ausschau nach einem sicheren Schlafplatz. Schließlich stieg er auf eine umgestürzte Korkeiche, deren Wurzelballen so hoch in die Luft ragte, dass er sich gut zum Schlafen eignete. Wie ein Wall aus Erde war er und krallte sich dennoch weiter in den Boden, als wollte er das Leben einfach nicht loslassen. Die Krone des gestürzten Baumes hatte frisch ausgetrieben, obwohl sie nicht länger in den Himmel griff, sondern in die Erde. Behände balancierte Staubfinger den mächtigen Stamm hinauf, krallte die Finger in die raue Rinde.
Als er oben zwischen den Wurzeln stand, die sich in die Luft streckten, als könnten sie auch dort Nahrung finden, flogen schimpfend ein paar Feen auf, die offenbar gerade nach Baumaterial für ihre Nester gesucht hatten. Natürlich, es wurde Herbst und damit Zeit für einen etwas wetterfesteren Schlafplatz. Die blauen Feen gaben sich nicht sonderlich viel Mühe mit den Nestern, die sie im Frühling bauten, doch sobald das erste Blatt sich bunt färbte, begannen sie, sie auszubessern und zu polstern, mit Tierhaaren und Vogelfedern, flochten zusätzliche Gräser und Zweige in die Wände und dichteten sie ab mit Moos und Feenspucke.
Zwei der winzigen blauen Dinger flatterten nicht davon, als sie ihn sahen. Begierig starrten sie auf sein fuchsblondes Haar, während das Abendlicht, das durch die Baumkronen fiel, ihre Flügel rot färbte.
»Ach ja, natürlich!« Staubfinger lachte leise. »Ihr wollt etwas von meinem Haar, für eure Nester.« Mit dem Messer schnitt er eine Strähne ab. Mit käferfeinen Händen griff die eine Fee zu und flatterte hastig mit dem Haarbüschel davon. Die andere, so winzig, dass sie wohl gerade erst aus ihrem perlmuttweißen Ei geschlüpft war, folgte ihr. Er hatte sie vermisst, die frechen blauen Dinger, so sehr vermisst.
Unter ihm hielt die Nacht Einzug zwischen den Bäumen, auch wenn über ihm die untergehende Sonne die Wipfel noch so rot färbte wie Sauerampfer in einer Sommerwiese. Bald würden die Feen in ihren Nestern schlafen, die Mäuse und Kaninchen in ihren Höhlen, den Eidechsen würde die Kühle der Nacht die Glieder steif machen; und die Jäger würden sich bereit machen, ihre Augen gelbe Lichter in der schwarzen Nacht. Nun, hoffen wir, dass sie keinen Appetit auf einen Feuerspucker haben, dachte Staubfinger, während er die Beine auf dem umgestürzten Stamm ausstreckte. Er stieß das Messer neben sich in die brüchige Rinde, zog sich den Umhang, den er zehn Jahre nicht getragen hatte, um die Schultern und starrte zu den immer dunkler werdenden Blättern hinauf. Eine Eule schwang sich aus einer Steineiche und glitt davon, kaum mehr als ein Schatten zwischen den Zweigen. Ein Baum wisperte im Schlaf, als der Tag verlosch, Worte, die kein Menschenohr verstand.
Staubfinger schloss die Augen und lauschte.
Er war wieder zu Hause.
Zauberzunges Tochter
Gab es doch nur eine Welt, die von anderen
Welten träumte?
Philip Pullman, Das magische Messer
Meggie hasste es, mit Mo zu streiten. Alles in ihr zitterte danach, und nichts konnte sie trösten, nicht die Umarmungen ihrer Mutter, nicht die Lakritzschnecken, die Elinor ihr zusteckte, wenn sie ihre lauten Stimmen bis in die Bibliothek gehört hatte, nicht Darius, der in solchen Fällen an die wundersame Wirkung heißer, honiggesüßter Milch glaubte.
Nichts.
Diesmal war es besonders schlimm gewesen, denn Mo war eigentlich nur zu ihr gekommen, um sich zu verabschieden. Ein neuer Auftrag wartete, ein paar kranke Bücher, zu alt und kostbar, um sie ihm zu schicken. Früher wäre Meggie mit ihm gefahren, aber diesmal hatte sie beschlossen, bei Elinor und ihrer Mutter zu bleiben.
Warum war er auch ausgerechnet in ihr Zimmer gekommen, als sie wieder in den Notizbüchern gelesen hatte?
Wegen dieser Bücher hatten sie in letzter Zeit oft gestritten, obwohl Mo das Streiten ebenso hasste wie sie. Meist verschwand er danach in der Werkstatt, die Elinor hinter dem Haus für ihn hatte bauen lassen, und Meggie ging ihm irgendwann nach, wenn sie es nicht mehr aushielt, wütend auf ihn zu sein. Er hob nie den Kopf, wenn sie durch die Tür schlüpfte, und Meggie setzte sich wortlos neben ihn, auf den Stuhl, der dort immer auf sie wartete, und sah ihm bei der Arbeit zu, wie sie es schon getan hatte, als sie noch nicht einmal hatte lesen können. Sie liebte es, seinen Händen dabei zuzusehen, wenn sie ein Buch von seinem zerschlissenen Kleid befreiten, fleckige Seiten voneinander lösten, die Fäden durchtrennten, die einen beschädigten Buchblock hielten, oder altes, unbeschriebenes Hadernpapier einweichten, um damit ein zerfressenes Blatt zu flicken. Es dauerte nie lange, bis Mo sich umdrehte und sie irgendetwas fragte: ob ihr die Farbe, die er für einen Leinenbezug gewählt hatte, gefiel, ob sie nicht auch dächte, dass der Papierbrei, den er zum Flicken angerührt hatte, etwas zu dunkel geraten wäre. Das war Mos Art, Entschuldigung zu sagen: Lass uns nicht mehr streiten, Meggie, lass uns vergessen, was wir gesagt haben …
Aber heute ging das nicht. Weil er nicht in seiner Werkstatt verschwunden, sondern fortgefahren war, zu irgendeinem Sammler, um dessen gedruckten Schätzen das Leben zu verlängern. Diesmal würde er nicht zu ihr kommen und ihr als Versöhnungsgeschenk ein Buch bringen, entdeckt in irgendeinem Antiquariat, oder ein Lesezeichen, verziert mit Eichelhäherfedern, die er in Elinors Garten gefunden hatte …
Warum hatte sie nicht in einem anderen Buch lesen können, als er in ihr Zimmer gekommen war?
»Himmel, Meggie, du hast ja nichts anderes mehr im Kopf als diese Notizbücher!«, hatte er sie angefahren, wie jedes Mal, wenn er sie in den letzten Monaten so in ihrem Zimmer gefunden hatte – auf dem Teppich liegend, taub und blind für alles, was um sie herum vorging, die Augen festgesaugt an den Buchstaben, mit denen sie aufgezeichnet hatte, was Resa ihr erzählt hatte – über das, was sie ›dort‹ erlebt hatte, wie Mo es mit bitterer Stimme nannte.
Dort.
Tintenwelt hatte Meggie den Ort genannt, von dem Mo so abfällig und ihre Mutter manchmal mit Sehnsucht sprach … Tintenwelt nach dem Buch, das von diesem Ort erzählte: Tintenherz. Das Buch war fort, aber die Erinnerungen ihrer Mutter waren so lebendig, als wäre kein Tag vergangen, seit sie dort gewesen war – in jener Welt aus Papier und Druckerschwärze, in der es Feen und Fürsten gab, Nixen, Feuerelfen und Bäume, die in den Himmel zu wachsen schienen.
Unzählige Tage und Nächte hatte Meggie neben Resa gesessen und aufgeschrieben, was ihre Mutter mit den Fingern erzählte. Ihre Stimme hatte Resa in der Tintenwelt gelassen, und so erzählte sie ihrer Tochter entweder mit Stift und Papier oder mit den Händen von jenen Jahren – den schrecklichen Wunderjahren, wie sie sie nannte. Manchmal zeichnete sie auch, was sie mit ihren Augen gesehen, aber mit ihrer Zunge nicht länger beschreiben konnte: Feen, Vögel, fremdartige Blüten, mit ein paar Strichen aufs Papier gebannt und doch so echt, dass Meggie fast glaubte, sie selbst gesehen zu haben.
Zunächst hatte Mo die Notizbücher, in denen Meggie Resas Erinnerungen festhielt, selbst gebunden, eines schöner als das andere. Doch irgendwann hatte Meggie bemerkt, wie besorgt er sie beobachtete, wenn sie in ihnen blätterte, ganz versunken in die Bilder und Worte. Natürlich verstand sie sein Unbehagen, schließlich hatte er seine Frau für viele Jahre an diese Welt aus Buchstaben und Papier verloren. Wie sollte es ihm da gefallen, dass seine Tochter kaum noch an etwas anderes dachte? Ja, Meggie verstand Mo sehr gut, und trotzdem konnte sie nicht tun, was er verlangte – die Notizbücher fortschließen und die Tintenwelt für eine Weile vergessen.
Vielleicht wäre ihre Sehnsucht nicht ganz so groß gewesen, wären all die Feen und Kobolde noch da gewesen, all die fremdartigen Geschöpfe, die sie mitgebracht hatten aus Capricorns verfluchtem Dorf. Doch es lebte nicht eines mehr in Elinors Garten. Die leeren Feennester klebten immer noch an den Bäumen, auch die Höhlen gab es noch, die die Kobolde gegraben hatten, aber ihre Bewohner waren verschwunden. Zuerst hatte Elinor geglaubt, sie wären fortgelaufen, gestohlen worden, was auch immer – doch dann hatten sie die Asche gefunden. Fein wie Staub hatte sie das Gras im Garten bedeckt, graue Asche, ebenso grau wie der Schatten, aus dem Elinors fremdartige Gäste einst hervorgegangen waren. Und Meggie hatte begriffen, dass es wohl doch keine Rückkehr vom Tod gab, auch nicht für Geschöpfe, die nur aus Worten erschaffen worden waren.
Elinor jedoch hatte sich mit diesem Gedanken nicht abfinden können. Trotzig und voll Verzweiflung war sie noch einmal zurück in Capricorns Dorf gefahren – um dort leere Gassen vorzufinden, niedergebrannte Häuser und nicht ein einziges atmendes Wesen. »Weißt du, Elinor«, hatte Mo gesagt, als sie mit verweintem Gesicht zurückkam, »ich hatte so etwas befürchtet. Ich konnte nie so recht glauben, dass es Worte gibt, die Tote zurückholen. Und außerdem – wenn du ehrlich bist –, sie passten nicht in diese Welt.« »Das tue ich auch nicht!«, hatte Elinor darauf nur erwidert.
In den Wochen danach hatte Meggie so manches Mal, wenn sie abends noch einmal in die Bibliothek schlich, um sich ein Buch zu holen, ein Schluchzen aus Elinors Zimmer gehört. Viele Monate waren seither verstrichen, fast ein Jahr schon lebten sie nun alle zusammen in dem großen Haus, und Meggie hatte das Gefühl, dass es Elinor gefiel, nicht länger allein mit ihren Büchern zu leben. Sie hatte ihnen die schönsten Zimmer überlassen. (Elinors Sammlung alter Schulbücher und ein paar Dichter, die bei ihr in Ungnade gefallen waren, hatten dafür auf dem Dachboden Quartier beziehen müssen.) Von Meggies Fenster aus blickte man auf schneegesäumte Berge, und vom Schlafzimmer ihrer Eltern sah man den See, dessen schimmerndes Wasser die Feen so oft dazu verlockt hatte hinunterzuflattern.
Noch nie war Mo so einfach fortgefahren. Ohne ein Wort des Abschieds. Ohne Versöhnung …
Vielleicht sollte ich nach unten gehen und Darius in der Bibliothek helfen!, dachte Meggie, während sie dasaß und sich die Tränen vom Gesicht wischte. Sie weinte nie, während sie mit Mo stritt, die Tränen kamen immer erst später … Und wenn er ihre verweinten Augen zu Gesicht bekam, blickte er jedes Mal furchtbar schuldbewusst drein.
Bestimmt hatten wieder alle gehört, dass sie sich gestritten hatten! Darius hatte vermutlich schon die Honigmilch aufgesetzt, und Elinor würde zu schimpfen beginnen, sobald sie den Kopf durch die Küchentür steckte, auf Mo und die Männer im Allgemeinen. Nein, besser, sie blieb in ihrem Zimmer.
Ach, Mo. Er hatte ihr das Notizbuch, in dem sie las, aus der Hand gerissen und es mitgenommen. Ausgerechnet das Buch, in dem sie Ideen für eigene Geschichten gesammelt hatte, Anfänge, aus denen nie mehr geworden war, erste Wörter, durchgestrichene Sätze, all ihre vergeblichen Versuche … Wie konnte er es ihr einfach wegnehmen? Sie wollte nicht, dass Mo darin las, dass er sah, wie vergeblich sie versuchte, die Wörter aneinanderzufügen, die ihr beim Lesen so leicht und machtvoll über die Zunge kamen. Ja, Meggie konnte aufschreiben, was ihre Mutter berichtete, sie konnte Seiten um Seiten mit dem füllen, was Resa ihr beschrieb. Doch sobald sie versuchte, daraus etwas Neues zu spinnen, eine Geschichte, die ihr eigenes Leben hatte, fiel ihr einfach nichts ein. Die Wörter schienen aus ihrem Kopf zu verschwinden – wie Schneeflocken, von denen nichts bleibt als ein feuchter Fleck auf der Haut, sobald man die Hand nach ihnen ausstreckt.
Jemand klopfte an Meggies Tür.
»Herein!«, schniefte sie und suchte in ihren Hosentaschen nach einem der altmodischen Taschentücher, die Elinor ihr geschenkt hatte. (»Sie haben meiner Schwester gehört. Ihr Name begann mit einem M wie deiner. Es ist unten in die Ecke gestickt, siehst du? Ich dachte, besser du hast sie, als dass die Motten sie fressen.«)
Ihre Mutter steckte den Kopf durch die Tür.
Meggie versuchte ein Lächeln, aber es misslang kläglich.
»Kann ich reinkommen?« Resas Finger malten die Wörter schneller in die Luft, als Darius sie über die Lippen brachte, und Meggie nickte. Sie beherrschte die Zeichensprache ihrer Mutter inzwischen fast ebenso selbstverständlich wie die Buchstaben des Alphabets – besser als Mo und Darius und viel besser als Elinor, die oft, wenn Resas Finger ihr zu schnell sprachen, verzweifelt nach Meggie rief.
Resa schloss die Tür hinter sich und setzte sich zu ihr auf das Fensterbrett. Meggie nannte ihre Mutter stets beim Vornamen, vielleicht, weil sie zehn Jahre lang keine Mutter gehabt hatte, vielleicht aber auch aus demselben unerfindlichen Grund, aus dem ihr Vater für sie immer nur Mo gewesen war.
Meggie erkannte das Notizbuch sofort, das Resa ihr in den Schoß legte. Es war dasselbe, das Mo ihr fortgenommen hatte. »Es lag vor deiner Tür«, sagten die Hände ihrer Mutter.
Meggie strich über den gemusterten Einband. Mo hatte es also zurückgebracht. Warum war er nicht hereingekommen? Weil er noch zu wütend gewesen war oder weil es ihm leidgetan hatte?
»Er will, dass ich die Notizbücher auf den Dachboden bringe. Wenigstens für eine Weile.« Meggie fühlte sich plötzlich so klein. Und gleichzeitig so alt. »›Vielleicht sollte ich mich in einen Glasmann verwandeln‹, hat er gesagt, ›oder mir die Haut blau färben, denn meine Tochter und meine Frau sehnen sich ja offenbar mehr nach Feen und Glasmännern als nach mir.‹«
Resa lächelte und strich ihr mit dem Zeigefinger über die Nase.
»Ja, ich weiß, natürlich glaubt er das nicht wirklich! Aber er wird jedes Mal so wütend, wenn er mich mit den Notizbüchern sieht …«
Resa blickte durch das offene Fenster in den Garten hinaus. Elinors Garten war so groß, dass man keinen Anfang und kein Ende sah, nur hohe Bäume und Rhododendronbüsche, die so alt waren, dass sie Elinors Haus wie ein immergrüner Wald umstanden. Direkt unter Meggies Fenster lag ein Stück Rasen, begrenzt von einem schmalen Kiesweg. Am Rand stand eine Bank. Meggie erinnerte sich noch gut an die Nacht, in der sie darauf gesessen und Staubfinger beim Feuerspucken zugesehen hatte.
Den Rasen hatte Elinors ständig mürrischer Gärtner erst am Nachmittag von welkem Laub befreit. In der Mitte sah man immer noch die kahle Stelle, an der Capricorns Männer Elinors schönste Bücher verbrannt hatten. Der Gärtner versuchte immer wieder, Elinor zu überreden, die Stelle zu bepflanzen oder neuen Rasen zu säen, doch Elinor schüttelte jedes Mal nur energisch den Kopf. »Seit wann sät man Rasen auf ein Grab?«, hatte sie ihn angefahren, als er das letzte Mal gefragt hatte, und ihn angewiesen, auch die Schafgarbe stehen zu lassen, die seit dem Feuer so üppig am Rand der schwarz gebrannten Erde spross, als wollte sie mit ihren flachen Schirmblüten an die Nacht erinnern, in der Elinors gedruckte Kinder von den Flammen verschlungen worden waren.
Die Sonne ging hinter den nahen Bergen unter, so rot, als wollte auch sie an das längst verloschene Feuer erinnern, und ein kühler Wind strich von draußen herein, der Resa schaudern ließ.
Meggie schloss das Fenster. Der Wind trieb ein paar welke Rosenblätter gegen die Scheibe. Blassgelb und durchscheinend blieben sie an dem Glas kleben. »Ich will doch gar nicht mit ihm streiten«, flüsterte sie, »ich hab mich früher nie mit Mo gestritten, na ja, fast nie …«
»Vielleicht hat er ja recht.« Ihre Mutter strich sich das Haar zurück. Es war ebenso lang wie das von Meggie, aber dunkler, als wäre ein Schatten darauf gefallen. Meist steckte Resa es mit einer Spange zusammen. Auch Meggie trug ihr Haar inzwischen oft auf diese Weise, und manchmal, wenn sie sich in dem Spiegel an ihrem Schrank betrachtete, schien es, als blickte ihr nicht sie selbst, sondern ein jüngeres Abbild ihrer Mutter entgegen. »Ein Jahr noch, dann wächst sie dir über den Kopf«, sagte Mo manchmal, wenn er Resa ärgern wollte, und Darius mit seinen kurzsichtigen Augen war es schon so manches Mal passiert, dass er Meggie mit ihrer Mutter verwechselte.
Resa fuhr mit dem Zeigefinger über die Fensterscheibe, als zeichnete sie die Rosenblätter nach, die daran klebten. Dann begannen ihre Hände wieder zu sprechen, zögernd, wie auch Lippen es manchmal tun: »Ich verstehe deinen Vater, Meggie«, sagten sie, »manchmal denke ich auch, dass wir zwei zu oft über diese andere Welt reden. Ich verstehe selbst nicht, warum ich immer wieder davon anfange. Und ständig erzähle ich dir von dem, was schön war, statt von den anderen Dingen: dem Eingesperrtsein, Mortolas Strafen, wie mir die Knie und Hände schmerzten von der Arbeit, so sehr, dass ich nicht schlafen konnte … all die Grausamkeiten, die ich dort gesehen habe … Hab ich dir je von der Magd erzählt, die vor Angst starb, weil ein Nachtmahr sich in unsere Kammer gestohlen hatte?«
»Ja, hast du!« Meggie rückte ganz dicht an ihre Seite, aber die Hände ihrer Mutter schwiegen. Sie waren immer noch rau von all den Jahren, in denen sie eine Magd gewesen war, erst Mortolas und dann Capricorns Magd. »Du hast mir alles erzählt«, sagte Meggie, »auch die schlimmen Sachen, aber Mo will das nicht glauben!«
»Weil er spürt, dass wir trotzdem immer nur von dem Wunderbaren träumen. Als ob ich davon viel gehabt hätte.« Resa schüttelte den Kopf. Wieder schwiegen ihre Finger eine ganze Weile, bevor sie sie weitersprechen ließ. »Ich musste mir die Zeit zusammenstehlen, Sekunden, Minuten, manchmal eine ganze kostbare Stunde, wenn wir hinaus in den Wald durften, um für Mortola Pflanzen zu sammeln, die sie für ihre schwarzen Tränke brauchte.«
»Aber da waren auch die Jahre, in denen du frei warst! Die Jahre, in denen du dich verkleidet und als Schreiber auf den Märkten gearbeitet hast.« Verkleidet als Mann … Meggie hatte sich nichts öfter ausgemalt als dieses Bild: ihre Mutter, das Haar kurz, im dunklen Kittel eines Schreibers, an den Fingern Tinte und die schönste Handschrift, die sich in der Tintenwelt finden ließ. So hatte Resa es ihr erzählt. So hatte sie sich ihr Brot verdient, in einer Welt, die Frauen das nicht leicht machte. Meggie hätte die Geschichte gleich noch einmal hören mögen, auch wenn sie ein trauriges Ende hatte, denn danach hatten die schlimmen Jahre begonnen. Doch waren nicht auch in denen wunderbare Dinge geschehen? Wie das große Fest auf der Burg des Speckfürsten, zu dem Mortola auch ihre Mägde mitgenommen hatte, das Fest, auf dem Resa den Speckfürsten gesehen hatte, den Schwarzen Prinzen und seinen Bären und den Gaukler auf dem Seil, Wolkentänzer …
Resa jedoch war nicht gekommen, um all das erneut zu erzählen. Sie schwieg. Und als ihre Finger doch wieder sprachen, taten sie es langsamer als sonst. »Vergiss die Tintenwelt, Meggie«, sagten sie. »Lass sie uns zusammen vergessen, wenigstens für eine Weile. Für deinen Vater … und für dich selbst. Sonst bist du irgendwann blind für die Schönheit, die dich hier umgibt.« Und wieder blickte sie nach draußen, in die aufziehende Dämmerung. »Ich habe dir eh alles erzählt«, sagten ihre Hände. »Alles, wonach du gefragt hast.«
Ja, das hatte sie. Und Meggie hatte ihr viele Fragen gestellt, tausend und noch mal tausend: Hast du jemals einen der Riesen gesehen? Welche Kleider hast du getragen? Wie sah die Festung im Wald aus, auf die Mortola dich gebracht hat, und dieser Fürst, von dem du redest, der Speckfürst, war seine Burg groß und prächtig wie die Nachtburg? Erzähl mir von seinem Sohn, von Cosimo dem Schönen, und vom Natternkopf und seinen Gepanzerten. War in seiner Burg wirklich alles aus Silber? Wie groß ist der Bär, den der Schwarze Prinz immer bei sich hat, und was ist mit den Bäumen, können sie wirklich sprechen? Was ist mit der alten Frau, die alle die Nessel nennen? Kann sie tatsächlich fliegen?
Resa hatte all die Fragen beantwortet, so gut sie es vermochte, aber selbst aus tausend Antworten fügen sich nicht zehn Jahre zusammen, und einige Fragen hatte Meggie nie gestellt. Nach Staubfinger zum Beispiel hatte sie nie gefragt. Aber Resa hatte trotzdem von ihm erzählt: dass jeder in der Tintenwelt seinen Namen kannte, auch noch viele Jahre, nachdem er verschwunden war, dass man ihn den Feuertänzer nannte und Resa ihn deshalb sofort erkannt hatte, als sie ihm in dieser Welt zum ersten Mal begegnet war …
Es gab noch eine Frage, die Meggie nicht stellte, obwohl sie ihr oft durch den Kopf ging, denn Resa hätte sie nicht beantworten können: Wie ging es Fenoglio, dem Verfasser des Buches, das erst ihre Mutter und schließlich sogar seinen Schöpfer zwischen seine Seiten gesogen hatte?
![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)



![Tintenblut [Tintenwelt-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/52c21247ab9c6ceec994ff4bce1626b8/w200_u90.jpg)

![Tintentod [Tintenwelt-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/48531063f67bfadcad247f206737472f/w200_u90.jpg)





![Gespensterjäger im Feuerspuk [Band 2] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/961288edbdff425f4f1f3c26568a5f3b/w200_u90.jpg)