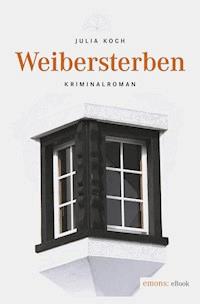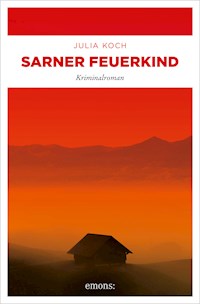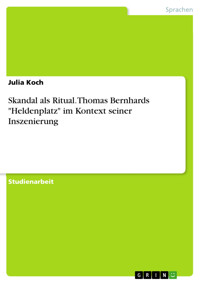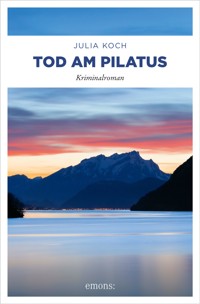
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein packender Kriminalroman über ein Stück unerforschter Schweizer Geschichte. Restauratorin Clara von Grünenstein wird beauftragt, das Mobiliar einer altehrwürdigen Villa zu begutachten. Doch neben einigen wertvollen Stücken findet sie auch Gegenstände, die mit dem Dritten Reich in Verbindung stehen. Kurz darauf liegt eine tote Frau im Garten des Anwesens, und im nahe gelegenen Luzern hält eine rechtsextreme Gruppierung die Stadt in Atem. Alles nur Zufall, oder besteht ein Zusammenhang? Clara stellt Nachforschungen an und fördert dabei Erschreckendes zutage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Julia Koch, in Bremen geboren, verbrachte ihre Kindheit im Kanton Obwalden. Seit ihrem Studium an der Universität Bern unterrichtet sie Jugendliche in Sprachen und Kunst. Mit ihrer Familie lebt sie heute im Herzen der Schweiz.
Diese Geschichte ist frei erfunden, hätte sich aber durchaus so abspielen können. Ähnlichkeiten zwischen den Romanfiguren und real existierenden Personen sind zufällig. Die genannten Orte entsprechen der Wirklichkeit, wurden jedoch von der Autorin im Rahmen der künstlerischen Freiheit zugunsten des Erzählflusses teilweise abgeändert. Im Anhang befindet sich ein Glossar.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Patrick Frischknecht/imageBROKER
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Dr. Marion Heister
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-103-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Nous ne sommes pas seulement tenus responsablespour ce que nous faisons,mais aussi pour ceque nous ne faisons pas.
Wir sind nicht nur verantwortlich für das,was wir tun,sondern auch für das,was wir nicht tun.
Molière (1622–1673)
EINS
Die Wut. Ich kann sie spüren, seitdem ich auf der Welt bin.
Der Mensch kommt als nackte Leinwand auf die Welt. Er ist eine Tabula rasa, eine leere Tafel. Ein verschrumpeltes Häufchen Mensch, das an der Brust seiner Mutter die ersten Eindrücke der Umwelt aufnimmt. Der Herzschlag seiner Mutter, den es aus der inneren Perspektive her kennt und nun zum ersten Mal ausserhalb der schützenden Mutterhülle hört. Der leichte Schweissgeruch der Mutter. Die Wärme, die sie ausstrahlt. Kräftige Hände, die es von der Brust emporheben und mit einem rauen Leinentuch abreiben. Das Gefühl der Empörung, aus der behaglichen Höhle ins grelle Licht des Lebens gerissen worden zu sein.
Die Seele des Neugeborenen ist leer und wird erst im Verlaufe des Lebens gefüllt mit den Erfahrungen, die es später in seiner Kindheit machen wird. Das Streicheln der Mutter auf dem Rücken und das Gefühl der Geborgenheit, wenn man abends in die frisch gewaschene Bettwäsche schlüpft, der Geruch eines heissen Sommertages.
Der Kieselstein, der eine Stirn aufplatzen lässt. Der verwesende Frosch in der Streichholzschachtel, der Strick um den Hals der Henne. Die nassen Bettlaken, die einen frierend aufwachen lassen. Die Tafel des Lebens beginnt sich früh zu füllen. Bei einigen Kindern steht da bereits in jungen Jahren viel geschrieben.
Vor allem Worte prägten sich mir am tiefsten ein auf dieser Tabula rasa. Auf meiner befand sich schon vor meiner Einschulung eine präsentable Sammlung.
Kartoffelfresser, Verfluchter, Bastard, Teufelskind. Sohn einer Schwanzlutscherin.
Natürlich habe ich mich gewehrt, aber gegen ein ganzes Dorf kam ich nicht an. Die Bedeutung der Worte verstand ich damals noch nicht, aber ich spürte sehr wohl, wie sie gemeint waren. Ich wurde bereits am Tage meiner Geburt zum Aussenseiter gestempelt. Die Dorfbewohner haben bemerkt, dass meine Leinwand nicht rein weiss war. Ohne, dass sie es sehen konnten, bemerkten sie den roten Punkt. Er war noch winzig klein, und doch haben sie auf ihn reagiert.
Meine Tabula war beschrieben, bevor ich den ersten Atemzug nehmen konnte. Schon im Mutterleib wurde die Reinheit der Leinwand beschmutzt. Sie war keineswegs leer, wie das bei all den anderen Neugeborenen der Fall ist. Auf meiner war bereits ein Punkt, ein roter Punkt. Er war das Erbe meines Vaters.
Ich habe ihn gespürt, ohne zu wissen, dass er da war. Zwischen meinen Schläfen, inmitten meines Kopfes sitzt er. Je nach meiner Gemütsverfassung verhält er sich still, aber er ist da. So klein wie der Einstich einer Spritze, nicht einmal mit einer Lupe zu sehen.
Ein leises Sirren, das mir nur auffällt, wenn ich darauf achte. Unvermittelt kann er anwachsen, bis er meinen gesamten Kopf ausfüllt und ich das Gefühl habe, einen roten Feuerball unter meinem Schädeldach zu beherbergen. Müsste ich ihn beschreiben, den roten Punkt in meinem Kopf, dann ginge das am besten mit dem Wort Wut. Wut gepaart mit einem Heisshunger nach Leben, untermalt mit einem Grundton von Rache.
Ja, das kommt dem Gefühl am nächsten. Wut, Heisshunger und Rache.
Und da ist sie, die Frage, die sich die Menschheit seit Jahrhunderten stellt. Entwickelt sich das Böse in einem Menschen erst durch die gemachten Erfahrungen, oder steckt es bereits in seinen Anlagen? Mit anderen Worten: Wird ein Mensch böse geboren, oder machen ihn die Erlebnisse erst dazu? Die Gene meines Vaters waren stark genug, um diejenigen meiner Mutter zu überlagern. Der winzige rote Punkt auf meiner Tabula rasa ist er, mein Vater. Er sitzt in meinem Schädel.
Da ich ihn nie kennengelernt habe, sind meine Gefühle zwiegespalten. Einerseits will niemand mit diesem roten Punkt geboren werden, andererseits ist es das einzige Andenken an meinen Vater, das ich besitze.
Der rote Punkt und sein Tagebuch, das mir vierzig Jahre nach meiner Geburt in die Hände gefallen ist. Endlich ergab alles einen Sinn. Der rote Punkt macht Sinn.
Sagt mir eine leise Stimme der Vernunft, dass ich vergessen und verzeihen soll? Dass ich die Vergangenheit begraben muss?
Nein, eine solche Stimme meldet sich nie, und wenn sie es täte, dann würde ich sie auslachen. In meinen Venen fliesst starkes Blut. Ich bin meines Vaters Nachkomme, ich kann nichts dafür.
Es war eine solche Erlösung, dies zu erkennen. Dass der rote Punkt schuld an meinem Verhalten ist. Ich kann nichts dafür. Es ist das Böse, das mein Vater mir vererbt hat.
***
Die Kamera schwenkte nach links, und der Zuschauer erhaschte einen Blick auf die Fassade des Kunst- und Kongresshauses in Luzern. Die drei Buchstaben KKL tauchten kurz auf, bevor das Bild wieder auf den Flüchtenden traf.
Der rennende Mann trug Turnschuhe, eine graue Trainingsjacke und, soweit man den verwackelten Filmaufnahmen entnehmen konnte, eine schwarze Kapuzenjacke.
«Geil! Mann, halt drauf!», war eine Stimme aus dem Off zu vernehmen.
Der Flüchtende zog etwas aus seiner Jackentasche, bekam es nicht recht zu fassen und liess es schlussendlich fallen.
«Der Mohrenkopf hat was verloren.» Die Stimme klang verzerrt, dann ertönte ein Ächzen. «Guck mal, ein Handy!»
Eine Hand erschien im Bild, die mit spitzen Fingern ein Telefon präsentierte.
Im Hintergrund sah man, dass der Flüchtende an Vorsprung gewann. Er blickte sich kurz um. Seine dunkle Haut glänzte im Licht der Strassenlampen. Die Augen waren weit aufgerissen, er hatte sichtbar Angst.
«Lass den Scheiss.»
Das Geräusch von Schuhen auf Asphalt ertönte, als mehrere Gestalten am Filmenden vorbeizogen. «Er entwischt uns!»
Das Handy verschwand aus dem Blick, und die Aufnahmen wurden wieder wackelig, weil der Filmer ebenfalls zu rennen begann. Die anderen Männer grölten, als sie sahen, dass er weiterfilmte. Der Flüchtende hetzte an der geschlossenen Bar vorbei, sein Kopf schwenkte nach allen Seiten. Er suchte verzweifelt Hilfe.
Seine Verfolger waren ganz in Schwarz gekleidet, über die Gesichter hatten sie Sturmhauben gezogen. Nur zwischen Handschuhen und Ärmeln blitzte ab und zu ein kleines Stück blasse Haut des Handgelenks auf. Vom Filmer war ausser seinen behandschuhten Händen nichts zu sehen.
«Nummer eins, nach rechts», befahl eine verzerrte Stimme. «Nicht, dass die Kokosnuss in den Bahnhof läuft. Dort sind die Bullen.»
Vor der Pädagogischen Hochschule bog eine Person ab, streckte die Arme weit auseinander, als ob sie Kühe vor sich hertreiben wollte. Der Flüchtende sah den Weg versperrt und blieb einige Sekunden zögernd an Ort und Stelle stehen.
«No, please!», flehte er auf Englisch. Die Hände erhoben, blickte er direkt in die Kamera.
Der Filmer kam näher, blieb stehen, und das Bild fokussierte schärfer. Die gelbe Ampel des Fussgängerstreifens leuchtete in stetem Rhythmus auf, um den Autofahrern zu signalisieren, dass sie selbst auf Fussgänger zu achten hatten. Das gelbe Licht erhellte die Situation wie in einer perversen Theaterszenerie.
«Ja, Mann», wisperte der Filmer. «Das gibt Tausende von Klicks.»
Die anderen Männer kamen näher. Einer hielt einen Baseballschläger in der Hand, den er vor sich hin und her schwenkte.
«Zeit, die Kokosnuss zu knacken.»
Der Flüchtende ächzte auf, dann machte er unversehens einen Sprung nach vorne und preschte zwischen beiden hindurch in Richtung Dunkelheit. Die Kamera schwenkte, bis sie ihn wieder im Bild hatte.
«Fackeln wären jetzt geil», flüsterte der Mann hinter der Kamera.
Der Gejagte rannte über die Parkfläche, die tagsüber für die Touristenbusse zur Verfügung stand, dann verschwand er zwischen den Bäumen in einem kleinen Park.
Dieselbe Stimme, die vorher Nummer eins befohlen hatte, den Weg in Richtung Bahnhof abzuschneiden, lachte heiser auf, bevor sie jedem Instruktionen gab, wo er hinzulaufen hatte. Schlussendlich drehte der Mann sich zur Kamera um, hielt einen Zeigefinger in die Höhe und sprach: «Lasst uns dieses Ungeziefer vernichten!»
Das Bild verlor sich in der Dunkelheit. Verwackelte Aufnahmen von Ästen, einem Gebüsch, untermalt von schwerem Atem. Dann ein Schnitt, neue Szene.
«Wartet mal, ich muss mit Licht filmen, sonst sieht man nichts», ertönte plötzlich die Stimme des Filmers wieder. Auf einmal wurde die Szenerie erhellt, und man sah, wie die Männer einen auf dem Boden knienden Mann umzingelten.
«Halt die Klappe und film weiter!»
Der grösste der Männer machte einen Schritt auf das Opfer zu. Die anderen taten dasselbe. Der Kreis wurde immer enger.
«Wieso bist du noch nicht im Flüchtlingszentrum? In deinem Käfig, wo Tiere wie du hingehören?» Der Anführer kam näher, während er sprach. Die anderen begannen aufgeregt zu lachen. Das Licht schwenkte über die Szenerie. Man erkannte feste schwarze Schnürstiefel mit weissen Schnürsenkeln, schwarze Hosen und die mit Kapuzen bedeckten Köpfe.
Ein heftiger Stoss in den Rücken liess das Opfer nach vorne taumeln. Der Mann fiel auf seine Hände, versuchte noch, sich an einem der Männer festzuhalten. Bekam nur glatten Stoff zu fassen, der ihm aus den Fingern rutschte. Hart knallte er mit dem Kopf auf den Boden. Kieselsteine zerschrammten die zarte Haut über der Wange. Man hörte ein Scharren, dann sah man einen Fuss, der sich in den Magen des Opfers grub. Instinktiv krümmte sich der Mann am Boden zusammen, schützte seinen Kopf mit beiden Armen. Erneut ein Tritt, diesmal in den Oberschenkel. Dann einer gegen die Stirn, dazwischen eine Stimme, die rief: «Nicht gegen seinen Kopf, du Idiot! Ich geh nicht wegen Mord ins Gefängnis.»
«Wieso, dann ist’s ein Affe weniger.»
Die Tritte gegen den Körper nahmen zu. Es sah aus, als ob auf ein Bündel Kleidung eingeschlagen wurde. Das Opfer wehrte sich schon lange nicht mehr.
«Filmst du auch alles?»
***
Clara war tief in Gedanken versunken, als das Klingeln des Telefons sie aufschreckte. Sie legte das Messer beiseite, mit dem sie soeben Lauch, Champignons und etwas Chili klein gehackt hatte, und griff zum Handy.
«Gestern Abend wurde in Luzern ein Asylant zusammengeschlagen. Der Name des Opfers lautet Kidane Kudus. Ganz üble Sache.» Spichtig, der Chefredakteur der Obwaldner Zeitung, kam wie immer gleich zur Sache. «Die Täter haben das Video bereits ins Netz gestellt. Musst du dir ansehen, tut mir leid, die Bilder wirst du so schnell nicht wieder los.»
Clara klemmte das Handy zwischen Wange und Schulter ein und warf das Gemüse in die Bratpfanne, wo sie es mit Olivenöl andünstete.
«Bruno geht zur Pressekonferenz, die die Kantonspolizei Luzern einberufen hat. Regula ist unterwegs, um im Asylantenheim etwas über den Mann zu erfahren. Dich brauche ich, um die Stimmung am Tatort einzufangen. Du weisst schon. Wie sieht es da aus? Wer ist dort normalerweise unterwegs? Ist es da noch sicher? Was könnte die Stadt Luzern unternehmen, um solche Taten gar nicht erst zuzulassen? Et cetera pp. Um Fotos brauchst du dich nicht zu kümmern. Hanspeter, der neue Fotograf, ist schon unterwegs.»
Clara hörte Spichtig schlürfen, dann das Klirren einer Tasse, die auf den Unterteller zurückgestellt wurde.
«Was ich brauche, sind Zeugenaussagen und Meinungen. Ich weiss, du hast noch nicht viel Erfahrung, aber ich glaube, das kriegst du hin.»
Clara schaute sehnsüchtig auf die Tortellini, die sie sich mit der Gemüsesosse hatte zubereiten wollen. Seufzend sagte sie: «Gut, mach ich. Schick mir die Eckdaten per Mail. Ich bin schon auf dem Weg.»
Sie stellte die Pfanne zur Seite, steckte sich eine trockene Scheibe Brot zwischen die Zähne und suchte wider besseres Wissen mit ihrem Handy nach dem Video im Netz, von dem Spichtig gesprochen hatte. Es schien bereits wieder gelöscht worden zu sein, jedenfalls wurde sie nicht fündig. Frustriert seufzte sie auf, sie würde warten müssen, bis Spichtig ihr eine Kopie schickte.
Sie vergewisserte sich, dass sie Handy, Notizmaterial und ihren kleinen Laptop in die Tasche gesteckt hatte, bevor sie das Haus verliess.
Clara von Grünenstein schrieb zwischendurch für die Zeitung, wenn ihr ihre Arbeit als Restauratorin alter Spielsachen Zeit dazu liess. Obwohl sie keinen Wert darauf legte, aufzufallen, tat sie das allein durch ihre Körpergrösse. So überragte sie mit ihren fast eins achtzig die meisten Schweizer. Um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken, bevorzugte sie Kleidung in dunklen Farben. Manchmal war es auch ihr Gemüt, das sie dazu greifen liess.
Sie parkte den Wagen im Bahnhofparking inmitten der Stadt Luzern, das unter die Erde gebaut worden war und dessen Ausgang für die Fussgänger direkt im Untergeschoss des Bahnhofs mündete. Linker Hand befanden sich einige Kleider- und Parfümgeschäfte. Auf der gegenüberliegenden Seite reihte sich ein Take-away-Angebot an das nächste. Vom waschechten arabischen Beefburger über Sushi bis zu veganen Mahlzeiten war alles verfügbar, was der hungrige Magen begehrte. Sogar ein berühmter Schweizer Schokoladenhersteller für anspruchsvollere Gaumen präsentierte seine farbenfrohen Schokoküsse in den Schaufenstern. Vorbei die Zeiten, als man dazu noch Mohrenkopf sagte, dachte Clara. Für sie stellte die Namensänderung der Süssigkeit kein Problem dar, im Gegenteil, sie konnte die Beweggründe dahinter sehr gut nachvollziehen und korrigierte jeden, der sie sich noch nicht angeeignet hatte. Sie beeilte sich, den Bahnhof zu durchqueren.
Eine Gruppe Jugendlicher mit schweren Rucksäcken sammelte sich mitten im Bahnhof, und der Leiter zählte alle durch, bevor sie in den Regionalzug stiegen. Der Grösste von ihnen hatte eine Fahne im Rucksack stecken mit der Aufschrift «Jungwacht Entlebuch». Eine Reisegruppe Asiaten fotografierte begeistert Kinder, die ihnen fröhlich aus den Zugfenstern zuwinkten.
Clara verliess den Bahnhof durch den Seitenausgang und ging entlang der Pädagogischen Hochschule bis zum Ufer des Sees.
Schon von Weitem sah sie ein rot-weisses Plastikband im Wind flattern. Sie versuchte, näher heranzukommen, aber das gesamte Areal war abgesperrt. Der Platz unter den Bäumen mit ihrem ersten Frühlingsgrün wirkte friedlich und lud zum Verweilen ein. Wenn da nicht die drei Kerzen gewesen wären, die jemand vor das Absperrband gestellt und angezündet hatte.
Zwei Männer in blauen Uniformhemden mit der Aufschrift «POLIZEI» am Rücken diskutierten lebhaft miteinander. Vergeblich versuchte Clara, sie auf sich aufmerksam zu machen. Entweder hörten die Beamten sie nicht, oder sie ignorierten sie bewusst. Clara streckte sich, um über das Gebüsch zu spähen, aber von hier aus konnte sie nichts erkennen. Frustriert marschierte sie die Absperrung entlang, vielleicht gab es weiter hinten etwas Spannendes zu sehen. Hinter ihr fuhr ein Reisebus heran, stoppte auf dem Parkplatz und öffnete die Türen. Müde Gesichter tauchten auf. Die Touristen machten den Anschein, als ob sie heute Morgen bereits eine andere Schweizer Stadt besichtigt und eigentlich eine Pause dringend nötig gehabt hätten. Träge richteten sie ihre Rucksäcke und hängten sich die Kameras griffbereit um den Hals. Spätestens vor der Kapellbrücke würden alle aus ihrer Lethargie erwacht sein, war Clara überzeugt. Kein einziger der Touristen realisierte, dass sich nur wenige Meter von ihnen entfernt ein Verbrechen abgespielt hatte.
Clara hatte das Areal weiträumig umgangen, jedoch nichts gefunden, was Spichtig zufriedenstellen würde. Sie war als Freelancerin bei der Zeitung angestellt und deshalb darauf angewiesen, dass der Redakteur ihr auch Aufträge zuschanzte. Wenn sie hier versagte, würde er sie in Zukunft vielleicht nicht mehr in Betracht ziehen.
Seufzend blickte sie sich um. Ein junger Mann rauchte gegen einen Baumstamm gelehnt und beobachtete das Geschehen. Sie ging auf ihn zu. Erst von Nahem erkannte sie, wie schmuddelig seine Aufmachung war. Die zerknitterte Kleidung war löcherig und bestimmt seit langer Zeit ungewaschen, was darauf schliessen liess, dass er auf der Strasse lebte. Auch dass eine prall gefüllte Plastiktüte neben seinen Füssen lag, bestätigte Clara den Verdacht.
«Entschuldige bitte», sprach sie ihn an. «Darf ich dich was fragen?»
Als der junge Mann träge den Kopf hob, sah Clara seine stecknadelgrossen Pupillen. Er musste vor Kurzem Drogen konsumiert haben. Ob ein Junkie als Zeuge taugte? Trotzdem wagte sie den Versuch.
«Hast du gestern Abend etwas gesehen?»
Der Mann blickte sie an, reagierte aber nicht weiter auf sie. Sein Blick schien durch sie hindurchzugehen.
Clara deutete auf das abgesperrte Terrain vor ihnen. «Es soll hier jemand zusammengeschlagen worden sein. Ein Asylbewerber. Hast du etwas davon mitbekommen?»
Nachdem Clara einige Augenblicke abgewartet hatte, ohne dass der Mann sich bewegte, wandte sie sich ab. Der Drogenrausch war zu stark, hier war nichts zu holen. Schade.
«Hab den im Vögeligärtli gesehen.» Der Mann beugte sich nach vorne, um umständlich seine Tüte zu greifen. Das Gleichgewicht zu halten, bereitete ihm grosse Mühe. «Sag, hast du mir einen Stutz?»
Clara suchte in ihrer Jackentasche vergebens nach Kleingeld. Schliesslich nahm sie ihr Portemonnaie heraus und streckte ihm eine Zehnernote hin. «Was kannst du mir sonst noch über ihn erzählen?»
Gierig griff der Mann nach dem Geld, aber Clara zog es zurück, bevor er es erwischte. «Sag schon, weisst du was?»
Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. «Der ist oft im Vögeligärtli. Mit den anderen.»
«Mit welchen anderen?»
Es war das erste Mal, dass er sie direkt ansah. «Na, mit den anderen Ausländern. Die sitzen da den ganzen Tag auf den Bänken rum.» Er schniefte. «Sind eigentlich ganz nett. Reden nur und sitzen. Krieg ich jetzt den Stutz?» Er hielt ihr die offene Hand entgegen, und Clara legte die Zehnernote hinein.
«Bist ein liebes Schätzeli», brabbelte er, dann dackelte er mit seiner Tüte in der Hand auf dem Trottoir davon.
Clara sah ihm amüsiert hinterher. «Schätzchen» war sie schon lange nicht mehr genannt worden, und auch wenn sie sich sehr wohl bewusst war, dass dies seine Masche beim Betteln war, so hatte er ihr doch ein Schmunzeln entlockt.
Nun denn, wenn sie Spichtig mehr als eine Beschreibung eines kleines Parks am Seeufer liefern wollte, wo mittags die Studenten ihre Sandwiches vertilgten und nachmittags Mütter die ersten Schritte ihrer Dreikäsehochs beobachteten, dann würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als sich dieses Vögeligärtli anzusehen. Vielleicht tat sich hier eine weitere Informationsquelle für die Zeitung auf.
Sie öffnete Google Maps auf ihrem Handy und startete die Suche. Das Vögeligärtli war in gut zehn Minuten Fussmarsch zu erreichen. Sie verzichtete darauf, sich das Gedränge im Bahnhof nochmals anzutun, und zog es stattdessen vor, um das KKL herumzuspazieren. Auf die wenigen Minuten mehr würde es auch nicht ankommen.
Vor dem Kunst- und Kongresshaus befand sich ein grosser Brunnen, auf dessen rundherum laufenden Stufen die Leute sassen und ihre Sandwiches verdrückten. Von hier aus hatte man einen wunderbaren Blick auf die Luzerner Bucht. Wie ein Finger stupste der Vierwaldstättersee an dieser Stelle in die Stadt hinein und zeigte sich von seiner schönsten Seite. Ein prunkvoll geschmücktes Dampfschiff näherte sich der Anlegestelle und liess laut ein heiseres Horn ertönen. Die Schwäne tauchten und streckten dabei ihre Hintern in die Höhe, was vor allem die Asiaten begeisterte. Fotoapparate wurden gezückt. Am gegenüberliegenden Ufer standen stolz die prächtigen Hotels aus der Gründerzeit, die bestimmt einiges über ihre Gäste in den letzten hundert Jahren zu erzählen gehabt hätten.
Clara überquerte die Zentralstrasse, wo sich die Autokolonnen stauten, und bog beim grössten Fast-Food-Restaurant der Stadt nach rechts in eine Quartierstrasse ein. Sofort änderte sich die Stimmung.
Das Hirschmattquartier, nur durch einige Parallelstrassen von den sich kreuzenden Hauptstrassen der Stadt entfernt, wirkte seltsam friedlich und beschaulich. Eine wohltuende Oase im Stadtdschungel. Ein lang gezogenes Gebäude aus schlichten Steinquadern bestimmte die ganze Längsseite des Parks. «Zentral- und Hochschulbibliothek» prangte in Lettern an der Fassade, auf der zwei in Stein gehauene Figuren eingelassen waren. Ein Mann, der zu einer fliegenden Figur am Himmel blickte. Vielleicht ein Engel, rätselte Clara. Sie würde es zu Hause nachschauen, vielleicht ergab sich hier eine Nebenbemerkung für einen Bericht.
Sie drehte sich um und blickte auf den Park, der vor ihr lag. Er war kleiner als ein Fussballfeld und ähnelte tatsächlich eher einem kleinen Vogelgarten als einem Stadtpark. Ringsherum wurde er von hohen Bäumen eingesäumt, die Rasenflächen waren gepflegt und immer wieder von üppig bepflanzten Blumenbeeten unterbrochen. In der rechten Ecke befand sich ein kleiner Spielplatz. Sie schoss mit ihrem Handy ein paar Bilder, um sich besser daran erinnern zu können, dann schlenderte sie auf dem Kiesweg weiter und schaute sich aufmerksam um. Ausser einem alten Mann auf einer Bank und zwei Müttern, die ihre Kinder auf der Rutsche beaufsichtigten, war kein Mensch zu sehen.
«Spielen Sie Schach?»
Sie wandte sich der Stimme zu und sah, dass der alte Mann von der Bank aus zu ihr herüberwinkte. Die Beine gespreizt, damit der wuchtige Bauch beim Sitzen genügend Platz hatte, sah er sie begeistert an. Zu seiner Linken standen die kniehohen Spielfiguren in Schwarz und Weiss auf einer auf den Boden aufgemalten Spielfläche parat.
«Sie bekommen den ersten Zug.»
«Nein danke.»
Clara näherte sich ihm. Schach spielen wollte sie nicht, aber vielleicht wusste er etwas über das Opfer zu berichten. Die Aussicht, unverrichteter Dinge nach Sarnen zurückfahren zu müssen, behagte ihr gar nicht. «Mit Schach kann ich nicht dienen. Da hätten Sie mich innert kürzester Zeit matt gesetzt.»
«Das bringe ich Ihnen gerne bei.» Mit einem Ächzen holte er Schwung und stand auf. «Ich bringe es allen bei, die hierherkommen.»
«Heute nicht. Vielleicht ein anderes Mal.»
Der Alte kicherte heiser. «Na, ich hätte ja Glück haben können.» Er deutete mit der Hand in den Park. «Heute ist so wenig los hier. Normalerweise finde ich immer jemanden, der eine Partie mit mir spielt. Ist bestimmt wegen dem Kidane. Der sitzt doch sonst immer mit seinen Freunden dort drüben. Die haben jetzt sicher Angst, wieder hierherzukommen.» Er zog ein kariertes Taschentuch aus seiner Hose und schnäuzte laut. «Der Kidane ist ein gescheiter Kopf. Das ist der Einzige, der mich schlagen kann im Schach.»
«Kidane?», fragte Clara nach.
Der Mann setzte sich wieder auf die Bank, glücklich, dass er ihr Interesse noch hatte wecken können. «Der Asylant, der zusammengeschlagen wurde gestern Abend. Das ist der Kidane. Jedenfalls haben das die anderen heute Morgen gesagt.»
«Die anderen?»
«Wir treffen uns jeden Morgen gegen halb zehn hier. In unserem Alter können wir nicht mehr so lange im Bett liegen, und unsere Frauen sind froh, wenn sie uns ein paar Stunden los sind. Wir treffen uns bei jedem Wetter. Auch wenn es regnet, aber wenn es unter null ist, dann nicht. Das ist dann nicht gut für unsere alten Gelenke, wissen Sie? Jedenfalls wusste der André, dass es der Kidane ist. Sein Schwiegersohn arbeitet bei der Polizei, und der hat es ihm heute Morgen bestätigt, als wir ihn angerufen haben. Der André hat sein Handy auf laut gestellt, sodass wir alle zuhören konnten.»
«Der Schwiegersohn hat bestätigt, dass es sich beim Opfer um Kidane handelt? Wissen Sie den Nachnamen?»
Der Alte spuckte auf den Boden. «Also bestätigt hat er es nicht. Der muss ja den Datenschutz einhalten. Ich denke, das sagt man so, nicht wahr? Datenschutz. Aber wir haben ihm die Namen der Afrikaner gesagt, mit denen wir hier immer wieder Schach spielen, und er sagte jedes Mal Nein. Ausser bei Kidane, da ist er einfach still geblieben.» Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu. «Streng genommen hat er so nicht gegen den Datenschutz verstossen. Schlau, nicht wahr?»
Clara tat ihm den Gefallen und lächelte. «Sie spielen also Schach mit Kidane?»
Begeistert, eine Zuhörerin gefunden zu haben, begann der Alte zu erzählen.
«Also eigentlich mag ich die Afrikaner hier nicht haben. Wir haben in der Stadt sowieso viel zu viele Ausländer. Wissen Sie, die Kenianer, die sind ganz heimtückisch. Oder sind es die Algerier oder die Tunesier? Egal, sind ja alle vom gleichen Ort. Die lächeln dich freundlich an, und dann verkaufen sie den Kindern vor dem Schulhaus diese Drogen. Die Männer tragen so dicke goldene Uhren. Wenn die Neger in Horden zusammenhocken, dann kann man es schon mit der Angst bekommen, nicht wahr? Die schauen dann so finster. Wenn die mich überfallen würden, dann hätte ich keine Chance wegzurennen mit meinen alten Beinen.»
«Wurden Sie denn schon einmal überfallen?», fragte Clara.
«Nein, natürlich nicht. Das würde ich mir nicht bieten lassen. Aber wissen Sie, wer mir noch mehr Angst macht? Die Araber! Da könnte ein Terrorist darunter sein, der Bomben baut und dann in der Stadt explodieren lässt.»
Innerlich seufzte Clara auf, liess sich jedoch nicht anmerken, wie der offen zur Schau gestellte Rassismus sie ärgerte. Sie versuchte deshalb, das Thema zu wechseln. «Haben Sie sich auch vor Kidane gefürchtet?»
«Aber nein!» Der Alte scharrte mit den Füssen im Kies. «Der ist doch ganz anders. Nicht wie diese Kriminellen. Der Kidane kommt immer mit seinen beiden Kollegen vorbei, und dann spielen wir eine Partie. Der ist aus Eritrea, wissen Sie? Er hat mir erzählt, wie er von seiner Verwandtschaft ausgewählt wurde, um nach Europa zu reisen, um Geld zu verdienen. Alle Onkel haben geholfen, die Reise zu finanzieren. Der hat ganz schön Glück gehabt, dass er von dort wegdurfte. Ich meine, was würde er jetzt dort machen? Ziegen hüten und vor seiner Hütte hocken. Gibt ja nicht viel, was man dort unten arbeiten könnte. Ja, der Kidane ist wirklich ein spezieller Asylant. Der ist gescheit, wissen Sie?»
Clara griff nach ihrem Notizblock in der Tasche. «Darf ich Sie in der Zeitung zitieren?»
«Sie sind Journalistin?» Der Alte sah sie von der Seite her an. Plötzlich schlich sich ein misstrauischer Zug auf sein Gesicht. Offensichtlich behagte ihm die Situation nicht. Einerseits fürchtete er wohl die Veröffentlichung seiner Worte, andererseits war es ein gutes Gefühl, dass er als wichtig genug eingeschätzt wurde, um zitiert zu werden.
Eilig schob Clara nach: «Selbstverständlich nur, wenn Sie auch einverstanden sind. Die Leser interessieren sich immer sehr für Meinungen aus der Bevölkerung.»
Der Alte lächelte zögerlich und diktierte dann Clara seinen vollen Namen und seinen Wohnort. Friedrich, genannt Fredi, Kappeler aus Kriens, zweiundachtzig Jahre alt.
Für einen ganzen Bericht reichte es immer noch nicht, aber die Tatsache, dass Kidane mit den Einheimischen Schach gespielt hatte und diese ihn als «gescheit und ganz anders als die anderen Ausländer» beschrieben, fand Clara ziemlich interessant. Es sagte einiges über das Opfer aus und noch mehr über Fredi Kappeler. Sie verabschiedete sich von dem Mann, der auf seiner Bank sitzen blieb und darauf wartete, dass jemand vorbeikam, mit dem er eine Partie spielen konnte.
Während Clara durch den Park schlenderte, dachte sie darüber nach, dass Kidane Schach spielte. Was sagte das über einen Menschen aus, dass er Schach spielte? Soweit sie wusste, galt Schach als das Spiel der Könige und war sehr anspruchsvoll. Strategische Spielzüge und taktisches Geschick waren ab einem gewissen Niveau unabdingbar. So auf die Schnelle liess sich das nicht erlernen. Kidane hatte das Spiel entweder bereits vor seiner Ankunft in Luzern beherrscht, oder er war ein äusserst gescheiter Kopf, wie der Alte vor wenigen Minuten bestätigt hatte.
Sie erreichte den Spielplatz, wo die Kinder eine Leiter auf den Spielturm hinaufkletterten, um danach die Rutschbahn hinunterzusausen. Sie waren mit Feuereifer in ein Spiel vertieft, bei dem es um Seemonster und Piraten ging. Die Mütter sassen nebeneinander auf einer Bank, blickten in ihre Handys und ignorierten einander.
«Verzeihung», sprach Clara sie an. «Ich schreibe für die Obwaldner Zeitung. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen?»
Synchron blickten beide Mütter von den Bildschirmen hoch und blickten sie erstaunt an. Eine von ihnen hatte tiefe Augenringe und wirkte ziemlich übernächtigt. Die andere strahlte Clara aus einem perfekt geschminkten Gesicht an. Das Aufmalen des Konturenstifts für die Lippen musste Stunden gedauert haben.
«Die Zeitung, oh mein Gott. Was will denn die Zeitung von uns?» Ihren Worten liess sie ein unsicheres Kichern folgen.
«Gestern Abend wurde hinter dem KKL ein Mann zusammengeschlagen. Haben Sie davon gehört?»
Die perfekt gestylte Frau griff mit gespreizten Fingern an ihre linke Brust, als ob sie sich vergewissern wollte, dass ihr Herzschlag nicht aus dem Rhythmus geriet. Clara sah, dass ihre Acrylnägel mit Glitzersteinchen verziert waren. Ein Wunder, dass sie mit diesen langen Nägeln überhaupt ein Handydisplay bedienen, geschweige denn einem zappelnden Kleinkind Kleidung überstreifen konnte.
«Hinter dem KKL sagen Sie? Und warum interviewen Sie uns hier, statt die Menschen dort?»
Clara lächelte ihr beruhigend zu. «Der Mann hält sich oft hier im Vögeligärtli auf, um Schach zu spielen. Vielleicht haben Sie etwas davon gehört?»
«Oh mein Gott!» Die Frau war aufgestanden, das Handy noch immer in der linken Hand, und sprintete nun auf ihren schneeweissen Turnschuhen zur Rutschbahn, wo sie ihren verdutzten Sohn packte und ihn in den Kinderwagen steckte. Er wehrte sich vehement dagegen, dass sein Spiel so abrupt unterbrochen wurde, und seine Schuhe hinterliessen hässliche Spuren auf dem Bezug des Buggys. «Dann ist es hier nicht mehr sicher für Familien mit Kindern! Komm, Tristan, wir gehen woanders spielen.» Sie packte den Griff des Kinderwagens und rauschte mit dem brüllenden Kind davon. Fassungslos blickte Clara ihr hinterher.
«Die ist nicht ganz dicht», ertönte eine leise Stimme hinter Claras Rücken. «Machen Sie sich nichts draus.»
Clara drehte sich um und sah, dass die übernächtigte Mutter aufgestanden war.
«Das ist so eine tigermom. Sie wissen schon, eine, die alles perfekt macht und die ihre Kinder zu Königen erklärt hat. Die müssen sicherlich einmal die Besten im Sport und in der Schule sein. Mir tut der Kleine jetzt schon leid. Vorhin ist sie ausgeflippt, weil er einen Kieselstein in die Hand genommen hat, und bevor er die Rutschbahn hinunterdurfte, hat sie diese mit Desinfektionsspray sauber gemacht.»
Die Frau war jünger, als Clara gedacht hatte. Anfang zwanzig, vielleicht ein paar Jahre älter. Trotz der Müdigkeit im Gesicht sah sie Clara aufmerksam an.
«Sie sind also Journalistin. Was wollen Sie wissen?»
Wie schon zuvor beim alten Mann erzählte Clara, was gestern Abend mit Kidane geschehen war, und fragte nach, ob die Frau etwas davon mitbekommen hatte.
«Nein, es ist eigentlich immer alles ruhig, wenn wir hier sind, und wir sind jeden Tag hier.» Die Frau blickte zu ihrem Mädchen, das noch immer in das Spiel mit den Seemonstern vertieft war, und ein Lächeln schlich sich auf ihr Gesicht. «Allerdings sind wir ja nur tagsüber da. Die Alten dort drüben spielen ab und zu mit den jungen Männern Schach. Die sehen nicht wie Schweizer aus, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich will ja politisch nicht unkorrekt sein, aber man sieht ihnen an, dass sie nicht von hier sind. Ihre Hautfarbe ist halt schon dunkler als unsere. Auf jeden Fall habe ich niemals mitbekommen, dass es zu einem Streit gekommen wäre. Im Gegenteil, die sind immer entspannt und grüssen höflich, wenn man an ihnen vorbeikommt.»
Clara stellte noch einige Nachfragen, aber die Frau konnte ihr nicht weiterhelfen. Clara bedankte sich für das Gespräch und verabschiedete sich von ihr.
Keine Spur davon, dass sich hier gestern Nachmittag etwas abgespielt hatte, das zum Überfall geführt hätte. Wohl oder übel musste Clara nach Sarnen zurückfahren und die wenigen Informationen, die sie hatte gewinnen können, Spichtig schicken. Der Chefredakteur der Zeitung würde nicht begeistert von dieser mageren Ausbeute sein. Hoffentlich gab es mehr Informationen auf der Pressekonferenz, zu der Bruno gefahren war. Die Sonne war mittlerweile hinter Wolken verschwunden und ein kühler Frühlingswind aufgekommen.
Zu Hause schickte Clara ihre Informationen an Spichtig. Da das Loch in ihrem Magen immer grösser wurde, öffnete sie den Kühlschrank und suchte nach etwas Essbarem. Das Gemüse, das sie klein geschnitten hatte, kurz bevor der Anruf von Spichtig gekommen war, lag schlapp in einer Tupperdose. Sie hatte keine Lust, sich etwas zu kochen, stattdessen schnappte sie sich Schlüssel und Portemonnaie und lief in ihren Finken zum Nachbarshaus, wo sich im Erdgeschoss eine Pizzeria eingerichtet hatte.
«Ciao, Clara, come stai? Wie immer?»
Clara setzte sich auf einen Barhocker und bestellte einen doppelten Espresso, während sie auf ihre Pizza Verdura mit «extra scharf» wartete. Sie liebte es, zuzusehen, wie der Pizzaiolo den Teig vorsichtig knetete, in die Luft warf, um ihn danach hauchdünn auszurollen. Der klein gewachsene Mann bediente sich aus den vielen Behältern, die er vor sich aufgereiht hatte, und zauberte den gewünschten Belag auf den Teigboden. Mit einer überdimensionalen Schaufel beförderte er die Pizza in den Ofen. Er schloss die Klappe und drehte sich mit einem Zwinkern zu Clara um.
«Mmh, molto bene, carissima!» Er wischte sich das Mehl an der Schürze ab, die stramm über seinen ausladenden Bauch gebunden war. «Wann heiratest du mich endlich?»
Clara verschluckte sich an ihrem Kaffee und antwortete lachend: «Hast du vergessen, dass du verheiratet bist?»
Er wackelte mit allen zehn Fingern vor seinem Gesicht. «Teigkneten gibt starke Finger, weisst du?» Dann brach er in schallendes Gelächter aus.
Die Ehefrau des Pizzameisters bediente an der Kasse einen Kunden und rief gleichzeitig Clara zu: «Heirate bloss nicht! Da siehst du Sachen, die du sonst niemals zu sehen bekommen würdest.»
Sie gackerte laut los, als ihr Mann mit einem Küchentuch über seinem Kopf herumwedelte und ihr scherzhaft drohte. «Warte nur, bis wir heute Abend allein sind. Dann kriegst du was zu sehen, das vergisst du dein Leben nie mehr.»
Seine Ehefrau griff theatralisch nach dem Kruzifix um ihren Hals. «Dio mio, wie habe ich das nur verdient!»
Wie gut die zwei sich verstehen, dachte Clara sehnsüchtig. Beide waren nahe dem Pensionsalter, arbeiteten aber immer noch fleissig in der Pizzeria und hatten ihren Humor im Alltag bewahren können. Irgendwann einmal wollte sie ebenfalls einen Mann an ihrer Seite haben, mit dem sie auch im Alter noch Scherze treiben könnte. Wie schön musste es sein, wenn man sich blindlings auf den anderen verlassen konnte.
Ihre Beziehungen hatten bislang nie länger als einige Monate gehalten. Auch das Verhältnis zu Valentin war aussergewöhnlich gewesen. In den einsamen Nachtstunden, wenn sie nicht schlafen konnte und deshalb rauchend auf dem Balkon sass, gestattete sie sich den ehrlichen Gedanken, dass diese Beziehung niemals eine Zukunft gehabt hatte. Nun sass Valentin im Gefängnis, und sie hatte sich langsam daran gewöhnt, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Wenn er fand, dass es ihm leichter fiel, die Strafe als Single abzusitzen, ohne Sehnsucht nach jemandem zu haben, dann blieb ihr wohl oder übel nichts anderes übrig, als dies zu akzeptieren. Eine Beziehung funktionierte nur wechselseitig. Einer allein konnte sie nicht aufrechterhalten.
Clara drehte an dem massiven Ring an ihrem Mittelfinger, der ursprünglich für eine Männerhand geschmiedet worden war. Seit Valentins Verhaftung waren sechs Monate vergangen, und seine Reaktion auf ihren letzten Besuch schmerzte Clara noch immer so sehr, dass sie sich, wann immer möglich, den Gedanken daran verbot, was hätte sein können, wenn er dereinst aus dem Gefängnis käme. Zu viel Konjunktiv, als dass sich die Trauer über die verlorenen Möglichkeiten gelohnt hätte, redete sie sich ein.
Valentin war noch nie ein Mann vieler Worte gewesen, aber bei ihrem letzten Besuch hatte er ihr deutsch und deutlich gesagt, was Sache war.
«Du brauchst mich nicht mehr zu besuchen.» Die Worte waren wie ein nasser Lumpen in ihr Gesicht geklatscht. «Das mit uns, das engt mich ein. Es ist besser für mich, niemanden zu haben, der mich ans Leben da draussen erinnert.»
Anscheinend hatte er es geschafft, sich mit der Situation im Gefängnis zu arrangieren, er wirkte fitter als bei Claras letztem Besuch. War er damals noch ein Häufchen Elend gewesen, so sass er nun aufrecht am Tisch vor ihr, der Blick gnadenlos direkt. «Den Ring kannst du behalten, er bedeutet mir nichts.»
«Hör mal, Valentin», hatte sie ihm zu erklären versucht. «Unsere Beziehung konnte sich noch nie an normalen Massstäben messen. Jeder hat immer sein Ding getan, und keiner hat den anderen ausgebremst in seinen Entscheidungen. Du kannst definitiv nicht behaupten, ich hätte dich eingeengt. Aber du musst doch zugeben, dass wir einander guttun.» Noch während sie die Worte aussprach, merkte sie, wie lahm diese klangen. «Du brauchst doch jemanden, der für dich da ist. Jeder braucht einen Freund.»
Valentin hatte dankend abgelehnt, war aufgestanden und ohne ein weiteres Wort hinter der Tür und damit aus ihrem Leben verschwunden.
Entschlossen drehte sie den Ring von ihrem Finger und steckte ihn in die Tasche ihrer Jeans.
«Pizza Verdura extra scharf für die bella donna!»
Clara schreckte aus ihren Gedanken hoch und nahm den Karton mit einer Menge lieber Wünsche des Wirtepaars mit nach Hause.
Während sie am Küchentisch die Pizza direkt aus dem Karton ass, las sie auf ihrem Laptop die Obwaldner Zeitung und suchte darin den Artikel über Kidane.
Vier Unbekannte haben am gestrigen Mittwochabend einen zweiundzwanzigjährigen Mann in Luzern niedergeschlagen und ihm das Portemonnaie gestohlen. Ob dank des Zeugenaufrufs der Polizei bereits Hinweise auf die Täter eingetroffen sind, will der Luzerner Kripo-Chef aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.
Clara griff nach dem Glas Weisswein, das sie sich eingeschenkt hatte, und trank einen Schluck. Gespannt las sie weiter, was Bruno geschrieben hatte.
Der Überfall hat sich am Seeufer hinter der Pädagogischen Hochschule abgespielt. Tagsüber stellen hier Reiseunternehmen ihre Busse gegenüber dem Park ab. Der Uferbereich ist dann gut frequentiert von Studenten und Familien, abends und nachts ist jedoch nicht viel los. Das kann mit ein Grund sein, weshalb der Überfall hier stattgefunden hat.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber noch ist unklar, was das Opfer dort zu suchen hatte.
Clara erinnerte sich daran, wie es am Seeufer ausgesehen hatte, als sie am Nachmittag dort gewesen war. Sie konnte sich sehr gut vorstellen, dass sich hinter den hohen Hecken ein Überfall abgespielt hatte, von dem niemand etwas geahnt hatte.
Der Mann, der von hinten niedergeschlagen worden ist, konnte keinen der Angreifer erkennen. Er erlitt beim Überfall unter anderem schwere Kopfverletzungen und befindet sich noch immer in Spitalpflege. Die Polizei hat das Opfer bereits letzte Nacht kurz befragen können und dies in der Zwischenzeit nochmals ausführlich getan. Dass die Angreifer aus der Rechten Szene stammen könnten, wollte die Polizei nicht bestätigen. Sie dementierte es aber auch nicht. Weitere Details kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht nennen.
Der Weisswein war mittlerweile lauwarm geworden, trotzdem trank Clara das Glas aus und las dann weiter. Spichtig hatte es geschafft, ihre spärlichen Informationen in seinen kritischen Kommentar einfliessen zu lassen, in dem er die Frage stellte, wie sicher die Stadt Luzern nach zweiundzwanzig Uhr noch war. Clara zog die Augenbrauen hoch, es schien, als ob ihre Arbeit doch nicht ganz umsonst gewesen war.
Ihr Handy meldete den Eingang einer Mail. Spichtig hatte ihr wie versprochen das Video geschickt, das zeigte, wie Kidane verfolgt und anschliessend zusammengeschlagen wurde. Sie zögerte einen kurzen Augenblick, dann spielte sie es ab.
Nachdem sie es gesehen hatte, war ihr der Hunger vergangen. Sie hatte kaum die Hälfte der Pizza gegessen, und doch brachte sie keinen Bissen mehr hinunter. Verstört schaltete sie das Handy aus. Diese Bilder würde sie noch lange mit sich tragen, das hatte Spichtig ihr am Telefon prophezeit, und er würde recht behalten.
Ein lautes Gähnen neben ihr schreckte sie auf. Joker langweilte sich und versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Ganz im Gegensatz zu Clara fühlte er sich pudelwohl und zu allen Schandtaten bereit. Wartend sass er neben ihrem Stuhl. Der einjährige schwarze Labrador blickte sie mit einem schelmischen Blick an, den zerkauten Ball in seinem Maul. Seit er vor einigen Monaten angeschossen worden war, stand eines seiner Ohren senkrecht nach oben, während das andere in manierlicher Labradorart anständig nach unten hing. Nichtsdestoweniger war Joker der hübscheste Hund für Clara. Im Moment war er vor allem die willkommene Ablenkung vom grässlichen Video.
ZWEI
In Filmen erhält der Held an seinem achtzehnten Geburtstag eine Hinterlassenschaft seines verstorbenen Elternteils, wahlweise auch seiner Paten oder Grosseltern, und sein Leben verändert sich daraufhin zum Guten. Eine bildschöne Frau verliebt sich in ihn und schenkt ihm eine Handvoll Kinder, beruflich wird er erfolgreich Karriere machen und viel Geld verdienen. Den Rest seines Lebens geniesst er in seiner Villa, die lauschig am See gelegen ist, und schmeisst eine Grillparty nach der anderen für seine unzähligen Freunde. Friede, Freude, Eierkuchen.
Ich musste fünfundzwanzig werden, um eine Kiste mit Andenken an meine verstorbene Mutter in die Hände gedrückt zu bekommen, und dumm, wie ich war, stellte ich diese Kiste in die hinterste Ecke des Kleiderschrankes, wo sie in Vergessenheit geriet. Die Büchse der Pandora wartete unter Staubmäusen darauf, hervorgeholt und geöffnet zu werden.
Hätte ich sie damals schon geöffnet, wären mir viele harte Jahre erspart geblieben. Andererseits hätte der kleine rote Punkt vielleicht viel früher zu wachsen begonnen. Wer kann das rückblickend schon sagen?
Das Tagebuch meines Vaters ist eigentlich eher eine Ansammlung von Erinnerungen, niedergeschrieben in zwei alte Schulhefte, eine tägliche Notiz des Erlebten. «Memoro», lateinisch für: Ich erinnere mich. So betitelte er jedes Kapitel, dazu schrieb er jeweils eine Jahreszahl.
Die Buchstaben, zu Beginn noch gestochen scharf auf die Linien gesetzt, werden gegen Ende des zweiten Heftes krakeliger. Huschen mal hier über eine Linie, tauchen mal dort drunter. Ich setze mich auf den Sessel, dessen Bezug schon bessere Zeiten gesehen hat. Im Polster drückt eine verbogene Feder gegen mein Steissbein. Seine vier Beine sind kurz, weshalb meine Knie in die Höhe ragen. Ich lege das Tagebuch auf meinen Oberschenkeln ab, räuspere mich und sehe mein Gegenüber an.
«Ist es bereit?», frage ich. Mir ist es wichtig, dass es mir zuhört, sonst hat der ganze Aufwand, den ich hier betreibe, keinen Zweck.
Dieses Ding ist so unhöflich, nicht zu antworten. Vielleicht liegt das auch am Klebeband, das seinen Mund verschliesst. Es könnte wenigstens nicken oder mit den Augen zwinkern, damit ich weiss, ob ich beginnen kann. Da, ein kurzer Blick in meine Richtung, gut, es hat mich bemerkt. Ich kann beginnen. Endlich.
«Vielleicht erinnert es sich noch an ihn.» Prüfend blicke ich in seine Richtung und fahre dann fort. «An meinen Vater.»
Es wackelt mit den Beinen, das Bettgestell quietscht. Das Geräusch ist zu schrill für meine Ohren. Es verärgert mich. Es soll zuhören.
«Still jetzt!»
Ich stosse es mit meinem Fuss an, bis es endlich ruhig ist und mir zuhört.
«Es soll erfahren, wie ein roter Punkt von Generation zu Generation überleben kann.»
Gelblich gefärbte Augen blicken mich an. Was will es denn? Es durfte schon trinken, und gegessen hat es auch. In den Kübel hat es auch schon gemacht. Es hat alles, was es braucht. Nun muss es zuhören. Das ist wahrlich nicht zu viel verlangt.
Es begreift nicht, wie wichtig das ist, dass es die ganze Geschichte hört. Vom Anfang bis zum Ende. Das wird dauern, und wir haben nicht endlos Zeit. Nun ja, ich habe mehr Zeit als es.
Ich muss von vorne beginnen, und das ärgert mich. Seufzend beginne ich, die Sätze aus dem Heft vorzulesen, obwohl ich sie auch auswendig aufsagen könnte. Es soll merken, dass ich mir das nicht ausdenke. Das steht hier geschrieben. Das ist wichtig.
***
Das Wochenende über erledigte Clara alle anstehenden Arbeiten für ihre Puppenwerkstatt und brachte ihre kleine Wohnung im Dachgeschoss eines mehrstöckigen Hauses im Zentrum von Sarnen auf Vordermann. Im Erdgeschoss befand sich ein Geschäft für Hörhilfen, das sonntags geschlossen hatte, was das Wohnen in diesem Gebäude noch ruhiger gestaltete. Auch die übrigen Nachbarn waren zurückhaltende Zeitgenossen. Seit die alleinerziehende Mutter mit ihren Zwillingen ausgezogen war, war es still im Haus geworden. An ihrer Stelle hatte sich ein junges Pärchen eingelebt, das entweder arbeitete oder seinen offenbar zahlreichen Freizeitbeschäftigungen nachkam. Ausser den sündhaft teuren Mountainbikes, die sie in ihrem Keller einschlossen, hatte Clara jedenfalls noch nichts von ihnen bemerkt. Auch Remo, der die Wohnung neben ihr bewohnte, war entweder auf der Arbeit, im Ausgang oder ging seinen beiden Leidenschaften nach. Einerseits war er ein begeistertes Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, andererseits wanderte er des Nachts herum und guckte durch die Fenster. Mit ihm hatte Clara am meisten Kontakt, weil er sich liebend gerne als Hundesitter einspannen liess.
Das Video ging Clara immer noch nach. Wer schlug einen Menschen nur wegen seiner Hautfarbe halb tot? Wer schlug auf einen Menschen ein? Sie konnte die Tat nicht nachvollziehen. Wo die Intelligenz aufhörte, begann die Gewalt, hatte ihre Mutter immer gesagt.
Clara fuhr sich durch ihr schulterlanges Haar, das sie im Sommer noch raspelkurz getragen hatte. Entgegen dem Klischee, dass attraktive Frauen lange Haare haben mussten, war es bei ihr eher ihre spontane und vor allem selbstbestimmte Art gewesen, die die Männer angezogen hatte.
Vor einigen Wochen hatte sie ihren letzten Geburtstag vor der bösen Vier gefeiert. Nur mit Joker als Begleitung war sie wandern gewesen und hatte anschliessend die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Sie mochte es mittlerweile ruhig, die wilden Zeiten, als sie nächtelang durchgefeiert hatte, waren vorbei. Von einigen Ausnahmen mal abgesehen. Damals wohnte sie noch mitten in der Stadt Bern und hatte gemeinsam mit ihren Freundinnen, allen voran Laetitia, regelmässig die Clubs unsicher gemacht. Nein, auch sie hatte damals nicht nur vernünftige Entscheidungen getroffen, aber hey, das Leben war ausgesprochen lustig gewesen.
Bis ihre Mutter innert kürzester Zeit an Brustkrebs erkrankt und schlussendlich daran gestorben war. Clara war auf die Bremse getreten, hatte sich zuerst um ihre Mutter und dann um deren Beerdigung gekümmert.
Ehe sie sich versah, hatte sich ihr einstmals so grosser Freundeskreis verabschiedet, da sie sich nicht mehr auf jeder Party blicken liess. Erst in dunklen Stunden realisiert man, auf welche Personen man bauen kann. Nur noch eine Handvoll lieber Menschen war ihr geblieben, und auch diese hatten sich nach und nach verabschiedet, nachdem Clara in die Innerschweiz, nach Obwalden, gezogen war. Einzig Laetitia hatte treu den Kontakt mit ihr aufrechterhalten.
Der Entscheid, ihre gut laufende Puppenklinik inmitten der Altstadt von Bern aufzugeben, war ihr nicht leichtgefallen, aber mittlerweile hatte sich bei ihren Kunden herumgesprochen, dass sie ihr Geschäft von Sarnen aus weiterführte, und die Anfragen fanden den Weg auch hierhin.
Zumeist trudelten sie per Post ein, und Clara machte sich dann auf den Weg, um ihre Patienten, wie sie die antiken Puppen und Stofftiere nannte, persönlich beim Besitzer abzuholen. Das war ihr allemal lieber, als die Kunden in ihrer eigenen Wohnung zu empfangen. Sie mochte es nicht, Fremde zu sich einzuladen. Wenn sie alles anfassten, ihr Klo benutzten, einen Blick ins Schlafzimmer wagten. Das fühlte sich für Clara falsch an. Dabei wurde eine Abstandsgrenze überschritten, und sie spürte, dass die Räume nicht mehr rein waren. Sie merkte selbst, dass sie im Begriff war, eine Schrulligkeit zu entwickeln, die nicht gesund war, aber wer sollte sich daran stören?
In den letzten Monaten war sie ab und zu als freie Mitarbeiterin bei der Obwaldner Zeitung eingesprungen, für die sie kurze Artikel schrieb. Das besserte ihr schmales Einkommen auf und brachte Abwechslung in ihren Alltag. Mit ihrer Arbeit über den verfolgten Asylbewerber schien Spichtig jedenfalls zufrieden gewesen zu sein, sonst hätte er sich bereits bei ihr gemeldet.
Das grösste Zimmer der Wohnung hatte sie als Werkstatt eingerichtet. Sollte sie Besucher empfangen, dann tat es ihre Küche ebenso, die sie mit viel Liebe gemütlich dekoriert hatte. Das Wohnzimmer wurde dominiert von einem langen Holztisch, dessen Platte von Kratzern und Brandspuren übersät war. Gerade diese Narben machten ihn zu Claras Lieblingsmöbel in ihrem Daheim, seit sie ihn bei einem Trödler entdeckt und nach Hause bugsiert hatte.
Was, wenn der Tisch reden könnte? Was würde er alles zu erzählen haben?
Entlang der Wand, stets in greifbarer Nähe, waren ihre Werkzeuge angeordnet. Sie brauchte nicht mehr hinzusehen, konnte blindlings danach greifen. Sosehr sie in gewissen Bereichen ihres Lebens eine Chaotin war, so strukturiert war sie bei ihrer Arbeit. Hier hatte jedes Ding seinen eigenen Platz, und sie konnte es nicht leiden, wenn Besucher etwas anfassten oder, noch schlimmer, verschoben.
Joker hatte seine Schmusedecke schon kurz nach seinem Einzug bei Clara unter den Holztisch geschleppt und schlief seitdem hier oder, verbotenerweise, im Schlafzimmer. Er mochte es besonders, wenn sie arbeitete und er auf ihren Füssen schlief. So entspannte sich auch Clara wunderbar, und während sie arbeitete, geschah es nicht selten, dass sie die Zeit vergass und die Nacht zum Tag machte.
Sie hatte sich eingerichtet hier in Sarnen. Und es könnte alles wunderbar sein, wenn da noch eine andere Person an ihrer Seite wäre, dachte Clara. Sie war nun bereit, mit einem Mann eine gemeinsame Zukunft zu planen. Aber wo sollte sie ihn finden? Die Zeiten, als sie gemeinsam mit Freundinnen die Bars unsicher gemacht hatte, waren längst vorbei, und sie hatte kein Interesse daran, diese nochmals auferstehen zu lassen.
Sie sah ihren Poststapel durch, sortierte die Werbung aus und hielt schliesslich einen rosa Briefumschlag in den Händen. Caroline, eine der wildesten Frauen aus ihrer einstigen Clique, lud Clara zur Trauung und zur anschliessenden Feier im Kanton Freiburg ein. Festliche Kleidung sei erwünscht, die Damen bitte schön in Pastelltönen. Die Vorstellung löste bei Clara mentalen Brechreiz aus.
«Komm, kleiner Mann, wir gehen ein paar Bälle werfen!»
Begeistert rannte Joker aus dem Zimmer und schlitterte auf dem Parkett um die Kurve, bevor er schwanzwedelnd vor der Wohnungstür auf sein Frauchen wartete. Sie wollte die Zeit mit ihm noch geniessen, denn morgen fing sie einen grossen Auftrag an, der sie zur Abwechslung ausser Haus führen würde.
***
Schon im Flur der Wohnung schlug Clara der bestialische Gestank entgegen, und sie wünschte, sie wäre zu Hause geblieben. Auch heftiges Ausatmen nützte nichts, die Partikel setzten sich in ihrer Nasenschleimhaut fest und würden dort für einige Zeit bleiben.
Die Deckenlampe war defekt, weshalb der enge Flur nur von dem Licht erhellt wurde, das spärlich durch die geöffnete Schlafzimmertür drang. Im schummrigen Licht tanzten die Staubpartikel in der Luft, bevor sie sich auf den vergilbten Tapeten oder auf eine der unzähligen Flaschen senkten, die praktisch den gesamten Fussboden bedeckten. Wie eine Seiltänzerin suchte sie sich einen Weg durch das Labyrinth der Bierflaschen und getraute sich nicht, sich an den Wänden abzustützen, zu sehr ekelte sie sich davor, etwas in dieser Wohnung anzufassen. Es schien, als ob alles hier drinnen mit einem schmierigen Fettfilm bedeckt sei.
Als ein Herr Gustav Balthasar aus Hergiswil sich vor zehn Tagen telefonisch bei Clara nach ihrer Arbeit als Gutachterin erkundigt hatte, hätte sie sich nicht träumen lassen, was da auf sie zukam. Die Wohnung seiner verstorbenen Schwester müsse geräumt werden. Da nicht auszuschliessen sei, dass sich Wertsachen in der Hinterlassenschaft fänden, musste jemand alles genau unter die Lupe nehmen und etwaige Kostbarkeiten aussortieren.
Einfach verdientes Geld, war Claras erster Gedanke gewesen, und sie hatte zugesagt, die Wohnung zu besichtigen. Nun bereute sie ihre Entscheidung aufs Heftigste.
Es half nichts, Clara musste Luft holen, wenn sie nicht ersticken wollte. Sofort roch sie den Gestank nach Erbrochenem, und wenn sie sich nicht täuschte, kam dieser von der eingetrockneten Pfütze, die treffsicher vor der Badezimmertür platziert worden war und dabei auch die Wände besprenkelt hatte. Schnell schritt sie bis zum Ende des Flurs, betrat das Wohnzimmer und hechtete zu einem der Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Einen Moment lang hing sie nach Sauerstoff schnappend über der Fensterbrüstung und versuchte, sich zu sammeln.
Obwohl sie vorgewarnt worden war, hatte der Zustand der Wohnung sie überrascht. Sie stand inmitten eines hygienischen Alptraums. Langsam drehte sie sich um und verschaffte sich einen ersten Eindruck des Wohnzimmers. Die Raumhöhe war weitaus höher als in normalen Zimmern, und sogar Clara mit ihren fast einen Meter achtzig fühlte sich klein.
Links der Tür stand ein durchgesessenes Ledersofa direkt an der Wand, davor ein mit überquellenden Aschenbechern und Bierbüchsen übersäter Salontisch. Plastiksäcke, zerlesene Bücher und eine Menge undefinierbarer Kleidungsstücke. Alles war schmutzverklebt.
Die Wolldecken auf den Sitzflächen des Sofas wiesen gelbe Flecken auf, und Clara wandte den Blick schnell ab, um sich nicht vorstellen zu müssen, wessen Ursprungs sie waren. Auch im Wohnzimmer war der Fussboden vollgestellt mit leeren Bierflaschen, jedoch ragten hier langhalsige Schnapsflaschen wie kleine Leuchttürme aus dem Meer des grünen Glases empor. Wie konnte ein Mensch in diesem Chaos leben, überlegte Clara kopfschüttelnd.
Das Wohnzimmer war wie ein gleichförmiges L geschnitten, und sie spähte über die Flaschen gebeugt um die Ecke, um auch den Rest des Raums zu sehen.
Auf dem Esstisch türmte sich das schmutzige Geschirr gleich stapelweise, in der Küche war vermutlich kein einziger Teller und kein Besteck mehr sauber in den Regalen. Unter dem Tisch entdeckte sie mehrere mit Paketschnur zusammengebundene Aktenordner, die durchtränkt waren von einer gelben Flüssigkeit. Angesichts der ansehnlichen Sammlung Altglas lag der Gedanke nahe, dass es sich dabei um Bier handelte, das versehentlich ausgekippt worden war. Jedenfalls hoffte sie, dass es Bier war und nicht etwa Urin.
Die Wand gegenüber dem Sofa war zugestellt mit einer imposanten Wohnwand, die in den Sechzigern wohl ein Vermögen gekostet hatte, heute jedoch niemanden mehr interessierte. Dies war der einzige einigermassen saubere Teil des Raumes, wenn man von der hohen Staubschicht darauf einmal absah. Zum ersten Mal, seit sie die Wohnung betreten hatte, konnte Clara sich vorstellen, den Job tatsächlich auch anzutreten, zuvor war der Ekel zu gross gewesen. Doch bevor sie nur annähernd in die Nähe dieses Möbels kam, müsste sie stundenlang Flaschen in Kisten packen und nach draussen verfrachten. Das würde das Messer in ihrem Rücken, wie sie ihre chronischen Rückenschmerzen nannte, nicht dulden. Seit nunmehr zehn Jahren lebte sie mit ihrer Arthrose, die normalerweise typisch für über Siebzigjährige war. Das Messer und Clara, sie hatten sich aneinander gewöhnt.
Sie machte kehrt und stieg über die Flaschen im Flur hinweg bis zum Schlafzimmer, wobei sie aus den Augenwinkeln einen Blick ins Badezimmer warf. Okay, diesen Raum würde sie unter keinen Umständen betreten, wenn er nicht zuvor mit einem Hochdruckreiniger generalüberholt würde. Da konnte Balthasar noch so viel bezahlen, einen zweiten Blick würde sie nicht hineinwerfen.
Der Gestank nahm mit jedem Schritt zu, je näher sie dem Schlafzimmer kam. Hier musste die Frau gestorben sein. Wenn Clara es richtig verstanden hatte, war sie eines Morgens tot im Bett liegend aufgefunden worden. An eine Wiederbelebung sei nicht mehr zu denken gewesen, obwohl ihr Bruder noch den Notarzt gerufen hatte. Wenn man vom Zustand der Wohnung auf denjenigen der Bewohnerin schloss, hatte sie nicht gut auf sich geachtet. Mit grosser Wahrscheinlichkeit war die Frau schwer alkoholabhängig gewesen.
Das Bettgestell ragte wie eine bröckelige Ruine in den Raum, die Matratze war offensichtlich bereits aus dem Haus gebracht worden. Auch in diesem Zimmer öffnete sie als Erstes das Fenster und lüftete gründlich. Neben dem Bettrahmen stand ein einfacher Abstelltisch, darauf eine Lampe mit einem kostbaren Schirm aus farbigem Glas und mehrere Bierdosen. Ein raumhoher Schrank, Nussbaum, Echtholz, antik, registrierte ihr Gehirn. Er stand an der Wand, daneben eine hübsche kleine Kommode, deren Deckblatt unwiderruflich zerkratzt war. Auch hier war alles zentimeterhoch mit einer Staubschicht bedeckt.
Sie überschlug im Kopf die Arbeit. Die Wohnwand im Wohnzimmer und die Kommode im Schlafzimmer, das würde nicht allzu lange dauern. Aber alle restlichen Räume des Anwesens, zu dem die kleine Wohnung gehörte, zu durchsuchen, bräuchte seine Zeit. Mehr als zwei, drei Wochen, schätzte Clara. Zwar war sie keine Expertin, wenn es um Antiquitäten des Mobiliars ging, was sie Herrn Balthasar bereits am Telefon gesagt hatte, aber sie war Spezialistin in der Restauration von Stoffen, antiken Puppen, Teddybären und Spielsachen. Zudem traute sie sich durchaus zu, andere Antiquitäten von Wert zu erkennen und aussortieren zu können. Den genauen Frankenbetrag, der bei einem Verkauf erzielt werden könnte, müsste dann allerdings ein Schätzer bestimmen.
Herr Balthasar hatte Clara in den vergangenen Wochen mehrere Objekte zugeschickt und sie von ihr restaurieren lassen. Offenbar hatten ihre Arbeiten und die fairen Preise, die sie dafür verlangte, ihn überzeugt, und nun wollte er, dass Clara sich auf dem Anwesen mal umsah. Wenn Clara gewusst hätte, welcher olfaktorische Alptraum auf sie zukäme, hätte sie nicht einmal für die Besichtigung zugesagt.
Sie verliess die Wohnung, überquerte den Hinterhof und genoss dabei die frische Luft. Ihre Schritte knirschten im Kies. Auch hier stapelte sich der Müll, allerdings säuberlich in Säcke und Kisten gepackt und bereit zur Entsorgung. Balthasar hatte versucht, die Wohnung seiner Schwester selbst auszumisten, war an der schieren Menge der zu begutachtenden Güter jedoch gescheitert.
Die imposante Villa der Familie Balthasar stammte aus der Zeit um 1900 und wies den Grundriss eines lang gezogenen U auf. Die untersten Wohnebenen dienten der Repräsentation der Familie, so hatte es Balthasar Clara bei ihrer ersten Begegnung erzählt. Nun schien es aber, als hätte die Villa die letzten Jahrzehnte in einem Dornröschenschlaf verbracht.
Clara suchte nach dem Klingelschild und fand es an der mit Efeu zugewucherten Mauer. Die Glocke hallte im Innern des Gebäudes nach. Am Telefon hatte Balthasar erzählt, dass seine Schwester bis zu ihrem Tod in einem der beiden Seitenflügel gelebt habe, während er im anderen Flügel alles unter strengster Kontrolle gehalten habe. Die Mitte des Hauses, einstmals das Zentrum des Familienlebens, werde nur noch betreten, wenn man im Regen trockenen Fusses von einem Flügel in den anderen wollte.
Der Kontrast hätte nicht grösser sein können. Während die Wohnung der Verstorbenen mit Müll und Altglas vollgestellt gewesen war und vor Dreck gestarrt hatte, glänzte es im gegenüberliegenden Hausflügel des Anwesens vor Sauberkeit.
«Nun, ich nehme an, Sie haben sich einen ersten Eindruck verschafft, Frau von Grünenstein?»
Das Alter des rüstigen Mannes war schwer einzuschätzen, und er hielt sich kerzengerade. Er empfing sie an der Wohnungstür und stieg dann mit federnden Schritten die Treppe bis in die erste Etage hoch, wo er wartete, bis Clara nachgekommen war. Im Wohnzimmer wies er auf ein Sofa. Distinguiert liess er sich in einem Sessel gegenüber nieder. In dieser sauberen Umgebung beschlich Clara das Gefühl, den Gestank aus der Wohnung in ihren Haaren und den Kleidern mitgebracht zu haben, und sie schnüffelte peinlich berührt an ihrem Jackenärmel.
«Sie müssen sich nicht genieren, ich weiss, wie es dort drüben aussieht.» Balthasar räusperte sich, während er gleichzeitig mit der flachen Hand die pomadisierten Haarsträhnen nach hinten strich. «Und wie es dort riecht.»
Seine schlanke, fast schon asketisch magere Gestalt kleidete er im klassischen Stil. Den Knopf des Vestons hatte er geöffnet, bevor er sich hingesetzt hatte. Das Seidentuch in der Brusttasche wies dieselben dezenten Blautöne auf wie das faltenfreie Hemd.
«Ja, das war in der Tat eine Herausforderung», gestand Clara und fuhr gedankenverloren über den Stoff des Sofas, wobei das Wort «Sofa» dem edlen Möbel keineswegs gerecht wurde. Sie hatte viel eher auf einem Kanapee aus dem 19. Jahrhundert Platz genommen, das mit edlem Brokatstoff in Gold und Bordeauxrot bezogen war. Wenn sie sich in Balthasars Wohnzimmer umschaute, konnte sie eher nachvollziehen, weshalb dieser ihr den Job angeboten hatte. Hier legte ein Mensch Wert auf edles Mobiliar, das er zu pflegen wusste. Es war zwar nur schwer vorstellbar, lag aber durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Wohnung der Schwester einstmals ebenso ausgesehen hatte, bevor die Räume unter Bergen leerer Flaschen und Unrat begraben worden waren.
Balthasar beugte sich nach vorne, um die beiden Teetassen aus feinstem Porzellan mit frisch aufgebrühtem Tee aufzufüllen.
So etwas Profanes wie ein Teebeutel wäre hier gänzlich fehl am Platz, dachte Clara und schmunzelte heimlich, und doch entdeckte sie unter einem Sessel versteckt einen Laptop.
«Ich will ehrlich zu Ihnen sein.» Balthasar hob mit abgespreiztem kleinen Finger die Teetasse in die Höhe und trank einen winzigen Schluck, bevor er sie wieder auf den Unterteller zurückstellte, ohne dabei ein Geräusch zu verursachen. «In diesem Haus lebten bereits mehrere Generationen, und alle haben ein Händchen für Kunst gehabt. Nach dem Tod meiner Eltern 1955, an die ich mich übrigens nicht mehr erinnern kann, sind nur noch meine Schwester und ich übrig geblieben, und da wir beide kinderlos sind, haben wir die meisten Räume des Hauses nicht mehr genutzt.» Er zog die Bügelfalten an seiner Hose glatt. «Ich meine, was soll ich mit all diesen Zimmern? Mir reicht meine Wohnung hier.»
«Eine sehr schöne Wohnung, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben. Sie haben einen exquisiten Geschmack.»
Clara sass aufrecht auf der Kante des Kanapees und getraute sich kaum zu atmen. Der ganze Raum war vollgestellt mit Kostbarkeiten, wie sie schon beim Betreten des Wohnzimmers bemerkt hatte. Während die Schwester aufgrund ihrer Sucht leere Bier- und Schnapsflaschen gesammelt hatte, war Balthasar offenbar auf der Suche nach weitaus Seltenerem gewesen.
«Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie ein gutes Auge dafür haben, und nachdem Sie in den letzten Monaten die antiken Puppen meiner Mutter und die Krippenfiguren der Familie für mich restauriert haben – eine vorzügliche Arbeit, wie ich Ihnen gerne versichere –, bin ich zu Erkenntnis gelangt, dass Sie die richtige Frau für diese Arbeit sind.»
«Herr Balthasar, am Telefon sprachen Sie davon, dass ich die Wohnung Ihrer Schwester nach Antiquitäten durchsuchen soll, bevor die Entrümpelungsfirma alles entsorgt.»