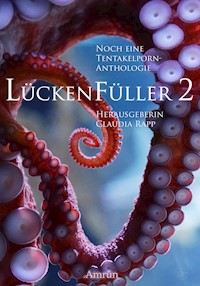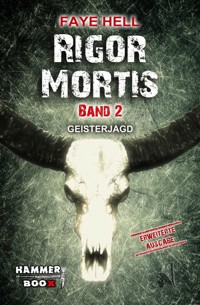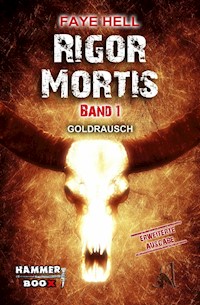Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hannah ist unheilbar krank. Nach einer Amerikareise wird sie zusätzlich zu ihren körperlichen Beschwerden von grauenhaften Visionen geplagt. Teuflische Kreaturen bevölkern ihre düstere Albtraumwelt, sogar die Menschen in ihrem Umfeld verändern sich und verfolgen sie. Mit Hilfe der richtigen Therapie hofft die junge Frau die paranoiden Wahnvorstellungen in den Griff zu bekommen. Sie will die Zeit, die ihr noch bleibt, mit ihrer großen Liebe Lukas erleben und nicht im erschreckenden Paralleluniversum ihres zerrissenen Geistes gefangen sein. Doch was, wenn der blanke Horror kein Irrsinn ist, sondern die neue Wirklichkeit und die reale Welt von gestern nur noch eine vergängliche Erinnerung? Hat Hannah das unsagbar Böse wiedererweckt? Oder sind es ihre eigenen Dämonen, die sie bekämpfen muss? Der neue Roman der Gewinnerin des Deutschen Phantastik Preises für das Beste Debüt 2016!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TOTE GÖTTER
FAYE HELL
© 2017 Amrûn Verlag
Jürgen Eglseer, Traunstein
Covergestaltung: Mark Freier
Lektorat: Simona Turini; Lektorat Turini
Korrektorat: Jessica Idczak, Stilfeder
Satz: Stefan Stern
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-95869-293-0
Besuchen Sie unsere Webseite:
amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Erwachen
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Teil 2 Schattenkönige
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
Teil 3 Gift
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Teil 4 Offenbarung
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Epilog
Teil 1Erwachen
I
Das Diner ist mehr als verlassen.
Es ist ausgestorben.
Menschenleer.
Nur meine einsame Seele stört die gestaltlose Ruhe, mein kalter Atem haucht dem längst Vergangenen vorübergehend Leben ein. Staubig von Monaten, matt von Jahren, verschlissen von Jahrzehnten, abgelebt von Generationen dämmert es vor sich hin. Eine stumme, eine traumlose Dämmerung. Kein Schlaf, vielmehr ein Nichtwachsein. Es hat mit meiner Gegenwart ebenso wenig gerechnet, wie ich damit, hier zu sein.
Monoton reiht sich Tisch an Tisch, nutzlos geworden wie alles andere. Bartresen, Hocker, Bänke, Stühle. Selbst die beschlagenen Messinglampen an der drückend niedrigen Decke und die verschmierten, großflächigen Fenster an der straßenseitigen Fassade. Selbst der lang gestreckte Raum an sich.
Nicht mehr gebraucht.
Einst haben sich hier glückliche Familien wagenradgroße Pizzen geteilt, zittrig graue Rentner fette braune Soße über ihre gestampften Kartoffeln gegossen und pickelige Teenager gelangweilt, aber lautstark ihre Erdbeershakes geschlürft. Tagtäglich.
Montag bis Sonntag. Von acht bis dreiundzwanzig Uhr. Ganztägig warme Küche. Fragen Sie uns nach unseren Frühstücksangeboten und nach unseren hausgemachten Kuchen.
Damals.
Aber das Diner hat sie alle vergessen.
Ich sitze mitten im Raum, an einem der quadratischen Tische, direkt unter einer der schweigenden Messinglampen, den Blick Richtung Straße. Ich frage mich, ob es die Fenster sind, die der Schmutz der Jahre grau gefärbt hat, oder ob es das Grau selbst ist, das von außen gegen die Fenster drückt. Es ist nicht hell in diesem Diner, aber auch nicht dunkel. Das Licht und die Schatten sind gegangen wie die Menschen. Das rote Kunstleder meines Stuhls knirscht wehmütig seiner Glanzzeit hinterher, einer Zeit, die wahrhaftig Zeit gewesen ist. Es knirscht bei jeder noch so kleinen Bewegung. Selbst dann, wenn ich mich nicht bewege. Dann weint es still, aber es weint.
Mein Platz ist gut gewählt, obwohl ich es nicht gewesen bin, die ihn gewählt hat. Ich ziehe den freistehenden Tisch eindeutig den Sitznischen zu meiner Rechten vor. Die Bänke stehen eng beieinander, die Tische sind schmal. Zu eng und zu schmal. Allein der Gedanke an die Sitznischen bedrängt mich. Und selbst der Bartresen zu meiner Linken missfällt mir. Ich müsste dem Raum den Rücken zukehren. Da ist zwar ein Spiegel an der Wand hinter dem Tresen, aber der ist milchig wie der Schleier vor meinem linken Auge. An meinem Tisch hingegen kann ich alles sehen, auch wenn es nichts zu sehen gibt, bis auf die Abenddämmerung des Einstigen. Doch kann ich genau davon nicht genug bekommen. Es ist, als möchte ich jedes zerschlagene Trinkglas, jede zerfetzte Speisekarte, jeden ausgepackten Zahnstocher und jedes einzelne, raumgewinnende Staubkorn beobachten. Ansehen, absehen, bis noch die letzten Zeitzeugen weggesehen sind. Ich bin ein gierig lebender Organismus inmitten dieser allgegenwärtigen Vergänglichkeit, dieser vollkommenen Vergangenheit. Und ich will mehr.
Ich drehe meinen Kopf über meine rechte Schulter, bis ich die Wand in meinem Rücken überblicken kann. Eine dunkelbraune Holzverkleidung, zerrissene Werbeplakate, verblichene Drucke hinter zerbrochenem Glas. Stockenten und Rotwild. Mein überspanntes Genick knackt. Ein seltsam lautes Geräusch in dieser allumfassenden Stille. Aber es knackt nur, es schmerzt nicht. Eine der Kunstdruck-Stockenten ist tot. Sie liegt auf dem Rücken, auch ihr Hals ist verdreht, grausam verdreht. Ich kann ihre leeren Augen erkennen. Die leeren Augen einer toten Stockente.
Und sie erkennen mich.
Unangenehm berührt senke ich den Blick, vielleicht zu spät. Ein eben noch unbenanntes Gefühl nennt sich nun Angst und ergreift von mir Besitz. Angst, denke ich. Rasch wende ich mich von der Wand ab und blicke wieder geradeaus.
Direkt in das Gesicht eines Mannes.
»Hallo. Schön, dass du es einrichten konntest«, sagt er laut und lächelt leise.
Er ist mittleren Alters, hat kurz geschnittenes, blondes Haar und blaue Augen. Er trägt ein kurzärmliges, perfekt gebügeltes, blaues Hemd und eine hellgraue, ärmellose Strickweste. Sein Lächeln ist aufrichtig und durchaus wohlwollend. Er scheint mir sehr zugetan. Freundschaftlich würde ich meinen. Offensichtlich ist er erfreut, mich hier und heute zu treffen.
Nur, ich kenne ihn nicht.
Mir ist sein Gesicht fremd, wie mir dieser Ort hier fremd ist.
Völlig unbekannt.
»Ja, sehr schön«, antworte ich, wobei meine Antwort weit mehr eine Frage ist. Ich habe viele Fragen. Das habe ich mir angewöhnt. Es ist meine Art – meine neue Art –, mit meiner Angst umzugehen: Ich frage. Der Blick auf die Dinge des Lebens, Wirklichkeit wie Unwirklichkeit, verändert sich, wenn der Tod plötzlich nicht mehr eine vage formulierte Unbekannte, sondern eine klar definierte Konstante darstellt. Ich werde sterben wie jeder andere auch, allerdings bin ich mir dessen schmerzhaft bewusst. Mir hat man es deutlich gesagt.
»Ich habe mir dich anders vorgestellt. Größer, älter«, fährt der Mann fort. Seine Stimme ist angenehm klar, wird aber von einer schmeichelnden Dunkelheit getragen.
»Anders? Ich habe gar keine Vorstellung von dir gehabt. Ich habe nicht mal gewusst, dass du überhaupt existierst, geschweige denn, dass ich dich treffen würde«, entgegne ich selbstsicher, nur um zaghaft nachzusetzen: »Das tu ich doch gerade, dich treffen?«
»Genau, wir treffen einander. Und das viel früher als erwartet.«
»Viel früher ... du hast mich erwartet?«
»Selbstverständlich habe ich das. Wie verläuft deine Reise bisher?«
»Reise?«
»Deine Reise, ja.«
Es dauert einen Augenblick, bis die Gedanken, die sich in meinem Kopf überschlagen, an die richtigen Stellen fallen und ich weitersprechen kann.
»Die Reise ... Sie verläuft ganz ausgezeichnet. Ehrlich, ich liebe es. Ich habe bisher viel Außergewöhnliches erlebt ... Und sie ist noch nicht einmal zu Ende. Morgen werde ich ...«
Ich halte inne. Ist sie das wirklich? Nicht zu Ende? Gibt es dieses Morgen überhaupt für mich? Oder ist mein Leben schlussendlich ohne Vorwarnung vergangen, wie ein Wimpernschlag und innerhalb desselben?
»Das ist meine Reise nicht, oder? Zu Ende ...«, frage ich vorsichtig nach.
»Oh nein, nein. Für wen hältst du mich? Entschuldige, wenn ich diesen Eindruck erweckt haben sollte. Deine Reise ist natürlich nicht zu Ende. Du wirst viel mehr erleben und viel mehr sehen. Das ist es nämlich, was du tust. Das ist es, was du kannst. Sehen.«
»Ja genau, sehen ... sehr komisch.«
Er lächelt mich wissend an, aber er schweigt. Das Schweigen stört mich nicht, auch nicht das Verweilen des eigentümlichen Moments. Es ist sein Lächeln, das mich verunsichert.
Es ist absolut unverändert.
Und das kann einfach nicht sein. Nichts Lebendiges ist so gleichbleibend, noch nicht einmal über die kurze Dauer eines beiläufigen Gesprächs hinweg. Was lebt, das vergeht, und was vergeht, das verändert sich.
Plötzlich lehnt er sich in meine Richtung, kommt mit seinem fortwährend lächelnden Gesicht immer näher und streckt seine Hand nach mir aus. Instinktiv zucke ich zusammen und rücke vom Tisch ab.
»Nicht doch. Komm her. Alles ist in Ordnung«, versichert er mir und seine sonore Stimme schnurrt und brummt. »Du kannst mir vertrauen. Es ist nur ... das ist eine wunderschöne Kette, die du da trägst. Diese Biosphäre ... darf ich sie anfassen?«
»Lieber nicht ...«, erwidere ich und lege schützend beide Hände über den tropfenförmigen Anhänger, der, an einer dünnen goldenen Kette befestigt, direkt über meinem Herzen ruht. »Wirklich lieber nicht.«
Ein Schatten huscht über seine strahlend blauen Augen, huscht über sein Lächeln und er zieht seine Hand zurück, als habe er sich an der bloßen Vorstellung der Berührung verbrannt.
»Du hast recht ... lieber nicht ... Was habe ich mir nur dabei gedacht? Welch anmaßende Torheit.«
Betreten senkt er seinen Blick, wie ich zuvor ängstlich den meinen, und stammelt Unverständliches. Leise, verdammt leise. Womöglich eine Entschuldigung. Ich sollte nachfragen, nicht weil ich höflich bin, sondern weil ich ihn tatsächlich verstehen will. Mehr noch, ihn verstehen muss. Auf einmal erscheint es mir unendlich wichtig, zu wissen, was er gesagt hat. Vielleicht sogar zu mir.
Aber es ist zu spät.
Seine Aufmerksamkeit gilt schon nicht mehr meiner Person, auch die hingebungsvoll bewunderte Kette hat er anscheinend längst vergessen. Mit einer überraschten Euphorie, als habe er sie nie zuvor in seinem Leben gesehen, bestaunt er seine eben erst beschämt zurückgezogene Hand. Spreizt die Finger, als wolle er der Herrlichkeit und Beweglichkeit jedes einzelnen huldigen. Ekstatisch dreht er die Hand vor seinen manisch weit aufgerissenen Augen hin und her, hin und her.
Handfläche, Handrücken.
Handfläche, Handrücken.
»Sie ist perfekt. Sie ist perfekt ...«, stammelt er, außer sich vor Begeisterung. Immer und immer wieder.
perfekt, perfekt, perfekt
Andächtig führt er die Hand zum Mund, riecht erst verzückt daran und leckt gleich darauf darüber. Gierig fährt seine Zunge über jeden einzelnen Finger, liebkost und erkundet die Zwischenräume. Vor allem die wie die Schwimmhäute eines Frosches aufgespannte Haut zwischen den Fingern hat es ihm angetan. Beharrlich stößt und schlägt er seine Zunge dagegen, bis er seine bebenden Lippen über eine Fingerkuppe legt und genüsslich daran zu saugen beginnt. Die schmatzenden Geräusche dringen unwirklich laut an mein Ohr. Gebannt verfolge ich die surreale Darbietung.
Dieses Lecken, Stoßen und Saugen, es muss gesehen werden.
Unverhofft hält der Mann inne, sucht meinen verstörten Blick und zieht seinen Zeigefinger, den er zu Gänze in seinen Mund geschoben hat, langsam wieder hervor. Silbern glänzender Speichel läuft seinen Unterarm entlang. Bedächtig leckt er sich mit seiner unnatürlich langen Zunge über seine ebenmäßig geschwungenen Lippen.
»Verzeih meine kurze Abwesenheit. Aber du musst verstehen, die Sache erfordert Hingabe, denn er ist einfach zu köstlich. Er schmeckt geradezu deliziös, der Mensch. Willst du ihn probieren? Willst du ihn ebenfalls?«, fragt er und hält mir mit einer einladenden Geste, die deutlich macht, dass es sein vollkommener Ernst ist, seine Hand hin. »Nur keine Scheu. Befreie dich, erschaffe dich. Koste. Koste den Menschen!«
Mein Gesicht verzieht sich zu einer verzerrten Maske hilfloser Höflichkeit.
Danke, aber danke nein.
Ich schüttle zaghaft den Kopf und hoffe inständig, dass mein unüberwindbarer Ekel und mein maßloses Entsetzen mir nicht anzumerken sind und er meine kategorische Ablehnung demnach eher meiner Bescheidenheit zuschreiben wird. Ich darf nicht gegen die Etikette des Irrsinns verstoßen, darf mir keinen Fehler erlauben. Und was genau ein Fehler ist, wird an diesem absonderlichen Ort mit Sicherheit mein selbstversessenes Gegenüber festlegen.
»Ich fühle mich geschmeichelt, aber ... ich hatte heute schon ... Mensch«, lehne ich ab.
»Du weißt nicht, was dir entgeht. Wir alle sind gelungen, aber ich bin besonders appetitlich!«, preist er sich weiterhin an, glücklicherweise ohne sich aufzudrängen. Sein mir zuvor bereits unheimliches Lächeln ist mittlerweile einem angsteinflößenden Grinsen gewichen. Und er wirkt hungrig. Ich kann es tief drinnen in seinen feurig glühenden Augen sehen.
Er ist hungrig.
Sehr hungrig.
Langsam, als wäre der Vorgang nicht mehr als ein unbedeutender Teil seiner tagtäglichen Routine, zieht er einen seiner Fingernägel vom mürben Fleisch. Sein Körper leistet keinen Widerstand, gibt sich kampflos der Selbstverstümmelung hin. Mühelos löst sich der perfekt manikürte Nagel mit einem saftigen Schmatzen vom fleischig aufplatzenden Nagelbett.
»Selbst Nägel sind schmackhafter, als du denkst. Knusprig und zäh zugleich. Beinah wie gekochte Schweineschwarte, allerdings etwas dünner.«
Er lacht laut auf und steckt sich den Nagel in den Mund. Zuerst lutscht er mit geschlossenen Augen und verzücktem Gesichtsausdruck daran, als würde er an einem sämigen Sahne-Bonbon nuckeln, doch bald schon kaut er mit seinen blendend weißen, großen Zähnen ungeduldig darauf herum. Dann öffnet er die Augen. Mit einem Sag-es-bloß-nicht-weiter-Zwinkern signalisiert er mir, dass diese spezielle Leckerei wohl zu zäh für ihn ist, und gleich darauf spuckt er den eben gezogenen Nagel mitten auf den silbernen Tisch.
»Warum sich mit belanglosen Kleinigkeiten aufhalten, wenn der sagenhafte Mittagstisch reichlich gedeckt ist? Hast du schon einmal Finger probiert? Auch nicht?! Ich könnte mich ausschließlich von Fingern ernähren!«
Begeistert löst er das Fleisch mithilfe der Fingernägel vom Knochen und stopft es sich glückselig strahlend in seinen blutverschmierten Mund, aber bald scheint ihm das zu langsam für seinen übermächtigen Appetit und er nagt direkt am Knochen wie an herzhaften Schweinerippchen.
»Das fällt einem ja förmlich in den Mund«, bestätigt er mir nachdrücklich die Qualität seiner Selbst, während er hastig weiter schlingt, als könne ihm jemand sein eigenes Fleisch streitig machen. Das schnalzende Reißen einer Sehne hallt in meinem gedankenleeren Kopf wider wie der Anschlag einer einzelnen Harfenseite in einem Dom. Das Nagen seiner Zähne an seinen Knochen kreischt unerbittlich wie eine Kreissäge an Buchenholz.
»Man darf es natürlich nicht nur auf das helle Fleisch abgesehen haben. Man muss die Blutgefäße und das gelbe Fett zu schätzen lernen. Und die Haut. Verdammt, ich liebe die Haut, selbst wenn sie nicht knusprig gebraten ist. Haut-Sushi!«
Er gräbt die Nägel seiner linken Hand in den Handrücken seiner rechten, bis seine Fingerkuppen unter der Haut verschwinden und sich seine Finger krümmen. Dann festigt er seinen Griff, reißt entschlossen an und zieht sich einen Großteil der Haut über den gesamten Unterarm hinweg ab. Das geht dermaßen leicht und schnell, als würde er einem Hasen das Fell über die Ohren ziehen. Nach einem beherzten Ruck hält er einen riesigen Fetzen Haut in der Hand, an dem in fetten Brocken sein Fleisch hängt und in dicken Schlieren sein Fett klebt. Sein Blut klatscht zäh auf den Tisch, beinahe spült es den verschmähten Fingernagel mit sich fort auf das abgetretene, dunkelgrüne Linoleum.
»Das vielleicht?«, fragt er und hält mir den Hautfetzen vors Gesicht, »Das ist gut. Das ist verdammt gut. Willst du das?«
Was mir wahrscheinlich – im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne – meine Haut rettet, ist, dass er seinem hysterischen Fresswahn bereits blind verfallen ist. Seine enthusiastisch entflammte Frage ist eine rein rhetorische. Er wartet meine Antwort, die technisch gar nicht mehr möglich wäre, da es mir sowohl Atem als auch Sprache verschlagen hat, erst gar nicht ab.
»Nein?! Gut, dann bleibt mehr für mich.«
Er legt erwartungsvoll stöhnend seinen Kopf in den Nacken, hebt die linke Hand hoch, reißt seinen Mund weit auf und lässt den Hautfetzen langsam, wie einen glibberigen, eben frisch aus der Verpackung gezogenen Speckstreifen, Stück für Stück hineingleiten.
Während er an seiner Haut saugt, nagt und schlingt, wandert mein Blick zu seiner grauenvoll zugerichteten rechten Hand. Zwei seiner Finger sind nahezu vollständig abgenagt, ein dritter weist deutliche Bissspuren auf. Das kränklich blaue Muskelfleisch seines Unterarms pulsiert eigenartig, zuckt wie unter Storm. Große Stücke sind herausgerissen, teilweise kann ich die weißen Knochen hindurchschimmern sehen. Wie Perlen im wulstigen Inneren einer Auster. Sein hellrotes Blut ergießt sich in Strömen über den Tisch. Zu seinem eigenen, aber vor allem zu meinem Glück wird er verblutet sein, bevor er mehr von sich selbst auffressen oder mir noch mehr und noch nachdrücklicher anbieten kann.
Da senkt er den Kopf und blickt mich an, als würde er mich seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder wahrnehmen. Seine Augen leuchten vor elegischem Entzücken, sein beseeltes Gesicht ist menschenfleischverschmiert.
»Auch du wirst ihn kosten. Und auch du wirst ihn lieben, den neuen Menschen.«
»Hannah? Hannah, verdammt ... was ist?! Was hast du?!«
Seine Stimme war fest, nicht ein Hauch von Unsicherheit lag darin. Zweifellos. Es waren wie immer seine Augen, die ihn verrieten. Seine warmherzigen, wunderschönen Augen, die so schwarz waren, dass man, blickte er nicht direkt in grelles Licht, kaum eine Pupille erkennen konnte. Und am Ende dieses langen Tages war ich es, die in das sanft gleißende Licht der sinkenden Sonne schaute, also ruhten seine Augen tiefschwarz und erfüllt von dunkler Furcht auf mir.
»Was soll denn sein?«, fragte ich so ungezwungen wie möglich, mir durchaus dessen bewusst, dass jetzt zwar keine Gefahr mehr drohte, aber gerade eben sehr wohl etwas gewesen war. Etwas, das ganz einfach nicht sein sollte. Mir war, als wäre ich kurz weg gewesen. Doch war dieses vage Bild bereits fort, bevor ich es mit meinem alarmierten Bewusstsein hatte erfassen und mit meinen verblassenden Worten beschreiben können. Was dermaßen flüchtig war, hatte keine Berechtigung. Auf gar nichts. Und schon gar keinen Anspruch auf mich.
»Was denn sein soll? Echt jetzt?! Wir sitzen hier. Wir plaudern. Plötzlich bist du ganz still, antwortest nicht mehr, starrst gedankenverloren vor dich hin. Ins Leere ... als würdest du ... als hättest du ... Und dann schreist du. Einfach drauf los. Es ist ...«, wie auf der Suche nach dem richtigen Wort fuhr er sich, offensichtlich immer noch irritiert, aber wenigstens wieder einigermaßen beruhigt, durch seine widerspenstigen dunkelblonden Locken. »... es ist unheimlich gewesen. Du hast mir Angst gemacht. Ich habe gedacht, du ...«
»Es ist alles in Ordnung, ehrlich«, unterbrach ich ihn. Ich wollte sie nicht hören, seine Befürchtungen, wollte sie nicht teilen, seine Ängste. Wo ich gerade erst dieses nie besessene Bild verloren hatte. Diese trostlose Erinnerung an etwas, das ich meinerseits nicht teilen konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Weil es nie passiert war. Weil ich das niemals Passierte längst vergessen hatte.
»Wenn du Schmerzen hast, sagst du es mir. Du hast versprochen, es zu sagen. Und deine Augen, wenn du ...«
»Ich werde es nicht für mich behalten, falls ich genau hier, am wahrscheinlich schönsten Ort, den ich jemals gesehen habe – und ja, ich kann weiterhin sehen – plötzlich mein Augenlicht gänzlich einbüße. Und Schmerzen hab ich immer. Aber solange ich sie habe und nicht sie mich, mach ich mir keine großen Sorgen. Und du solltest das gefälligst auch bleiben lassen, sonst wäre ich erst gar nicht mit dir weggefahren. Denn du hast mir versprochen, nicht übervorsichtig zu sein. Vorsichtig ja, aber bitte keine unnötigen und erst recht keine verrückt machenden Superlative.«
Fürsorglich legte er seinen Arm um mich und zog mich bedächtig an sich. Immer näher, bis ich ihm schließlich ganz nah war. Ohne ein weiteres überflüssiges Wort zu verlieren. Ich fühlte mich wohl in seinen Armen, hatte mich beinahe von der ersten Umarmung an bei ihm zu Hause gefühlt. Eigentlich hatte ich mich bereits nach seinen Armen gesehnt, als wir einander völlig verlegen und ein wenig gehemmt bei unserem ersten gemeinsamen Abendessen gegenübergesessen hatten. Völlig verlegen und ebenso fremd. Fremd. Etwas, das unserem aufrichtigen Miteinander nicht lange hatte standhalten können. Schnell war aus einem Fremd ein Vertraut geworden.
Mit einem zufriedenen Seufzer, der mir allein gehörte und der weder schlechte Erinnerungen noch eine ungewisse Zukunft duldete, kuschelte ich mich an ihn, bis ich sein durch und durch gutes Herz an meiner Wange pochen spürte und es in meinem Ohr schlagen hörte. Sicher dort geborgen ließ ich meinen Blick schweifen. Dieses unberührte Stück Natur war wirklich der schönste Ort, den ich in meinem Leben bisher gesehen hatte. Nicht dass ich weit gereist oder weltgewandt gewesen wäre, aber diese Eigenschaften waren nicht notwendig, um das beurteilen zu können. Nicht für mich.
Wir saßen hoch oben am höchsten Punkt der cremeweißen Sanddünen und blickten, ins geschmeidige Licht der roten Abendsonne gehüllt, hinaus auf den verführerisch stillen Lake Michigan. Ich konnte kein gegenüberliegendes Ufer ausmachen, zu groß war der See, zu weit entfernt jedes mögliche Ufer jenseits des unsrigen. Es war kaum vorstellbar, dass dieser traumhafte Platz an diesem frühen Abend uns allein gehören sollte, und dennoch war es so. Kein anderer Mensch war gekommen, um von den Sleeping Bear Dunes aus den Sonnenuntergang über dem Großen See zu bestaunen. Wir waren ganz allein, allerdings selten zuvor weiter weg davon gewesen, einsam zu sein. Nur wir waren hier und nur hier waren wir für uns.
In wenigen Tagen würden wir wieder nach Hause fahren und dort würde ein Teil dieser Magie dem belanglosen Alltag weichen müssen. Aber ich würde die kostbare Erinnerung mit mir nehmen, ich würde wahrhaftig einen Teil dieser Welt an einer dünnen, goldenen Kette immer bei mir tragen. Sorgsam eingeschlossen in eine schimmernde Hülle aus gewissenhaft bewahrendem Glas. Behutsam wie der liebevolle Abendwind, der mich in diesem kostbaren Augenblick sanft umfing, umfing ich das zerbrechlich wirkende, dennoch beständige Schmuckstück mit meiner rechten Hand und drückte die Biosphäre an mein Herz. Der Hauch einer Welt in einem Hauch von Nichts. Und obwohl mir diese beschützende Geste einen Augenblick lang befremdlich bekannt erschien, konnte ich sie keiner greifbaren Erinnerung zuordnen und deshalb beunruhigte sie mich nicht weiter. Nicht diese flüchtige Geste. Es war die flüchtige Schönheit, die mich ängstigte und schlussendlich innenhalten ließ. Was, wenn ich nie wieder etwas dermaßen Schönes sehen würde? Was, wenn bald schon überhaupt nie wieder irgendetwas?
»Darf ich dich behalten?«, brach es unverhofft aus mir heraus. Mit einer klanglosen Stimme, so leise, dass ich meine Worte selbst nicht hören konnte. Die wenigen gewichtigen Worte, die ich Lukas immer wieder fragen musste und die er genau deshalb verstand, auch ohne sie tatsächlich zu vernehmen. Dieselbe Frage, immer wieder, in genau diesem Wortlaut, mit genau dieser Intention. Weil ich hören wollte, dass es Beständigkeit im Chaos gab. Dass ich zwar zu große Hoffnungen in meine eigene Unverwüstlichkeit gesetzt hatte, aber dem Unvorhersehbaren und grausam Endgültigen nicht allein ausgeliefert war. Dass er da war für mich. Solange ich selbst ebenfalls für mich da war.
»Mich behalten? Denkst du wirklich, du wirst mich einfach wieder los? Du musst mich behalten!«
Ich konnte ihn schmunzeln hören, weil ich wusste, wie seine Stimme klang, wenn er schmunzelte, und dennoch war mir dieser Klang nicht genug. Ich wollte es in seinem Gesicht sehen. Mich weich windend wie eine schnurrende Katze löste ich mich von seinem Herzen und aus seiner vorsichtigen Umarmung, rückte ein Stück weit ab von ihm und liebkoste sein Gesicht mit meinen Blicken. Doch im diffusen Gleißen der immer tiefer stehenden Sonne konnte ich seine Gesichtszüge nur noch schwer erkennen, deshalb streckte ich meine Hand aus und berührte vorsichtig sein Lächeln.
»Ach, muss ich dich behalten? Dann ist es ja gut, dass das alles ist, was ich will.«
Unendlich schön war sein Strahlen, unendlich schön sein glückliches Gesicht.
Zauberhaft umrahmte ihn das Gold der Abendsonne. So zärtlich und dennoch fordernd, dass mir beinahe war, als würde es durch ihn hindurchscheinen. Dass mir beinahe war, als wäre er eine mystische Lichtgestalt.
Als wäre er nicht wirklich da.
Als wäre er nicht wirklich.
II
Wir wollten den Abend nicht vergehen lassen. Er hätte ewig andauern können, und wir mit ihm. Fest aneinander gekuschelt blieben wir, in unsere eigene Ewigkeit versunken, am Strand sitzen, bis ein kühler Wind, der von weit draußen über dem starr in schwarzen Schlaf versunkenen See hereinzuwehen schien, uns grimmig in die Knochen kroch und uns mit liebevoller Strenge hinfort trieb. Im tiefsten Dunkel der Nacht stolperten wir, unter dem immerwährend weit aufgespannten, sternenklaren, aber mondleeren Himmelszelt, mehr zufällig richtig als tatsächlich zielgerichtet, zum Auto. Merkwürdig ausgelassen, aber im Angesicht der Natur zu ehrfürchtig, um laut zu lachen oder auch nur aufdringlich zu kichern, verließen wir den magischen Ort in friedvoll fröhlicher Stille.
Diese unverfälschte Fröhlichkeit blieb uns durch die kurze, aber erholsame Nacht hinweg bewahrt und beim Frühstück in einer kleinen Bäckerei in Glen Arbor waren wir bereits weniger friedvoll fröhlich, sondern eher schon auffällig gut gelaunt, beinahe schon ausgelassen übermütig, was sich verdammt gut anfühlte.
Den Magen angenehm gefüllt mit leckeren Hashbrowns, gebratenem Speck und French Toast, aber hoffnungslos überschwemmt von mehreren Tassen Kaffee befanden wir, dass es höchste Zeit war, endlich in die Gänge zu kommen. Immerhin waren wir nicht gekommen, um zu bleiben, wie sehr wir uns auch vielleicht insgeheim danach sehnten. Bleiben, das Leben und den Lauf der Dinge einfach anhalten, niemanden und nichts fortschreiten lassen. Aber ein Verweilen war nicht vorgesehen, also brachen wir auf. Auf zu neuen Zielen am selben Ufer, solange uns Zeit dazu blieb. Auf dieser Reise.
Den üblichen Unsinn plappernd, den man nur dann gedankenlos gelassen vor sich hin labern kann, wenn man schon seit geraumer Zeit ein Paar ist, aber eben noch nicht lang genug, um unsinniges Gerede an sich und jedes weitere generell überflüssig zu machen, schlenderten wir lachend zum blauen Geländewagen, den wir unweit der Bäckerei im Halbschatten abgestellt hatten.
»Du oder ich?«, fragte Lukas und warf mir bereits, natürlich ohne meine Antwort abzuwarten, den Autoschlüssel zu. Lässig wie gewollt und überraschenderweise weit geschickter als erwartet, schnappte ich mir den Schlüssel, brüllte: »Die Detroit Tigers haben die Sache fest im Griff«, riss die Autotür auf und ließ mich auf den Fahrersitz fallen.
Autofahren war eines der großartigen Dinge, die mir die Krankheit bisher nicht nehmen hatte können, aber gewiss noch nehmen würde. Sollten sich meine Symptome verschlechtern, würde ich künftig auf diese Unabhängigkeit verzichten müssen. Das letzte Wort hatten in diesem Fall die Ärzte. Heute Morgen hielt mich allerdings gar nichts davon ab, mich hinters Steuer zu setzen. Ich lächelte.
Kaum hatte ich den Motor gestartet, plärrte das Radio los.
»Hast du das laufen lassen?!«, schrie Lukas über den Lärm der scheppernden Gitarren hinweg, die aufgrund des schwachen Radiosignals entsetzlich röhrten und nicht, weil es Teil des unverfälschten Klangbildes gewesen wäre.
»Ist ja wunderbar! The Boss! Wie könnte man einen weiteren Tag on the road stilvoller starten?«, brüllte ich zurück und schlug warnend nach seiner Hand, die er ausgestreckt hatte, um das Radio leiser zu stellen. »Weiche, Ungläubiger!«
Wenige hundert Meter weiter wurde der satte, kämpferische Sound Springsteens vom weinerlich-düsteren Selbstmitleid Eddie Vedders abgelöst.
»Schon wieder?«, stöhnte Lukas verächtlich, aber wenig überzeugend. »Kennen die denn wirklich keine andere Band?«
»This is so fucking 90ies!«, beschwerte auch ich mich völlig überzogen, nur um im selben Moment loszulachen und lautstark in das gebrochene Gejaule miteinzustimmen.
»Ooohh, aahhh ... Ich leb immer noch ...«
»Mach, dass es aufhört! Mach, dass es aufhört.«
Lukas legte sich beide Hände flach über die Ohren und begann ein anderes Lied, vermutlich irgendwas von Metallica, lautstark gegen Eddie und mich anzusingen. Lautstark und chancenlos. Eddie war vielleicht weinerlich, aber ich war überzeugend.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Umstand genau meinem gequälten Beifahrer gnädig gestimmt war. Ein Kratzen in meinem Hals, die weitere Playlist des Senders oder vielleicht mein vorausschauendes Denken, das mich nach einem Supermarkt Ausschau halten ließ, um sicherzugehen, dass uns auf dem Weg nicht mitten in der Einöde der Hunger einholen und niederstrecken würde. Wahrscheinlich war es ein ausgeklügeltes Zusammenspiel mehrerer dieser Faktoren, das letzten Endes Lukas’ Ohren und seine Nerven verschonte. Jedenfalls ließ ich das Radio irgendwann allein vor sich hin trällern und Lukas durfte sogar die Lautstärke auf ein Niveau absenken, das ein halbwegs anständiges Gespräch zuließ. Zumindest lautstärkentechnisch.
In einem K-Mart in der Nähe von Ludington stockten wir unsere mageren Vorräte auf und es gelang mir sogar, gegen den schoko- und süßstoffokkupierten Willen von Lukas, den Kauf einer Gemüseplatte mit Sauerrahm-Dip durchzusetzen.
Unsere heutige Etappe war weit weniger naturbelassen als die bisherigen, die nahenden Ballungszentren warfen ihren kargen, urbanen Schatten voraus. Das Gelände war nicht mehr unwegsam, die Vegetation weniger üppig und schon gar nicht mehr ungezügelt, die Straßen dafür umso breiter und ein gemütlicher Rastplatz schlichtweg unauffindbar.
Den breiten Highway an einer zufällig gewählten Ausfahrt verlassend, landeten wir schließlich im Nirgendwo und waren dazu gezwungen, es uns auf der von Unkraut überwucherten Böschung eines trüb vor sich hinplätschernden Kanals unter einer Straßenbrücke bequem zu machen. Um das idyllische Bild zu vervollständigen, hatte das lauschige Plätzchen darüber hinaus einen unverhofften Komfort zu bieten. Eine mobile, chemische Toilette. Dass nicht einmal Gemüse im Magen, ein Plumpsklo im Rücken, Autos über unseren Köpfen, Feuerameisen in unseren Hosenbeinen und ein trüber Kanal vor Augen Lukas davon abbringen konnten, den Tag vor allem eines zu finden, nämlich abwechslungsreich und unterhaltsam, sprach weniger für meine Planung als für seine optimistische Beständigkeit. Und ich war ebenfalls nicht gewillt, mir die unterhaltsamen Stunden oder die gute Laune nehmen zu lassen.
Ich war nicht gewillt.
Aber das spielte keine Rolle.
Nicht für meine Laune, die über wirklich viele lobenswerte Eigenschaften verfügt, aber auch über ein beängstigendes Eigenleben.
Wie meine Fantasie.
Wie meine Angst.
Als wir aufbrachen, diesmal saß Lukas am Steuer, immerhin musste er darauf bestehen, als Mann das größere Stück der Strecke zu fahren, holte mich die Erinnerung an den vergangenen Abend ein und eine bleierne Melancholie befiel mich. Ich sah uns deutlich, wie in einem Film, am Strand sitzen. Ich sah die Liebe in unseren Augen und die Zärtlichkeit in unserer Umarmung. Sah den Wind in unseren Haaren und das goldene Licht auf unseren Gesichtern. Und ich sah das Herz, das Lukas in den Sand gemalt hatte.
Unser gemeinsames Herz.
Unser gemeinsames Leben.
Eine Linie im Sand.
In diesem Augenblick attackierte mich die Angst. So heftig, dass ich mich selbst leichtgläubig gescholten hätte, hätte ich die Zeit dazu gehabt, überhaupt irgendetwas zu tun. Es war einfältig gewesen zu glauben, ich hätte diese kalte Angst tief in den dicht bewaldeten Porcupine Mountains zurückgelassen oder, besser noch, in diesem stillgelegten Bergwerkschacht in Soudan begraben. Meine Angst war nicht zurückzulassen und sie war nicht zu begraben. Sie war mir wie immer dicht auf den Fersen.
Es gibt diesen weißen Fleck in meiner Familie. Oder blinden, verborgenen, gemiedenen Fleck, wie auch immer man ihn nennen will. Aber in meiner Vorstellung ist er weiß, weiß wie endgültig getilgt und nicht nur verdammt und vergessen.
Ein absolutes, ein totales Tabu.
Etwas, worüber nicht einmal nicht gesprochen wird. Ein Jemand, ein Niemand, ein Niemals-gewesener. Der Vater meines Vaters. Er war ein Nazi, damals, und schön in seiner Uniform. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber ich erinnere mich, dass es jemand gesagt hat, weil man ja sonst wenig sagt. Über ihn, über den Großvater. Aber schön war er, schön in seiner Uniform. Und sicher auch stolz. Und sicher auch überzeugt. Und sicher auch tödlich. Keiner von uns weiß etwas über sein Leben im Krieg oder die Verbrechen, die er begangen hat, aber wir wissen, dass er im Krieg gewesen ist.
Aber seine Nazi-Vergangenheit, welche die Vergangenheit seiner Generation ist, ist nicht der wahre Grund, warum ihn und seine Existenz eisiges weißes Schweigen umgibt, obgleich sich über kaum etwas privat dermaßen konsequent schweigen und öffentlich ergriffen sprechen lässt. Doch es ist nicht die Geschichte allgemein, es ist eine ganz persönliche Geschichte.
Mein Vater hat, da war er gerade mal sechzehn Jahre alt, das Hab und Gut seiner Mutter und sein eigenes in einen Leiterwagen gepackt und ist mit ihr eines Nachts vor dem Vater, der den Krieg mit nach Hause gebracht hatte, geflohen. Weil sie den Hass nicht mehr ertragen konnten. Die Spielschulden und den Alkohol.
Und die Schläge.
Zwei Leben und ein Leiterwagen. Aber es waren wenigstens zwei fast neue Leben.
Viele Jahrzehnte später, als mein Großvater starb, war mein Vater bei seinem Begräbnis. Das hat niemand erwartet. Vielleicht hat er es deshalb getan. Auf jeden Fall war das Begräbnis das erste Mal nach all der vergangenen Zeit, dass er seinen Vater wiedersah. Zwar seinen toten, aber immerhin. Mein Vater hat keine einzige Träne vergossen. Das hat er selbst erzählt. Für ihn war es nicht einmal mehr sein grausamer Vater, der da in dem Sarg lag. Für ihn war es nur noch ein toter Fremder. Ein feiger, toter Fremder. Feige, weil er sich selbst das Leben genommen hatte. Erschossen. Vielleicht mit einer Waffe aus dem Krieg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe niemanden gefragt. Denn warum fragen, wenn keiner was sagen wird, außer eben, dass man nicht weinen soll, weil er tot ist. Aber dieser feige Fremde, über den niemand spricht, der ist mein einziger echter Held.
Mein Großvater, der Spieler.
Mein Großvater, der Säufer.
Mein Großvater, der Selbstmörder.
Mein Großvater, der Held.
Ich habe Multiple Sklerose. Sofern man so etwas haben kann. Haben, das klingt seltsam. Als würde ich irgendetwas besitzen. Haben, als hätte ich etwas davon. Als würde es mir etwas einbringen. Genau genommen hat es mir etwas weggenommen.
Vor zwei Jahren.
Knapp nach meinem vierundzwanzigsten Geburtstag. Völlig unverhofft. Aber richtig krank wird man immer völlig unverhofft.
Beim ersten Schub – so nennen die Ärzte das, Schub – habe ich fünfzig Prozent der Sehkraft meines linken Auges eingebüßt. Schlagartig. Auf diese Weise hat man es aber wenigstens schnell und eindeutig identifizieren können, das böse Ding in meinem Körper, das man zwar irgendwie kennt, aber keiner ganz genau, und das deshalb keiner vollkommen heilen kann. Es ist das unheilbare Ding in meinem Körper, das zwar meine Nervenhüllen auffrisst, aber wenigstens auf einen Namen hört. Es ist das unbekannte, aber benannte Böse. Und das ist wichtig. Sonst bekommt man kein Interferon, und das braucht man. Interferon. Davon hat man dann auch was, nämlich häufig starke Schmerzen. Aber es macht auch was. Es hält das hungrige Ding in meinem Körper so gut es kann von meinen Nerven fern. Man will keine weiteren Schübe. Man will nicht mehr verlieren. Weil noch, da hat man immerhin was. Milchige fünfzig Prozent, verschleierte fünfzig Prozent, oft undurchsichtige fünfzig Prozent.
Die sind mir geblieben.
Die fünfzig Prozent und das Mitleid.
Ich lebe nicht schlechter, seit ich weiß, dass ich krank bin. Irgendwann vielleicht sogar ein sabbernder Krüppel in einem Rollstuhl bin. An einen Körper gefesselt, der mich nicht mehr will und den ich erst recht nicht mehr will. Weil er meinen Verstand und meinen Geist gefangen hält, in einem verdrehten, schwachen Gefängnis aus Menschenhaut, Menschenfleisch und Menschenknochen.
Irgendwann.
Und das Vielleicht ist dabei das Höchstmaß an Zuversicht.
Ich lebe nicht schlechter, ich lebe anders. Möglicherweise sogar besser, auf jeden Fall aber intensiver. Ich könnte viele ergreifende, tiefsinnige Beispiele bringen, aber ich ...
Ich fahre gerne Auto, und ich fahre schneller als früher. Ziemlich schnell. Nicht riskant. Meistens nicht riskant. Bisher nicht. Allerdings riskiere ich gerne etwas, solange es mein eigenes, beinahe intaktes Leben ist, das ich riskiere. Das ist selbstbestimmt. Und lebendig. Und ich fahre gerne schnell, gebe gerne richtig Gas. Weil ich das Gefühl habe, dass es das ist, was ich tun muss.
Mit dem Leben richtig Gas geben, weil es eben irgendwann – und ich meine das sabbernde Rollstuhl-Irgendwann – zu Ende gefahren ist.
Aus ist.
Und deshalb ist er mein Held, mein Großvater.
Weil er sich selbst eine Kugel in seinen kranken Kopf geschossen hat, bevor er am Ende war. Weil er nicht bis ans vom Schicksal verordnete Ende gehen, sondern selbst entscheiden wollte, was sein Ende ist. Und wie. Und wann.
Und das ist es, was ich tun will und tun werde. Mein eigenes Ende völlig eigenmächtig bestimmen wie mein Held. Bevor mein Leben nicht mehr mein Leben ist, bevor ich nur noch hoffe und niemandem mehr Hoffnung gebe, bevor ich mehr leide als lache und beweine, woran ich mich erfreuen sollte. Bevor ich für alle, die mich lieben, nicht mehr Liebe, sondern nur noch Belastung bin ... bevor das alles passiert, werde ich abdrücken.
Ich hoffe inständig, dass es mich nicht überrascht.
Das Ende.
Dass ich, wenn es soweit ist, die physische Kraft haben werde, abzudrücken, denn die psychische habe ich. Das ist nicht egoistisch. Es tötet mich und schützt meine Hinterbliebenen. Das ist erst recht nicht feige. Es ist das bewusste Umsetzen einer Entscheidung, die ich habe treffen müssen, um überhaupt weiterleben zu können. Über meinen Tod zu bestimmen hat mir mein Leben zurückgegeben.
Für mich.
Und für das Herz im Sand.
»Du bist still. Ist was?«
Unsanft riss mich Lukas aus meiner ureigensten Finsternis zurück an das Licht des Tages. Ich konnte ihn ignorieren und wieder ins Dunkel abtauchen oder antworten. Ich fand, ich war lange genug abgetaucht.
»Es ist nichts ... ich bin einfach müde.«
Abweisend drehte ich meinen Kopf weg von ihm. Die Landschaft raste an mir vorbei, als könne sie es nicht erwarten, zu vergehen. Als könne sie es nicht erwarten, vergangen zu sein. Ich wünschte mir, ich wäre mehr wie die Landschaft. Obwohl, eigentlich war ich das. Vorübergehend.
»Müde? Ich kann dich nicht schlafen sehen.«
»Ja genau ... weil man immer schläft, wenn man müde ist. Lass mich. Ich denke nur ...«
»Ich dachte, du bist ... Woran denkst du denn?«
»Ich hab gesagt, lass mich.«
»Kann ich nicht. Es ist meine Aufgabe, das nicht zu tun. Dich nicht zu lassen, wenn du ... wenn du gerade mal wieder denkst. Also, woran denkst du?«
»An meine Familie.«
»Deine Familie? Dann hoffe ich, du denkst dabei auch an uns. An unsere zwar kleine, aber gemeinsame Familie. Denkst an dich und mich. Du bist keine Einzelkämpferin und du musst es nicht sein. Ich lass dich nie allein, vergiss das nicht. Du kannst nicht einfach nur die Frage stellen, wenn du Angst bekommst, und sie dadurch zu einer leeren Phrase degradieren. Du darfst mich behalten, aber du musst mich an dich ranlassen. Du musst auf meine Antwort hören, und du musst an meine Antwort glauben. An mich. Du und ich, für immer und überall. Das verspreche ich dir.«
Er hatte mehr Kraft in die Worte gelegt, als er eigentlich gewollt hatte. Und er hatte mehr Worte gebraucht, um zu sagen, was er zu sagen hatte. Schon seit gestern Abend. Schon seit Langem. Erschöpft, wie leergesprochen, schwieg er nun.
Ich musste ihn nicht ansehen, um zu wissen, dass genau jene schwarzen Wolken, die er nicht wahrhaben wollte, seine noch schwärzeren Augen vernebelten. Auch er kämpfte gegen das Vergangene und auch für ihn war dieser Kampf manchmal aussichtslos. Und dann tat die Erinnerung das, was Erinnerungen eben tun: Sie holte ihn ein. Die Erinnerung an eine Zeit, in der das Leben sich die Freiheit herausgenommen hatte, die Vorzeichen zu ändern.
Die überdeutliche Erinnerung an diesen einen Augenblick.
»Du kannst gehen. Du musst nicht bleiben«, hatte ich ihm damals angeboten und es war mehr als ein Angebot gewesen. Es war meine vollste Überzeugung. Weil ich das Beste für ihn gewollt hatte und ich es nicht mehr sein hatte können. Das Beste.
»Kann ich«, hatte er geantwortet, »aber ich werde bleiben. Weil ich das ebenfalls kann.«
»Du kannst es dir überlegen. Du musst dich nicht gleich entscheiden, musst es nicht gleich wissen.«
»Muss ich nicht. Aber ich weiß es. Was ist mit dir? Willst du denn? Ich meine, es dir überlegen? Gehen? Mich verlassen?«
»Nein.«
Er hatte meinen Kopf vorsichtig in beide Hände genommen, mit seinen Daumen sanft die Tränen von meinen Wangen gewischt und meine Nase geküsst.
»Dann lass uns zusammenbleiben und zusammenhalten.«
Und er hatte es sich tatsächlich nicht überlegt. Er war geblieben und er war immer noch da. Genauso wie die Erinnerung an diesen Augenblick.
»Wir beide. Das haben wir einander versprochen«, setzte er leise nach und bestärkte damit ebenso seine Worte, wie er versuchte, meine Zuversicht und mein Vertrauen zu stärken. Mein Vertrauen in ihn, in uns und vor allem in mich selbst.
Er ließ mit seiner rechten Hand das Lenkrad los und griff nach meiner. Drückte sie sanft, hielt sie liebevoll fest. Eine einsame Träne rann über meine Wange. Ich konnte das Salz riechen und ich konnte das Eisen in meiner Kehle schmecken, doch Lukas konnte sie nicht sehen.
Die Träne.
Sollte er auch nicht.
Es war nicht so, dass ich Angst hätte, dass er sein Versprechen brechen würde. Ich wusste, für ihn waren es keine leeren Worte.
Er würde dieses gemeinsame Versprechen einhalten.
Ich nicht, Großvater.
Ich nicht.
III
Ich erwachte verspannt, aber ausgeruht. Hinter meiner Stirn pochte es, aber das war unbedeutend. Keine Schmerzen, nur ein Pochen. Ungelenk richtete ich mich im Beifahrersitz auf. Auch meine schwermütigen Gedanken hatte ich weit hinter mir gelassen. Mir war fast, als hätten sie mich im Vorübergehen gestreift. Als wären sie nie an die Oberfläche des Wachseins vorgedrungen. Noch bevor ich dieser Überlegung länger nachhängen konnte, zauberte sich, von der Schönheit der Landschaft gemalt, ein Lächeln auf meine Lippen und die Klauen der klammen Erinnerung lösten sich endgültig, als hätten sie sich an meinem Strahlen verbrannt.
Wir hatten gehalten.
Unser Auto stand allein auf einem kleinen Parkplatz, von wo aus man einen atemberaubenden Ausblick auf den weitläufigen Sandstrand hatte, der beinahe ebenso leer war wie die plattgewalzte Parkfläche. Die Beifahrertür stand weit offen, Lukas war bereits ausgestiegen, saß auf einem Stein am Rande des Parkplatzes und kehrte mir, den Blick weit hinaus auf den Lake Michigan gerichtet, den Rücken zu. Ich drehte meinen Kopf zur Seite, bis ich es tief in mir knacken hörte – etwas, das ich immer tat, wenn ich geschlafen hatte –, zupfte meine verdrehte Bluse zurecht und stieg aus.
»Wir sind da?«, fragte ich, mir der Überflüssigkeit der Frage im selben Atemzug bewusst, was mich seltsamerweise kichern ließ. Irgendwie fühlte ich mich angenehm aufgedreht, fast schon übermütig. Ich musste wirklich verdammt gut geschlafen haben. Ich schlang von hinten beide Arme um Lukas und hauchte ihm einen Kuss auf die linke Wange. Langsam, als würden meine Lippen jede seiner Poren wahrnehmen wollen. Und eigentlich wollte ich genau das. Ihn wahrnehmen, in allem, was er war, in all seiner Unnachahmbarkeit. Richtig in ihn eintauchen, oder vielmehr ...
»Seit einer halben Stunde. Du hast geschlafen wie ein Murmeltier. Gibt es eigentlich Murmeltiere in dieser Gegend?«, überlegte er laut. Ich verschloss seine fragenden Lippen mit meinen, um nicht nur seine Haut zu schmecken, sondern wirklich seine Essenz, und aus seiner Murmeltier-Überlegung wurde ein wohliges Brummen.
»Komm mit, ich zeig dir eines«, flüsterte ich ihm ins Ohr und es war einzig dieses Flüstern, oder vielmehr das Sehnen, das diesem Flüstern innewohnte, das mich dazu veranlasst hatte, den berauschend intimen Kuss zu beenden. Ich konnte das Beben in meinen Worten hören, wie ich es in meinem Inneren spüren konnte. Tief in mir, ein flammendes, ein begehrliches Feuer. Sich verstohlen nach den Leuten unten am Strand umblickend, ließ sich Lukas nach kurzem Zögern von mir zum Auto davonziehen. Dort sanken wir, ineinander verschlungen, hinab auf den glühenden Sand.
»Warte«, stöhnte Lukas, es war mehr ein animalischer Laut als ein wirkliches Wort, und befreite sich aus meiner Umarmung, was ich mit einem enttäuschten Gurren quittierte. Sekunden später war er aber schon wieder über mir, hob mit einer Hand sachte mein Becken an und schob einen unserer Schlafsäcke unter mich.
»Du sollst nicht verbrennen.«
Ich hätte mich gerne länger mit seinem Körper beschäftigt. So lange, bis es morgen gewesen wäre, oder irgendwann. Aber ich wollte ihn zu sehr und ich wollte ihn tief in mir. Am besten sofort. Uns blieb nicht einmal mehr genug Zeit, uns vollständig zu entkleiden.
Seufzend und bebend lag ich mit nacktem Unterleib auf dem Schlafsack, die Beine gespreizt, mein Becken ihm auffordernd entgegengereckt. Mehr als bereit für ihn. Und er nahm mich sofort. Mit einem lustvollen Ächzen, das mich selbst noch mehr erregte, stieß er in mich. Nicht mit einem einzigen, harten Ruck, sondern quälend langsam, Zentimeter für Zentimeter, bis er mich komplett ausfüllte. Dort verweilte er, genoss unsere fleischliche Vereinigung, die intimste Umarmung zweier Liebender. Dann endlich bewegte er die Hüften. Erst kreisend, dann stoßend. Stieß mich schlussendlich hart und unerbittlich, wie ein wildes Tier, bis in das Gleißen eines alles erfüllenden, eines alles verschlingenden, eines alles auflösenden Orgasmus.
Und ich kam, als wolle ich niemals ankommen.
Endlos.
Eng umschlungen verweilten wir, bis die elektrisierten Wogen meiner Haut geglättet waren, mein rasselnder Atem wieder gleichmäßig ging und mein wallendes Blut wohlverteilt zurück in meinen ekstatisch erhitzten, aber von der sanften Brise angenehm frisch umschmeichelten Körper floss. Ich hätte es sofort ein weiteres Mal tun wollen, aber noch lieber wollte ich mir diese Sehnsucht bewahren.
Nachdem wir den Schlafsack wieder verstaut und diverse Badesachen wahllos in den Wanderrucksack geworfen hatten, lieferten wir uns, jung, wie wir uns fühlten, es aber glücklicherweise nicht mehr waren, ein Wettrennen hinab zum Seeufer. Dort ließ mich das unverhoffte Gefühl absoluter Perfektion und allgemeingültiger Unendlichkeit andächtig innehalten. Ein solcher Anblick war durchaus nicht neu für mich, immerhin hatte ich in diesem Urlaub schon mehr als zwei Wochen an den Ufern dieser großen Seen verbracht, dennoch war das sich mir bietende Panorama schlichtweg überwältigend. Und hätte ich jeden einzelnen mir verbleibenden Morgen die Chance, einen scheuen Blick auf diese Vollkommenheit zu erhaschen, ich würde jedes Mal aufs Neue gleichermaßen in Ehrfurcht versinken und vor Begeisterung brennen. Langsam ging ich in die Knie, berührte den feuchten Sand, streckte die heiße Hand nach dem kühlen, schäumenden Nass aus. Die kleine Biosphäre löste sich von meiner schweißnassen Brust, baumelte frei an der goldenen Kette, wurde hingezogen zu ihrem Ursprung, zu den großen, alten Wassern.
Wie ein Kompass des Ewigen.
Ein universeller Kompass des einzig Wahren, des Einzigen überhaupt.
Ihre Wasser wie ein Wasser.
Und mir war, als würde ich jenen innigen Moment, diesen intimsten Akt der Zweisamkeit, den ich eben mit diesem mir alles bedeutenden Menschen vollzogen hatte, nun mit diesem alten, immerwährenden Wasser fortsetzen. Als würde ich mich dem See hingeben, wie ich mich zuvor Lukas hingegeben hatte. Und es schien mir eine ebenso würdige wie logische Fortsetzung. Hier, das wusste ich, könnte ich mich hingeben bis zum Absoluten.
Zur Selbstaufgabe.
Lukas hatte unsere Sachen einfach fallen lassen, seine Schuhe und sein Shirt abgestreift und war direkt in den See hineingelaufen. Seine aufrichtige Ausgelassenheit war keiner erhabenen Andacht gewichen. Es war, als würde der große See zwar auch seine Energien neu beleben, ihm aber sein wahres Ich, sein eigentliches Geheimnis vorenthalten. Und das war gut so, denn genau deshalb würde der See das meine ebenfalls bewahren.
Ich war hier sicher.
Mit einem Strahlen, das von dort kam, wo selbst im Menschen nur Helles wohnt, beobachtete ich Lukas, der sich im Wasser gebärdete wie ein junger Seehund. Es war unter anderem diese unverfälschte Begeisterung gewesen, in die ich mich damals verliebt hatte, und ich empfand es heute noch als Leistung meinerseits, dass ich es schaffte, ihn nicht um seine Euphorie zu beneiden.
Nachdem ich Lukas ausreichend oft hochspringen, niederschlagen und abtauchen gesehen hatte, machte ich mich daran, unsere Badesachen auszupacken. Wir würden ein paar Stunden hierbleiben, also genug Zeit für Lukas, sich auszutoben, und für mich, Dan Simmons in seine hypnotische Welt und ins weite All zu folgen. Ich hatte das Buch vor Jahren bereits gelesen, war aber immer mehr als geneigt, nach Hyperion – wo selbst der Tod die wahrhaft Liebenden nicht trennen konnte, weil alles relativ war wie die Zeit – zurückzukehren. Ich breitete mein Badetuch aus, legte mich darauf und grub meine nackten Füße ungehindert in den herrlich heißen Sand, bis es schmerzte. Dann rollte ich mein Sweatshirt zusammen und schob es mir als Nackenstütze hinter den Kopf. Perfekt. Das Wasser rief auch mich, aber ich würde dem Ruf nicht folgen. Ich liebte das Wasser, doch ich scheute die unmittelbare Berührung, wenn diese über Fingerspitzen und Zehen hinausging. Mit dem Bett im Sand war meiner Sehnsucht Genüge getan.
Ich wollte gerade nach meinem Buch greifen, als mir ein etwa sieben Jahre alter Junge auffiel. Er stand in einiger Entfernung regungslos da und starrte mich an. Mit seiner rechten Hand hielt er die Hinterflosse eines aufblasbaren Schwimmtieres fest.
Ein quietschbunter Clownfisch, hoffnungslos überdimensioniert.
Das schrille Vieh war wie gestrandet zur Seite gefallen und drückte sein breit grinsendes Maul in den glühend heißen Sand.
Röstet Nemo.
Ich erwartete, dass der eigentümliche Junge sich bald an mir sattgesehen haben würde, denn richtig aufregend war ich nicht, in meiner verschwitzen Bluse und meinen weiten Wandershorts, aber er ließ sich nicht beirren und sein Interesse wurde, wenn überhaupt, nur noch nachdrücklicher.
Sein Starren wurde es jedenfalls.
Nachdrücklicher.
Und unangenehm.
Krampfhaft versucht, nicht länger auf das Kind zu achten, griff ich nun wirklich nach meinem Buch, schlug sogar eine wahllose Seite auf und begann zu lesen, doch der Junge verunsicherte mich. Ich musste aufschauen, um zu sehen, ob er mich nach wie vor beobachtete. Und das tat er. Begierig. Unablässig.
Ich war wie gebannt, konnte den Blick ebenfalls nicht mehr abwenden. Wie hypnotisiert nahmen wir den Blick des jeweils anderen gefangen und verloren uns selbst jeden Augenblick mehr darin. Zumindest war ich es, die verloren ging.
Völlig weggetreten, wie ferngesteuert, hob er seine linke Hand und winkte mir zu.
Stand da, starrte und winkte.
winkte, winkte, winkte
immer weiter
winkte, winkte, winkte
Plötzlich zog er seine rot-weiß gestreifte Badehose aus, offenbarte stolz seine Nacktheit. Sein Geschlecht war das eines kleinen Jungen, aber es war nicht zu klein, um seine Erregung deutlich zu zeigen. Es war ein Anblick grausamster Widersinnigkeit, die bloße Existenz dieser wenigen ewigen Sekunden machten mich zur Täterin. Zur unschuldig Schuldigen. Da packte der nackte Junge seinen Clownfisch, setze sich auf ihn, krallte sich mit beiden Händen an den Haltegriffen fest, die das Schwimmtier links und rechts der Augen hatte, und ritt den Zierfisch bis zur Besinnungslosigkeit.
Fickte splitternackt sein buntes, quietschendes Spielzeug.
Und starrte mich dabei unablässig an.
Schrie und stöhnte.
Stieß fest zu, rieb sich gierig.
Und starrte und starrte.
IV
Am frühen Abend verließen wir den Strand, um unsere Sachen ins Hotel zu bringen. Ich war ebenso froh, den Strand verlassen zu können, wie ich unfähig war, dem Hotel die Bezeichnung »Hotel« zukommen zu lassen.
Glücklicherweise schaffte es Lukas wie gewöhnlich, die Ausschläge meines ausnahmslos zu deutlichen Extremen tendierenden Wesens mühelos auszugleichen.
Mit einem Lächeln.
Und einem »Kinder sind einfach scheiße. Punkt. Deshalb hassen wir Kinder. Punkt.« und einem weiteren »Wenn du dich an das Motel in Ashland erinnerst, und so gut ist sogar dein chaotisch überstrapaziertes Gedächtnis, dass es fünf Tage zurückreicht, musst du zugeben: Das hier ist wirklich kein Hotel, das ist ein verdammter Palast!«
Und schon waren Kinder wieder einfach nur Plagegeister, der Strand so schön, wie ich ihn bei unserer Ankunft wahrgenommen hatte, und das Hotel tatsächlich ein Palast. Unser ganz privater Palast. Weil ich heute Nacht meinen schweren Kopf, dem ein schießwütiger Verstand innewohnte, auf Lukas’ breite Schulter betten und mich geborgen fühlen würde. Behütet, ohne eingesperrt zu sein, verstanden, ohne ausgefragt zu werden, bestärkt, ohne irgendetwas anderes.
Ohne jegliche Einschränkung.
Nachdem wir uns den Sand aus den Haaren und von der Haut gewaschen hatten – zumindest soweit es der bescheidene Wasserdruck und der Sand, der sich an Stellen verkrochen hatte, an denen Sand einfach nichts zu suchen hat, zuließen – kramten wir ausnahmsweise nicht unsere üblichen Wanderklamotten hervor, sondern die einzige Garnitur vorzeigbare Kleidung, die wir für diesen Urlaub überhaupt eingepackt hatten. Heute würde es keinen fettigen Burger geben und auch kein Mikrowellengericht aus dem nahegelegenen Supermarkt, behelfsmäßig wo und wie auch immer aufgewärmt. Heute würde mich Lukas fein zum Essen ausführen. Und das entzückende Urlaubsstädtchen Saugatuck hatte definitiv eine ansprechende Auswahl an Restaurants zu bieten, die diesem Vorhaben mehr als gerecht werden würden.
Ich gab mein Bestes, mein im mickrigen Licht der Badezimmerlampe grellorange leuchtendes und hoffnungslos widerspenstiges Haar mit Hilfe unzähliger Haarnadeln zu zähmen, und ich musste abschließend mehr als zufrieden eingestehen, dass das Endergebnis durchaus sehenswert war. In altmodische Wellen gelegt, umrahmte der kunstvoll gebogene Kupferdraht, der nur an ganz seltenen Tagen die Bezeichnung Haar verdiente, mein Gesicht auf schmeichelnd vorteilhafte Weise. Meine Haut war blass wie immer, es gab einfach nicht genug Sonnenstrahlen auf dieser Welt, um meinen Teint eine sommerliche Nuance dunkler einzufärben, aber meine Wangen waren zart gerötet und meine grün-blauen Augen strahlten. Beide Augen. Auch der linke Deserteur, der es hervorragend verstand, mich an meinen Makel die Krankheit zu erinnern.
Immerzu.
Ausnahmslos.
Selbst dann, wenn mich Glück oder Vergessen vorübergehend in Sicherheit wiegen wollten. Doch auch ich verstand mich auf so einiges und ich wusste, wer mein Feind war. Kannte ihn beinahe ebenso gut, wie er mich kannte. Und an Abenden wie heute hatte ich dem Nebelschleier mehr als genug entgegenzusetzen: das Feuer in meinem Herzen, das Beben in meinen Lenden und das Strahlen in meinen Augen.
Wie gesagt, in beiden Augen.
Vielleicht war ich nicht immer eine Kämpferin, doch ich hatte Träume für den besten Fall und Pläne für den schlimmsten, und meist war ich eine zaghafte Optimistin. Dennoch zögerte ich kurz, als ich nach dem Medikamenten-Pen griff, der am Waschbeckenrand lag. Dass mir die pure Notwendigkeit bewusst war, hieß nicht, dass ich mich jemals daran gewöhnen würde.
Lukas, der bereits voll angezogen am Bett lag, beobachtete mich verstohlen, als ich nur in Unterwäsche aus dem Badezimmer kam und neben ihm in mein weichfließendes, schwarzes Kleid schlüpfte.
»Was grinst du so dämlich?«, fragte ich und warf sein schmutziges T-Shirt, das er über das Fußende des Bettes gehängt hatte, nach ihm.
»Ich grinse, weil das alles hier ...«, er fuhr mit einem verheißungsvollen Blick die Konturen meines Körpers entlang, »... heute Nacht ganz allein mir gehören wird.«
»Ausnahmslos unter der Bedingung, dass du mich zuvor zu einem Essen ausführst, das einem Palast wenigstens annähernd gerecht wird«, neckte ich ihn kichernd.
»Wie Prinzessin wünschen«, entgegnete er, schwang sich vom Bett auf und bot mir galant seinen linken Arm an. »Lass uns gehen, soweit uns unsere Füße tragen und unsere Erwartungen locken!«
Wie sich zeigte, hatten wir weit zu gehen. Verdammt weit. Ich verfluchte die Entscheidung, das Auto für die Aussicht auf ein paar Flaschen Bier, die ich ohnehin besser nicht trinken sollte, stehengelassen zu haben, lobte mir aber gleichermaßen meine flachen Schuhe. Nicht dass ich eine Wahl gehabt hätte, viel Stauraum hatte mein Rucksack nicht zu bieten und deshalb waren die schwarzen Rauleder-Ballerinas meine einzigen Schuhe, die keine wie auch immer gearteten Wanderschuhe waren. Der Abend war lau und die sinkende Sonne tauchte den Himmel in ein seltsam wehmütiges Kaleidoskop roten Vergehens.
Bald würde auch dieser Tag vergessen sein.
Lukas hatte seinen linken Arm um mich gelegt und ich drängte mich unbewusst näher an ihn, als wir nach einem gut einstündigen Fußmarsch das Zentrum Saugatucks erreichten. Ich hatte mit vielen Menschen gerechnet, allerdings waren das hier nicht viele Menschen, das hier waren die meisten. Ich war versucht zu denken, es wären alle.
Alle Menschen.
Realistisch gesehen waren es auf jeden Fall alle Urlauber, die Saugatuck und Umgebung aufzuweisen hatte, der reinste Menschenauflauf. Ein großteils rotgebrannter, gut gelaunter, sich umherschiebender Menschenhaufen. Hotelzimmer und Zweimannzelte, Federkernmatratzen und Schlafsäcke blieben heute Abend gewiss leer. Eigentlich zum Fürchten und noch eigentlicher zum Davonlaufen, doch Lukas hielt mich fest und er hielt mich sicher, und bald schon konnte ich das fröhliche Treiben zwar nicht ausgelassen, aber beinahe entspannt genießen.
Die Straßen waren heimelig eng und in der unmittelbaren Innenstadt gab es kaum Verkehr. Offensichtlich hatten sich andere an diesem wunderschönen Abend ebenfalls für einen Spaziergang entschieden und ihre Autos stehengelassen, um die Idylle nicht zu stören. Ein Fluss, der wohl weiter flussaufwärts in den großen See münden würde, bereicherte das Städtchen mit den bunten Häusern um eine Promenade. Direkt am Wasser war ein winziger Vergnügungspark. Auf einem uralt wirkenden Karussell drehten sich Schwäne und andere Wasservögel im Kreis. Über die pittoresken Gässchen verstreute Straßenmusiker spielten Country- oder Bluessongs, die Touristen blieben in kleinen Gruppen stehen, erfreuten sich an der Musik und belohnten die Künstler dann doch nur mit Münzen. Die meisten Lokale hatten Terrassen, von denen aus man den im Abendlicht golden schimmernden Fluss überblicken konnte, leider war jeder einzelne Tisch besetzt, es war gänzlich aussichtslos, überhaupt einen Platz an der begehrten Riverfront zu ergattern. Also beschlossen wir mit leichtem Bedauern, vom Fluss weg und wieder weiter stadteinwärts zu schlendern.
Glücklich lauschte ich den uns vom sanften Abendwind hinterhergetragenen Klängen eines mir beiläufig vertrauten Liedes, ließ den lebensfrohen Blick kreisen, bestaunte die Häuserfronten und goutierte die Auslagen der kleinen Modeboutiquen mit dem aufrichtigen Interesse einer, die es sich ohnehin nicht leisten kann. Selbst mein unstetes Wesen erschien mir in diesem einzigartigen Moment wie dieser Ort. Nahezu perfekt. Als ich dermaßen befreit den wohlgelaunten und gut gekleideten Fremden zulächelte, die mein Lächeln höflich angemessen, aber aufrichtig freundlich erwiderten, wurde mir plötzlich klar, dass ich mich getäuscht hatte. Das hier war nicht die nahezu perfekte Idylle.
Es war die perfekte Idylle.
Perfektes Wetter, perfekte Künstler, perfekte Häuser, perfekte Kleider, perfekte Menschen.
Unglaublich perfekt.
Hinterhältig fuhr mir jener Wind, der mir eben erst sanft die wundersamen Töne der wunderschönen Melodie hinterhergetragen hatte, die eisige Kälte vom Fluss heraufwehend in den Nacken, bis sich die kleinen Härchen darauf alarmiert aufstellten.
Zu perfekt.
»Es ist wunderschön hier«, sagte Lukas just in diesem Augenblick und ich kuschelte mich enger an ihn, um mich zu wärmen und um ihm möglichst unauffällig und vor allem ungehört zuzuflüstern: »Zu schön ... Es ist einfach zu schön. Denkst du nicht?«
»Zu schön? Hast du sie noch alle?«, witzelte Lukas, als hätte ich etwas unglaublich Dummes gesagt und das absichtlich, um endlich einmal lustig zu sein. Was ich ohnehin nie war. Sarkastisch, gemein und verletzend im humorvollen Gewande, aber niemals lustig. Auch nicht in meiner Dummheit.
»Ich mache keine Witze«, flüsterte ich. »Das hier ist zu schön. Es ist perfekt. Es ist einfach nicht echt.«
»Du bist paranoid«, entgegnete er, schon ein wenig ernsthafter, aber weiterhin erheitert. Ich konnte nicht mit ihm lachen.
»Nur weil du paranoid bist, heißt es nicht...«
»... dass sie nicht trotzdem hinter dir her sind«, vervollständigte er meinen Satz.
»Spürst du das denn nicht?«, beharrte ich.
»Was spüren?«
»Na, das ... alles. Es ist ... Es ist wie eine Lüge. Nein, es ist nicht wie ... es ist eine Lüge.«
»Die einzige Lüge hier wird die sein, die ich da vorn in dem Lokal erzähle, um einen Tisch zu bekommen. ‚Ja, natürlich haben wir reserviert!‘«
»Du verstehst mich nicht.«
»Ganz im Gegenteil, ich verstehe dich sehr gut und genau deshalb lassen wir das jetzt. Ich weiß, du hast es gern geheimnisvoll und siehst Zusammenhänge, wo es keine gibt und Gespenster, die es überhaupt nicht gibt. Aber nicht jetzt.«
Er knuffte mich in die Seite, stieß mich spielerisch vom schmalen Gehweg und zog mich dann sogleich enger an sich. Zärtlich strich er mir über mein Haar, küsste sanft meinen Scheitel, als wolle er mein eigentliches Wesen, meine Essenz selbst küssen. Meine dunklen Gedanken schmolzen unter seiner schützenden Berührung dahin und seine Unbefangenheit ließ mich die unheimliche Perfektion der zur Schau gestellten Authentizität wieder mit begeistertem Staunen wahrnehmen. Denn ignorieren konnte ich sie nicht.
Dazu war sie zu offensichtlich.
So offensichtlich, dass ich des dunklen Schemens, der uns in unauffälligem Abstand und ebensolchem Gewande von Häuserblock zu Häuserblock folgte und uns mit wachem Blick niemals aus den Augen ließ, nicht gewahr wurde. Ausgerechnet an diesem Abend wurden wir tatsächlich verfolgt und ausgerechnet mir war es nicht aufgefallen. Fiel es nicht auf. Weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, mich vor Dingen zu fürchten, die nicht im Verborgenen lagen. Mein Verfolgungswahn verbarg ihn gut, unseren Verfolger.
V
»Das ist verdammt teuer!«, flüsterte ich über den Rand der Speisekarte hinweg. Nicht dass ich erwartet hätte, dass einer der Anwesenden Deutsch, geschweige denn meinen österreichischen Ohrwaschel-Graben Dialekt verstanden und deshalb meine Privatsphäre untergraben hätte, aber ich war es gewohnt, solch geartete Einwände quasi-pantomimisch anzudeuten und niemals laut auszusprechen. Somit fiel es Lukas leichter, sie zu entkräften. Und dieser fadenscheinige Einwand musste so dringend entkräftet wie mein Hunger gestillt werden.
Zart gebratener Lachsburger mit karamellisierten Zwiebeln, grünen Kirschtomaten und Kapernbeeren, verfeinert mit fruchtiger Limettensauce auf Sesambrot. Dazu reichen wir Süßkartoffel-Spalten mit Zimt und Sweet-Chili.
Ich musste es haben, selbst wenn wir es uns nicht leisten konnten.
»Zu teuer ...!«, hauchte ich also, voll heuchlerischer Inbrunst. »Viel zu teuer ...«
Lukas schüttelte beschwichtigend den Kopf, aber seine funkelnden Augen kicherten mich an, lachten mich übermütig aus. Ich konnte den unverkennbaren Laut, der üblicherweise zu diesem Blick gehörte, förmlich hören. Das überambitionierte Mega-Summen einer hochgezüchtet fetten Hummel mit tauringetränktem Arsch, beim Vorsummungsgespräch als Feuerwehrsirene. Erst harmonisch abfallend, danach atonal ansteigend. Doch hier und heute blieb das Summen ebenso stumm wie meine Einwände und Lukas musste sich auf das verschwörerische Augengekichere beschränken.
Ich lächelte breit, hummelarschbreit. »Wenn das deine Meinung ist. Du weißt, du hast immer recht. Also ... ich nehme dann einmal den Lachsburger. Und was darf es für dich sein?«
»Überflüssige Frage. Natürlich das Steak!«
»Mit brauner Soße?«
»Ganz sicher nicht. Ich trau denen hier echtes Fleisch zu.«
Jetzt mussten wir beide lachen, und das alles andere als leise. Ich hätte es auch um nichts in der Welt missen mögen. Wenn ich mich heute an eine Sache erinnere, dann an das Lachen. Nicht an jedes einzelne, aber an die meisten. Und es waren vielleicht nicht viele, aber es waren einige, denn ich hatte mir angewöhnt, wenn es einen Grund gab zu lachen, es niemals leise zu tun. Ich hatte es mir geschworen, als die Welt rund um mich auf einem Auge trüb geworden war. Ich hatte mir geschworen zu lachen.