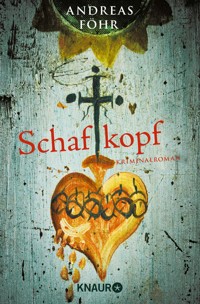9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach dem #1-Spiegel-Bestseller »Schwarzwasser«: Fall 8 für Wallner & Kreuthner - das ungleiche Tegernseer-Ermittler-Duo des Bestseller-Autors Andreas Föhr. Krimi-Fans und ganz besonders Bayern- und Regionalkrimi-Fans werden mit Hochspannung, einem intelligenten Kriminalfall sowie Föhrs trockenem Humor voll auf ihre Kosten kommen. Kommissar Clemens Wallner von der Kripo Miesbach und Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner, liebevoll "Leichen-Leo" genannt, bekommen alle Hände voll zu tun, als ausgerechnet der Schafkopf-Held Johann Lintinger durch eine Schrottschere seiner rechten Hand beraubt wird. Ein würdiges Begräbnis muss her für diese legendäre Rechte, beschließt Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner, und so wird gleich neben einer alten Kapelle, die hinter dem Garten der Mangfall-Mühle steht, ein Grab ausgehoben. Dabei macht »Leichen-Leo« seinem Spitznamen mal wieder alle Ehre, denn der Ruheplatz ist bereits belegt: von einer männlichen Leiche. DNA-Untersuchungen ergeben, dass es sich um den seit vier Monaten vermissten Vermögensberater Daniel Ulrich, ansässig in Frankfurt, handelt. Er soll in Miesbach einen Wagen gestohlen haben. Doch warum? Und wo sind seine Frau und sein Sohn? Schnell haben Kommissar Wallner und die Kripo Miesbach mehr Fragen als Antworten und eine bemerkenswerte Spurensuche im vermeintlich idyllischen Oberbayern nimmt ihren Lauf. »Im Hype-Reigen der deutschen Regional-Krimis ist ›Schwarzwasser‹ herrlich unprovinziell und vielschichtig – und bringt den Leser trotzdem mit Dialekt und Schrulligkeit zum Lachen.« Stern »Föhr hat ein Händchen für die Mischung zwischen Humor und Spannung, ein gutes Timing und jede Menge Erfahrung, wie man einen Stoff, eine Stimmung griffig macht.« Südwestpresse über »Schwarzwasser« Alle Bände der Wallner & Kreuthner-Krimis auf einen Blick: Band 1 - Prinzessinnenmörder Band 2 - Schafkopf Band 3 - Karwoche Band 4 - Schwarze Piste Band 5 - Totensonntag Band 6 - Wolfsschlucht Band 7 - Schwarzwasser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Föhr
Tote Hand
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner möchte die Hand eines Freundes, die der Schrottschere zum Opfer fiel, würdig bestatten. Beim Ausheben des Grabes muss er feststellen, dass es bereits belegt ist: mit der Leiche eines Mannes. Die Kripo Miesbach findet bald heraus, dass der unbekannte Tote einige Monate zuvor einen Wagen gestohlen hat und damit in der Nähe des Fundorts gegen einen Baum gerast ist. Doch die Obduktion ergibt: Der Mann starb nicht an seinen Unfallverletzungen; dennoch wurde er, offenbar kurz nach dem Unfall, vergraben. Wer ist der Tote? Und was ist damals passiert?
»Herrlich unprovinziell und vielschichtig.« Stern
»Andreas Föhr brilliert durch die Kombination von Ernst und Humor.« Petra
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Für Anni und Gustl
Prolog
Berlin, Mai 2010
Sie standen vor dem Club und rauchten und redeten mit den Jungs, die sie kennengelernt hatten. Daniel war schon älter, vielleicht fünfundzwanzig. Seine Augen waren blau, die Haare rotblond, die Wimpern waren hell. Er strahlte eine Selbstsicherheit aus, die aus der Tiefe kam, so schien es Sena jedenfalls. Jemand, der weiß, was er wert ist im täglichen Kampf ums Überleben. Er berührte sie, zog sie an sich, nahm ihre Hand und bewahrte dabei immer das Spielerische, sandte eine klare Absicht in ihre Richtung, die dennoch angenehm unverbindlich war. Sena war ein bisschen verliebt. Julias Junge war nicht so alt, nicht mehr achtzehn wie die Mädchen, aber jünger als Daniel. Vielleicht wirkte er auch nur unreifer. Senas Hand lag in der von Daniel, sie lehnte sich an seine Schulter und sah zum Himmel. Die Nacht über Berlin war ungewöhnlich klar. Sie konnte den Kleinen Wagen sehen. In Nächten wie dieser hatte sie mit ihrem Vater auf dem Balkon gestanden, er hatte auf die Sterne gedeutet und sie gelehrt, den Polarstern zu finden. Vor sechs Monaten war der Vater gestorben. Sie hatte eine halbe Flasche seines Rasierwassers behalten, um daran zu riechen, wenn sie sich nach ihm sehnte. Wie jetzt.
»Was glotzen die Typen so?«, sagte Julia.
Es riss Sena aus ihrer Melancholie.
In der Hofeinfahrt des Industriegeländes, in dem sich der Club befand, standen zwei Männer. Der eine mit Schnauzbart um die fünfzig, der andere ohne Bart in den Zwanzigern. Sie starrten feindselig in Richtung der jungen Leute, rührten sich aber nicht von der Stelle. Sena wusste: Die Blicke galten ihr. Sie ließ Daniels Hand los.
»Entschuldigt mich kurz.«
Onkel Adal war wieder da. Extra aus Ankara angereist. Auch den jüngeren Mann neben ihm kannte Sena: Emre. Der Mann, den sie heiraten sollte. Sena und Emre waren an unterschiedlichen Orten in Deutschland aufgewachsen. Aber ihre Familien kamen aus demselben Dorf an der Nordküste der Türkei. Zwei Monate nach Timurs Tod hatte Adal Emres Vater im Heimatdorf getroffen. Sie hatten getrunken und des Toten gedacht und überlegt, was man für die Familie tun könne. Und da hatte Adal die Idee gehabt, von der er nicht verstehen konnte, warum sie seinem verstorbenen Bruder nie in den Sinn gekommen war. Oder vielleicht war sie das, aber dann hatte er sie niemandem mitgeteilt: nämlich, dass Sena und Emre das ideale Paar abgeben würden. Was für ein wunderbarer Gedanke, die lange Freundschaft, die die Familien verband, durch eine Hochzeit zu krönen. Senas Mutter, der ihr Mann zwar ein wenig Geld, aber eine nur geringe Rente hinterlassen hatte, müsste nicht mehr für die Tochter aufkommen. Und Sena wäre in einem sicheren Hafen und würde in eine lange befreundete Familie einheiraten. Was konnte man sich als junge Frau mehr wünschen? Die beiden Männer waren sehr angetan von ihrem klugen Beschluss, tranken noch einen Raki und gaben sich die Hand darauf.
»Hi, Emre«, sagte Sena auf Deutsch und dann auf Türkisch: »Was willst du, Onkel Adal? Ich habe dir gesagt, dass ich nicht heirate.« Und zu Emre: »Ist nichts Persönliches.«
»Was spricht dagegen?« Adal sah seine Nichte verständnislos an. »Du könntest sogar in Deutschland bleiben.«
»Ich bin achtzehn. Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich bin volljährig. Und das wäre ich übrigens auch in der Türkei.«
»Und du glaubst, deswegen bist du auch klüger als alle anderen? Ist das so? Klüger als zwei erfahrene Männer von fast fünfzig Jahren. Zwei Männer, die lange und sehr gründlich überlegt haben, was das Beste für alle Beteiligten ist. Aber nein, du weißt das alles besser. Weil, du bist ja schon achtzehn.« Er schlug Emre mit dem Handrücken auf den Oberarm. »Sag halt auch mal was.«
»Na ja …«, begann Emre etwas zögerlich auf Deutsch, »… du bringst Adal und meinen Vater in eine ziemlich blöde Lage.«
»Könntest du vielleicht türkisch reden?«, unterbrach ihn Adal. »Oder soll ich nicht mitbekommen, was ihr sprecht?«
»Ist ja gut. Ich hab gesagt, dass Sena uns alle in eine dumme Lage bringt.« Emre wandte sich wieder an Sena, diesmal auf Türkisch. »Mein Vater und Adal haben sich das gut überlegt. Und … ich meine, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Ich mag dich und – na ja«, ganz kurz verfiel er ins Deutsche, »… hast du darüber nachgedacht, was ich dir angeboten habe?«
»Hab ich.« Adals Gesichtsausdruck zwang Sena wieder ins Türkische zurück. »Ich will nicht heiraten, okay?«
»Mehr als anbieten kann ich’s dir nicht.« Emre versuchte zu lächeln. »Aber dir ist klar, was du anrichtest? Das gibt ziemlichen Stress. Die zwei …«, er deutete auf Adal, »… haben schon alles besprochen. Aber die Entscheidung liegt natürlich bei dir.«
»Was redest du da!« Adal schob Emre ein Stück zur Seite, um sich direkt vor Sena aufzubauen. »Hör zu: Ich habe deinem Vater versprochen, dass ich mich um seine Familie kümmere, wenn er zuerst stirbt. Und das tue ich. Ich habe alles so arrangiert, dass es für jeden das Beste ist, und ich habe es mir nicht einfach gemacht. Und du? Hör ich: ›Danke, Adal‹? ›Danke, dass du das alles für mich und meine Mutter getan hast‹? Nein, nichts. Keinen Dank. Stattdessen willst du, dass ich mein Wort breche.« Er wurde lauter. »Was ist gegen Emre zu sagen? Was? Ist er so schlimm? Musst du deswegen die Freundschaft von zwei Familien zerstören?« Adal hatte sich in Rage geredet. Er ging bebend vor Wut auf Sena zu und fasste ihren Arm. »Ich lass mich doch von einem kleinen Mädchen nicht lächerlich machen. Du kommst jetzt mit!«
Adal zog Sena am Arm mit sich fort, rot im Gesicht und schwitzend. Sena wehrte sich, aber gegen den kräftigen Mann hatte sie keine Chance. Plötzlich blieb Adal stehen. Sena sah zuerst nur, dass ihn jemand am Kragen gepackt und nach hinten gezogen hatte. Es war Daniel.
»Was ist hier los?«, fragte er.
»Schon okay«, sagte Sena.
Aber für Adal war es nicht okay. Er versuchte sich aus Daniels Griff zu winden. Als das nicht gelang, schlug er ungelenk um sich.
»He, spinnst du?«, sagte Daniel, drehte Adal den Arm auf den Rücken und trat ihm in die Kniekehle. Senas Onkel sackte zu Boden, ein weiterer Tritt in den Rücken beförderte ihn mit beiden Händen vornüber in eine schwarze Pfütze.
Sena wollte Daniel beruhigen, sandte aber vorher einen Blick zu Emre und erschrak. »Vorsicht!«, rief sie Daniel zu.
Emre hatte ein Springmesser in der Hand, die Spitze wies in Daniels Richtung, und er funkelte Daniel wütend an.
Daniel ging einen Schritt auf Emre zu. »Was wird das?«
Emre schwieg. Währenddessen erhob sich Adal leise fluchend aus der Pfütze. Daniel schickte ihn mit einem Tritt gegen die Schulter wieder zu Boden.
»Lass den Mann in Ruhe!«, schrie Emre ihn an. »Und verpiss dich!«
Ohne zu überlegen, so hatte es den Anschein, fasste Daniel nach der Hand mit dem Messer, verdrehte den Arm, das Messer fiel zu Boden, und Daniels Ellbogen zuckte in Emres Gesicht. Emre taumelte, stolperte über seinen eigenen Fuß und kam neben Adal auf dem Asphalt zu liegen. Das alles geschah innerhalb einer Sekunde.
Daniel ging einen Schritt auf die beiden zu, und es hatte den Anschein, als würde jetzt eine wüste Schlägerei losbrechen. Aber Sena trat ihm in den Weg.
»Lass es gut sein. Ich hab keinen Bock, dass noch jemand verletzt wird.«
Sie zog Daniel weg in Richtung Club. Als sie in sicherer Entfernung waren, drehte sich Sena noch einmal um. Adal wischte sich den Schmutz von der Hose. Emre hob das Messer auf, und dann richtete er seinen Blick auf Sena. Mit offenem Mund starrte er sie an. Wie eingefroren mit dem Messer in der Hand. Sena verkrampfte sich der Magen.
»Lass uns reingehen«, sagte sie.
1
Landkreis Miesbach, 2018
An einem Vormittag im November, es war gegen 10.50 Uhr, die Sonne war kraftlos, und Raureif lag auf dem Blechdach der Verwaltungsbaracke, trennte die Schrottschere Johann Lintinger die rechte Hand vom Arm. Genau am Gelenk. Lintinger, seit jeher hart im Nehmen, rief den Notarzt, der ihn mitsamt seiner abgetrennten Hand nach Agatharied ins Krankenhaus brachte. Die gute Nachricht: Er könne sie wieder annähen, so der Chirurg, was vermutlich zwölf Stunden dauern werde. Halbwegs funktionieren würde die Hand anschließend auch, nur in ästhetischer Hinsicht müsse Lintinger gewisse Abstriche machen. Wenn man freilich bedenke, was so eine Schrottschere mit massiven Eisenteilen anstelle, nicht wahr … Er wolle nicht von Glück reden. Aber es sei eben alles relativ. Zum Erstaunen des Chirurgen lehnte Lintinger die Replantation seiner Hand ab.
Über die Gründe für den Unfall sollte noch viel spekuliert werden. Es sei eben altersbedingt gewesen, sagten einige. Und damit meinten sie nicht, dass Lintinger langsamer im Kopf oder unkonzentrierter sei als früher. Sie bezogen sich vielmehr auf den Umstand, dass Lintinger, seit er die sechzig überschritten hatte, um halb sechs statt um halb acht aufstand. Beibehalten hatte er freilich die Gewohnheit, ab dem Frühstück Bier zu trinken. Nur hatte er jetzt am Vormittag zwei Stunden mehr Zeit dafür. Schon gegen elf war daher die erste Hälfte des Kastens geleert. Selbst bei einem geübten Trinker wie Lintinger beeinträchtigten zwei Promille die Feinmotorik und Reaktionszeit. Eine andere Frage war, wie man sich überhaupt allein mit einer Schrottschere die Hand abtrennen konnte, denn zwischen Schere und Steuerung lagen mindestens zwei Meter. Irgendetwas musste da gewaltig schiefgelaufen sein.
Am Nachmittag versammelten sich Lintingers Sohn Harry, Wirt des Gasthauses Zur Mangfallmühle, sowie einige Freunde am Krankenbett, darunter auch Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner und dessen Kollege Sennleitner.
»Und? Ois fit im Schritt?«, versuchte Kreuthner einen unverkrampften Einstieg.
»Endlich bin ich sie los!« Lintinger hielt lachend den verbundenen Stumpf seiner Hand in die Luft. »Hat eh nur g’stört, des blöde Teil.«
Die Runde lachte ein wenig beklommen, und Kreuthner gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass zumindest nicht Lintingers Humor in die Schrottschere geraten war. Irgendetwas freilich störte Kreuthner in diesem Moment, ohne dass er es benennen konnte. Wie er später darüber nachdachte, kam er darauf, was es war: Der alte Lintinger war für alles Mögliche bekannt, nur nicht für seinen Humor.
Nach dem Krankenbesuch saßen die Freunde nachdenklich im Wirtshaus Zur Mangfallmühle beisammen und sinnierten über das Unglück, das Johann Lintinger widerfahren war. Einig war man sich, dass es eines Tages einfach hatte passieren müssen. Schon als Lintingers Sohn Harry noch bei seinem Vater auf dem Schrottplatz gearbeitet hatte, war am Abend ein Kasten leer gewesen. Es entspann sich ein kleiner Disput darüber, ob Lintinger, der beinharten Logik des Alkoholismus folgend, jetzt noch mehr trank als damals oder ob nicht die schwindenden Kräfte seiner Leber dem Alkoholkonsum eine natürliche Grenze setzten. Während die Argumentation lauter und hitziger wurde, glitt Kreuthners Blick an der einst senfbraun gestrichenen, jetzt speckig-dreckigen Holzvertäfelung hinter dem Stammtisch hinauf und blieb an einem kleinen Bilderrahmen hängen, den sie dort aufgehängt hatten. Hinter der Glasplatte waren acht Spielkarten befestigt, vier Ober und vier Unter. Darunter stand in ungelenker Handschrift: Johann Lintinger – 18. Nov. 2015. Alle anderen am Tisch folgten Kreuthners Blick.
»Legendär!«, seufzte Sennleitner. »Das einzige Solo-Sie, wo ich in meinem Leben g’sehen hab.«
»Und wo is es dring’steckt?« Kreuthner presste die Lippen aufeinander. »In seiner rechten Hand.« Kreuthners Stimme war jetzt belegt, und er brachte kein weiteres Wort mehr heraus.
»Endlich is sie weg, hat er g’sagt.« Ein bitteres Lachen stieg in Harry Lintinger auf. »Wie kann man so was sagen?«
»Er hat’s halt nicht zeigen wollen«, sagte Kreuthner leise.
»Weg. Für immer.« Sennleitner betrachtete seine eigene rechte Hand. Am Mittelfinger fehlte die Hälfte des vorderen Glieds. In der Hektik eines Polizeieinsatzes hatte er sich die Hand in der Streifenwagentür eingeklemmt. Sein Blick ging wieder nach oben zu den Karten. »Wer hat eahm eigentlich des Blattl damals geben?«
»Er is selber der Geber gewesen.« Kreuthner hatte seine Rührung inzwischen niedergerungen und betrachtete mit leicht zusammengekniffenen Augen das gerahmte Schafkopfblatt an der Wand.
»So a Zufall!«
»Magst du da irgendwas andeuten?«, fragte Harry Lintinger, und in seinen Ton war mit einem Mal eine gewisse Schärfe hineingeraten.
»Ich hab nur g’sagt, es war a Zufall. Ein …« Sennleitner rang um die richtigen Worte zur Schadensbegrenzung. »Ein … witziger Zufall. Dass er’s auch noch selber gegeben hat. Mehr nicht.«
Ja, es war schon ein komischer Zufall gewesen. Aber an Betrug glaubte eigentlich keiner. Nicht, dass es dem alten Lintinger an krimineller Energie gebrach. Da hatte er schon dickere Bretter gebohrt. Doch konnte sich keiner vorstellen, wie man sich mit Lintingers klobigen, von Hornhaut überzogenen Pranken ein Solo-Sie hinmischen sollte. Auch fehlte Lintinger, wenn man mal ehrlich war, das Hirnschmalz für so einen Coup.
»Was machen die im Krankenhaus eigentlich mit der Hand?«, lenkte Kreuthner das Gespräch wieder auf unverfängliches Terrain.
So richtig wusste es keiner. Irgendwie entsorgen würde man so eine Hand wohl. Aber wie genau …?
»Wozu willst’n des wissen?«, fragte Sennleitner.
In Kreuthners Augen blitzte jetzt jenes Funkeln, das immer blitzte, wenn etwas Großes Form annahm in seinem Kopf.
»So a Hand, verstehst …?«, sagte er. »So eine Hand, wo schon mal ein Solo-Sie dring’steckt is, die kannst doch net einfach wegschmeißen.«
»Des geht gar net«, pflichtete der junge Lintinger kopfschüttelnd bei. »So eine Hand, die begleitet dich ein ganzes Leben. Also normal. Und von wem kannst du des sonst noch sagen?«
»O ja. Selbst wenn der beste Freund sich schleicht – dann … dann is die Hand immer noch da.« Sennleitner nahm einen kräftigen Schluck Bier, um einer machtvoll aufkommenden Rührung Herr zu werden. »So eine Hand ist fast noch treuer wie ein Hund.«
»Hand – Hund …« Kreuthner machte eine abwägende Geste. »Könnt ich nicht entscheiden.«
»Wisst’s ihr noch, wie mir den Lucky beerdigt haben?« Jetzt hatte auch Harry Lintinger einen Kloß im Hals. Die Rede war von dem Rottweiler, der elf Jahre dafür gesorgt hatte, dass der lintingersche Schrottplatz sich weder bei Einbrechern noch bei Polizisten großer Beliebtheit erfreute. Im Grunde schlug jeder außer den Lintingers drei Kreuze, dass das bissige Vieh endlich tot war.
»Eine Seele von einem Hund«, sagte Sennleitner.
»Und mit Anstand unter der Erde. Aber die Hand von deinem Vater – die schmeißen s’ einfach weg?« Kreuthner sah Harry Lintinger auffordernd an.
Der googelte gerade etwas auf seinem Handy. »Abfallschlüssel AS 180102. Körperteile, Organabfälle, Blutbeutel. Müssen gesondert entsorgt werden. So schaut’s aus.«
»Da hab ich …«, Kreuthner lehnte sich lächelnd zurück und führte den Bierseidel zum Mund, »… eine bessere Idee.«
Zwei Tage später wurde Johann Lintinger mit seinem Armstumpf entlassen. Am Tag davor war Kreuthner in Uniform zum Krankenhaus gefahren und hatte die Herausgabe von Lintingers Hand verlangt, weil in der Sache wegen Versicherungsbetrugs ermittelt werde. Da Lintinger die Hand ohnehin nicht mehr angenäht haben wollte, gab man sie Kreuthner gegen Unterschrift in einem Kühlgefäß mit und ermahnte ihn, sorgsam damit umzugehen. Kreuthner versprach es.
Harry fuhr mit seinem Vater direkt vom Krankenhaus zur Mangfallmühle. Damit war Johann Lintinger sehr einverstanden, denn seine Gefährten hatten ihm lediglich zwölf Flaschen Bier ins Krankenhaus bringen können, bevor eine rigorose Krankenschwester dem Alkoholverkehr ein Ende bereitet hatte mit dem Hinweis, Lintingers Fahne könne man bis ins Stationszimmer riechen, es gebe schließlich noch andere Patienten. Lintinger befand sich also quasi im Stadium des trockenen Entzugs, und ein nervöses Zittern hatte sich seiner verbliebenen Hand bemächtigt. Harry zapfte seinem Vater erst einmal drei, vier Halbe, danach war wieder vernünftig mit ihm zu reden. Kreuthner und Sennleitner, die im Wirtshaus auf Lintinger gewartet hatten, ließen ihren Kameraden nicht allein trinken und deuteten an, dass man noch eine Überraschung für ihn bereithalte. Für die sich Lintinger freilich erst interessierte, nachdem der Alkoholspiegel auf normal gestellt war.
»Kannst dich noch erinnern?«, sagte Kreuthner und deutete auf das eingerahmte Solo-Sie an der Wand.
Lintinger nickte, kicherte in sich gekehrt und murmelte: »Leck mich am Arsch, war des geil.«
»Die Überraschung für dich hat a bissl damit zu tun«, klärte ihn Sennleitner auf.
»Ah geh? Jetzt bin ich aber g’spannt.«
»Dann gehen mir mal nach draußen.« Kreuthner stand auf und strebte in Richtung Hinterausgang. Dabei gab er Harry ein Zeichen, der hinter dem Tresen einen Gegenstand in der Größe eines Schuhkartons hervorholte und sich den anderen anschloss.
Das schöne Wetter des Amputationstages hatte leider nicht lange gehalten. Es war wieder kalt und grau geworden, und ein beständiger Nieselregen ging über dem Mangfalltal nieder. Kein schlechtes Beerdigungswetter, dachte Kreuthner und schlug den Kragen seiner Jacke hoch. An der kleinen Kapelle hinterm Wirtshaus blieben sie stehen. Vor seiner kleinen Ansprache räusperte sich Kreuthner und wartete, bis alle zur Ruhe gekommen waren.
»Lieber Johann, mir haben uns hier an diesem geschichtsträchtigen Ort versammelt, weil mir eine Überraschung für dich haben. An dieser Stelle liegt, wie du weißt, der Hansl Waldhofer, einer der Helden von der Jagerschlacht im Grund.« In besagter Schlacht nahmen anno 1833 einige Bauernburschen an dem feigen Jäger Johann Baptist Mayr blutige Rache dafür, dass er den Menten Sepp hinterrücks erschossen hatte. So jedenfalls die Lesart von Kreuthner und seinen Spezln. Hansl Waldhofer war in dem Scharmützel von Mayrs Hund gebissen worden. Angeblich ruhten Waldhofers Gebeine vor der winzigen Kapelle. Aber das war Legende. Die Kapelle stand schon immer hinter dem Wirtshaus, und keiner wusste, wer sie errichtet hatte und wofür sie gut war. Irgendwer hatte vor vielen Jahren mal eine Art Votivtafel neben die Madonna gehängt, auf der in naivem Stil dargestellt war, wie ein Mann mit Feder am Hut und Gewehr in der Hand von einem monströsen Hund in den Hintern gebissen wird. »Nun, mir haben gedacht«, fuhr Kreuthner fort, »dass dies hier ein würdiger Ort ist für … nun ja, ich sag amal: eine letzte Ruhe.«
»Wollt’s mich schon beerdigen? Bis jetzt is nur mei Hand hin.«
»Jetzt kommst du selber aufs Thema. Sehr gut.« Kreuthner räusperte sich noch einmal. »Deine rechte Hand! Die Hand, wo ein Solo-Sie dring’steckt is. Le-gen-där!«
»Des Solo-Sie is in der linken g’steckt.«
Kreuthner war erstaunt, und ihm fehlten für einen Moment die Worte. Beim Blick in die Runde stieß er auf ratlose Gesichter. Selbst Harry schien nicht zu wissen, in welcher Hand sein Vater die Spielkarten üblicherweise gehalten hatte.
»Ah so …«, bemühte sich Kreuthner, seine Fassung wiederzuerlangen. »Aber dann hast mit der rechten ausg’spielt.«
»Beim Solo-Sie spielst net aus, des legst einfach hin. Was wird’n des hier? Ich krieg langsam an Durst.«
»Is auch net so wichtig, mit welcher Hand …« Kreuthner betrachtete seine Hände und grübelte kurz darüber nach, in welcher von beiden er die Karten hielt. »Na, jedenfalls haben mir hier ein Geschenk für dich.«
Sennleitner kam jetzt mit einem kleinen Kasten, den er aus der Schuhschachtel genommen hatte. Er sah aus wie eine Miniaturschatztruhe aus dunklem Holz mit Messingbeschlägen an den Ecken und einem ebenso mit Messingbeschlag versehenen Schloss an der Vorderseite. Auf dem flachen Deckel war das patinierte Blechrelief einer knorrigen Hand. Kreuthner hatte beim Gmunder Steinmetz ein Exemplar von Dürers Betenden Händen erstanden, das sonst auf Grabsteine montiert wurde. Die andere Hand, die hinter der vorderen Hand teilweise sichtbar war, hatte er mit einer Metallsäge sorgfältig entfernt.
Kreuthner hielt Lintinger die Schatztruhe hin und bemühte sich, ein angemessenes Pathos in seine Stimme zu legen: »Deine – Hand!«
Der Beschenkte kniff die Augen argwöhnisch zusammen, und statt das Kästlein entgegenzunehmen, was mit einer Hand ohnehin schwierig war, tappte er mit dem Zeigefinger auf das Dürerrelief. »Meine Hand? Des is doch a linke Hand.«
»Die gibt’s nur in Links«, rechtfertigte sich Kreuthner. »Wichtig ist ja der Inhalt.«
»Soll ich’s jetzt aufmachen?«
Kreuthner kamen mit einem Mal Bedenken. Der Inhalt des Schatzkästchens war zwar über sechzig Jahre ein Teil von Lintinger gewesen. Insofern sollte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn Lintinger nicht tief bewegt sein würde. Andererseits – Lintinger schien nicht begriffen zu haben, dass da tatsächlich seine fehlende Hand drin war. Wenn er derart unvorbereitet mit ihr konfrontiert wurde – und Lintingers Hand war schon zu Lebzeiten kein schöner Anblick gewesen –, könnte das die gute Absicht zunichtemachen.
»Wart an Moment mit dem Aufmachen. Ich muss noch was dazu sagen.«
»Sag amal – wieso hast du die Karten in der linken Hand g’habt?«, meldete sich jetzt Harry Lintinger, der sich in der Zwischenzeit offenbar tiefschürfende Gedanken zu dem Thema gemacht hatte. »Du hast doch auch mit rechts geschrieben.«
»Nur, wo’s nicht anders gegangen is. Den Rest hab ich mit links g’macht.«
Harry Lintinger starrte seinen Vater an, als habe der ihm jahrelang schändliche Lügen aufgetischt. »Wieso das denn?«
Johann Lintinger seufzte ein langes »Mei …« und ließ die Schultern hängen. »Des kann ich euch net erklären. Ihr tätet’s des im Leben net verstehen.«
»So blöd samma a net«, sagte Kreuthner und stellte die Schatztruhe auf die Bank vor der Kapelle, denn sie wurde ihm unbequem. »Was soll denn der ganze Schmarrn mit rechts und links?«
Sennleitner reichte Lintinger eine Flasche Bier. Kreuthner schenkte Sennleitner ein zustimmendes Nicken, während Lintinger sich stärkte.
Als die Flasche halb leer war, entfuhr Lintinger ein sattes »Aaah!«, dann wischte er sich mit dem Jackenärmel den Schaum vom Mund und sah in die Runde. »Ihr wollt’s es also unbedingt wissen?«
Keine Frage – alle wollten wissen, was Lintinger ihnen anscheinend über Jahre nicht gesagt hatte.
»Die G’schicht is die: Ich hab meine rechte Hand nie mögen. Is einfach so. Warum?« Er zuckte theatralisch mit den Schultern. »Keine Ahnung. Die hat irgendwie net zu mir gehört, verstehst?«
Nein, das verstand niemand, und es war jedem anzusehen.
»Des is, wie wennst du eines Tages aufwachst und du hast a drittes Bein. Was machst damit? Es nervt. Was willst mit am dritten Bein?«
»Aber du hast die Hand doch hergenommen«, beharrte Harry. »Beim Schreiben zum Beispiel.«
»Ja, weil ich Rechtshänder bin. Des is ja der Scheiß. Was glaubst, wie mich des fertigg’macht hat.«
»Wie lang geht des schon?«
»Mein ganzes Leben. Wie ich vier war, hab ich zum Christkind gebetet, dass es die Hand wieder mitnimmt. Aber wenn’s kommen ist, hab ich ja nicht mit ihm reden dürfen. Ach, jetzt is es schon weg! Hat’s immer g’heißen. Mit siebzehn hab ich dann g’spannt, dass die mich die ganze Zeit verarschen.«
Kreuthner brauchte jetzt auch ein Bier. Zum Glück hatte Sennleitner daran gedacht, einen halben Träger aus der Wirtschaft mitzunehmen. Kreuthner nahm einen nachdenklichen Schluck, schüttelte den Kopf und sah in den Nieselregen. »Heißt des, des war kein Zufall mit der Hand?«
Lintinger betrachtete den noch sauberen Verband an seinem Armstumpf, und eine gewisse Verschmitztheit blitzte ihm aus den Augen. »Zufall?« Er schüttelte den Kopf. »A Unfall war’s. Und ich werd auch nix anders net sagen. Aber manchmal hat a Unfall ja auch was Gutes.«
»Jetzt hör auf mit dem Schmarrn. Des gibt’s net, dass einer seine Hand loswerden will. Wie blöd musst denn da sein?«
»Ich bin net blöd«, rief Lintinger erregt. »Ich bin krank! Des is a Krankheit.«
Harry Lintinger zückte sein Handy und gab etwas ein.
»Krank? Im Kopf – oder was meinst?« Kreuthner war noch nicht gewillt, Lintingers Unsinn zu glauben.
»Jawoll! Des is im Kopf. Und des hat auch an Namen: Xe… – wart amal … Xenophobie. So heißt des ganz offiziell.«
»Is des net, wennst keine Flüchtlinge magst?«
»Xenomelie«, meldete sich Harry, der immer noch auf sein Smartphone blickte. »Sehnsucht nach Amputation. Scheiße – was net alles gibt!« Er blickte seinen Vater irritiert an. »Warum hast denn nie was g’sagt?«
»Weil des eh keiner versteht.« Lintinger deutete auf die kleine Schatztruhe. »Was is jetzt da drin?«
Harry Lintinger, Sennleitner und Kreuthner tauschten hastige Blicke, und da sonst keinem was einfiel, war es wieder mal an Kreuthner, die Situation zu retten.
»Des … des is a Kastl«, sagte er und setzte ein verbindliches Lächeln auf.
»Bin ja net blind. Aber wieso is da die Hand drauf?«
»Weil … weil des Kastl was mit deiner Hand zu tun hat. Und zwar ham mir uns denkt, wennst du eine Prothese kriegst oder so an Haken wie der Captain Hook …« Ein Lachen ging durch die Runde, dessen Grund aber eher die Erleichterung darüber war, dass Kreuthner einen Weg aus dem Schlamassel gefunden hatte »… dann kannst die da reintun, wennst es grad net brauchst.«
»Aha.« Lintinger ging die drei Schritte zu der Bank und versuchte, mit der linken Hand den Deckel des Kästleins zu öffnen. Es gelang ihm aber nicht.
»Abgesperrt.« Kreuthner hielt einen Schlüssel hoch.
»Is da schon was drin?«, fragte Lintinger und schubste die Truhe ein paar Zentimeter die Bank entlang.
»Nein, nein. Erst wenn die Prothese drin is.«
Lintinger schob weiter an der Truhe herum. »Logisch is da was drin. Die is ja ganz schwer. Mach mal auf!«
»Innendrin, des … des müss ma noch sauber machen. Es is alles a bissl eilig g’wesen. Heut Nachmittag kannst sie dann haben.«
Lintinger hatte anscheinend Lunte gerochen und bedachte Harry und die anderen beiden mit misstrauischen Blicken. »Mach des Kastl auf!«, sagte er schließlich zu Kreuthner.
»Es is wirklich ganz dreckert. Richtig … eklig.«
»Ihr habt’s es mir g’schenkt. Und damit g’hört’s mir. Schlüssel!«
Kreuthner schüttelte verzweifelt den Kopf. »Tu dir des net an!«
Der Warnung ungeachtet nahm Lintinger Kreuthner den Schlüssel weg und sperrte die Schatztruhe auf. Der Deckel klemmte, und er musste mit seinem Armstumpf dagegenhalten. Aber schließlich klappte Dürers Hand nach hinten, und das Innere der Kiste wurde sichtbar. Auf den ersten Blick stachen die blauen Kühlakkus hervor, die der Zersetzung des Inhalts entgegenwirken sollten. Umgeben von den Akkus war etwas Helles in Plastik eingeschweißt. Plötzlich klappte der Deckel wieder zu. Kreuthner hatte seine Hand draufgelegt und schob das Kästlein etwas zur Seite. Lintinger sah Kreuthner ernst und mit dem Ausdruck einer schlimmen Ahnung im Gesicht an.
»Es is net des, was ich glaub, dass es is, oder?«
»Mei …« Kreuthner wand sich, als habe er Bauchgrimmen. »Es hat ja keiner wissen können, dass du und deine Hand, dass ihr so a g’störts Verhältnis habt’s. Mir ham denkt, es is a ganz besondere Hand, verstehst? Wegen dem Solo.«
Lintinger starrte auf das Kästchen und sagte nichts mehr. Die anderen starrten auf das regenfeuchte Gras zu ihren Füßen.
Das Erdreich war erstaunlich locker und nicht, wie erwartet, von Wurzeln durchzogen. Mit Hacke und Spaten hoben sie ein Grab neben der Kapelle aus. Lintinger hatte entschieden, die Hand – wo schon alles vorbereitet war – wie geplant zu beerdigen. Eine Grabplatte wollte er aber nicht, sodass Harry beim Steinmetz anrufen und die schon bestellte Granittafel mit der Hand und den Spielkarten und dem doppeldeutigen Schriftzug:
Eine Wahnsinns-Hand!
wieder abbestellen musste. Da Lintinger – wohl zur Strafe – auf einer Grabestiefe von sechs Fuß bestanden hatte, zogen sich die Arbeiten trotz guter Bodenverhältnisse hin. Gerade war Sennleitner mit der Hacke zugange, als er verwundert ausrief: »Ja, ist die schon herin?«
»Wer is herin?«, fragte Harry.
»Die Hand!«
Sennleitner trat einen halben Schritt zurück. Mehr ging nicht in dem engen Loch. Am Boden vor Sennleitners Gummistiefeln glänzte etwas. Es war Plastikfolie. Ihr Inhalt changierte von Dunkelbraun bis Beige.
Es war natürlich absurd, aber Kreuthner checkte zur Sicherheit die Schatztruhe. War die Hand versehentlich in die Grube gefallen? War sie nicht.
»Sei Pratz’n is noch im Kastl. Muss was anderes sein«, meldete er an Sennleitner.
Der kniete nieder, wischte den Dreck von der Folie und versuchte, sie aus der Erde zu ziehen. Vergebens. Offenbar war die Folie größer, als der erste Anschein vermuten ließ. Und so kratzte Sennleitner mehr Erde weg, und die Plastikfläche wurde immer größer. Unter der Folie war jetzt auch etwas Dunkelblaues zu sehen.
»Was is’n des Blaue da?« Harry Lintinger starrte wie die anderen gespannt ins Loch.
Sennleitner zog die Folie glatt, um die Spiegelung zu reduzieren.
»Heilige Scheiße!«, sagte er schließlich. »Stoff …«
2
Wallners Großvater hatte sich verändert. Äußerlich. Natürlich – er ging auf die neunzig zu, und die eine oder andere Falte war dazugekommen. Aber das war es nicht, was Wallner auffiel. Es waren mehr die Dinge, die Manfred selbst an sich vornahm. Zum Beispiel rasierte er sich jeden Tag. Bis vor einem halben Jahr hatte einmal die Woche genügt. Und er setzte sich in die Sonne. Der letzte Sommer hatte viel Sonne gebracht, und Manfreds faltiges Gesicht hatte eine sportliche Bräune bekommen. Doch was Wallner am meisten verwunderte: Manfred war lange nicht mehr beim Friseur gewesen. Die weißen Haare mussten schulterlang sein. Aber das konnte Wallner nur vermuten, denn Manfred trug sie immer zu einem Pferdeschwanz gebunden. Hinter all diesen Veränderungen hätte Wallner früher eine Frau vermutet, die Manfred beeindrucken wollte. Doch wo hätte Manfred eine kennenlernen sollen? Er verließ kaum das Haus, denn das Gehen fiel ihm schwer. Die einzigen Frauen, die im Hause Wallner verkehrten, waren Wallners Tochter Katja, die mit ihrer von Wallner geschiedenen Mutter alle paar Wochen zu Besuch kam, und Manfreds zwölfjährige Enkelin Olivia, Wallners Stiefschwester. Sie besuchte in Miesbach das Gymnasium und verbrachte ab und zu den Nachmittag bei ihrem Großvater. Natürlich hatte Wallner Manfred gefragt, was der Grund für die Veränderungen sei. Mit dem Stoppelbart, hatte Manfred gesagt, sehe er aus wie ein Penner. Und ganz allgemein wolle er seinen Typ verändern, wenn’s recht wär. Oder glaube Wallner, das lohne sich nicht mehr bei einem alten Mann? Manfreds Ton wurde dabei leicht patzig, sodass Wallner nicht weiter nachfragte. Doch war ihm klar, dass Manfred irgendetwas verschwieg. Nun – er würde es noch herausfinden.
Sie saßen beim Mittagessen in einer Wirtschaft am Oberen Markt. Dazu lud Wallner seinen Großvater einmal die Woche ein, damit er nicht jeden Tag allein essen musste.
»Und sonst? Alles klar?«, fragte Wallner, um die etwas stockende Konversation am Laufen zu halten.
»Alles wunderbar.« Manfred schob sich lustvoll eine Gabel mit Fleisch und Knödel in den Mund. »Bis auf die vermaledeite Gicht. Es is wirklich a Kreuz. Heut zwickt’s mich wieder im Knie.«
»Aber der Schweinsbraten schmeckt immer?« Wallner deutete auf den Teller vor Manfred.
»Der hat doch nix mit meiner Gicht zu tun.«
»Ah ja? Hat der Dr. Ismael nicht gesagt, du sollst kein Schweinefleisch essen?«
»Der is a Islamist. Die ham was gegen Schweinefleisch.«
»Soweit ich weiß, ist er koptischer Christ. Und die haben gar nichts gegen Schweinefleisch. Die essen selber welches.«
Manfred ließ Messer und Gabel sinken. »Willst mir jetzt das Mittagessen verleiden?«
»Ich darf ja wohl mal was sagen, wenn du jeden Tag über deine Gicht jammerst, aber nicht bereit bist, was dagegen zu tun.«
»Keine Sorge. Ich tu einiges dagegen.«
»Vernünftige Ernährung scheint nicht dabei zu sein.«
Manfred schnitt trotzig ein besonders fettes Stück von seinem Braten.
Wallner betrachtete seinen Großvater, und er kam ihm klein und zerbrechlich vor. »Schau – ich will dir doch deinen Schweinsbraten nicht verleiden. Aber du solltest wirklich auf deine Ernährung achten. Öfter mal Gemüse essen, zum Beispiel. Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein.«
»Gemüse!« Manfred schüttelte heiser lachend den Kopf. »Vom Gemüse kriegst koa Schmalz net. Net in die Arm und net im Hirn. Weißt, warum ich so alt g’worden bin?« Er hielt Wallner das an der Gabel wabbelnde Fett entgegen. »Deswegen!«
Wallner hob beschwichtigend die Hände. »Dann viel Spaß mit dem Knie.«
Zu Wallners Erstaunen schob sich Manfred das fette Stück Braten nicht in den Mund, sondern legte die Gabel wieder auf dem Teller ab.
»Des Knie is mei g’ringste Sorge.« Er zog ein geschmerzt-missmutiges Gesicht. »Hast auch an Ratschlag für die Blase?«
Manfred stand mühsam vom Tisch auf und tapste mit kleinen Schritten in Richtung Toilette. Wallner sah ihm nach. Einerseits tat ihm sein Großvater leid, weil er sich bei den kleinsten Alltagsverrichtungen so abmühen musste. Andererseits konnte Manfred mit seinen achtundachtzig Jahren immer noch selbst auf die Toilette gehen und kam auch sonst gut zurecht. Wallner erachtete das als großes Glück, ebenso wie den Umstand, dass Manfreds Gehirn noch tadellos arbeitete, auch wenn er manchmal unkonzentriert schien und sich an Dinge und Namen nicht erinnerte. Aber das war normal in dem Alter.
Aus den Augenwinkeln bemerkte Wallner, dass ein Mann am Tresen mit der Kellnerin redete. Sie deutete mit dem Kopf in seine, Wallners, Richtung, worauf sich der Mann in Bewegung setzte und auf ihn zukam.
»Sie sind Herr Wallner?«, fragte der Mann, als er am Tisch stand. »Ich bin Severin Mittner.« Mittner reichte Wallner die Hand. Wallner schätzte ihn auf Mitte vierzig, er hatte Ringe um die Augen und eine fahle Gesichtsfarbe.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Wallner und taxierte seinen Gesprächspartner. Wenn Mittner ein Verbrechen melden wollte, würde er ihn zur Polizeistation schicken.
»Ihre Nachbarin hat gesagt, dass Sie hier sind«, sagte der Mann. »Ich hatte Ihnen eine Mail geschrieben, dass ich komme. Aber vielleicht haben Sie sie nicht gelesen.«
»An meine private Mailadresse?«
»An die Adresse, die auf der Website steht.«
»Das ist die allgemeine Mailadresse der Polizei. Vielleicht ist es nicht an mich weitergeleitet worden. Um was geht es denn?«
In Severin Mittners Gesicht flackerte Irritation auf. »Polizei?«
»Ja. Kripo Miesbach. Oder welche Website haben Sie gemeint?«
Mittner betrachtete jetzt seinerseits Wallner sehr gründlich und sagte schließlich: »Sie schauen auch gar nicht aus wie auf dem Foto. Aber Fotos im Internet, das ist natürlich so eine Sache …«
»Welches Foto – wo – im Internet?« Wallners Stimme hatte unwillkürlich einen inquisitorischen Ton angenommen, denn der Eindruck verdichtete sich gerade dramatisch, dass das Zusammentreffen mit Herrn Mittner einer Verwechslung entsprang.
»Auf … auf Ihrer Website.« Mittner wirkte stark verunsichert. »Sie haben doch eine Website?«
»Nur die der Polizei …«
»Sie san der Severin Mittner, oder?«, hörte man mit einem Mal Manfreds hohe Stimme.
Mittner drehte sich um und sah, wer ihn angesprochen hatte. Erleichterung überkam ihn, und er stach mit dem Zeigefinger auf Manfred ein. »Ah! Jetzat!« Mit dem Daumen deutete er auf Wallner. »Er hat gesagt, er wär Wallner.«
»Is er auch. Aber net der Wallner. Des bin ich.« Manfred signalisierte seinem Enkel mimisch, dass Mittner nichts sei, was ihn irgendetwas anginge.
»Sie sind des auf dem Foto, gell?«
»Ja, ja. Gehen wir rasch vor die Tür?« Manfred wandte sich kurz angebunden an Wallner. »Bin gleich wieder da.« Dann verließ er mit Herrn Mittner die Wirtschaft.
Durch das Fenster konnte Wallner sehen, wie sein Großvater einige anscheinend freundliche Worte mit Mittner wechselte, dann trennten sich die beiden. Mittner ging weg, Manfred kam wieder herein.
»Wer war das?«
»Ach, niemand weiter. Ein Bekannter.«
»Kein besonders guter Bekannter, wenn er mich mit dir verwechselt.«
»A … Telefonbekanntschaft. Mir ham uns noch nie gesehen.«
Wallner nickte voller Argwohn. »Wo habt ihr euch kennengelernt?«
»Keine Ahnung. Ist schon länger her. Vielleicht beim Klosterfest letztes Jahr.«
»Aber dann hättet ihr euch ja schon mal gesehen.«
»Ich weiß es nicht mehr. Du lernst irgendwo wen kennen, tauschst Telefonnummern, und irgendwann hast vergessen, wo du den herkennst.«
»Komisch – er sagt, er kennt dich von einer Website im Internet.«
Manfred machte ein befremdetes Gesicht, aber Wallner konnte sehen, dass sein Großvater über eine Antwort nachdachte, die noch halbwegs Sinn ergab. Bevor es dazu kam, klingelte Wallners Handy. Er sah kurz auf das Display, sagte: »Tut mir leid, ist dienstlich«, und ging dran. Wallner sagte nicht viel, außer gelegentlich aha und okay. Dann versprach er, sofort zu kommen, und beendete das Gespräch.
»Musst weg?«, fragte Manfred, und die Hoffnung, das Gespräch damit zu beenden, schwang unverkennbar mit.
»Ja. Es gibt eine Leiche.« Er lächelte seinen Großvater an. »Wir können ja heute Abend weiterreden.«
3
Wallner fuhr die schmale, waldige Straße durchs Mangfalltal entlang. Es hatte aufgehört zu regnen, aber von den Bäumen tropfte immer wieder Wasser auf die Windschutzscheibe. In Anbetracht der Außentemperatur von etwa zwölf Grad hatte sich Wallner für seine Daunenjacke entschieden, denn er fror leicht.
Der Parkplatz vor dem Wirtshaus war voll mit Einsatzfahrzeugen. Irgendjemand hatte das Blaulicht auf seinem Streifenwagen angelassen. Wozu das gut sein sollte an diesem gottverlassenen Ort, war Wallner ein Rätsel. Die Mangfallmühle lag einsam im kühlen Flusstal. Das nächste Haus war einige Hundert Meter entfernt. Das nächste noch einmal so weit. Kein guter Ort für eine Gastwirtschaft, sollte man meinen, denn die ist ja auf Publikumsverkehr angewiesen. In diesem Fall war die Abgeschiedenheit freilich sehr nach dem Geschmack der Kundschaft. Allerlei Gelichter verkehrte in der Mangfallmühle, Menschen, die gern unter ihresgleichen blieben und die Blicke benachbarter Anwohner scheuten. Auch Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner gehörte, man musste es leider sagen, zu den regelmäßigen Gästen des Lokals. Deswegen hatte es Wallner auch nicht gewundert, dass Kreuthner ausgerechnet dort auf eine Leiche gestoßen war.
Die Kapelle lag weniger als hundert Meter vom Wirtshaus entfernt am Waldrand und war weiträumig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt worden. Wallner vermutete, dass in den weißen Papieroveralls mit Kapuze Tina und Oliver vom K3, der Abteilung für Spurensicherung, steckten. Sie standen vor einem Loch neben der Kapelle und diskutierten anscheinend. Wallner hätte gern gewusst, was da geredet wurde. Doch außer der Spurensicherung und dem Rechtsmediziner, der noch nicht aus München eingetroffen war, hatte direkt am Tatort niemand etwas zu suchen.
In der allgemeinen Betriebsamkeit hatte noch niemand seine Ankunft bemerkt, und Wallner ließ den Blick für einen Moment schweifen. Das Wirtshaus machte einen heruntergekommenen Eindruck. Harry Lintinger ließ nur die nötigsten Reparaturen ausführen. Einen Teil des maroden Dachs hatte er statt mit Ziegeln mit rotem Blech decken lassen. Es stammte vom Schrottplatz seines Vaters Johann – dem mit der nur noch einen Hand – und war von diesem auch selbst aufgebracht worden. Jetzt glänzte es regennass zwischen den bemoosten Ziegelflächen. Unten an der Fassade waren Ausblühungen, mineralische Stoffe, die im Putz mit der Feuchtigkeit aufstiegen und schmutzige Flecken bildeten. Aber das gehörte in der Gegend bei alten Häusern dazu. Lintingers mangelnder Renovierungseifer hatte auch sein Gutes. Die Fenster waren noch alt und klein, mit Sprossen und von einer schlichten Eleganz, verglichen mit der Thermopenklobigkeit neuer Modelle. Der umlaufende Holzbalkon war schief und leicht gewellt, aber antik und komplett erhalten. Ebenso die Eingangstür, ein verwittertes Prachtstück der Schreinerkunst von vor hundertfünfzig Jahren.
»Willst es kaufen?«, fragte Mike Hanke von der Seite.
Mike war Wallners dienstältester Mitarbeiter. Sie waren etwa der gleiche Jahrgang, und sollte Wallner eines Tages die Arbeitsstelle wechseln, würde vermutlich Mike Leiter der Kripo Miesbach werden. Nur hatte Wallner keine Ambitionen, Miesbach zu verlassen. Nicht, solange Manfred lebte.
»Die Feuchtigkeit hier wär nichts für den Manfred.«
»Die Kälte hier ist nichts für dich. So schaut’s doch aus.« Mike grinste Wallner fröhlich an und klopfte ihm auf die Daunenjackenschulter. Er selbst trug nur Flanellhemd ohne Jacke. »Wir haben uns in der Wirtsstube eingerichtet.« Mike ging voraus zum Gebäude.
Im Gastraum der Mangfallmühle saßen mehrere Beamte an Tischen mit Laptops, andere telefonierten oder redeten miteinander. In einer Ecke waren Kreuthner und Sennleitner, beide in Zivil, sowie Johann Lintinger versammelt. Harry Lintinger stand hinter dem Tresen und bediente die Kaffeemaschine. Wallner grüßte beim Hereinkommen in Kreuthners Richtung, dann die anderen Kollegen.
»Was gibt’s bis jetzt?« Wallner und Mike nahmen an einem Wirtshaustisch Platz, den Mike für sich requiriert hatte, wie Wallner an dem mit lustigen Sprüchen beklebten Laptop erkannte.
»Magst an Kaffee? Ist gar net so schlecht hier.«
»Vielleicht später.«
»Na gut.« Mike kippte sich den Kaffeerest aus seiner Tasse in den Mund. »Bis jetzt sieht’s so aus: Direkt neben der Kapelle sind der Leo und seine Spezln auf eine Leiche in einem Plastiksack gestoßen.«
»Gestoßen?«, fragte Wallner mit offenem Befremden im Gesicht. »Die war doch vergraben. Wie stößt man zufällig auf eine vergrabene Leiche?«
Mike zuckte die Schultern. »Frag ihn selber. Tina und Oliver haben den Sack weitgehend freigelegt. Jetzt warten sie auf den Rechtsmediziner, damit der sich ein Bild von der Auffindesituation machen kann. Bis jetzt lässt sich nur sagen, dass es sich um eine menschliche Leiche mit deutlichen Verwesungsspuren handelt. Möglicherweise liegt sie schon einige Zeit da. Durch das Plastik ist sie relativ gut konserviert worden und war vor Tieren geschützt. Schimmelt allerdings ziemlich.«
»Von den vier Herren da«, Wallner deutete mit dem Kopf auf Kreuthner und Kumpane, »weiß keiner, wer die Leiche ist?«
Mike schüttelte den Kopf.
»Wissen wir, welcher Staatsanwalt kommt?«, fragte Wallner.
»Der Tischler.«
Wallner schien überrascht und zögerte einen Augenblick. »Ich hab gedacht, der wär in Urlaub?«
»War wohl leider ein Gerücht.«
Wallner befragte zuerst Kreuthner. Die Sache war mehr als merkwürdig. Man gräbt ja nicht zufällig eine Leiche irgendwo im Wald aus, noch dazu neben einer Kapelle. Irgendetwas war also faul, und Wallner rechnete damit, die eine oder andere Lüge aufgetischt zu bekommen. Kreuthner war der geschickteste Lügner von den vieren. Wenn er ihn nach den anderen befragte und in Widersprüche zu deren Aussagen verstrickte, würde er sich womöglich herausreden. Wenn er ihn zuerst befragte, mussten sich die anderen herausreden. Das würde es für Wallner leichter machen.
»Mir gehen also nichtsahnend a bissl im Wald spazieren, und plötzlich sagt der Sennleitner: Schau amal, da is a Fuchs neben der Kapell’n. Was macht’n der da? Und wie ich hinschau, denk ich mir, des is ja komisch. Der grabt was aus. Und in dem Moment spannt der Fuchs, dass mir hinschauen, und haut ab.« Kreuthner hob die Hände, und die Geste besagte in etwa: Was es nicht alles gibt.
»Schöne Geschichte. Und was ist wirklich passiert?«
»Ja, glaubst am Polizeikollegen vielleicht net? Jetzt wird’s aber hint höher wie vorn.«
»Dass du mit dem Sennleitner und den Lintingers bei Regen spazieren gehst, glaubst du wohl selber nicht. Ihr seid zum Saufen hergefahren. Und Füchse sind nachtaktiv. Die graben nicht mittags vor eurer Nase Leichen aus.«
»Mei … jetzt, wo’sd es sagst …« Kreuthner kraulte sich das Kinn. »Stimmt. Mir san eigentlich hier in der Wirtschaft gehockt, und da sagt der Sennleitner: Schau mal, neben der Kapell’n, da is a Hund. Ein streunender Hund war’s. Sah a bissl aus wie a Fuchs.«
Wallner sah Kreuthner genervt an. »Sag mir einfach, warum ihr da gegraben habt.«
»Das ist meine Privatsache. Oder glaubst, ich hab den Burschen aufm Gewissen?«
Eine Tasse Cappuccino wurde vor Wallner auf den Tisch gestellt. »Kaffee?«, fragte Harry Lintinger.
»Ja, gern. Danke.«
Wallner riss das Tütchen Zucker auf und schüttete den Inhalt in den Kaffee. Dann sah er Lintinger hinterher, der zurück zum Tresen ging.
»Was glaubst du, wie lang ich brauch, bis ich euer schmutziges Geheimnis aus deinem Freund Harry rausgeholt hab?« Wallner drehte sich wieder zu Kreuthner.
Der betrachtete nachdenklich sein Glas auf dem Bierdeckel und kam zu der Einsicht, dass Wallner da ein baumstarkes Argument gebracht hatte.
»Wir wollten was vergraben«, räumte er ein.
»Und was?«
»Des is doch wurscht.«
Wallner betrachtete Kreuthner, der die Arme vor der Brust verschränkte. Aus dem Augenwinkel bemerkte Wallner Mikes Tablet. Auf dem Display war die Karte der Gegend zu sehen, mit dem Wirtshaus und der Kapelle. Wallner fiel etwas auf. Er vergrößerte die Karte mit zwei Fingern, schob die Kapelle ins Zentrum und las die genaue Bezeichnung des Ortes: Kapelle zur toten Hand. Der Name rührte daher, dass der Grund, auf dem das Kirchlein stand, dem Kloster Tegernsee vor dreihundert Jahren von einem hohen Herrn mit der Auflage der Unveräußerlichkeit – oder wie es damals hieß: zur toten Hand – gestiftet worden war. Das Kloster existierte schon lange nicht mehr, aber der Name hatte sich gehalten. Der Name ließ Wallner zum Tresen blicken, hinter dem jetzt Harry Lintinger und sein Vater mit dem verbundenen Armstummel standen.
»Ihr wolltet nicht zufällig seine Hand vergraben?« Wallner deutete Richtung Tresen. Sein Blick war ungläubig bis angewidert.
»Is des verboten?«
»Keine Ahnung. Außerhalb vom Friedhof wahrscheinlich schon.«
In diesem Augenblick wurde es unruhig im Eingangsbereich. Jemand war hereingekommen: Staatsanwalt Jobst Tischler. Er begrüßte flüchtig einige Beamte, die er kannte oder, genauer gesagt, an die er sich erinnern konnte. Denn er hatte schon mit fast jedem hier im Raum zusammengearbeitet, sich aber kaum mal einen Namen gemerkt.
»Soll ich dem Tischler das mit der Hand etwa erzählen?«, fragte Kreuthner.
»So wichtig bist du nicht, als dass er mit dir reden würde«, murmelte Wallner.
»Herr Wallner!«, rief Tischler schon aus fünf Metern Entfernung.
Wallner stand auf und begrüßte Tischler per Handschlag. Die beiden Männer verband ein schwieriges Verhältnis, was unter anderem darauf beruhte, dass Wallners Verhältnis zu Tischlers Chefin sehr gut war. Tischler fühlte sich oft zurückgesetzt oder übergangen. Manchmal auch zu Recht.
»Eine Leiche im Plastiksack?« Tischler stellte seinen Attachékoffer auf einen Wirtshausstuhl und machte den Reißverschluss der Barbour Wachsjacke auf, die er über dem Anzug trug.
»Ja, scheint schon einige Zeit im Boden zu liegen.«
»Wer hat sie entdeckt?«
»Der Wirt der Kneipe hier«, sagte Wallner. »Und ein paar seiner Freunde. Wir haben das Plastik, in das die Leiche eingehüllt ist, noch nicht geöffnet. Wir warten noch auf den Rechtsmediziner.«
»Ist eingetroffen.« Mike war an den Tisch getreten. »Diskutiert gerade mit Tina und Oliver, ob sie die Leiche auspacken sollen. Hallo, Herr Tischler.« Er reichte Tischler die Hand.
»Hallo! Schön, Sie zu sehen, Herr …«
»Hanke«, half Mike ihm aus.
»Ja, richtig. Hanke. Was wissen wir bis jetzt über die Leiche und den Plastiksack?«
Wallner gab Mike ein Zeichen, dass er Tischler informieren sollte. Mike setzte sich dazu.
»Über die Leiche kann man im Augenblick wenig sagen, außer dass sie einigermaßen verwest ist. Das wird kein Spaß bei der Obduktion.«
»Ja, freu mich drauf«, sagte Tischler. Er musste als zuständiger Staatsanwalt dabei sein.
»Alter, Geschlecht, Todeszeitpunkt – alles offen. So vom ersten Ansehen liegt sie schon Monate oder Jahre im Boden. Das Plastik ist vermutlich ein gängiger Flachbeutel aus Polyethylen. Zum Wareneinpacken.«
»Gibt’s die in der Größe?«
»Die Leiche steckt in Hockstellung in dem Beutel. Ich hab das mal gecheckt …« Mike zückte sein Handy, rief eine Internetseite mit einer Tabelle auf und scrollte sie nach unten. »Bei dem Internethändler hier«, er deutete auf das Display, »gibt es sie bis achtzig mal eins sechzig. Die Dicke beträgt hundert Mikrometer, also ein Zehntelmillimeter. Das ist ziemlich robust.«
»Ist in der Gegend jemand verschwunden?«, fragte Tischler.
»Hier im Landkreis in den letzten Jahren nicht. Also keiner, der infrage kommt. Wir werden das natürlich bundesweit recherchieren. Aber dazu müssen wir erst mal wissen, ob es sich um Mann oder Frau handelt. Und wenn wir das Alter eingrenzen könnten, wär’s auch nicht schlecht.«
»Also Obduktion abwarten«, sagte Tischler genervt.
»Auf einen Tag kommt’s auch nicht mehr an«, mischte sich Wallner in das Gespräch.
»Aber es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben, wer das sein kann.« Tischlers Stimme hatte jetzt vollends diesen nölig-quäkigen Klang, den sie alle kannten. »Man vergräbt doch nicht einfach jemanden, ohne dass es irgendwelche Spuren gibt.«
»Wenn Sie eine Idee haben, lassen Sie es uns wissen.«
Hatte Tischler offenbar nicht. »Und was soll ich der Presse erzählen?«
»Dass wir nicht den Hauch einer Ahnung haben.« Wallner lächelte und legte seine Hand auf Tischlers Arm. »Das macht die Sache geheimnisvoll und spannend.«
Dieser Gedanke wiederum schien Tischler zu gefallen. Chefermittler im Fall der geheimnisvollen Kapellen-Leiche – damit konnte man arbeiten.
»Na gut. Dann halten Sie mich auf dem Laufenden.« Tischler nahm seine Wachsjacke und den Attachékoffer.
»Sie wollen nicht dem Auspacken der Leiche beiwohnen?«
Das war ein Scherz. Man würde die Leiche im Plastiksack in die Gerichtsmedizin bringen, um sie möglichst wenig zu kontaminieren. Tischler lächelte angeödet und strebte nach draußen. Hier war für ihn im Augenblick nichts zu tun. Allgemeine Erleichterung machte sich breit.
Wallner wandte sich wieder Kreuthner zu und deutete aus dem Fenster in Richtung der Kapelle.
»Was ich mich frage: Warum vergräbt man dort eine Leiche? Ist doch ziemlich riskant.«
Mike nahm jetzt am Tisch Platz und hörte zu.
»Du meinst, weil man’s von hier aus sehen kann?« Kreuthner schob den Unterkiefer vor und starrte jetzt ebenfalls aus dem Fenster zur Kapelle.
»Hier im Mangfalltal gibt es viele Orte, wo einen garantiert keiner beim Vergraben stört. Wieso hier neben einer gut besuchten Gastwirtschaft?«
»Vielleicht war’s dem Täter wichtig, dass die Leiche hier liegt.«
»Ein Ritual wie bei einem Serienmörder?«
Kreuthner zuckte mit den Schultern. »Wir sollten mal die anderen Kapellen im Landkreis checken. Wer weiß.«
»Es gibt Hunderte von Kapellen im Landkreis«, gab Wallner zu bedenken. »Hast du eine weniger aufwendige Idee?«
Kreuthner schwieg. Auch Mike hatte keine Eingebung.
»Vielleicht wurde das Opfer hier in der Wirtschaft umgebracht«, setzte Wallner selbst das Brainstorming fort, »und das war einfach der nächstbeste Ort zum Vergraben.« Er sah Kreuthner mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Kreuthner war gut vernetzt und wusste Dinge, die Wallner nicht wusste und zum Teil auch nicht wissen wollte. Vielleicht hatte die Leiche ja wirklich mit dem Wirtshaus zu tun oder mit dessen Gästen. An krimineller Energie herrschte in der Mangfallmühle kein Mangel.
»Also, in den letzten Jahren ist mir hier herinnen kein Mord aufgefallen, wennst des meinst«, sagte Kreuthner.
»Ist irgendein Stammgast auf einmal nicht mehr gekommen?«
»Andauernd. Aber dann is er entweder eing’fahren oder vor der Polizei abg’haut.«
»Gab’s mal Streit zwischen Gästen?«
»Streit zwischen den Gästen …?« Kreuthner lachte tonlos und schüttelte den Kopf. »Check lieber die Kapellen im Landkreis. Da hast weniger Arbeit.«
Wallner verschränkte die Hände hinter dem Kopf und starrte die Wand an, während Kreuthner den Rand des Bierglases mit dem Daumen abwischte und den Schaum betrachtete. Schließlich sagte er: »Im Sommer war’s hier a Zeit lang totenstill. Vielleicht is die Leiche da begraben worden.«
»Wieso? Was war da los?«
Kreuthner nahm noch einen Schluck, bevor er antwortete.
4
Miesbach, Juli 2018
Setz dich«, sagte Polizeihauptkommissar Dieter Höhnbichler, der Chef der Schutzpolizei im Landkreis, und deutete auf einen Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch. Kreuthner nahm missmutig Platz. Er wusste bereits, dass sein Kollege Greiner ihn angeschwärzt hatte.
»Der Greiner will mir nur eine reinwürgen. Der hat einfach was gegen mich.«
Greiner und Kreuthner verband seit Längerem eine innige Feindschaft. Höhnbichler wusste das.
»Dann ist da also nichts dran an dem, was er behauptet?«
»Was behauptet er?«
Höhnbichler öffnete einen Aktendeckel, der nur ein dünnes Schriftstück enthielt, und beugte sich darüber.
»Vorletzte Nacht gegen 2.20 Uhr seid ihr am Wirtshaus Zur Mangfallmühle vorbeigefahren. Ist das richtig?«
Kreuthner nickte.
»In diesem Moment trat jemand aus dem Wirtshaus, den ihr als Harry Lintinger, den Wirt der Mangfallmühle, identifiziert habt. Korrekt?«
»Er hat die Wirtschaft abgeschlossen und war grad am Gehen.«
»Gut. Dann sind wir so weit d’accord. Dem Greiner ist dann aufgefallen, dass Lintinger angetrunken wirkte und seinen Pkw in Betrieb nehmen wollte. Als sich Lintinger in den Wagen gesetzt und diesen angelassen hatte, schlug der Greiner vor, den Lintinger einer Alkoholkontrolle zu unterziehen. Das hast du verweigert. Stimmt das?«
»Stimmt.«
»Welche Gründe gab’s dafür?«
»Ich hab keine Anzeichen von Alkoholisierung sehen können. Und ohne konkreten Verdacht dürfen mir keine Kontrolle durchführen.«
»Na ja …« Höhnbichler blickte durch seine Lesebrille in die vor ihm liegende Akte. »Ich zitiere: Der Verdächtige torkelte auf dem Weg zu seinem Fahrzeug und schlug auf halber Strecke lang hin. Um den Wagen aufzusperren, brauchte er eine halbe Minute und musste sich zwischendurch übergeben.«
»Es ist bekannt, dass der Lintinger einen empfindlichen Magen hat. Des is völlig normal, dass der speien muss. Und … ja mei, kann sein, dass er mal g’stolpert is auf dem Weg zum Wagen. Der Parkplatz vor der Wirtschaft ist ganz schlecht beleuchtet.«
Höhnbichler klappte die Akte zu und lehnte sich in seinen Bürosessel zurück.
»So, Leo. Jetzt pass amal auf: Wir wissen beide, dass du fast jeden Tag in der Mangfallmühle bist. Der Lintinger ist ein alter Spezl von dir. Und wenn die Gerüchte stimmen, die ich natürlich nicht glaube, solange nichts bewiesen ist, dann verkaufst du ihm auch noch selbst gebrannten Schnaps.«
»Ich? Schnaps?« Kreuthner wirkte ernsthaft entsetzt und fragte sich, wer ihn da bei Höhnbichler hingehängt hatte.
»Wie auch immer. Du bist ein erfahrener Polizist und machst einen ganz ordentlichen Job. Dass du Leut kennst, wo der Ruf vielleicht nicht ganz makellos ist – okay. Wir leben auf dem Land. Da kann man das nicht immer sauber trennen. Aber eins, und das sage ich dir ganz deutlich, eins geht gar nicht: Strafvereitelung im Amt. Du musst dich entscheiden: Gehörst zu uns oder zu denen. Wenn so was noch mal vorkommt, bist du raus. Ist das klar?«