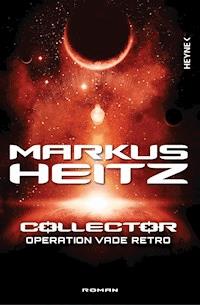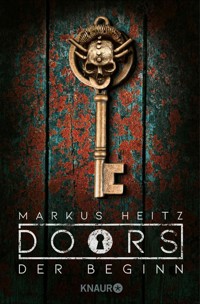Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters." Diese Nachricht hinterlässt ein Serienmörder an sorgfältig inszenierten Tatorten, die Todesbildern nachempfunden sind: alte Gemälde, moderne Fotografien oder Bilder aus dem Internet. Anfangs glauben die Ermittler noch, die Hinweise wären am Tatort versteckt oder es gäbe einen Zusammenhang zwischen den Vorlagen und den Opfern. Doch dann machen sie eine grausige Entdeckung: Auf den Vorlagen erhöht sich die Zahl der abgebildeten Toten - aber da ist noch mehr: Die Spuren für die Ermittler sind an einem besonderen Ort vom Täter verborgen worden …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Heitz
Totenblick
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters.« Diese Nachricht hinterlässt ein Serienmörder an sorgfältig inszenierten Tatorten: Gemälden, modernen Fotografien oder Bildern aus dem Internet nachempfunden, die alle eine Todessituation darstellen, inszeniert der Täter echte Repliken – mit genau drapierten Toten und dem Hinweis auf den Totenblick auf einem Zettel.
Anfangs glaubt Kommissar Peter Rhode noch, die Hinweise wären am Tatort versteckt oder dass es einen Zusammenhang zwischen den Vorlagen und den Opfern gibt. Doch dann fallen dem Totenblick mehr und mehr seiner Kollegen zum Opfer, und auf den Vorlagen erhöht sich die Zahl der abgebildeten Toten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, es wird immer dringlicher, die Hinweise, von denen der Täter bei jedem Mord spricht, zu finden. Aber diese sind an einem besonderen Ort vom Täter verborgen worden …
Inhaltsübersicht
Fiktionshinweis
Un-Fiktionshinweis
Semi-Fiktionshinweis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Nachwort
Fiktionshinweis
Sämtliche in dem Roman vorkommenden Figuren sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Sollte sich jemand darin wiedererkennen, hat er eine sehr lebhafte Phantasie und kann sich darob geschmeichelt fühlen.
Auch die Handlung ist konstruiert und basiert nicht auf realen Geschehnissen oder konkreten Vorlagen aus der Gegenwart/Vergangenheit.
Die Zukunft kann ich leider nicht ausschließen, aber ich hoffe, dass die im Roman beschriebenen Dinge niemals geschehen werden.
Vor allem Vampire gibt es nicht. Aber die kommen auch nicht drin vor.
Und wenn doch, sind sie nicht real, sondern frei erfunden, wie schon gesagt.
Aber den Tod, den gibt es, und er kommt im Roman mehrfach vor. Ebenso wie Bestatter. Und ein Bestatter erscheint ebenso, aber der ist wiederum als Figur frei erfunden, wie schon gesagt.
Un-Fiktionshinweis
Manche Straßen, Musikgruppen und sonstige Zutaten gibt es dann doch wirklich. Und dann ist es volle Absicht.
Ach ja, die Stadt Leipzig existiert selbstverständlich.
Und sie ist faszinierend, lebendig und voller Abwechslung!
Semi-Fiktionshinweis
Manche Straßen mögen zum Zeitpunkt des Lesens bereits anders aussehen, sich gewandelt haben.
Bitte nicht wundern: Das sind keine Fehler. Das ist die allgegenwärtige Veränderung.
Das geht in der schönen Stadt sehr rasch, wie zum Beispiel in der Hainstraße: Eben im Bereich Richtung Hauptbahnhof noch eine Brache, dann buddelten während der Schreibphase die Archäologen, und bald wird sich die Hainspitze auf dem Areal nach vorne in Richtung Brühl schieben.
Oder hat sie es vielleicht schon längst getan?
Ich wünsche mir und auch den Bewohnern, dass sich Leipzig seinen speziellen, ganz besonderen Charme erhält, allen Neubauten zum Trotz.
Prolog
Armin Wolke kam über die kopfsteingepflasterte Ausfahrt des Werk II gestolpert.
Im Kopf dröhnten die letzten Töne der Zugabe von Solitary Experiments und jede Menge Promille, die er sich über die Bierchen in den vergangenen Stunden akribisch zugeführt hatte. »Da leck mich doch am …«, murmelte er und musste sich an der rauhen Backsteinwand abstützen; die letzten Reste einer vertrockneten Kletterpflanze lösten sich unter der Berührung und rieselten raschelnd zu Boden.
»Alles klar?«, sagte eine junge Frau im Vorbeigehen.
»Schon gut«, antwortete er, atmete tief ein und rülpste. Bier, Kohlensäure, ganz unschick, gerade im Dialog mit hübschen unbekannten Damen. Da Armin prinzipiell nie Gehörschutz benutzte, weil er ihn als Sounddiaphragma ablehnte, hörte er alles dumpfer. Ein leichtes Piepsen im rechten Ohr warnte ihn davor, sich morgen wieder 120 Dezibel zu geben. Konnte er auch nicht. Da befand er sich in einer anderen musikalischen Welt, ganz ohne dröhnende Bässe und Synthesizer. »Geht gleich wieder.«
»Kenn dein Limit«, erwiderte sie lächelnd und folgte ihren Begleiterinnen.
Kleine Klugscheißerin, dachte Armin grinsend und verließ leicht schwankend das Veranstaltungsgelände, das im 19. Jahrhundert als Gasmesserfabrik errichtet worden war. Nun vereinte das Werk II als Kulturstätte verschiedene Hallen und Räumlichkeiten, in denen Konzerte, Theateraufführungen und Events stattfanden.
Armin hörte noch immer den Bass, der in seinen Ohren brummte. Solitary Experiments hatte passend zur alten Bestimmung des Bauwerks sprichwörtlich Gas gegeben. Die Electrobeats der Berlin-Leipziger Band brachten ihn und die Besucher zum Tanzen und Schwitzen. Und wie immer hatte der Schlagzeuger sich zur Freude der Mädels das rote Hemd vom tätowierten Oberkörper gerissen und mit den Sticks auf die Drums eingedroschen.
Jetzt war Armin müde und wollte nur nach Hause. Auch wenn man sich mit 26 Jahren durchaus noch jugendliche Unvernunft leisten konnte, verzichtete er lieber darauf. Sein Ausflug stellte genug Aufbegehren gegen sein sonstiges Leben dar.
Die Cargohose, das dünne schwarze EBM-Shirt mit dem silbernen Aufdruck Old School, alles klebte an ihm. Jemand hatte ihm dazu noch einen Drink übergekippt, so dass er wie ein besoffenes Gummibärchen stank. Das Gel für die nach hinten gelegten hellbraunen Haare hätte er sich sparen können.
Die Menge umströmte und überholte ihn. Alle wanderten zur Tram, um in die Innenstadt zu gelangen.
»Ja, fein«, motzte er, weil er ahnte, dass er nicht mehr in die nächste Bahn passen würde. »ÖPNV-Lemminge.«
Und es kam noch schlimmer: Aufgrund eines Unfalls, das verkündete die kleine Anzeige in orangeroter Laufschrift am Bahnsteig, waren die Linien in Richtung Hauptbahnhof vorerst lahmgelegt. Als Ersatz standen Busse mit Warnblinkanlagen auf dem Randstreifen bereit.
»Nee, ohne mich«, murmelte Armin mit einem Blick auf die Massen, die sich im Inneren zusammenquetschten. Er beschloss zu laufen, bis er an eine Haltestelle kam, die wieder angefahren wurde.
Außerdem konnte er unterwegs ein bisschen ausnüchtern. Seine Kirsche, Mendy, würde ihm sonst wortlos das Kissen aufs Sofa packen. Sie hatte ihm bereits vorher deutlich zu verstehen gegeben, dass sie den Konzertbesuch schlecht fand. Total betrunken durfte er nicht ins Schlafzimmer kommen. Die subversive Macht der Frauen.
Er lief los, vorbei an den Fronten geschlossener Geschäfte und noch geöffneter Bars und Restaurants.
Am Wochenende war in der Gegend zwar einiges los, richtig voll wurde es aber erst weiter unten in der KarLi, in der Karl-Liebknecht-Straße, wo sich die Bars und Restaurants aneinanderreihten. Da könnte er vielleicht bei einem Spätkauf noch ein Wegbier … Armin verwarf den Gedanken.
Heute war auf den Bürgersteigen der KarLi weniger Betrieb als üblich. Der kalte Wind jagte die Nachtschwärmer ins Innere der Kneipen. Die Nacht roch nach den Kippen der Raucher, die gelegentlich vor die Tür mussten, um ihrer Sucht zu frönen, und nach Essensdünsten, die aus den Abzugsschächten der Gastronomie quollen.
Die Bewegung verschaffte Armin etwas Wärme, aber er fröstelte dennoch. Sein dünner Körper kannte so etwas wie eine isolierende Fettschicht nicht. Schließlich verfiel er in leichten Laufschritt, um nicht zu sehr auszukühlen.
Dabei folgte er immer der KarLi und hoffte auf eine Tram. Taxi wollte er nicht fahren, das kostete mindestens zehn Euro. Die hatte er zwar locker, aber dafür ausgeben? Schließlich besaß er eine Monatskarte.
Das unebene Pflaster stellte seine Koordination auf eine ordentliche Probe, die er bislang gut gemeistert hatte. Inzwischen passierte Armin die Haltestelle Kurt-Eisner-Straße.
Keine Tram weit und breit.
Plötzlich trat neben ihm aus dem Schatten einer Einfahrt zwischen Dönerladen und indischem Restaurant eine dunkle, großgewachsene Gestalt. Ohne etwas zu sagen, schwang sie einen länglichen hellen Gegenstand auf Brusthöhe gegen Armin.
Instinktiv wich er aus. Zwar war seine Reaktion aufgrund des Alkohols ziemlich ungelenk, doch sie erfüllte ihren Zweck: Das abgerundete Ende des Baseballschlägers surrte dicht an ihm vorbei.
»Kohle, Handy und den teuren Krempel her«, zischte der Angreifer und hob den Baseballschläger mit beiden Händen. Das Gesicht hatte er mit einem Tuch vor Mund und Nase unkenntlich gemacht, die Kapuze seines Pullis warf einen Schatten auf Stirn und Augen. »Alles auf den Boden! Los! Oder ich hol’s mir selbst.«
Armin wusste, dass er zu benebelt war, um sich mit einem bewaffneten Räuber anzulegen. Ein Treffer mit dem Baseballschläger, und die Lichter gingen schmerzhaft aus – und noch schmerzhafter wieder an. Außerdem könnten seine Finger etwas abbekommen, und das wäre mehr als verheerend …
Doch die Promille sorgten gleichzeitig für genügend Selbstüberschätzung, um jegliches Manko auszugleichen.
»Fick dich«, schleuderte er dem Vermummten heldenhaft entgegen und nahm eine Kämpferpose ein. Nicht, dass er Erfahrung im Prügeln besaß, aber vielleicht konnte er damit Eindruck schinden.
Die abgerundete Spitze sauste dieses Mal zu schnell heran und traf ihn auf den rechten Oberarm, brachte Armin aus dem Gleichgewicht – und schon bekam er das Ende in die Magengrube. Er klappte zusammen und übergab sich.
»Idiot, echt«, beschimpfte ihn der Räuber noch dazu. »Kotzt mir auf die Schuhe.«
Der Baseballschläger traf Armin beim dritten Einschlag frontal gegen die Brust und warf ihn auf den Rücken.
Sein Hinterkopf schlug auf die Gehwegplatten, dann spürte er die tastenden Hände des Angreifers überall an sich. Von irgendwoher ertönten laute Rufe, der Überfall war von einem Passanten bemerkt worden.
»Bleib unten, wenn du keine in die Fresse bekommen willst«, wurde Armin angezischt.
Die Benommenheit mischte sich mit Übelkeit und verhinderte eine Gegenwehr. Endlich ließ der Räuber von ihm ab.
»Hey«, rief Armin schwach und stemmte sich auf die Beine. Sein Oberarm brannte wie Feuer, sein Kopf brummte, und in seinem Magen schien ein Vulkan zu brodeln. »Du Arschloch! Lass mir wenigstens die Ausweise da!« Er stand schwankend auf dem Trottoir und merkte, wie sein Kreislauf absackte.
Der Maskierte blieb stehen, kehrte zurück. »Bleib unten, habe ich gesagt!«, fauchte er und versetzte ihm einen Tritt gegen die Hüfte. »Scheiße, sei froh, dass ich dir nicht deine blöde Fresse einschlage.«
Armin wankte unter dem Treffer, versuchte sich abzufangen und torkelte dabei ungewollt quer über die Straße, bevor er neben dem Markierungsstreifen auf die Knie fiel; in seinen Ohren hallten die Schritte des Räubers, der sich rasch entfernte.
Autos hupten und wichen aufblendend aus, ihre Scheinwerfer verdoppelten und verzerrten sich wie fette Sterne mit Gloriolen.
Armin kroch benommen über den feuchtkalten Asphalt, stand auf, strauchelte und ging erneut zu Boden. Er schaffte es, nicht angefahren zu werden, und konnte plötzlich nachvollziehen, wie sich ein Torero fühlte. Seine Stiere hatten Motorhauben und Kühlergrills, auf denen er landen würde, sollte er patzen.
Das Adrenalin verjagte den Alkohol aus seinem Blut; zumindest überlagerte es die Auswirkungen für einige sehr wache, lebensrettende Sekunden: Mit einer Schulterrolle rettete er sich vor heranwalzenden breiten Reifen und einem fast schon geschliffen wirkenden Frontspoiler – um sich auf den Gleisen wiederzufinden. In Sicherheit.
Da schrillte eine Tramglocke grell und anhaltend: Die Strecke war wieder in Betrieb genommen!
Armin hob resignierend den Kopf und starrte in die heranrasenden Scheinwerfer, unter denen rechts und links Funken stoben.
Er konnte sich nicht bewegen; seine bleischweren Glieder pinnten ihn. Der Fahrer versuchte eine Notbremsung, doch sie würde nicht ausreichen, um seinen dröhnenden Schädel vor einer Kollision mit der wesentlich härteren Wagenvorderseite zu bewahren.
»Junge, komm da weg!«, schrie ihm jemand mit starkem sächsischem Akzent ins Ohr, dann wurde Armin an den Schultern gepackt und derart professionell zur Seite gezogen, als hätte die Person das Gleiche schon hundertmal gemacht.
Die Tram rauschte zentimeterdicht an seinen Schuhspitzen vorbei und erfüllte die Luft mit dem Geruch von heißem Stahl; es kreischte laut und anhaltend. Heiß prasselten die glühenden Funken gegen Armin, brannten auf seiner Haut.
Keuchend versuchte er, sich zu erheben. Der Mann, der ihn von den Schienen gezogen hatte, stützte ihn. »Scheiße«, flüsterte er unentwegt, dabei zitterte er vor Kälte und Schock.
»Ruhig«, sagte der Mann beschwichtigend. »Ruhig.«
Die Tram war inzwischen zum Stehen gekommen, und ein tobender Fahrer sprang aus der Kabine und rannte auf sie zu. Schaulustige an der Haltestelle hielten ihre Handys hoch und filmten oder schossen Aufnahmen. »Hey, du!«, rief er wütend. »Freundchen, das wird teuer. Deinen Ausweis. Sofort!«
Armin war schlecht, die Sicht blieb leicht verschwommen. »Geklaut«, bekam er mühsam heraus und deutete auf die andere Straßenseite. »Gerade eben.«
»Die Scheiße kannste vergessen!«, schrie ihn der Fahrer an und baute sich drohend vor ihm auf. »Besoffener Depp! Her mit deinen …«
»Nur die Ruhe, Herr …«, schritt der Lebensretter ein und las vom Namensschildchen ab, »… Müller. Er kann nichts dafür. Ich habe gesehen, wie er von einem Vermummten einen Tritt bekam. Das war der Auslöser für den Unfall. Der junge Mann kann froh sein, dass er noch lebt.«
»Aha.« Der Fahrer funkelte dennoch aufgebracht mit den Augen. »Trotzdem nicht abhauen. Polizei und Rettungswagen sind unterwegs. Ich habe wegen der Zirkusvorstellung zwei Verletzte in meiner Tram.« Dann wandte er sich wieder um und kehrte zum Gefährt zurück.
»Eine Entschuldigung von Herrn Müller wäre schön gewesen.« Armins Lebensretter schüttelte den Kopf und blickte ihn aus warmen, braunen Augen an, die von einer schwarzen Hornbrille eingerahmt wurden. »Ich verstehe ja, dass er aufgeregt ist, aber …«
Armin übergab sich ein zweites Mal, diesmal aus mehreren Gründen: vom Laufen, von den Treffern mit dem Baseballschläger, vom Alkohol, vor Aufregung und vor Angst, fast unter eine Tram geraten zu sein.
Auch diese unrühmliche Szene wurde sicherlich von Handys festgehalten und stand bald in einem tollen sozialen Netzwerk. Sein Vater würde toben, wenn sich herumsprach, wie er sich in der Öffentlichkeit zum Trottel machte. Am liebsten würde er losheulen, vor Erleichterung und vor Scham. Das Schluchzen tarnte er mit einem Husten.
Armin spuckte aus, wischte heimlich die Tränen von den Wangen und setzte sich. »Danke«, murmelte er unverständlich und sah seinen Retter an.
Er schätzte den Mann auf knapp 60. Er war groß und normal gebaut, trug die silberschwarzen Haare kurz geschnitten. Ein leichter roter Kratzer zog sich vom Kinn abwärts, eine alte Narbe war an der linken Stirn erkennbar. »Ich bin Armin.« Er streckte ihm die Hand hin.
»Lui. Eigentlich Ludwig, aber die meisten nennen mich Lui.« Er lächelte. »Keine Sorge. Das wird schon wieder. Ich kann der Polizei sagen, was ich gesehen habe und dass du nicht freiwillig zwischen den Autos herumgekrochen bist.« Er nahm eine Zigarettenpackung aus der Jackentasche und hielt sie ihm hin. Seine Kleidung war leger wie seine Sprechweise: dunkle Stoffhose, darüber ein offenes weißes Hemd; eine kurze Lederjacke schützte ihn vor der Kühle.
»Nee, danke. Nichtraucher.«
»Sehr gut.« Ludwig steckte sich eine an.
Polizei und Krankenwagen rückten an, die Strecke wurde natürlich wieder gesperrt. Armin machte seine Aussage, so gut er konnte. Das Zittern wollte nicht aufhören, trotz der folienartigen Rettungsdecke, die ihm ein Beamter umgelegt hatte. Ludwig bestätigte stark sächselnd die Ausführungen. Die Frage, ob man seinen Vater benachrichtigen sollte, verneinte Armin. Das würde noch fehlen.
Nach einer Anzeige gegen unbekannt wegen Körperverletzung und dem Rattenschwanz von Forderungen der Leipziger Verkehrsbetriebe sowie einer Inaugenscheinnahme durch die Sanis wurde er von den Gesetzeshütern entlassen. Tramfahrer Müller entschuldigte sich nach wie vor nicht für sein ruppiges Auftreten.
Ludwig bot an, den aufgelösten jungen Mann nach Hause zu fahren, und nervte unterwegs nicht mit tiefsinnigen Gesprächsversuchen oder Beruhigungs-Smalltalk.
In der Katharinenstraße stieg Armin aus und schlich sich durch den Hof in die geräumige Altbauwohnung. Mittlerweile tat ihm alles weh, vom Kopf bis zu den Füßen, doch das Beben der Gliedmaßen hatte aufgehört.
Auf dem Sofa lag bereits sein Kopfkissen – eine Anklage aus Polyesterfüllung und Baumwollbezug. Mendy wollte ihn nicht neben sich liegen haben. Bestimmt ging sie davon aus, dass er voll wie eine Haubitze vom Konzert zurückkehrte.
Zuerst spielte Armin mit dem Gedanken, sich dennoch ins Schlafzimmer zu schleichen, um seinen geschundenen Körper auf dem weichen Bett auszustrecken. Doch dann müsste er ihr erzählen, was alles geschehen war, und das würde Zeit in Anspruch nehmen. Dabei brauchte er jetzt einfach ein paar Stunden Ruhe. Dringend.
Scheißabend, dachte er, faltete die Decke auseinander und schlüpfte darunter, um ein bisschen das Gefühl von Geborgenheit zu bekommen, wenn sich schon seine Freundin verweigerte.
Als er sich hinlegte, kam ihm der erschreckende Gedanke, dass der Räuber nun wusste, wo er wohnte. Dank des gestohlenen Ausweises und der Papiere.
Und dass der Typ leicht nachvollziehen konnte, wessen Sohn Armin Wolke war.
Trotz der unschönen Erkenntnis döste er ein.
Am nächsten Morgen lag ein Zettel auf dem Beistelltischchen. Von Mendy.
Sie riet ihm, die Wohnung zu putzen, wie es vereinbart gewesen war. Sie käme gegen 16 Uhr zurück, und danach würde sie kochen. Russisch.
Eine Art Friedensangebot an ihn, das wusste er. Ihr tat es leid, dass sie ihn mal wieder aus dem Schlafzimmer verbannt hatte. Das Übliche zwischen den beiden.
Seufzend stemmte er seinen dünnen Körper von der Couch; wenigstens spürte er keinen Kater. Das Kotzen hatte verhindert, dass zu viel Alkohol in seinem Blut geblieben war, um für die hässlichen Nachwehen von übermäßigem Bierkonsum zu sorgen. Das einzig Gute der letzten Nacht!
Armin schleppte sich unter die Dusche, vorbei an dem blinkenden Festnetztelefon, auf dem der AB ihm drei neue Nachrichten zum Abhören anpries. Sicherlich sein Vater, der wissen wollte, was er auf einem EBM-Konzert zu suchen hatte, obwohl er heute Abend ein Klavierkonzert im Gewandhaus geben sollte. Chopin.
Es war nicht leicht, der erfolgreiche Spross eines noch erfolgreicheren Ex-Konzertpianisten und Intendanten der Leipziger Oper zu sein.
Ginge es nach seinem Erzeuger, würde Armin den Rest des Lebens in einer Schutzhülle verbringen, wo ihm und vor allem seinen Händen nichts geschehen konnte.
Der extrem erfolgreiche chinesische Pianist Lang-Lang hatte seine Finger für siebzig Millionen Euro versichern lassen.
Von dessen Virtuosität und einer ähnlich hohen Summe war Armin noch weit entfernt, aber hätte ihm der Baseballschläger einen Knochen gebrochen oder seine Hände schwer getroffen, hätte er ein echtes Problem. Karrierepause oder sogar Karriereende. Und das wegen nicht mal hundert Euro, einer mittelmäßigen Uhr und eines Smartphones.
Er duschte ausgiebig, spülte den penetranten Gummibärchengeruch ab und schlüpfte in eine frische Unterhose. Nach dem Frühstück sah die Welt bestimmt besser aus. Rauchen, nein. Kaffee, ja bitte. Stark und schwarz und viel.
In dem großen Spiegel begutachtete er die vielen blauen Flecken, die von den Attacken und seinen Stunts herrührten, tastete die Beule an seinem Hinterkopf ab. Chopin würde unter den Folgen des Überfalls leiden und in der Tat etwas holpriger klingen.
Er fand es schade, dass er Ludwig nicht nach seiner Adresse gefragt hatte, um ihm vielleicht eine Eintrittskarte zukommen zu lassen. Als Dankeschön. Die Polizei müsste seine Adresse aufgenommen haben.
Armin lief durch die stuckverzierte Altbauwohnung zurück zum Telefon. Er musste die Banken anrufen, um die Karten sperren zu lassen, was er schon früher hätte tun sollen. Aber gestern ging gar nichts mehr.
Schon von weitem hörte er das Läuten. Sein Vater versuchte wieder, ihn zu erreichen.
Er bog um die Ecke, schlenderte an der Küche vorbei – und sah einen Arm, der sich blitzschnell aus dem Durchgang nach ihm streckte; behandschuhte Finger, die einen Elektroschocker hielten; blanke Kontakte, die von knisternder, bläulicher Elektrizität umspielt wurden und auf ihn zustießen. Er fühlte die Berührung auf der nackten Brust.
Dann jagte ein Stromschlag durch seinen Körper, kontrahierte die Muskeln nach Belieben und ließ Armin mit einem Stöhnen auf das alte Parkett stürzen.
Für Sekunden sah er nur grelles Licht und spürte ein schmerzhaftes Nachkribbeln in jeder Zelle. Ein elektrischer Baseballschläger.
Er rang nach Luft und konnte sich nicht rühren, sosehr er sich auch bemühte. Gezwungenermaßen sah er auf die feinen Rillen im Holz und atmete den schwachen Geruch des Pflegemittels ein.
Unregelmäßige Schritte näherten sich Armin, er hörte ein leises Lachen. »Na, Goldjunge?«, raunte jemand.
Das Piepsen des AB ertönte.
»Hier ist dein Vater, Armin. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Ich habe schon mit Mendy telefoniert. Nimm den Hörer ab! Ich muss mit dir …«, vernahm er die gereizt-vorwurfsvolle Stimme, in der wie immer sehr viel Druck lag.
»Soll ich deinem Vater was von dir ausrichten?«, fragte der Unbekannte spöttisch und übertönte die aufgeregt hinterlassene Nachricht, die aus der Box drang.
Goldjunge.
Der Räuber von gestern Nacht hatte erkannt, dass es Lukrativeres gab als knapp hundert Euro, eine mäßig teure Uhr und ein Smartphone: Lösegeld.
Armin bekam die Zähne nicht auseinander, obwohl er den Typen gerne angeschrien hätte, er solle verschwinden.
»Keine Vorschläge? Dann lasse ich mir was einfallen.«
Es knisterte ankündigend, dann folgte der Einschlag des Blitzes.
Kapitel 1
Ich finde es hier unheimlich.« Karo sah ihre jüngere Halbschwester an, sie musste sich dafür ein bisschen nach unten beugen. Wenn man nicht hinschaute, konnte auch nichts passieren, so lautete ihre Devise. Sie hielt zwei Plastiktüten mit Einkäufen in den Händen und stellte sie für einen Moment ab.
Das unterste Deck der Tiefgarage war schwülwarm und roch nach alten Abgasen und Reifenabrieb. Irgendwo in einer Abteilung über ihnen fuhr ein Wagen eine Rampe hinauf, es rappelte und schepperte metallisch und hallte noch lange nach zwischen den grauen, rissigen Betonwänden und Pfeilern.
Elisa grinste frech und wackelte mit dem blonden Schopf, so dass die Zöpfe wippten. »Pech gehabt«, sagte sie fröhlich und aufgekratzt. »Jetzt komm!« Das zehnjährige Mädchen lief los, quer durch das verlassene, halbdunkle Parkhaus. »Wir sollen zum Kassenautomaten kommen, hat Papa gesagt.«
»Warte, verdammt!« Karo nahm die Tüten auf und eilte ihr nach. Die Sohlen der Turnschuhe quietschten leise auf dem Boden und gaben komische Geräusche von sich, sobald sie über farbige Markierungen hastete.
Die Vierzehnjährige sah die hellen Haare ihrer Halbschwester im schummrigen Licht leuchten; nicht alle Lampen funktionierten, wie sie sollten. Sie kam sich wie in einem Krimi vor. Und der Kassenautomat war sehr, sehr weit entfernt. Auch wie in einem Krimi oder Horrorstreifen.
Elisa schien das alles nichts auszumachen. Sie hüpfte, spähte in jede dunkle Ecke, als wollte sie Phantome herauslocken, die dort möglicherweise lauerten. In ihrem Kleid erinnerte sie an ein modernes Rotkäppchen, das durch eine zeitgemäße Adaption des Märchens streifte.
Karo dagegen versuchte, in ihrem Top-Rock-Strumpfhose-Mantel-Outfit erwachsener zu erscheinen. Ihre Mutter hatte sie vor kurzem mit einem kritischen Blick bedacht und etwas wie »zu hübsch« gemurmelt; anschließend erfolgte ein Gespräch über Sex und Verhütung.
Die Einkäufe waren schwer, die dünnen Griffe schnitten in ihre Handflächen.
»Elisa, warte!« Karo schüttelte den Kopf und musste die Tüten wieder kurz abstellen. »Du könntest mir helfen!«
Ihre Halbschwester winkte ihr nur ausgelassen zu und verschwand hinter einem Smart. »So einen hat Papa auch«, kam ihre hohe Kinderstimme wie aus dem Off.
»Ja, und es sieht scheiße aus, wenn er drinsitzt«, rief Karo zurück. »Jetzt komm her!«
Dass es scheiße aussah, lag weniger an dem Modell, sondern eher daran, dass ihr Vater zwei Meter groß war, ein wahrer Hüne, mit Muskeln und Bäuchlein, aber unglaublich fit.
Ihre Mutter sagte, dass er ohne den Musketierbart wie eine Mischung aus Bruce Willis und Kurt Russell aussehen würde. Karo hatte Kurt Russell erst mal googeln müssen. Elisas Mutter teilte die Meinung nicht ganz, sondern verglich ihn eher mit Viggo Mortensen aus dem Film Hidalgo. Auch den hatte Karo im Netz prüfen müssen.
Sie selbst fand: Ihr Vater wurde nichts von dem gerecht, wohl aber war er ein echtes Original und kein austauschbarer Mensch. Das begann schon mit seinem ersten Vornamen. Karo kannte niemanden, der Ares hieß. Diese Haltung, nicht dem ausgetrampelten Weg zu folgen, weil ihn alle gingen, gab er an seine Töchter weiter, und beides machte Karo stolz. Es gab genug langweilige, angepasste Menschen.
Weniger stolz dagegen war sie auf Elisa.
Warum auch?
Wegen deren Mutter hatte Papa sie verlassen, und das kotzte Karo mächtig an. Selbst nach so vielen Jahren. Dass Papa sich wiederum von ihr und Elisa trennte, bedeutete eine tröstliche Genugtuung.
Sie und Elisa mochten sich nicht, doch die Halbgeschwisterbeziehung und das Einschreiten des Vaters verhinderten meistens Schlimmeres. Papa bestand auf Familientreffen. Ein Harmoniesuchti, wie Mutter ihn nannte.
Aber mit Elisa allein durch ein so gut wie leeres Parkhaus zu laufen, das stellte eine harte Belastung dar.
Ihre Halbschwester tauchte neben dem Smart wieder auf und steuerte auf einen silberfarbenen Van zu. »Oh, das ist toll! Siehst du die Felgen! Mann, sind die groß!«
»Ich habe die Schnauze voll!«, rief Karo wütend. »Wenn du …«
Die Schiebetür des Vans wurde ruckartig geöffnet, und eine schlanke, maskierte Frauengestalt sprang heraus. Sie streckte sich, langte nach der überrascht aufquiekenden Elisa.
Karo wurde kalt vor Schreck. Sie wollte loslaufen, doch sie konnte sich nicht bewegen.
Dafür war Elisa umso beherzter. Sie schlug die Hand zur Seite, hob den Fuß und ließ die Ferse mit voller Wucht auf den Spann der Angreiferin niederschießen. Ihr nächster Tritt ging gegen das Knie, dabei schrie sie ganz laut um Hilfe.
Die Maskierte fluchte und bekam einen Zopf zu packen.
Elisa schrie und trat weiter. Die Schuhkanten hagelten nur so gegen die Knie und in den Schritt der Vermummten, dann setzte sie einen Schwinger gegen den Magen und die Körpermitte.
Daraufhin ließ die Maskierte stöhnend von ihr ab und sank in den Van.
Elisa drehte sich sofort um und rannte los in Richtung beleuchteten Gang, wo der Kassenautomat stand.
»Warte!« Karo folgte ihr und ließ die Einkäufe zurück. Sie fand es bewundernswert, wie gut und schnell ihre Halbschwester reagiert hatte.
»Danke fürs Helfen, blöde Kuh!«, rief sie über die Schulter und durchquerte eine dunkle Parzelle, bevor sie in den Gang trat und sich keuchend gegen die Wand lehnte. Sie hatte das Ziel fast erreicht. »Das merke ich mir!«
Karo bemerkte den Angreifer, der sich hinter einer Säule hervorschwang, zu spät.
Sie kreischte schrill auf und versuchte, Abstand zu gewinnen. Ihre Gedanken rasten. Sie überlegte, was sie gegen den Mann machen konnte. Das Wissen war da, aber die Panik lähmte sie.
Er kam auf sie zu, das Gesicht unter einer weißen Eishockeymaske verborgen, und die prankengroßen Hände näherten sich ihr. Ihr persönlicher Horrorfilm hatte begonnen.
»In die Eier! Tritt ihm in die Eier«, rief Elisa aufgeregt.
Karo sah den Koloss vor sich aufragen. »Weiß ich auch!« Sie ließ ihn näher kommen und trat ihm in den Schritt.
Aber er wehrte den halbherzigen Versuch ab und packte sie an der Schulter, zog sie zu sich. »Meiner Freundin seid ihr entkommen, aber mir nicht!«, rief er.
Karo zog das Knie hoch, und dieses Mal konnte er nichts dagegen machen. Er schnaufte. Dann verpasste sie ihm einen geraden Schlag mit dem Handballen gegen die Maske, wo sie ungefähr die Nase vermutete. Normalerweise wäre sie nun auf die Augen des Mannes losgegangen, aber der Gesichtsschutz verhinderte das.
»Na? Was machst du jetzt?« Er blockte ihren Doppelangriff gegen seine Ohren und stieß sie um. »Jetzt bist du fällig!« Er beugte sich über sie.
Karo prallte mit dem Hintern auf den Beton. Sie keuchte vor Schmerzen und Angst, aber sie hakte den Fuß schnell in seiner Kniekehle ein, mit dem anderen schob sie von vorne gegen den Oberschenkel und brachte den Gegner zu Fall.
Sie blieb liegen, drehte sich in eine bessere Position und attackierte seinen Oberkörper mit einer Serie aus Fersentritten, die ihm die Luft aus der Lunge jagte.
Als sie zum Abschluss auf den Hals zielte, fing er ihr Bein ab. »Es reicht«, sagte er gepresst.
Elisa war plötzlich da, machte einen großen Satz und hüpfte dem Mann mit beiden Füßen und dem lauten Schrei »In die Eier!« auf den Schritt.
Jedenfalls hatte sie darauf gezielt.
Doch er schaffte das Kunststück, den Unterkörper zur Seite zu drehen, so dass ein Kinderfuß auf den Boden, der andere auf seine Hüfte prallte. »Ich habe gesagt, es reicht!«
Elisa balancierte und hielt das Gleichgewicht. »Och, Papa!«, maulte sie. »Das hätte dir echt weh getan.«
»Ich weiß«, knurrte er und ließ Karos Bein los, um sich die Maske abzuziehen. Darunter kamen sein runder Glatzkopf sowie sein Musketierbart zum Vorschein. Die Nase hatte sich vom Schlag leicht gerötet. Ein Teil der Kraft war auf sein Gesicht übertragen worden.
Karo erhob sich, er half ihr dabei. »Das war voll gemein«, beschwerte sie sich. »Elisa hast du nicht so hart rangenommen wie mich.«
Er lachte und strich ihr über den dunklen Schopf, was sie gleichzeitig schön fand und nervte. Sie war kein kleines Mädchen mehr wie ihre Halbschwester. »Na ja, so sehr geschont ist sie nicht worden. Sie hat sich nur schneller gewehrt als du.« Er sah zum Van. »Dolores?«
»Das werden riesige blaue Flecken«, rief sie zurück; sie saß auf der Einstiegskante, eine Hand auf den Unterleib gelegt. Die Maske hatte sie ebenfalls abgezogen, die brünetten Haare fielen bis auf Höhe der unteren Rippe. »Elisa, du bist eine Teufelin, weißt du das?«
»Ja, das sagt Mama auch immer!«, jubelte sie und tanzte um ihren Vater. »Haben wir bestanden?«
»Klar haben wir«, zischte Karo und wischte sich den Schmutz vom Hintern. »Noch mal mache ich das nicht mit.« Dabei war sie froh, den Kursus bei ihrem Vater belegt zu haben. Es gab ihr Sicherheit, und sie wusste jetzt, was sie gegen einen Angreifer tun konnte. Und dass ihr Vater sich nicht zurückgenommen hatte, fand sie im Nachhinein gut. Das würde ein echter Vergewaltiger auch nicht. Jetzt musste sie nur noch ihre Schreckhaftigkeit in den Griff bekommen. Das Problem kannte ihre Halbschwester beneidenswerterweise nicht.
Er sah seine beiden Töchter der Reihe nach an, reichte jeder die Hand, wobei er sagte: »Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Wir sehen uns in einem halben Jahr zum Auffrischungslehrgang.«
»Oh, nee.« Karo stieß die Luft aus und verdrehte die Augen.
Elisa dagegen freute sich und umarmte ihn. »Aber dann treffe ich dich richtig, Papa!«
»Ich tue mir jetzt schon leid.« Sein Handy klingelte. Er kramte es aus der Beintasche und nahm den Anruf entgegen, entfernte sich dabei ein paar Meter von ihnen.
»Ich war besser als du«, flüsterte Elisa grinsend und rempelte Karo in die Seite.
»Mir doch egal«, gab Karo zurück. Sie erinnerte sich an die Einkaufstüten, in denen nichts als Gewichte gewesen waren. Karo sah, wie Dolores sie bereits in den Van lud. Sie hatte eine sehr sportliche Figur und kaum Oberweite für ihre 20 Jahre, aber ein schönes Gesicht, das von den langen dunkelbraunen Haaren perfekt betont wurde. Karo hoffte, später auch mal so gut auszusehen, allerdings mit größeren Brüsten, dann wäre alles in Ordnung.
Die junge Frau band sich den Pferdeschwanz neu. Sie benutzte dazu das Haargummi, das ihr Elisa geschenkt hatte; daran baumelte eine schwarze Katze mit gebleckten Zähnen und bösem Grinsen. Sie schwang sich in den Wagen, drehte das Fenster runter und fuhr los, winkte dabei grüßend aus dem Fenster. »Tschüssi, ihr beiden! Bis demnächst!«
Karo und Elisa winkten zurück; der Van rauschte davon. Bald vernahm man nur noch das Quietschen der Reifen und ein leises Scheppern, als er über die Rampen fuhr.
Ihr Vater kehrte zu ihnen zurück. »So«, sagte er und verstaute das Handy. »Dann mal einsteigen. Ich bringe euch nach Hause.«
Elisa sah sich um. »In deinem Smart?«
Er grinste noch breiter, was ihm etwas Altertümlich-Verwegenes gab. Das Musketierbärtchen stand ihm einfach gut. »Ratet mal. Zur Feier des Tages werdet ihr standesgemäß wie Prinzessinnen kutschiert.«
Karo blickte zu dem Porsche Panamera, der als einziges Auto noch auf dieser Ebene stand. »Das ist deiner?« Sie zeigte darauf. »Was ist denn los? Hast du eine Bank überfallen?«
»Früher mal. Heute nicht mehr. Die Kohle ist außerdem schon lange ausgegeben.« Er ging los und zückte den Schlüssel. Die Blinker leuchteten auf, klackend entriegelte sich der Wagen. »Bitte einsteigen, die Damen.«
Karo folgte ihm und der hüpfenden Elisa. Sie wusste wie meistens bei solchen trockenen Äußerungen nicht, ob ihr Vater es ernst gemeint hatte oder nicht. »Das ist eine echt starke Kiste, Papa.«
»Das ist sie. Warte mal, bis ich Gas gebe.« Er ging zum Kofferraum und holte den Kindersitz für die Kleine raus. »Aber nichts dreckig machen.«
»Dachte ich es mir doch.« Karo nickte. »Also nicht deiner.«
»Nein. Er gehört einem Kunden, zu dem ich gleich im Anschluss fahre. Habe den Wagen aus der Werkstatt abgeholt.« Er legte die Erhöhung auf den Rücksitz, Elisa kletterte hinein und wurde von ihm angeschnallt. »Gehört zum Service.«
»Boah, der ist aber groß für ein Sportauto!«, krähte ihre Halbschwester und streckte die Arme aus. »Papa, kaufst du dir auch so einen? Wenn du mal reich bist?«
»Da kannst du lange warten.« Karo nahm vorne Platz und bewunderte die Einlegearbeiten aus echtem Edelholz, das gnadenlos poliert war, so dass sich ihr Gesicht darin spiegelte. Der Wagen war eine Sonderanfertigung. »Papa wird nie reich sein.«
»Stimmt«, bestätigte er, schnallte sich an und startete den Motor. Wieder hatte er das mit einem Unterton gesagt, als meinte er das Gegenteil. Langsam setzte er den Porsche zurück.
Karo sah ihn verstohlen an. »Papa?«
»Ja?«
»Welche Bank hast du denn damals überfallen?«
Er schaltete in den ersten Gang und blickte zu ihr. In den moosgrünen Augen, in denen hellere Sprenkel schimmerten, lag der Schalk. »Du errätst das Jahr, ich sage dir dann die erste Bank«, schlug er ihr vor. »Einverstanden?«
Karo glaubte sich verhört zu haben. »Die erste Bank?«
Er lächelte, und die Bartenden schnellten in die Höhe. »Okay, Töchter: festhalten!« Er trat das Gaspedal durch, der Panamera schoss mit qualmenden Reifen aus der Parklücke und jagte an den Säulen vorbei.
Elisa juchzte vor Vergnügen, Karo dagegen starb auf dem Beifahrersitz tausend Heldentode. Trotz allen Grolls, den sie auf ihn hatte, trotz Elisa und des Lebens, das er führte, zu dem sie nicht ständig gehören durfte, liebte sie ihn.
Als er den Porsche hart in die Kurve drückte und das Heck herumschleuderte, musste sie lachen; ihr Vater und ihre Halbschwester stimmten ein.
»Nein, Herr Tzschaschel. Das sind keine Sit-ups, was Sie da machen. Das konnten Sie schon mal besser.« Ares setzte sich neben ihn auf die schwarze Isomatte. »Kommen Sie. Wir stehen das gemeinsam durch«, sagte er augenzwinkernd. Nur dass ich dabei nicht ins Schwitzen komme.
»Sie haben gut reden«, ächzte der übergewichtige Mann im fliederfarbenen Joggingdress, der sein Geld mit dem Beschicken von Ramschmärkten verdiente.
»Habe ich auch. Und wir haben das gleiche Gewicht.« Ares sah in seinen schwarzen Radlerhosen und dem gleichfarbigen Hoody dagegen hochmodisch aus. Er ließ sich nach hinten sinken, stützte die Beine auf und legte die Fingerspitzen hinter die Ohren. »Hoch mit dem Oberkörper, Blick zu den Wolken, Kopf nicht nach vorne drücken. Am Anfang reichen ein paar Zentimeter, und ausatmen dabei. Ich zähle: eins, zwei, drei …« Ares zählte weiter und dachte über den schwitzenden Mann nach, von dem er schon so manches schrecklich geschmacklose Geschenk bekommen hatte.
Sie befanden sich in dem kleinen, von einer Heerschar Gärtner angelegten Minipark hinter dem Anwesen und arbeiteten mit Bändern und Gewichten an der Verbesserung von Tzschaschels Form. Zwischendurch gab es kleine Dauerlaufeinlagen, zum Abschluss noch mal 45 Minuten lockeres Traben um die Rabatten. Immerhin: elf Kilo weniger in zwei Monaten.
Herbert »Herbie« Tzschaschel war Restegroßhändler und ein Phänomen, nicht nur wegen seiner graulockigen Vokuhila und den Siebziger-Jahre-Koteletten. Er verschacherte en gros die abenteuerlichsten Dinge, die auf den ersten Blick niemand brauchte: schlecht angemalte Gartenzwerge, nach Plastik stinkende Turnschuhe, rutschende Schneidbretter oder chinesische Winkeglückskatzen mit russischer Beschriftung. Aber sobald die magischen Aufkleber »Schnäppchen«, »reduziert« und »1 Euro« draufpappten, kauften die Menschen jeden Mist.
Tzschaschel war durch sein cleveres Vorgehen reich und fett geworden, also investierte er einen Teil seines Geldes wiederum in Ares, damit er ihn in Form brachte. Bislang hatte er es erfolgreich abwehren können, seinen Kunden mit Herbie ansprechen zu müssen, obwohl Tzschaschel es offensiv anbot.
» … zwanzig«, vollendete Ares und blieb liegen. »Kurze Pause, dann die letzten zwanzig.«
»Okay«, schnaufte Tzschaschel und starrte in die Wolken, als käme von da jemand herabgestiegen, ein Erlöser, der für ihn weitermachte. »Sie sind ein gnadenloser Personal Trainer, Löwenstein.«
»Das stimmt. Aber dadurch haben Sie schön abgenommen.«
Er drehte den Kopf zu ihm, sein Blick glitt an Ares hinab und über das Bäuchlein. »Wie kann man nur so fit sein und einen Bauch haben?«
»Nur keinen Neid, Herr Tzschaschel. Das ist alles hartes Training, und zwar über Jahre hinweg. Lassen Sie sich nicht täuschen.« Er klopfte gegen seine Dämmschicht, die nur leicht wogte; dabei schwollen seine Oberarmmuskeln zu beeindruckender Größe. »Gut getarnte Kraft.« Ares feixte und rieb sich einmal über den Kinnbart, strich die Haare dabei glatt. »Das schaffen wir bei Ihnen auch. Hoch mit Ihnen: eins, zwei …«
Während sein fliederfarbener Kunde neben ihm keuchte und hechelte, als würde er ein Kind auf die Welt pressen, dachte Ares daran, dass er seine zwei ungleichen Töchter ein Stück bereiter für das wahre Leben gemacht hatte.
Schließlich war das wahre Leben oft böse. Davon konnte er ein Lied singen.
Und vom Singen schweifte er zu den Routineproben für das Theaterstück: Kleists Zerbrochner Krug, allerdings in einer modernen Form.
Er war der Richter, vermutlich wegen seiner Glatze, wie er annahm. Aber die Rolle machte Spaß. Die Leipziger Volkszeitung hatte ihm bescheinigt, der trainierteste Dorfrichter Adam zu sein, den man bisher in Leipzig auf einer Off-Bühne gesehen habe. »Löwenstein stemmt die Rolle mit Leichtigkeit, was angesichts seiner Muskeln kein Wunder ist«, hatte der Kritiker geschrieben. Nach der Uraufführung gab es ein paar Umstellungen im Timing, die sie heute Abend nochmals durchgehen wollten.
» … zwanzig.« Ares federte in die Höhe und hielt Tzschaschel die Hand hin. »Gut gemacht! Jetzt drehen wir noch unsere Runden. Puls bis maximal 136, nicht zu schnell.«
Der Mann packte die Finger und ließ sich hochwuchten; seine Vokuhila wehte leicht, und die Löckchen wippten wie Miniaturstahlfedern. Fußballprofis hatten eine Zeitlang bis in die 80er solche Frisuren getragen und sich dafür nicht mal geschämt. »Klar.« Er sah zum Haus und winkte seiner Lebensgefährtin, die am Fenster stand. Anatevka.
Ihr weißer Pulli mit dem überdimensionalen Rollkragen hing auf einer Seite tiefer, so dass man die nackte Schulter sah. Sie trug nichts darunter, was sie sich bei dieser Figur leisten konnte. Die schwarzhaarige Schönheit lächelte und prostete ihm mit einem Kaffeehumpen zu. Sie war mindestens zwanzig Jahre jünger und siebzig Kilo leichter als Tzschaschel.
»Ach ja. Das ist doch mal Motivation!«
Und keinesfalls aus dem Ramsch, dachte Ares und grüßte sie ebenfalls. Eine echte Luxusrussin. »Dann beeindrucken wir die Dame doch mit weiterer Ertüchtigung.«
Sie nahmen ihren Dauerlauf auf, der Ares wiederum kaum anstrengte und höchstens als Aufwärmen angesehen werden konnte. Danach würde er ins Studio fahren und noch ein paar Eisen stemmen, anschließend zur Probe düsen. Es konnte ein äußerst gelungener Tag werden: Sport und Kunst.
Tzschaschels Handy gab ein Pfeifen von sich.
Der Geschäftsmann stoppte, um keuchend zu telefonieren. »Sorry, ist ein guter Freund«, schnaufte er noch erklärend.
Ares entfernte sich diskret einige Meter und sah zum Haus; Anatevka stand noch immer am Fenster. Sie hielt kein Telefon in der Hand. Kein Täuschungsversuch. Anfangs hatte sein Kunde versucht, mit »wichtigen Anrufen« Zeit zwischen den Übungen zu schinden, bis sich herausstellte, dass sie es gewesen war. Natürlich auf Geheiß ihres Lebensgefährten.
Tzschaschel legte auf. »Entschuldigen Sie, Löwenstein, aber das war wichtig«, berichtete er.
»Sie wissen, dass Sie das siebzig Euro kostet?«, fragte Ares. So lautete die Abmachung: Ein Anruf während der Lektion bedeutete eine Spende für einen guten Zweck.
»Der hier nicht. Das ist eine Notfallnummer.« Tzschaschels Gesicht hatte sich verändert, schien wächsern und bleich. Er lief zum Haus. »Können Sie mich hinbringen, Löwenstein?«
»Was ist passiert?« Ares folgte ihm.
»Ein Freund ist in Schwierigkeiten. Sein Sohn ist verschwunden … und ich bin gerade zu aufgeregt, um sicher zu fahren.«
»Kein Problem, Herr Tzschaschel. Nehmen wir Anatevka mit?«
Sie betraten das Anwesen.
Tzschaschel schüttelte den Kopf und eilte die Marmortreppen hinauf, vorbei an der bereitstehenden Russin, die ihm normalerweise einen Belohnungskuss erteilte.
Anatevka sah ihm verwundert nach, dann blickte sie zu Ares. Ihre gezupften, fein geschwungenen Augenbrauen schossen in die Höhe. »Was sein?« Wie immer redete sie in schönstem Falschdeutsch und mit dieser besonderen r-Betonung, die sexy klang.
»Ein Freund in Schwierigkeiten«, antwortete er. Das sollte Tzschaschel alles schön selbst erklären. Er bekam von ihr ein Glas Wasser gereicht, das er gerne trank.
Sie musterte zuerst Ares wie eine Katze ein Leckerli, dann ihre Fingernägel. Sie mochte es, zu schweigen. Insgeheim fragte er sich, ob sie jeden Mann, der schlanker als ihr Freund war, mit einem solchen Blick bedachte.
Sein Kunde kam schon wieder die Treppen herunter, in einen locker fallenden grauen Anzug gekleidet, der seine Korpulenz unvorteilhaft betonte, statt sie zu kaschieren. Tzschaschel musste durch die Dusche gerannt sein, sein frisches Hemd zeigte Wasserflecken, die Haare waren nass und hingen wie ein eingeschlafenes Tier auf dem Kopf. Er küsste Anatevkas Stirn. »Ich muss weg, mein Piröggchen. Georg braucht mich.« Schon war er zur Tür hinaus. »Kann spät werden«, rief er noch und warf Ares den Schlüssel des Mercedes S 500 zu.
Ares fing ihn auf. Er nahm seinen Rucksack, den er am Eingang abgelegt hatte, folgte Tzschaschel und wunderte sich, wie schnell der Mann sein konnte.
Beide stiegen ein.
»Wohin?«
»Zur Bank.«
Ares war nicht wirklich verschwitzt, aber kam sich dennoch in Radlerhosen und Hoody hinter dem Steuer der edel-rasanten Limousine deplaziert vor. Jeder Polizist dieser Welt würde ihn anhalten, um zu prüfen, ob er den Wagen gestohlen habe. »Welche, Herr Tzschaschel?«
»Ach so. Ja.« Er sah verwirrt aus. »Die Germania Bank. Die ist beim Neuen Rathaus.«
Ares nickte und fuhr die lange Auffahrt runter. Die Neugierde in ihm wuchs, doch er schwieg. Es ging ihn nichts an.
»Löwenstein, ich muss Ihnen sagen, dass wir gleich eine Million Euro durch Leipzig fahren werden«, eröffnete Tzschaschel angespannt. »Mit Ihnen neben mir fühle ich mich dabei deutlich wohler als mit meinem Piröggchen.« Er ließ das Fenster herunterfahren und den kühlen Wind in sein Gesicht brausen. »Der Sohn meines Freundes wurde entführt. Auf die Schnelle kann er das Lösegeld nicht organisieren. Ich springe selbstverständlich ein.«
»Machen wir auch die Übergabe?« Ares reagierte pragmatisch, was ihm einst bei den Bikern den Spitznamen Profi eingebracht hatte. Nicht nur, weil er mit Zweitnamen Leon hieß.
Tzschaschel stieß ein kurzes Lachen aus. »Wieso wusste ich, dass Sie nicht zuerst danach fragen, ob wir die Polizei eingeschaltet haben?«
»Na ja. Sie hatten die Bullen nicht erwähnt. Die meisten würden das tun.« Er hielt den Blick seiner grünen Augen auf den Verkehr gerichtet, fuhr souverän und zielstrebig die Karl-Tauchnitz-Straße entlang und bog ab.
»Nein, hat er nicht. Ich habe ihm davon abgeraten«, erwiderte Tzschaschel und knetete die Unterlippe. Der einströmende Fahrtwind erweckte das schlafende Tier auf seinem Kopf zum Leben und verpasste der trocknenden Vokuhila eine sehr eigene Form, um die er sich nicht kümmerte. »Bevor die Entführer durchdrehen und Armin umbringen, wenn sie einen Polizisten sehen, gebe ich lieber eine Million aus und lasse sie mir von der Polizei wiederbeschaffen. Oder von privaten Ermittlern.«
Ares ließ die Erklärung unkommentiert. Er sah es nicht ganz so wie sein Kunde.
Ohne es zu wollen, musste er ganz leicht lächeln. Ganz plötzlich hatte ihn das gefährliche Leben wieder eingeholt, obwohl er sich seit Jahren davon ferngehalten hatte. Nur ein kleiner Anruf, und schon steckte er mitten in einem beginnenden Kriminalfall. Als Personal Trainer.
Doch es durfte nicht sein. Allerhöchstens ein kleiner Ausflug in die andere Welt, die er gut kannte. Sehr gut. Zu gut.
Ares schwor sich, alles zu vermeiden, was ihn noch tiefer in die Sache verstrickte. »Machen wir die Übergabe oder nicht?«, hörte er sich selbst fragen und glaubte, dass es eher anbietend als ablehnend klang. Verdammt!
»Würden Sie das tun, Löwenstein?« Tzschaschel schien erleichtert. »Ich kann das nicht von Ihnen verlangen, das wissen Sie. Es würde sich auch nicht auf Ihren Job bei mir auswirken, wenn Sie ablehnen.«
Ares nickte. Diese Geste war neutral und konnte alles bedeuten; gleichzeitig überlegte er, ob er einen Freund anrufen sollte, um ihm einen Tipp zu geben …
Er verwarf seinen Gedanken wieder. Es ging ihn nichts an, und an einer Katastrophe wollte er keinen Anteil haben. Dass er sich als Bote beziehungsweise Begleiter angeboten hatte, involvierte ihn ohnehin zu sehr.
Der Ramschgroßhändler hakte nicht weiter nach und sah aus dem Fenster. Gelegentlich sagte er »Schrecklich« oder »So eine Scheiße«, bis sie mit dem S 500 auf dem Parkplatz der Bank standen.
Gemeinsam betraten sie die Halle, wurden gleich von einem Angestellten begrüßt und in einen Besprechungsraum geführt. Höflichkeit dominierte in dem nachfolgenden kurzen Gespräch, es wurde nicht viel gefragt, nicht einmal nach Sicherheiten. Ein kleiner dezenter Metallkoffer ruhte auf dem Tisch. Eine Million to go. Tzschaschel musste ein sehr guter Kunde sein.
Ares gab zu, dass ihn Tzschaschel gerade beeindruckte. Hier verlor er jegliche Plumpheit, bewegte sich gewandt, klang dennoch geschäftlich und druckvoll. Das war sein Terrain.
Nach zehn Minuten verließen sie das Gebäude wieder, ausgestattet mit jenem Metallkoffer, in dem eine Million Euro in Fünfhundertern steckte. Ares trug ihn zum Wagen, legte ihn in den Fußraum des Fonds und verriegelte vor Antritt der Fahrt die Schlösser.
»In die Katharinenstraße.« Tzschaschel setzte sich auf die Rückbank, telefonierte unterwegs mit seinem Freund und beruhigte ihn. Alles werde sich fügen, Armin werde nichts geschehen, und sollten die Entführer mehr verlangen, würde er sie schon runterhandeln. Er sei es gewohnt, den Preis selbst für beste Ware zu drücken. Dann legte er auf.
Sie passierten den Goerdelerring und kamen gut voran. Das Ziel war keine fünfzig Meter mehr entfernt.
Ares hatte sich beherrschen wollen, aber dann platzte er heraus: »Dann gibt es noch gar keine Forderung?«
»Nein.« Tzschaschel machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Seit wann ist der Sohn verschwunden?«
»Seit gestern Morgen. Er kam abends nicht zu einem Konzert, und das kann nur bedeuten, dass er entführt wurde.«
Ares setzte den Blinker und fuhr den S 500 die schmale Einfahrt hinein, die in einen Hof mündete; hinter ihnen schlossen sich die alten, aber restaurierten Tore wie von Geisterhand.
Der Mercedes hielt in einem Kaufmannshof aus dem Rokoko, in bester Lage und schräg gegenüber dem neu errichteten Einkaufszentrum am Brühl. Noch standen demontierte Baugerüste herum, die letzten Renovierungsarbeiten waren abgeschlossen und die Wohnungen bereits verkauft.
Tzschaschel wuchtete sich aus dem Wagen, Ares nahm den Koffer und begleitete ihn.
Eine Sicherheitskamera überwachte ihre Schritte, der Summer für die Eingangstür erklang rechtzeitig.
Sie gingen eine Treppe hinauf, die der Ramschkönig freiwillig statt des Aufzugs nahm, was Ares als sein Personal Trainer zufrieden registrierte.
Auf dem Absatz wurden sie bereits von einem Mann im dunkelblauen Anzug erwartet, der sichtlich fahrig wirkte.
Ares erkannte ihn sofort: Richard Georg Wolke, Kunstsammler, ehemals gefeierter Konzertpianist und Intendant der Leipziger Oper. Jetzt wusste er auch, welches Konzert Tzschaschel vorhin gemeint hatte: das groß und lange angekündigte Chopin-Konzert im Gewandhaus.
»Wer ist das?«, fragte Wolke sofort.
»Mein Personal Trainer, Ares Löwenstein«, antwortete Tzschaschel. »Er gibt Selbstverteidigungskurse und … ich dachte, es wäre gut, ihn dabeizuhaben. Bei der Übergabe.« Sie schüttelten sich die Hände. »So eine Scheiße, Georg!«
Wolke musterte Ares, dann machte er ihm Platz. »Ja. So eine Scheiße.« Er roch nach Alkohol, hatte das Hemd geöffnet und die Krawatte lose unter den Kragen geschoben. Die nussbraunen Haare hingen ungewaschen und wirr vom Kopf. »Ich hatte ihn davor gewarnt, ins Werk II zu gehen.«
Sie gingen durch die sanierte Wohnung. Schnell wurde deutlich, dass sie sich im Zuhause des Sohns befanden.
Ares bemerkte ein leichtes Frauenparfüm, von der Trägerin war allerdings nichts zu sehen. Er bezweifelte, dass das Werk II damit etwas zu tun hatte. Sollte sich herumgesprochen haben, dass Wolke junior ein lohnendes Ziel war, hätten sie ihn sogar von der Bühne des Gewandhauses gezerrt. Mitten im Chopin-Konzert.
Ares vermutete irgendwelche Ostmafiosi. Jugos vielleicht. Oder Russen. In beiden Fällen wäre es sinnvoll, die Forderungen zu erfüllen, ohne zu verhandeln. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, würde er das Tzschaschel stecken, bevor sie die Geisel in Scheiben zurückbekamen.
Der Ramschkönig setzte sich in einen zerbrechlich wirkenden Sessel und lehnte den angebotenen Whiskey ab. Ares wurde nicht beachtet. »Haben sie sich gemeldet?«
»Nein.« Wolke goss sich nach und kippte den Drink fast auf ex. Ares schätzte sein Alter auf Anfang sechzig, doch er hatte sich gut gehalten. Drahtig, sportlich und unermüdlich, wenn es um die Oper und deren Belange ging. Da seine Verbindungen bis hinauf in die höchsten Kreise der Politik reichten, holte er mehr als seine Vorgänger für das Haus heraus, wie man der Zeitung entnehmen konnte. Ein Mann, der selten ein Nein akzeptierte oder Widerspruch duldete.
Ares sah an der auf Technik-Optik und EBM getrimmten Einrichtung, dass hier ein Sohn gegen seinen traditionell eingestellten, übermächtigen Vater rebellierte. »Entschuldigen Sie bitte«, er konnte sich nicht beherrschen, »aber sind Sie sich sicher, dass Ihr Sohn entführt wurde? Kann er nicht einfach abgehauen sein?«
Beide Männer sahen ihn an. Der eine verwundert, der andere wütend.
»Warum sollte er das tun?«, schnauzte Wolke erbost. »Armin hat sich auf das Konzert gefreut. Monatelange Vorbereitung, Wochen am Klavier, um was mit seinem Fernbleiben zu erreichen?«
»Nun ja: um Sie zu ärgern?«, schlug Ares vor. »Ein bisschen Rebellion im goldenen Käfig.«
»Niemals«, schnarrte Wolke. »Außerdem geht Sie das nichts an, Personal Trainer.«
Ares presste die Lippen zusammen und hielt alles an Kommentaren zurück, was ihm auf der Zunge lag. Er kannte Männer wie den Intendanten. Hart, kalt und eine rauhe Schale, unter der jedoch kein weicher Kern, sondern noch eine weitere Panzerung wartete. Sie waren erfolgreich und kannten nichts anderes und erwarteten nichts anderes.
Daher hätte sich Ares auch nicht gewundert, wenn Armin wirklich irgendwo am Strand mit seiner Kirsche saß und sich lachend volllaufen ließ. Am besten mit der Kohle seines Herrn Papa.
Aber er wollte sich nicht zu früh für den Junior freuen. Es konnte durchaus sein, dass eine Entführung vorlag. Immerhin gab es ein gutes Motiv: Aus den Zeiten als Konzertpianist hatte Richard Wolke durch den Verkauf von Tonträgern und Tickets Millionen auf seinem Konto angehäuft.
Tzschaschel räusperte sich. »Ich nehme doch einen Whiskey, Georg. Ich muss ja nicht fahren.« Er lachte über seinen Verlegenheitsscherz, doch niemand fiel mit ein. Die Souveränität, die er in der Bank kurz hatte aufblitzen lassen, war verschwunden.
Der Flaschenhals senkte sich klirrend auf den Glasrand, gluckernd ergoss sich bernsteinfarbene Flüssigkeit in den Tumbler. Die Geräusche erschienen überlaut, zerschnitten regelrecht die Stille. Der renovierte Kaufmannshof war so gut isoliert, dass die Stadtgeräusche ausgesperrt blieben; dafür tönte jetzt Tzschaschels Schlucken unglaublich laut.
Ares stellte erst jetzt den Koffer ab und setzte sich auf einen Stuhl, ohne eine Einladung abzuwarten. Er hatte beschlossen, nichts mehr zu sagen.
»Bist du dir sicher?«, sagte der Ramschhändler.
»Womit sicher?«
»Na, mit der Entführung.«
»Scheiße, Herbie! Was soll ich denn sonst glauben? Mendy sagte, dass Armin nicht da war, als sie zurückkam, und die Wohnungstür offen stand. Die Aufzeichnungen der Kameras sind gelöscht! Verstehst du: gelöscht! Seitdem nichts. Kein Anruf, kein Lebenszeichen. Seit vierundzwanzig Stunden. Alle seine Klamotten und Sachen sind noch da. Und dann noch das geplatzte Konzert! Wie stehe ich denn da?«
»Wie ein Arschloch«, murmelte Ares und tat, als würde er einer Fliege hinterherschauen; dabei zwirbelte er an einem Bartende.
»Georg, ich weiß nicht …«, setzte Tzschaschel an und beugte sich nach vorne. Der Sessel knarrte warnend.
Das Telefon läutete.
Wolke nahm sofort ab und bellte ein »Ja?« hinein, das jeden, auch einen Entführer, in die Flucht geschlagen hätte.
Dann lauschte er.
»Nein«, antwortete er dann. »Nein, mein Sohn gibt keine Interviews, wie es ihm gerade geht. Er ist krank, das sagte ich schon gestern!« Wolke knallte den Hörer auf die Gabel und warf die Haare zurück. »Blöde Zeitungswichser!«, stieß er hervor.
Ares fand es bedauerlich, dass es nur wenige moderne Telefone gab, die man noch mit Wucht einhängen konnte. Es hatte etwas Archaisches. Frauen drückten Anrufe mit einem Knöpfchen weg, Männer ballerten dagegen den Hörer auf. Er machte sich die interne Notiz, sich auch ein Retro-Modell anzuschaffen.
Tzschaschel blickte in sein fast leeres Glas. »Wie lange willst du warten, bevor du die Polizei informierst? Ich meine, Armin kann auch einen Unfall gehabt haben. Er ging vielleicht schnell aus dem Haus, weil er was einkaufen wollte … und … keine Ahnung. Hast du in den Krankenhäusern schon angerufen?«
»Nein.« Wolke rieb sich über die Stirn. »Nein, das kann nicht sein. Sie hätten seine Papiere gefunden und mich in Kenntnis gesetzt. Man kennt meinen Namen. Und warum sollte er die Kameraaufzeichnungen löschen?«
»Sicher.« Tzschaschel stellte das Glas ab. »Du hast recht.«
Ares sah auf die Uhr. In zwei Stunden musste er zur Theaterprobe. Wie es aussah, konnte er die vergessen.
Er zog sein Smartphone und schrieb eine Mail an seine Kollegen, dass er aus einem wichtigen Grund nicht erscheinen konnte.
Die Probe absagen zu müssen nervte ihn gewaltig. Falls er zu einer eventuellen Übergabe mitging und sie trafen auf die Entführer, würde Ares sie spüren lassen, was es bedeutete, seinen Groll auf sich zu ziehen.
Armin erwachte langsam.
Um ihn herum war es dunkel und kalt. Seine Muskeln taten ihm weh, und er fühlte sich komplett verkrampft, was er auf die Nachwirkungen des Elektroschockers zurückführte. Fesseln um die Fuß- und Handgelenke schränkten seine Bewegungsfreiheit ein.
Er hörte das gedämpfte Geräusch von plätscherndem Wasser, so als würde jemand ein Bad einlassen.
Armin richtete sich trotz seiner Fesseln ächzend auf und tastete sich ab: Er war nackt bis auf die Unterhose, die er beim Zusammentreffen mit dem Maskierten getragen hatte. Kabelbinder lagen um seine Gelenke. Eine Flucht würde extrem schwer werden.
Dazu kam, dass Armin nicht wusste, wo er sich befand. Es roch nach Staub, feuchtem Gips und altem Holz. Nicht gerade die beste Umgebung. Vermutlich ein Verschlag in einem Hinterhof oder ein Keller.
Das Blubbern und Plätschern endete.
Jemand schlurfte humpelnd näher und pfiff dabei ein Lied. Débussy. La mer.
Es klickte, und dann rasselte eine Kette, die auf den Boden geworfen wurde. Quietschend öffnete sich vor Armin eine Tür, helles Taschenlampenlicht fiel herein und blendete ihn.
»Sieh einer an«, sagte die Stimme des Entführers in geschliffenem Hochdeutsch. Sie klang dumpf, was wohl von seiner Maske oder einem Schal rührte, den er vor dem Gesicht trug. »Du bist ja wach, Goldjunge.«
»Was wollen Sie?« Armin konnte sich irren, aber der Typ, der ihn auf dem Bordstein mit dem Baseballschläger niedergeknüppelt hatte, hinkte nicht, sondern konnte verdammt schnell laufen; außerdem hatte er gesächselt.
Schlagartig wurde ihm klar: Das war ein anderer Mann! Ein Kumpan womöglich.
»Wollen Sie Lösegeld?« Er hielt eine Hand als Sichtschutz gegen den grellen Strahl. »Mein Vater wird Ihnen eher das SEK auf den Hals hetzen. Er ist geizig und mag mich nicht besonders.«
Der Mann lachte leise und bückte sich, packte die Fußfessel mit einer Hand und zerrte Armin hinter sich her ins Freie.
»Hey! Hey, warten Sie«, rief er und versuchte erfolglos, sich an was festzuklammern. Die Kuppen rutschten über rauhes Holz, es gab keine Ecken oder Kanten, an denen er Halt fand.
Sein humpelnder Entführer schleifte ihn über einen abgelaufenen Dielenboden.
Splitter bohrten sich in die ungeschützte Haut, abgeplatzte Lackstücke blieben an ihm haften. Armin fluchte laut.
Er ahnte, dass er sich in einem alten, verlassenen Haus befand. In Leipzig gab es Hunderte davon, die auf eine Sanierung oder den Abriss warteten. Er konnte in der Innenstadt oder in einem ganz abgelegenen Teil sein.
Armin wurde rücksichtslos in ein größeres Zimmer bugsiert, das im Schein eines Baustrahlers lag. Der Humpelnde trug einen schwarzen Staubschutzanzug, Gummihandschuhe und -stiefel, wie er nun im grellen Licht feststellte.
Hier sah die Stuckdecke halbwegs in Ordnung aus, es roch nach nassem Gips und frischer Farbe.
Seine Augen gewöhnten sich an die Helligkeit, fokussierten die Umgebung. Eine Hälfte des Raumes war komplett renoviert worden: ein Dorian-Gray-Zimmer, auf der einen Seite heruntergekommen und zerfallen, auf der anderen glanzvoll und schön wie vor hundert Jahren am Tag, als die ersten Bewohner einzogen.
Wer tat so etwas? Sein Entführer?
Im intakten Teil stand eine altertümliche Badewanne. Auf einem Beistelltischchen lagen eine Feder, ein Tintenfass, ein zusammengerolltes Blatt Papier sowie sorgsam zusammengefaltete Leintücher.
Armin beschlich das Gefühl, sich bei den Vorbereitungen für ein Theaterstück oder an einem Filmset zu befinden. »Was soll das?«, rief er ängstlich. »Was haben Sie mit mir vor?«
Jetzt drehte sich der Mann zu ihm um – und blickte ihn durch die Vollmaske an, mit der er das Gesicht verbarg.
Sie hatte die klassische Form, mit leichtem venezianischem Einschlag und komplett in Weiß gehalten. Im oberen Drittel prangte ein übergroßes aufgeklebtes Auge in Schwarzweiß, dessen Lidränder von einer Schläfe bis zur nächsten reichten. Es erweckte den Anschein, als sei Armin Opfer eines Zyklopen geworden.
Der Mann ließ ihn los und beugte sich zu ihm. »So, Goldjunge. Da habe ich mir einen Künstler ausgesucht, um ein Kunstwerk zu erschaffen«, sagte er mit kaum unterdrückter Vorfreude. Die behandschuhte Rechte packte Armins Kinn, drückte den Kopf nach rechts, nach links. »Diese Ähnlichkeit. Frappierend. Wenn auch etwas jung. Doch Besseres findet sich nicht.«
Armin sah, dass das riesige Auge aus vielen kleinen, etwa einen Zentimeter großen Bildchen bestand, die akribisch nach Farbton und Motiv ausgesucht waren. Aus der Entfernung fügten sie sich mosaikgleich zu einem Auge zusammen.
Seine Pupillen zuckten suchend hin und her. Was genau auf den einzelnen Miniaturfotos abgebildet war, konnte Armin nicht genau erkennen, aber eines schien aus einem Krieg zu stammen. Nein, eher von einer Hinrichtung: Ein asiatischer Soldat tötete einen zivilen Landsmann aus nächster Nähe mit einer an der Schläfe aufgesetzten Waffe.
»Solltest du versuchen zu flüchten, verspreche ich dir die schlimmsten Schmerzen, die man erdulden kann, ohne zu sterben. Glaub mir, ich kann das. Ich habe viel gesehen und viel getan.« Der Mann erhob sich. »Entspann dich. Ich mache dich unsterblich. Unsterblicher, als es deine Klavierkunst jemals hätte tun können. Abgesehen davon wirst du überschätzt. Beim letzten Konzert hast du dich zweimal verspielt.« Er intonierte mit daa-dada-daa-dadadada-daaa einen Klavierlauf, seine Hände spielten auf imaginären Tasten, bis er abrupt innehielt und sich mit dem linken Zeigefinger gegen das Ohr tippte. »Ich kann das hören. Oh, ja, ich kann das hören.«
Armin erkannte die Stelle im Stück wieder – und begriff, in welcher Lage er sich befand: Er war in die Hände eines verrückten Fans gefallen!
Von aggressiven Stalkern oder fanatischen Anhängern stand öfter was in den Medien zu lesen. Nun hatte es ihn erwischt. Es waren schon erfolgreiche Romane über Szenen wie diese geschrieben worden, nur dass er sich mittendrin befand.
»Ist das meine Strafe?« Vielleicht ließ sich der Mann beschwichtigen. »Ich … will mehr üben, und ich spiele es Ihnen noch einmal vor! Ich kann es besser! Wirklich!« Er schluckte, hustete. »Bitte, geben Sie mir …«
Der behandschuhte Zeigefinger schwenkte vom Ohr weg und richtete sich auf die Maske. »Du hast in das Auge des Todes gesehen und den Totenblick empfangen. Denkst du, es ginge schadlos an dir vorüber?« Lachend schlurfte der Entführer zur Wanne, sah hinein und begab sich an den Beistelltisch, vor dem er niederkniete und das Tintenfass aufschraubte.
Armin zitterte vor Kälte und Angst.
Als er die hingebungsvollen Bewegungen sah, mit denen sein Entführer mittels Federkiel auf das Blatt Papier schrieb, wusste er, dass er nicht lebend aus dem Raum gelangen sollte. Diese Maske, beklebt mit vielen Einzelbildern und ein übergroßes Auge formend, das halbfertige Zimmer, die Staffage, die Bewegungen des Mannes verliehen der Szenerie etwas Surreales.
Sein Überlebenswille erwachte.
Behutsam, um den Verrückten nicht auf sich aufmerksam zu machen, rutschte Armin in Richtung der abgedunkelten Fenster.
Kapitel 2
Kriminalhauptkommissar Peter Rhode lief die wacklige Treppe des maroden Hauses in der Gorkistraße mit viel Elan hinauf. Der leichte graue Mantel wehte, die dunkelblauen Hosenbeine schlackerten. Er trug gerne Anzüge, auch wenn der Außendienst seinen Tribut vom Stoff forderte, aber als Leiter einer Ermittlungsgruppe fand er, dass er das seiner Stellung schuldig war.
Seine Pille wirkte noch nicht, das ADHS machte ihn aufgekratzt und übermotiviert, was nicht das Schlechteste war, wenn es darum ging, Kleinigkeiten an einem Tatort zu erfassen. Doch dabei schlichen sich leider auch Fehler ein. Er bemerkte viel und vergaß es auch gleich wieder, weil ein anderes Detail interessanter erschien.
Seine jüngste Tochter hatte ihn mal mit dem überhektischen Eichhörnchen Hammy aus dem Film Ab durch die Hecke verglichen. Seitdem trank er keine Cola mehr. Nach der Diagnose einer zusätzlichen Stoffwechselstörung fiel er sowieso aus allen gängigen Mustern zur Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndroms.
»Morgen.« Rhode nickte dem dunkelblau uniformierten Beamten zu, der am Eingang der Wohnung stand und Wache schob. Einen Ausweis musste er nicht zeigen, man kannte sich flüchtig von einem anderen Tatort. Rosenthaler oder so ähnlich hieß er.
»Morgen, Herr Rhode.« Der Kollege tippte sich gegen den Mützenschirm und wies gleich darauf mit dem Daumen in den Raum hinter ihm. »So was haben Sie noch nicht gesehen.«
»So schlimm?« Mit einer knappen Geste strich er dünne Nieselregentropfen von seinen kurzen schwarzen Haaren ab. Das Wetter meinte es nicht gut mit Leipzig, vom sogenannten goldenen Oktober fehlte jede Spur. Im Osten der Stadt wirkten die Wolken am Himmel auf ihn noch grauer, noch bedrückender. Dazu passte der Leichenfund.
»Nee. Eher merkwürdig. Abgefahren«, suchte der Polizist nach dem richtigen Wort. »Sie werden gleich erkennen, was ich meine. Aber schlecht wird Ihnen nicht. Ihre Kollegin Schwedt ist schon drin.«