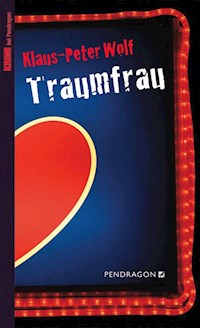
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder und klarsichtiger Roman über die dunkle Seite in Männerseelen und die Geschäfte mit asiatischen Frauen. Klaus-Peter Wolf berichtet von ungeheuerlichen Vorkommnissen.Die perfekte Frau. Davon träumen fünf Männer in der deutschen Provinz. Was als Schnapsidee bei einer Skatrunde beginnt, nimmt durch einen Lottogewinn unerwartet Form an. Die Traumfrau aus dem Katalog. Bildhübsch, sexy, fleißig und stumm soll sie sein. Aber als die Frau aus Thailand eintrifft, kommt alles anders als gedacht. Klaus-Peter Wolf ist für seine ungewöhnlichen Recherchen bekannt. Offiziell gründete er die Firma "Hot pants" (Steuernummer 18/079/0175/7) und durchforstete als Mädchen- und Frauenhändler getarnt die Szene. Er hat im Milieu verstörende Erkenntnisse gewonnen. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen entstand sein aufwühlender Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus-Peter Wolf · Traumfrau
Was fangen fünf Skatbrüder in einem deutschen Dorf mit ihrem gemeinsamen Lottogewinn an? Sie beschließen, sich eine asiatische Frau zu kaufen. Stumm soll sie sein und jedem Einzelnen die geheimsten Wünsche erfüllen. Aus den Stammtischphantasien wird Wirklichkeit, und das Drama beginnt.
Klaus-Peter Wolf ist für seine ungewöhnlichen Recherchen bekannt. Um zu ergründen, was in den Köpfen von Männern passiert, die sich über sogenannte „Ehevermittlungsinstitute” eine asiatische Frau kaufen, gründete Klaus-Peter Wolf die Firma „Hot pants” für Mädchen- und Frauenhandel (Steuernummer Finanzamt Hachenburg 18/079/0175/7). So getarnt hat er über zwei Jahre das „Milieu” durchforstet und beide Seiten des Marktes kennengelernt: die Käufer, die ihm ihre ansonsten verborgenen Motivationen enthüllten, und die Händler, die ihm ihre Geschäftspraktiken erläuterten. Herausgekommen ist ein spannender Roman über die Abgründe menschlichen Verhaltens.
Klaus-Peter Wolf, geboren 1954 in Gelsenkirchen, lebt heute in Ostfriesland. Er schreibt Kriminalromane, Psychothriller und auch Kinderbücher, die in 24 Sprachen übersetzt und mehr als acht Millionen Mal verkauft wurden. Seine Bücher und Filme wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet: u.a. Anne-Frank-Preis (Amsterdam), Magnolia Award (Shanghai), Rocky Award (Banff, Kanada), Erich-Kästner-Preis (Berlin). Zuletzt erschienen: „Ostfriesenkiller”, „Ostfriesenblut”, „Ostfriesengrab”, „Ostfriesensünde” und „Ostfriesenfalle”. Sein Roman „Ostfriesensünde” wurde von den Lesern der Krimi-Couch.de zum besten Krimi des Jahres 2010 gewählt. Im Pendragon Verlag lieferbar: „Samstags, wenn Krieg ist”. Mehr über den Autor erfahren Sie auf der Website: www.klauspeterwolf.de
Klaus-Peter Wolf
Traumfrau
Mit einem Nachwort von Klaus-Peter Wolf
PENDRAGON
Pendragon Verlag
gegründet 1981
www.pendragon.de
Veröffentlicht im Pendragon Verlag
Günther Butkus, Bielefeld 2011
© by Pendragon Verlag Bielefeld 2011
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag & Herstellung: Uta Zeißler (www.muito.de)
Umschlagfoto: ullstein bild – Eckelt/CARO
Satz: Pendragon Verlag auf Macintosh
Gesetzt aus der Adobe Garamond
ISBN 978-3-86532-260-9
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
1
Je mehr er über die Gewohnheiten und Lebensbedingungen der Schädlinge wusste, desto leichter fiel es ihm, sie wirkungsvoll zu bekämpfen. Da herumliegende Gartenabfälle den Insekten ideale Winterquartiere boten, kompostierte er im Herbst auch das letzte welke Blättchen. Er wollte es der feindlichen Insektenarmee von Anfang an so schwer wie möglich machen. Aber vor chemischer Kriegsführung schreckte er zurück. Er hatte Zeit genug, um Wollläuse, Schildläuse, Raupen, Schnecken aller Art und ähnliches Getier von den Pflanzen abzusammeln.
Im letzten Jahr hatte er strohgefüllte Blumentöpfe verkehrt herum an Stöcken neben seinen schönsten Pflanzen aufgestellt und die darin entstandenen Ohrenkneifernester verbrannt. Er war froh, dass ihn dabei niemand gesehen hatte. Er kam sich deswegen gemein vor. Auf eine merkwürdige Art hinterlistig. Seitdem versuchte er sich einzureden, dass Ohrenkneifer nicht nur Schaden an den Blüten anrichten, sondern auch irgendeine sinnvolle Aufgabe haben.
Schon vor dreißig Jahren, als er dieses Haus mit fünfzig Prozent Eigenleistung gebaut hatte, träumte er davon, sich im Garten einen eigenen Teich anzulegen. Doch damals war alles andere wichtiger gewesen: die Kinder, ein Auto, seine Ehrenämter in der Gemeinde, der Urlaub in Italien, die Krankheit der Frau. Doch was sollte ihn, den pensionierten Witwer, jetzt noch davon abhalten, sich seinen alten Wunsch zu erfüllen?
Die Befürchtungen der Nachbarn, es könne eine Mückenplage geben, bewahrheiteten sich nicht. Denn für seine Goldfische und Schleierschwänze waren Mückenlarven begehrte Leckerbissen.
Das Ausschachten und Wegkarren der Lehmerde war keine leichte Arbeit für einen Mann in seinem Alter. Den ganzen April über arbeitete er vier bis fünf Stunden täglich. Er nahm fünfzehn Kilo ab dabei. Dann lag endlich das große Loch wie ein weit geöffnetes Maul vor ihm und er senkte eine dreißig Quadratmeter große, schwarze Teichfolie darüber ab. Eine Tonne großer weißer Kiesel war angeliefert worden und versperrte einen Teil der Straße. Trotzdem half ihm niemand. Man schüttelte höchstens den Kopf über ihn.
Er vermischte gerade gute Erde mit Knochenmehl für Sumpf-und Wasserzonen, als sein Körper wie von einer Kugel getroffen zusammenzuckte. Die Schippe glitt ihm aus der Hand, und die Knie gaben nach. Dann saß er auf den Kieselsteinen und wusste, dass dies die erste Warnung war. Vielleicht hatte er noch zwei Jahre, vielleicht noch fünf oder zehn. Jedenfalls sagte ihm der krampfartige Schmerz in der Herzgegend, dass auch sein Leben endlich war.
Zwei Wochen später, in seinem Teich schwammen die ersten Fische, Froschbiss und Teichrosen gediehen prächtig, traf es ihn zum zweiten Mal. Er ging an der Ichte spazieren, verfolgt von einem zwitschernden Dompfaffe, der immer wieder das Quaken des Frosches übertönte, den Günther Ichtenhagen so gern für sein Feuchtbiotop gefangen hätte, als sein Herz zu zerreißen drohte. Diesmal war es schlimmer. Er befürchtete, den Heimweg nicht mehr alleine zu schaffen. Nur wenige Meter weiter wusste er eine Bank aus groben, unbearbeiteten Baumstämmen.
Aber er kam nicht bis dorthin. Die Beine gehorchten ihm nicht mehr, nur über seine Hände und Arme hatte er noch Kontrolle. Er scharrte Laub und Moos zusammen und formte es zu einer Art Kopfkissen. Er konnte es jetzt nicht ertragen, seinen Kopf auf den harten Boden zu legen. Zu Hause schlief er auf großen Daunenkissen. Er besaß keinen Hut, weil der Druck auf seinen Kopf dadurch unerträglich wurde. Selbst sein Lesebrillengestell bereitete ihm Schwierigkeiten. Er wollte den Kopf freihaben. Immer. Und wenn der Kopf mit anderen Gegenständen in Berührung kam, dann mussten sie weich und nachgiebig sein.
Nachdem er eine halbe Stunde oder länger so gelegen hatte, gelang es ihm, sich aufzuraffen und langsam, mit zittrigen Beinen, bis nach Hause zu kommen.
Er kochte nicht für sich. Zwar war die Küche mit allem ausgestattet, doch seit dem Tod seiner Frau hatte er sie nur noch benutzt, um sich Kaffee aufzubrühen oder mal zwei Spiegeleier in die Pfanne zu hauen.
Er frühstückte immer ausgiebig. Vollkornbrot, Tomaten (am liebsten aus dem eigenen Garten), Käse, Margarine. Keine Butter. Mittags aß er fast nichts. Manchmal trank er eine Tasse Kaffee und stippte zwei, drei Kekse hinein. Aber das war selten. Dafür saß er jeden Abend Punkt neunzehn Uhr in der Linde. Dort gab es preiswerte, gute Hausmannskost: große Schnitzel und Koteletts aus eigener Schlachtung.
Bevor er in die Linde ging, trank er einen Aalborg Jubiläums Aquavit. Dort gab es den Schnaps auch, aber er trank ihn lieber zu Hause. Nicht dass er geizig gewesen wäre, nein, aufs Geld kam es ihm nicht an. Aber in der Linde servierten sie diesen Schnaps auf eine, wie er fand, ungebührliche Art und Weise in einem Pinnchen. Er trank ihn aus einem eisgekühlten, langstieligen Original Aalborg Glas. Solange sie sich in der Linde nicht daran gewöhnen konnten, den Aalborg stilecht zu servieren, würde er ihn eben zu Hause trinken.
Er war um neunzehn Uhr immer der Erste am Stammtisch. Knapp fünf Minuten nach seinem Eintreffen stand das Essen bereits dampfend vor ihm. Darauf war Verlass. Den Salat aß er immer zuletzt. Meist trudelten dann auch schon seine Skatbrüder ein.
Zuerst Hermann Segler, der sofort einen Schnaps brauchte, um zu vergessen, dass der von seiner Frau geführte Lebensmittelladen im Dorf nicht einmal genug für die Miete abwarf. Da ihnen aber das Haus gehörte, waren sie auf das Geld, das der Laden abwarf, nicht angewiesen. Wer einen Wagen besaß, kaufte billiger in der Kreisstadt ein und ging nur zu Seglers, wenn unerwarteter Besuch kam oder um die Kleinigkeiten einzukaufen, für die eine Fahrt in die Kreisstadt nicht lohnte. Für vierzig Brötchen fanden sie jeden Morgen Abnehmer. Im letzten Sommer, als ein Bautrupp die Straße im Dorf aufbaggerte, verkaufte Frau Segler sogar belegte Brötchen an die Bauarbeiter. Die Eistruhe wurde leer, und ein paar zusätzliche Kästen Bier gingen über die Ladentheke. Dieser kurze Aufschwung dauerte aber keine zehn Tage, dann zog der Bautrupp weiter.
Hermann Segler wusste nicht genau, warum seine Frau darauf bestand, den Laden weiterzuführen. Weil die autolosen Einwohner von Ichtenhagen darauf angewiesen waren? Weil eine Geschäftsaufgabe wie eine Niederlage für sie gewesen wäre? Oder einfach nur, weil sie Angst hatte, sich sonst zu Tode zu langweilen?
Er selbst hasste das Geschäft. Er arbeitete als Metzger in der Kreisstadt und verstand seinen Sohn nur zu gut, der kurz nach seinem achtzehnten Geburtstag das elterliche Haus in Richtung München verlassen hatte und jetzt nur noch zu Weihnachten und den Geburtstagen per Postkarte Lebenszeichen gab.
Für einen guten Skatspieler war Martin Schöller noch zu jung, fand Günther Ichtenhagen. Man konnte an seinem Gesicht ablesen, wie sein Blatt aussah. Seine Kommentare waren zu laut, seine Freude über einen eingeheimsten Stich zu prahlerisch, und er beging einen grundlegenden Fehler: Er steckte die Karten immer in der gleichen Reihenfolge. Von links nach rechts. Erst die Buben, dann alle anderen Trumpfe, ihrer Gewichtigkeit nach geordnet, schließlich die Farben. Wenn Martin Schöller einen Trumpf zog und abwarf, konnte Günther Ichtenhagen jedes Mal abzählen, wie viele Trümpfe er noch in der Hand hielt, und auch ziemlich genau voraussagen, wie hoch sie waren.
Günther Ichtenhagen verriet diese Beobachtung den anderen Skatbrüdern nie. Wahrscheinlich waren sie alle schon von selbst drauf gekommen und hielten ebenfalls den Mund. Dass gerade dieser junge Lümmel, den er früher selbst unterrichtet hatte, immer wieder durch seinen Ordnungsfimmel hereinfiel, amüsierte Günther Ichtenhagen. In der Schule war Martin Schöller ihm nur einmal wirklich aufgefallen. Er sah ihn noch heute vor sich stehen mit frechem Blick, höhnischem Lächeln um die Mundwinkel, mit herausfordernder Körperhaltung, als ginge er zum Duell und nicht zur Tafel. Die krummen und schiefen Striche wollte Günther Ichtenhagen nicht länger durchgehen lassen. Er wischte sie einfach aus und drückte Martin das große Holzlineal in die Hand.
„Was denkst du jetzt?”, fauchte Günther Ichtenhagen seinen aufsässigen Schüler an. Er konnte diesen frechen Blick nicht einfach übergehen.
„Ich denke, dass Sie den Ordnungswahnvorstellungen eines preußischen Hauptfeldwebels erlegen sind.”
Er hatte diesen Satz nie vergessen. Das hatte noch nie einer zu ihm gesagt und erst recht kein Schüler. Fast bewunderte er die Respektlosigkeit dieser Worte. Aus ihnen sprach eine Weitsicht, die Günther Ichtenhagen durchaus respektierte. Das Ablehnen eines übertriebenen Militarismus. Wie dümmlich waren dagegen die Schimpfworte der anderen Schüler.
Martin Schöller hatte seine Möglichkeiten nie voll ausgenutzt. Er wollte immer alles jetzt und sofort und bekam dann gar nichts, auch nicht auf lange Sicht. Er nannte sich gern Lastwagenfahrer, das klang so schön nach großer weiter Welt, doch seine Skatbrüder wussten, dass er nur Beifahrer gewesen war. Einmal für sechs Monate bei einer Spedition. Die Strecke Hamburg–Frankfurt kannte er seitdem auswendig. Sein Vetter im Nachbardorf hatte ihm angeboten, eine Lehre in seiner Tischlerei zu machen. Damals hatte er das lächelnd abgelehnt. Tischlerei! Du meine Güte! Er wollte sein Leben nicht zwischen Sägespänen verbringen!
Er war ein Abenteurer, der noch nichts erlebt hatte. Ein Held ohne Heldentaten. Ein Killer, der kein Blut sehen konnte, ein einsamer Frauenheld. Seit einem Jahr ging er regelmäßig ins Bodybuilding Center. Dreimal in der Woche. Er hatte Zeit. Wo andere einen Bierbauch bekamen, saß bei ihm eine bewegliche Panzerplatte.
Seine Oberarme hatten vier Zentimeter zugelegt. An die Bizepsmaschine setzte er sich immer zuletzt, um seine Armmuskeln noch einmal so richtig aufzupumpen. Er machte geradezu erstaunliche Fortschritte und inzwischen hatte er sich vom Trainer auch überreden lassen, seine tägliche Eiweißration mit Schokoladengeschmack runterzuwürgen. Fünfundvierzig Mark für ein bisschen Eiweißpulver kam ihm reichlich viel vor, aber immerhin, sein Körper entwickelte sich großartig.
Die Vitamintabletten nahm er nicht mehr, sie waren ihm auf den Magen geschlagen.
„Wenn du jetzt am Ball bleibst, stehst du in zwei, drei Jahren auf der Posing Bühne”, orakelte der Trainer, doch trotzdem verschrieb Martin Schöller sich dem Bodybuilding nicht mit Haut und Haaren. Er lebte nicht nur für diesen Sport, so wie einige andere aus dem Studio, die dafür aßen, tranken und schliefen. Es erweiterte seine Möglichkeiten, gab ihm Selbstbewusstsein und das Gefühl, den Hollywood-Helden näher zu kommen. Aber der Gedanke, seine Muskeln niemals wirklich gebrauchen zu können, deprimierte ihn. Er trainierte für einen Ernstfall, den es nicht mehr gab. Der starke Recke, der die Prinzessin vor dem übel riechenden Drachen rettete, gehörte der Vergangenheit an. Bestenfalls. Wahrscheinlich erzählten auch die Sagen nur davon, wie die Männer damals gerne gewesen wären. Und vielleicht waren sie damals schon genau solche Stubenhocker wie wir heute ... Vielleicht würden in hundert Jahren die Menschen unsere Hollywood Videos sehen und denken: Das waren noch Zeiten, als man Abenteuer erleben konnte, als dem Mutigen die Welt gehörte, als das Böse immer verlor. Was es den Guten einfach machte, mutig zu sein.
Martin Schöller hatte sich die eher dunklen Haare hellblond färben lassen, und seitdem ringelten sich auch Löckchen auf seinem Kopf. Günther Ichtenhagen fand das albern. Wenn man mit sechsundzwanzig Jahren gesund, zeugungsfähig, aber ohne Beruf und eigenes Einkommen in Ichtenhagen festsaß, hatte man keinen Grund, den Weltmann zu spielen. Mit Schulterpolstern, weiten Ärmeln und V-förmig geschnittenen Oberteilen versuchte Martin Schöller, die Formen seines muskulösen Oberkörpers zu unterstreichen. Schließlich konnte er nicht immer im Muskel-T-Shirt herumlaufen.
Für einen Samstagabend – zwanzig Uhr – war es merkwürdig leer in der Linde. Sogar zwei Skatspieler fehlten noch: Hans Wirbitzki und Wolfhardt Paul, von allen Wolfi genannt. Martin Schöller schob Günther Ichtenhagens Essgeschirr zur Seite, rieb sich die Hände und sagte:
„Na, was ist – spielen wir schon mal einen?”
„Dir sitzt das Geld wohl zu locker”, stichelte Hermann Segler.
„Bis zwölf Uhr hab ich euch alles abgenommen, was ihr in den Taschen habt, hahaha, und dann geh ich noch in den Club! Ich erzähl euch beim nächsten Mal, wie es war, hahaha.”
„Aber vorher zahlst du deine Schulden in die Lottokasse!”
Hermann Segler blickte Martin Schöller zu ernst an, als dass dieser es für einen Scherz halten konnte, trotzdem witzelte Martin Schöller:
„Nun hab dich mal nicht so! Wenn wir sechs Richtige im Lotto haben, zahlst du mir meinen Anteil aus und ich begleich davon sofort meine Lottoschulden. Ha! Ha! Ha!”
„Nee, nee, damit das gleich ganz klar ist. So läuft das nicht. Wer vor der Ziehung nicht bezahlt hat, nimmt auch nicht an der Ausschüttung teil.”
Grinsend zog Martin Schöller sein Portemonnaie aus der Tasche und warf es auf den Tisch.
„Na, das wär ja wohl ein Witz. Da spiel ich jede Woche mit euch zusammen Lotto, und wenn ihr sechs Richtige habt, sagst du ätsch, Schöller, du hast aber vergessen zu bezahlen, hahaha. Juristisch gesehen geht das gar nicht. Wir sind nämlich eine Tippgemeinschaft. TG steht auf jedem Lottoschein. TG Lindestammtisch.”
Hanne Wirbitzki brachte drei Bier und lästerte:
„Man soll das Fell des Bären nicht verkaufen, bevor man ihn gefangen hat. An deiner Stelle würde ich jetzt gar nichts mehr bezahlen, Martin. Rechne mal aus, was du da im Laufe deines Lebens sparst, wenn du jede Woche den Einsatz zur Sparkasse bringst, statt ihn zu verspielen.”
„Wo bleibt Hans eigentlich”, fragte Günther Ichtenhagen nicht ohne Sorge in der Stimme. Wenn es Hans wirklich schlecht gegangen wäre, hätte Hanne sicherlich schon etwas gesagt, statt hier Witzchen zu machen; aber seit Günther Ichtenhagen seinen Körper und seine Gesundheit genauer beobachtete, machte er sich auch um andere Leute größere Sorgen.
Hans Wirbitzki war vor mehr als zehn Jahren nach Ichtenhagen gezogen. Jeder kannte seine Geschichte. Er kam aus dem Bergbau. Aus dem Ruhrgebiet. Die Zeche, in die er achtzehn Jahre lang, ohne ein Mal unpünktlich zu sein, eingefahren war, hatte dichtgemacht. Die billigen Wohnungen auf dem Land und der Sozialplan ermöglichten es Hans Wirbitzki und seiner Frau Hanne, nach Ichtenhagen zu ziehen.
Günther Ichtenhagen beneidete Hans Wirbitzki oft um seine fleißige, aktive Frau. Wochentags arbeitete sie in der Kreisstadt als Verkäuferin in einem Schuhgeschäft, abends besuchte sie die anderen Frauen im Dorf – sehr zum Leidwesen von deren Männern, denn sie war Avon-Beraterin und verließ kaum einen Haushalt ohne Seifen, Wässerchen und Pülverchen mitsamt einer gesalzenen Rechnung dazulassen.
Samstags und sonntags kellnerte sie in der Linde, und so waren die Wirbitzkis gemessen an ihrem Besitzstand in Ichtenhagen zwar Habenichtse, doch jeder erkannte den Fleiß der Frau an, die zusätzlich noch ihren ständig kränkelnden Ehemann versorgte.
Seit der Bergbaukrise arbeitete Hans Wirbitzki nicht mehr. Wenn er von seiner früheren Arbeit redete, dann mit den Worten: „Der Scheiß Pütt”.
Der war überzeugt davon, seine Gesundheit unter Tage gelassen zu haben. Trotz der frischen Luft hier in Ichtenhagen war sein Gesicht grau. Seine Lunge rasselte bei jedem Atemzug. Er nannte es Steinstaub, und obwohl er Schleim aushustete, rauchte er abends beim Skat Zigarren. Sechziger Fehlfarben.
„Der guckt noch die Sportschau”, beruhigte Hanne die Skatspieler.
„Schon vorbei”, bemerkte Martin Schöller, der immer erst nach der Sportschau in die Linde kam.
Hanne Wirbitzki schien dadurch nicht im Geringsten beunruhigt, sie wischte sich die biernassen Finger an der Schürze ab und sagte gleichgültig:
„Vielleicht ist er wieder vorm Fernseher eingeschlafen. Das passiert in letzter Zeit immer öfter.”
Hermann Segler wollte noch etwas zu ihr sagen, aber aus der Küche rief man bereits wieder nach ihr.
„Hanne! Wo bleibst du denn? Der Salat wird welk!”
Mit diesem Standardwitz wurde sie samstags, wenn die Geschäfte gut gingen, mindestens zwanzigmal in die Küche zitiert.
Wolfhardt Paul stampfte herein, wie es sich für einen bodenständigen Landwirt gehörte. Er war immer noch stolz darauf, Bauer zu sein, obwohl er längst nicht mehr von der Landwirtschaft leben konnte. Aber er hatte nicht verkauft wie so viele andere. Er verpachtete seine Wiesen auch nicht, und er vermietete sie nicht als Campingplatz an Touristen. Das fehlende Kleingeld holte seine Frau bei der Bundespost herein. Sie betrieb die Ichtenhagener Poststation. Er fragte sich immer, wann man diese kleine Station schließen würde. An guten Tagen verkaufte sie zehn Briefmarken. An schlechten gar keine, und die schlechten Tage überwogen. Gäbe es nicht einige Zeitschriftenabonnements, bräuchte der Postbus ihr Dorf an manchen Tagen gar nicht anzufahren. Vorigen Winter, als der Schnee kniehoch lag und seine Frau mit einer bösen Grippe zu kämpfen hatte, ließ er sich von ihr breitschlagen und trug morgens im Dorf zwei Pakete aus. Seitdem fanden es einige Leute lustig, ihn „Herrn Oberamtmann” oder „unseren Postillion” zu nennen, was ihn fuchsteufelswild machen konnte.
Er war Bauer und kein Postbote!
Hermann Segler hob ab, und Martin Schöller gab. Drei, zwei, drei, zwei. Günther Ichtenhagen fand das nicht korrekt. Er gab vier, drei, drei. Er fand, das gehöre sich so.
Dann sah er zu, wie Martin Schöller seine Karten auffächerte und zusammensteckte. Da er selbst den Kreuz-Buben hatte, gehörte nicht viel dazu zu ahnen, dass die drei Karten, die Martin Schöller so sorgfältig zu Anfang hintereinander hielt, Pik-, Herz- und Karo-Buben waren. Dazu kamen vier andere Trümpfe. Günther Ichtenhagen tippte auf Pik. Die restlichen drei Karten gehörten nicht zusammen, waren sozusagen Abfall. Bestimmt würde er die letzten zwei gegen den Skat austauschen, falls er ans Spiel kam.
Kaum hatte Günther Ichtenhagen achtzehn gesagt, maulten hinten bereits wieder die Fernsehgucker:
„Nicht so laut!”
Er begriff nicht, warum diese Leute in die Kneipe gingen. Fernsehen konnten sie zu Hause billiger und bequemer. Ihn störte es nicht, wenn der Fernseher lief. Aber dass sie jetzt nur noch flüstern durften, damit die ihren Krimi verfolgen konnten, sah er überhaupt nicht ein. Wie jeden Samstag rief er auch jetzt zum Fernsehtisch:
„Ihr kriegt noch einen viereckigen Kopf! Verlasst euch darauf!”
Die Fernsehgucker ließen sich dadurch natürlich nicht beeindrucken, sondern winkten nur gelangweilt ab.
Gegen einundzwanzig Uhr, Günther Ichtenhagen lag bereits mit zweihundertzehn Punkten vorn, betrat Hans Wirbitzki noch unausgeschlafen das Lokal, schielte kurz zu seiner Frau, nickte ansatzweise und setzte sich zu seinen Freunden. Hanne Wirbitzki bediente ihren Mann scheinbar wie alle anderen Gäste. Vielleicht musste man so viel Menschenkenntnis haben wie Günther Ichtenhagen, um zu sehen, dass sie das Bierglas vorwurfsvoll vor Hans Wirbitzki auf den Deckel setzte, und dass er mit einem gewissen triumphierenden Trotz trank.
Er hatte wie immer schwarze Ränder unter den Fingernägeln. Wenn er gab und aussetzte, spielte er mit dem Skat. Meist bog er die zwei Karten, bis sie fast knickten, zu einer Tüte und schälte sich mit dem spitzen Ende den Dreck unter den Fingernägeln weg. Günther Ichtenhagen fand das abstoßend. Es hatte deswegen schon mehrfach Streit gegeben. Wenn er seinen Skatbruder zurechtwies, führte er nur die Spielkarten ins Feld, die schließlich dabei beschädigt wurden. Seinen Ekel verschwieg er.
Martin Schöller nannte das: „Hans zinkt schon wieder die Karten.”
Hans Wirbitzki zuckte dann jedes Mal zusammen, ließ die Karten auf den Tisch klatschen und versuchte, seine Hände zu verstecken. Im Laufe des Abends vergaß er den Zwischenfall aber und begann erneut mit dem Reinigen seiner Fingernägel. Dann benutzte er entweder Streichhölzer oder die Kanten von Bierdeckeln.
Punkt zweiundzwanzig Uhr kam die Ziehung der Lottozahlen. Jetzt rief Hermann Segler zu den Fernsehguckern:
„Macht doch mal lauter!” Dabei drehte er sich nicht zum Apparat um, sondern sortierte weiter seine Karten. Er hatte ein Bombenblatt in der Hand.
Auch Wolfhardt Paul sah keinen Grund, das Spiel zu unterbrechen. Mindestens ein Kontra war bei seiner Karte drin. Günther Ichtenhagen glaubte ohnehin nicht an einen Lottogewinn. Er frotzelte nur mit Martin Schöller:
„Na, hast du endlich bezahlt, mein Kleiner? Ich fürchte, sonst bist du gleich nicht bei den glücklichen Gewinnern.”
Dann sah er wieder in seine Karten.
Hans Wirbitzki zog den Lottoschein aus der Tasche und ging zum Fernseher. Er musste sowieso aussetzen.
Wenn nicht so ein spannendes Grand Spiel gelaufen wäre, hätten sie vielleicht bemerkt, dass Hans Wirbitzki noch nervöser zu seiner Frau Hanne hinüberschielte als sonst. Der Lottoschein brannte fast in seinen Fingern. Er hatte Mühe, ihn festzuhalten und sich nichts anmerken zu lassen. Schon nachdem die dritte Kugel gefallen war, wusste er, dass sie drei Richtige hatten und spürte den heißen Hauch des Glücks. Auch die nächste Kugel würde eine ihrer Zahlen aufweisen. Er ahnte es. Und tatsächlich, da war sie!
Später schilderte er den anderen diese Situation immer wieder aufs Neue. Er wusste, dass die nächste Kugel für sie fallen würde! Und er fasste bereits den Entschluss, in der Kneipe kein Wort zu sagen.
Nicht weil er zu knauserig war, von dem Geld einen auszugeben, nein, er hatte Angst, sein Anteil würde gleich von seiner Frau übernommen, die damit sicherlich etwas sehr Vernünftiges anzufangen wusste, und genau das wollte er verhindern.
Das Wort zum Sonntag lief schon, als die anderen immer noch nichts von ihrem Gewinn ahnten.
Günther Ichtenhagen bekam die Punkte aufgeschrieben. Hans Wirbitzki trank sein Bierglas leer.
„Ich muss mal an die frische Luft.”
„Ist dir schlecht? Soll ich mitkommen?”
„Wenn du willst.”
Martin Schöller protestierte laut:
„Hey, hey, hey, ihr könnt jetzt nicht abhauen! Wir sind mitten im Spiel! Was sind das denn für Sitten! Seit wann hören wir samstags schon um zehn Uhr auf?”
Hans Wirbitzki ging nicht nach draußen. Sondern zur Toilette; besorgt folgte Günther Ichtenhagen ihm.
Er hasste den beißenden Geruch von Chlor. Jedes Mal, wenn er diese Toilette betrat, wünschte er sich in seinen Garten an seinen Teich zurück. Er atmete flach und so wenig wie möglich.
„Was hast du? Ich mach mir Sorgen um dich. Dir geht’s in letzter Zeit gar nicht gut, oder?”
„Du, Günther, wir – wir haben gewonnen.”
„Du meinst, ich bin dabei zu gewinnen, beim Skat ...”
Erst jetzt begriff er. „Du meinst ...?”
„Klar”, nickte Hans Wirbitzki, „im Lotto.”
„Wie viel Richtige? Du guckst ja so – also, jetzt spann mich nicht auf die Folter! Du wirst doch hier nicht für drei Richtige ...”
„Nicht drei, Günther, fünf. Fünf Richtige!”
Ehrlich erfreut klatschte Günther Ichtenhagen seinem Kumpel mit der flachen Hand auf die Schulter. Bei dem Gedanken, sie könnten sechs Richtige haben, war er erschrocken. Er fühlte sich schon zu alt für so große Veränderungen. Er brauchte keine sechs Richtigen mehr. Hatte ein Haus und seine Pension und dazu mäßige Ansprüche. Aber fünf Richtige, das war etwas. Darüber konnte man sich freuen. Fünf Richtige reichten nicht aus, um das Leben durcheinander zu bringen, wohl aber, um sich etwas zu gönnen, sich eine Freude zu machen.
„Warum sagst du mir das hier auf der Toilette? Das ist nicht geheim. Wir müssen den anderen sofort ...”
Er lachte hell auf.
„Wir können uns um eine Lokalrunde drücken, meinst du! Wenn wir die Sache als Geheimnis behandeln?”
Hans Wirbitzki schüttelte den Kopf.
„Nein, Günther, aber meine Frau kellnert da drin.”
„Na und? Soll sie es nicht erfahren?”
Hans Wirbitzki zuckte mit den Schultern.
„Ich dachte ja nur ... Wolfi wär’s sicher auch recht, wenn er ein paar Blaue hätte, von denen seine Frau nichts weiß. Dir kann’s natürlich egal sein, du bist Witwer ... Und wenn Hermann mit einem Lottogewinn nach Hause kommt, steckt seine Alte sowieso alles in den Lebensmittelladen. Und Martin kann seinen Gewinn als Kostgeld an die Eltern abdrücken, wollen wir wetten?”
„Vielleicht hast du Recht ... Wir sollten die Sache wirklich erst mal für uns behalten.”
Wieder an den Stammtisch zurückgekehrt, setzte sich Günther Ichtenhagen erst gar nicht mehr. Der Pastor hatte zu Ende gepredigt, das Fernsehen brachte jetzt eine Rock ‘n’ Roll Sendung und war noch lauter aufgedreht als sonst.
Mit einem Blick auf den Fernseher sagte Günther Ichtenhagen:
„Wisst ihr was, ich lad euch zu mir ein, auf ein Glas Wein.”
Das war unüblich. Zwar trafen sie sich manchmal in seinem Haus, aber samstags, wenn der Skatabend bereits begonnen hatte, war die Runde bisher nie abgebrochen worden.
„Oh”, kommentierte Hermann Segler, „auf ein Gläschen Wein! Gibt’s da was zu feiern?”
Martin Schöller, der schon sieben Striche auf seinem Bierdeckel hatte und auch beim Skat wieder dick in den Miesen stand, witterte ein kostenloses Besäufnis und stand gleich auf. Seine Bodybuilding Ambitionen hinderten ihn nicht daran, sich freitags und samstags einen Vollrausch anzutrinken. Meist steckte ihm seine Mutter fürs Wochenende zwanzig oder dreißig Mark zu. Sie zwackte es von der Haushaltskasse ab und fand sich großzügig. Aber es reichte kaum, um davon blau zu werden. Nicht einem Kerl wie ihm.
Wolfhardt Paul ging das alles viel zu schnell, er wollte erstmal in Ruhe austrinken und eigentlich auch gar nicht aus der Kneipe weg, aber die anderen zogen ihn mit hinaus; hier in der Linde brauchten sie nicht jedes Mal zu bezahlen, bevor sie gingen. Wenn sie genügend Geld in der Tasche hatten, beglichen sie alle Deckel auf einmal.
Von der Linde bis zu Günther Ichtenhagens Häuschen waren es knapp zweihundert Meter. Unterwegs schwieg Hans Wirbitzki verbissen. Er hatte Angst, wenn er jetzt mit der Information rausrückte, könnte Martin Schöller mit einem Freudenschrei das ganze Dorf und das Nachbardorf auf ihren Lottogewinn aufmerksam machen.
Der Gedanke, Geld zu haben, von dem seine Frau nichts wusste, wurde für ihn immer verlockender. Er konnte schon kaum noch begreifen, wie er es bisher ausgehalten hatte, über jede Mark Rechenschaft ablegen zu müssen.
Da er außer der Linde keine Gaststätten besuchte, wusste seine Frau stets besser als er, wie viel er schon durch seine Kehle gejagt hatte.
Plötzlich empfand er diese Situation als demütigend.
2
Nur Paul genehmigte sich einen Roten. Die anderen lehnten Wein ab. Zwar hatte Günther Ichtenhagen immer einen Kasten Bier im Keller stehen, doch der war nicht mehr ganz voll und auf ein richtiges Besäufnis war er nicht eingerichtet.
Plötzlich standen alle unter dem Druck, durcheinanderreden zu müssen und dabei so schnell wie möglich ihr Blut mit Alkohol zu verdünnen.
„Wie viel gibt es eigentlich für fünf Richtige?”
„So fünftausend bestimmt.”
Martin Schöller strahlte: „Das wären ja tausend für jeden. Wow. “
„So ein Quatsch”, protestierte Hermann Segler. „Ich wette, wir kriegen fünfzehn, ja! Zwanzigtausend Mark!”
Der Glanz in Martin Schöllers Augen kam nicht nur vom Bier. Hans Wirbitzki winkte ab.
„Nein, so viel gibt’s nicht.”
„Ruf doch mal einer bei der Lottozentrale an”, schlug Wolfhardt Paul vor.
Obwohl das einleuchtend war, beschwichtigte Günther Ichtenhagen seine Freunde und sagte:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
![Ostfriesenkiller [Ostfriesenkrimis, Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/dbd8a314f66948901aaa600a8c4b15f3/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenblut [Ostfriesenkrimis, Band 2] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6b5a4619bee82380ac4b783fbd8a5858/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenwut [Ostfriesenkrimis, Band 9 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d449130c695ea6a9907a9ea91fa7248d/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenfalle [Ostfriesenkrimis, Band 5] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4042741b3a9aa08fcc77449f2070c1bb/w200_u90.jpg)
![Ostfriesengrab [Ostfriesenkrimis, Band 3] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9a5c8f0bf03c26533a54f512ff342109/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenangst [Ostfriesenkrimis, Band 6] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/34271859184fc863a6885723313d82cf/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d3958465827dd46646bbdbea0658d80b/w200_u90.jpg)
![Ostfriesentod [Ostfriesenkrimis, Band 11 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0cbd7afab4c4f0767956186621b50dae/w200_u90.jpg)
![Totenstille im Watt. Sommerfeldt taucht auf [Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4f2087e48a583b582212567c9a28a6a0/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0c2377f30527a0cf66dd220218c3d294/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f7d8467eb4703c48ed48db68c0516d2f/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c256875a5ae7a11697130fc4974ec2c0/w200_u90.jpg)
![Ostfriesensünde [Ostfriesenkrimis, Band 4] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b1d85201215670f9610ba2920d58d75/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenmoor [Ostfriesenkrimis, Band 7 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18097dd3d217a1e2ca8fe50d64068b0f/w200_u90.jpg)

![Todesspiel im Hafen. Sommerfeldt räumt auf [Band 3] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/04fb798a55c759505dbed5f88be19287/w200_u90.jpg)

![Ostfriesengier [Ostfriesenkrimis, Band 17 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/dd092e493fc6e39498ffd17de3301947/w200_u90.jpg)









