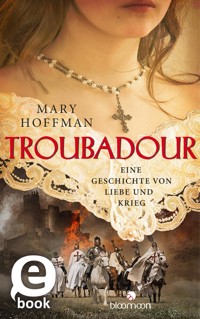
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bloomoon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Südfrankreich im 13. Jahrhundert. Elinor liebt Bertran, den Troubadour, doch für ihre Eltern kommt eine solche Verbindung nicht infrage. Stattdessen soll die 13-Jährige einen älteren Adligen heiraten. Doch Elinor nimmt ihr Glück selbst in die Hand, flieht und macht sich auf die Suche nach Bertran.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mary Hoffman
Troubadour
Eine Geschichte vonLiebe und Krieg
Aus dem Englischen von Eva Riekert
Für Rebecca Lisle und Linda Strachan,die beiden anderen Seiten des Triest-Dreiecks
Quand les hommes vivront d’amour,Ce sera la paix sur la terre,Les soldats seront troubadours,Mais nous, nous serons morts, mon frère
Wenn die Menschen in Liebe leben,Wird auf Erden Friede seinSoldaten werden zu Troubadouren,Wir jedoch, mein Bruder, sind dann nicht mehr
Raymond Lévesque
Inhalt
Prolog: Ein tödlicher Schlag
TEIL EINS: Donzela
Kapitel eins: Liebeslied
Kapitel zwei: Abschied
Kapitel drei: Entscheidungen
Kapitel vier: Wenn Wünsche Pferde wären
Kapitel fünf: Joglar
Kapitel sechs: Geißblatt
Kapitel sieben: Zwei Reisen
TEIL ZWEI: Trobairitz
Kapitel acht: Flucht
Kapitel neun: Amistat
Kapitel zehn: Cortesia
Kapitel elf: Dolor
Kapitel zwölf: Belagerung
Kapitel dreizehn: Die Nachtigall von Carcassonne
Kapitel vierzehn: Planh
TEIL DREI: Domna
Kapitel fünfzehn: Der Weg nach Monferrato
Kapitel sechzehn: Ein neuer Herr
Kapitel siebzehn: Zwei Burgen
Kapitel achtzehn: In Grün
Kapitel neunzehn: Liebesbeweise
Kapitel zwanzig: Der Magnet
Kapitel einundzwanzig: Herrin von Selva
Epilog: Aller guten Dinge sind drei
Geschichtlicher Überblick
Personenliste
Glossar okzitanischer Wörter
Glossar mittelalterlicher und französischer Worte
Danksagung
Über die Autorin
Impressum
Prolog
Ein tödlicher Schlag
15. Januar 1208
Eine kleine Gruppe von Mönchen strebte der Flussüberfahrt zu. Sie trugen die unverkennbaren weißen Kutten der Zisterzienser, auch wenn die Farbe schon eher ein schmutziges Grau war. Ihr Anführer, Pierre de Castelnau, ritt auf einem Maultier, doch er war keineswegs ein bescheidener Mann.
Als die Mönche das Ufer der Rhône erreichten, konnten sie sehen, dass die Fähre bereits auf dem Rückweg zu ihrem Ufer war. Die Gruppe ließ sich nieder, um zu warten. Der Anführer stieg vom Maultier und rieb sich mit den Händen übers Gesicht. Er war sowohl ungehalten als auch müde. Es war noch früh am Morgen, und er hatte die Messe nüchtern zelebriert, wenn auch mit wenig wohlwollenden und barmherzigen Gefühlen.
Pierre und seine Gefährten waren von Saint-Gilles gekommen. Er war vom Papst gesandt worden, als Legat, um mit Saint-Gilles’ mächtigem Herrscher, dem Grafen von Toulouse, zu verhandeln, doch der Graf hatte sich als unbelehrbar erwiesen. Er wollte dem Befehl des Papstes einfach nicht Folge leisten, die Ketzer aus seinem Land zu verjagen, und das, obwohl er selbst schon exkommuniziert war, weil er sich dem Papst widersetzt hatte. Pierres Auftrag war fehlgeschlagen.
Was kann man anstellen mit einem Mann, der sich nicht fürchtet, vom Kirchenoberhaupt verstoßen zu werden?, dachte Pierre. So ein Mann ist praktisch selbst ein Ketzer. Die letzten Worte des Grafen, die er dem päpstlichen Legaten am Tag zuvor nachgerufen hatte, als dieser den Hof in Saint-Gilles verließ, waren folgende gewesen: »Wohin Ihr geht und was Ihr auch tut, Pierre de Castelnau, nehmt Euch in Acht! Ich werde Euch im Auge behalten.«
Leere Drohungen, überlegte Pierre, der die Nacht mit seinen Gefährten in einem Gasthaus zugebracht hatte, ehe sie zum Fluss aufgebrochen waren. Von der anderen Uferseite, von Arles, würde er sich auf die lange Reise nach Rom machen und dem Papst berichten, dass der Graf weder seinem Gebieter auf Erden noch seinem himmlischen Herrn gehorchen wollte. Der Graf war einfach ein ungehobelter Starrkopf, aber Pierre hatte keine Angst vor ihm.
Die Fähre näherte sich dem Ufer. Sie trug nur einen Passagier, einen hübschen jungen Mann, der kaum über dreißig war. Er hatte aristokratische Züge, wenn seine Kleider auch nicht mehr in bestem Zustand waren. Bertran de Miramont achtete nicht besonders auf die Gruppe an der Uferböschung. In diesen Tagen wimmelte es von Mönchen, die sich sowohl in die Politik als auch in die Religion einmischten. Bertran versuchte sich möglichst nicht mit ihren Angelegenheiten zu befassen. Aber wie so viele Menschen der Region hatte er seine Gründe, warum er mit diesen Mönchen nicht in Verbindung gebracht werden wollte.
Daher wandte er den Kopf ab, um einen Augenkontakt mit der Gruppe zu vermeiden. Er würde förmlich das Haupt neigen, wenn er das Pferd von der Fähre geleitete, aber er wollte nicht in irgendeine Form von Gespräch mit den Zisterziensern verwickelt werden, schon gar nicht mit dem asketisch aussehenden Anführer.
Und aus diesem Grund war es Bertran, der als Erster sah, wie ein Mann im gestreckten Galopp aus dem Wald auf die Mönchsgruppe zuritt. Er hielt ihn für einen Kurier mit einer dringenden Botschaft, bis er die Lanze sah. Der Reiter verlangsamte sein Tempo nicht, sondern hielt direkt auf den Mann neben dem Maultier zu.
Bertran stieß einen Warnruf aus, und der Zisterzienser blickte in seine Richtung und sah ihn durchdringend an, da durchbohrte die Lanze des Reiters seinen Rücken und warf ihn auf die Knie.
»Schneller, schneller!«, rief Bertran dem entsetzten Fährmann zu und sprang vom Boot, sobald sie das seichte Ufer erreicht hatten. Er rannte durch das aufspritzende Wasser an Land und sah noch, wie der Mörder seine Lanze aus dem Körper riss, sein Pferd umwendete und in den Wald zurückstob.
Der sterbende Mönch, dessen Kutte sich jetzt alarmierend verfärbte, machte eine Drehung, um zu sehen, wohin sein Angreifer verschwunden war. Gestützt auf seine Gefährten, rief er dem abziehenden Reiter mit dem letzten Atemzug seiner Lungen nach: »Möge Gott dir vergeben, so wie ich dir vergebe!«
Bertran, dessen spezielles Metier das Wort war, hatte noch Zeit für den flüchtigen Gedanken, dass die Aussage des Mönchs auf kluge Weise zweideutig war, dann brach das Auge des getroffenen Mannes, und die Seele verließ seinen Körper.
Unter den Umstehenden brach Chaos aus: Die Mönche wussten nicht, ob sie beten oder klagen oder den Angreifer verfolgen sollten; Bertran, der tropfnass war, bot seine Dienste an, und der Fährmann führte sein Pferd für ihn von der Fähre.
»Bitte, Herr«, sagte einer der älteren Kirchenmänner; Bertran sah, dass er einen Bischofsring trug. »Verfolgt den Schurken. Denn er hat den Repräsentanten des Papstes umgebracht. Hier auf dem Boden liegt Pierre de Castelnau, der von Seiner Heiligkeit, Papst Innozenz, zum Grafen von Toulouse gesandt wurde.«
»Und hinter der Lanze steckte die Hand des Grafen, auch wenn ein anderer sie geschwungen hat«, sagte ein anderer Mönch verbittert. Ein weiterer übergab sich unauffällig in den Fluss.
Bertran war bestürzt. Er war ein Troubadour, ein Meister der Worte und Noten, weder Politiker noch Ritter. Er hatte seine Hilfe angeboten, um einen Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen, und er würde sein Bestes tun, um den Mann ausfindig zu machen. Aber das Opfer war ein erbitterter Feind, Feind all derer, die wie Bertran ein gefährliches Geheimnis hüteten, eines, das mit jedem Tag gefährlicher wurde.
Und schon, als er sich völlig durchnässt in den Sattel schwang und seinem Pferd in Richtung Wald die Sporen gab, wusste Bertran, dass die Szene, deren Zeuge er soeben geworden war, erst der Anfang war, ob er den Schuldigen fangen würde oder nicht.
Denn er war ein Andersgläubiger, ein Ketzer, und Papst Innozenz hatte gelobt, alle Ketzer auszurotten. Der Mord an Pierre war nur das erste Blutvergießen in einem Krieg auf Leben und Tod.
TEIL EINS
Donzela
Am liebsten führten die Troubadoure das Wanderleben der Reinen, die zu zweit die Wege bereisten.
Aus: Denis de Rougemont, Die Liebe und das Abendland
Kapitel eins
Liebeslied
Der auf einem Berg gelegene Ort Sévignan war nicht von einem großen Landbesitz umgeben. Lanval de Sévignan war nur ein kleinerer Lehnsherr, doch innerhalb der Mauern seiner Stadt war er der absolute Herrscher. Und innerhalb seiner Burg war sein Wort Gesetz.
Es sei denn, befand er bisweilen, wenn es um seine ältere Tochter ging. Seine Frau Clara war eine vorbildliche Ehefrau; sie hatte ihm als Erstes einen Sohn geboren, Aimeric, und darauf zwei Töchter, Elinor und Alys. Und obwohl Seigneur Lanval wohl einen weiteren Sohn vorgezogen hätte, um sicherzugehen, dass seine Linie fortbestehen würde, waren weitere Schwangerschaften nicht erfolgt, und er war mit seinem Los zufrieden. Aimeric war ein gesunder, kräftiger Sechzehnjähriger, der sich auf die Waffen verstand und bereit war, das Anwesen seines Vaters zu verteidigen oder das eines jeglichen Adligen in der Gegend, der um Hilfe bat.
Alys mit ihren elf Jahren war eigentlich die Einzige, die noch ein Kind war. Aber selbst die dreizehnjährige Elinor war noch weit davon entfernt, erwachsen oder gar zur Heirat bereit zu sein, weder ihrer Neigung noch ihren Fähigkeiten nach. Sie war eigensinnig, stur und stets im Konflikt mit ihrer Mutter. Es gab Momente, da hatten beide Eltern das Gefühl, dass sie eigentlich ein Junge hätte werden sollen. Und sie war leidenschaftlich. Lanval war sicher, dass sie einigen seiner Ritter bereits unzüchtige Blicke zugeworfen hatte, einschließlich der drei Knaben, die er für einen anderen örtlichen Lehnsherr in Pflege genommen hatte, der gesegneter mit Söhnen war als der Seigneur von Sévignan.
Vielleicht sollte man Elinor tatsächlich schon verheiraten, überlegte ihr Vater, aber im Augenblick machten ihm ernstere Angelegenheiten Sorgen. Er hatte bereits eine Truppe Spielleute samt ihrem Troubadour über die Winterszeit im Haus, aber vor ein paar Tagen war unerwartet Bertran de Miramont eingetroffen. Dessen Art war es eigentlich nicht, im Januar den Hof zu wechseln. Daher wusste Lanval, kaum, dass Bertran in den Burghof eingeritten war, dass sein Erscheinen nichts Gutes bedeutete.
Aber es war schlimmer, als er befürchtet hatte: Der päpstliche Legat ermordet und der Graf von Toulouse unter Verdacht! Bertran war dem Angreifer hart auf den Fersen gewesen, hatte ihn dann aber in Beaucaire verloren.
»Ihr habt den Mönchen doch nicht Euren Namen gesagt, oder?«, war Lanvals erste Frage gewesen.
»Sie haben mich nicht danach gefragt, Herr.«
»Und der Fährmann?«
»Der kennt mich sehr gut. Ich fahre oft nach Saint-Gilles, wenn ich an Graf Alfonsos Hof in Arles bin.«
»Und wie lange, ehe die Kunde von dem Mord Rom erreicht?«, fragte Lanval.
»Nicht lange«, sagte Bertran. »Und dann müssen wir alle auf der Hut sein.«
+++
Elinor versuchte die estampida, einen lebhaften Tanz, zu erlernen, aber sie verhedderte sich ständig mit den Füßen im Saum ihres Kleides. Was noch ärgerlicher war: Alys beherrschte den Tanz bereits perfekt. Heute war der Tag eines Heiligen – das Fest des heiligen Bertran von Saint-Quentin –, und in der großen Halle ihres Vaters sollte es Tanz und Musik und ein erlesenes Mahl geben. Elinor würde zum ersten Mal als das junge Burgfräulein in Erscheinung treten. Alys war zu jung, um dabei zu sein und mitzutanzen. Aber da sie nicht nur leichtfüßiger, sondern auch größer als ihre ältere Schwester war, wünschte Elinor von ganzem Herzen, dass sie selbst dem Ereignis fernbleiben und stattdessen Alys hinschicken könnte.
Natürlich würde sie dem Abend nicht wirklich fernbleiben – konnte es gar nicht. Sie hätte es einfach nur vorgezogen, von der dunklen Nische aus zuzusehen, von der sie die Feierlichkeiten des Hofes von jeher beobachtet hatte und von wo sie und ihre Schwester seit ihrer Kindheit der Musik und den Gedichten gelauscht hatten: ein Versteck, aus dem sie auch Bertran de Miramont zum ersten Mal gesehen hatte.
Elinor konnte es immer noch nicht glauben, dass Bertran anwesend war, hier in der Burg, und das an seinem Namenstag. Sie hatte sich darauf gefasst gemacht, Monate warten zu müssen, bis er im Frühling wieder erscheinen würde. Aber vor ein oder zwei Tagen war sie in einer Art übersteigerter Vorahnung auf die Mauern gestiegen, die Bergfried und Wohnschloss umgaben.
Sie war in letzter Zeit oft rastlos, hatte das Gefühl, dass ihre Kindheit rasch entschwand, und bangte, welche Zukunft sie als Frau erwartete, noch dazu als Edelfrau. Der Abend war kalt gewesen, und sie hatte ihren langen pelzgefütterten Umhang enger um sich gezogen. Sie musste damit rechnen, spätestens mit vierzehn verheiratet zu werden, auch wenn ihre Eltern noch nicht mit ihr darüber gesprochen hatten. Dass sie in der großen Halle als donzela, als Burgfräulein des Hauses, präsentiert wurde, war nur der Anfang.
Im Gegensatz zu Alys verbrachte Elinor keine Zeit damit, zu spekulieren, wer ihr Ehemann werden würde. Sie wusste, dass sie keine Wahl hatte, sobald sich ihr Vater entschieden hatte. Oder eher, sobald ihre Mutter einen geeigneten Mann für sie ausgesucht hatte. Er würde älter sein, viel älter, so viel stand fest. Die Männer des Languedoc heirateten nicht, ehe sie in den Dreißigern waren, und üblicherweise waren ihre Bräute halb so alt. Und gewöhnlich waren es nur die ältesten Söhne, die heirateten. Ihr Bruder Aimeric würde wohl doppelt so alt sein wie jetzt, ehe er in der großen Kathedrale von Bézier stehen würde, eine junge Frau an seiner Seite.
Elinor seufzte. Nicht zum ersten Mal wünschte sie, als Knabe geboren worden zu sein. Dann hätte sie Ritter werden können und hätte als Zweitgeborener nicht heiraten müssen. Sie hätte sich dem Haus eines anderen Burgherrn anschließen und die Zeit damit verbringen können, mit den hübschesten Dienstmägden zu flirten und Unmengen von Hammelfleisch zu verspeisen.
Aber es nützte ja nichts, sich über unabänderliche Dinge zu grämen. Sie hatte praktisch nur zwei Möglichkeiten: zu heiraten oder in ein Kloster zu gehen. Bei dem Gedanken daran, Nonne zu werden, musste sie lächeln. Ihre Mutter würde diese Vorstellung verächtlich ablehnen. Wenn auch nicht so sehr, wie sie sich über die Erwähnung von Bertran de Miramont lustig machen würde. Troubadoure waren ja auf ihre Art schön und gut und oft auch Edelleute, wenn auch nur die jüngeren Söhne von Adligen. Die edle Clara und die anderen Frauen von Lanvals Haushalt schätzten Bertran sehr, der es auch verstand, sich bei den Rittern und Knappen beliebt zu machen. Die edle Clara zog seine Kompositionen denen anderer Sängerpoeten vor. Als Frau des Burgherrn war sie seine domna, seine Inspiration für Liebeslieder und die Herrin seines Herzens – zumindest offiziell. Und er war ihr absoluter Liebling.
Aber ihre Tochter an ihn zu verheiraten? Kam nicht in Frage. Das war einer von Claras Lieblingssätzen, wenn es um ihre ältere Tochter ging, und Elinor konnte die Stimme ihrer Mutter innerlich hören, während sie die Burgmauern entlangwanderte. »Einen Troubadour heiraten? Kommt nicht in Frage!«
Und in dem Augenblick hatte sie ihn gesehen, wie er in gestrecktem Galopp auf die Burg zugeritten kam. Sie hätte Bertrans Pferd und Farben überall erkannt. Elinor hatte die Mauern eilig verlassen, ihn aber an jenem Abend nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ein- oder zweimal seither hatte sie zwar seine vertraute moosgrüne Samtjacke erblickt, aber heute Abend bei dem Fest würde sie ihn auf jeden Fall sehen.
Und vielleicht ihm gegenüber tanzen. Die Vorstellung reichte, um ihre ungehorsamen Füße wieder stolpern zu lassen, und jetzt war es an dem Tanzlehrer, zu seufzen.
+++
Perrin war ein joglar, ein Barde, einer der Spielleute, die den Winter in Sévignan zubrachten. Er war es gewohnt, die neuen Kompositionen von Bertran vorzutragen, aber wie jedermann war er überrascht, diesen so früh im Jahr auftauchen zu sehen. Schon kurz darauf suchte ihn der Dichter auf und nahm ihn mit in die Stallungen, wo sie reden konnten, ohne belauscht zu werden.
»Ermordet?« Perrin hörte die Nachricht mit Entsetzen. Er war ein junger Mann, fast noch ein Knabe, begriff aber schnell, was das für die Andersgläubigen bedeutete, zu denen sie gehörten. »Die Vergeltung wird nicht auf sich warten lassen!«
»Und sie wird blutig sein«, stimmte ihm Bertran zu. »Ich darf nicht bleiben, sondern reise ab, sobald das Heiligenfest vorüber ist. Jemand muss die Nachricht unseren anderen Brüdern und Schwestern überbringen.«
»Aber was können sie tun?«, fragte Perrin.
»Sie können die Gläubigen warnen«, sagte Bertran und senkte die Stimme noch mehr. Aufmerksam sah er sich im Stall um. Er war nicht sicher, ob das leise Klirren eines Geschirrs, das er gehört hatte, nur vom Januarwind herrührte. »Und alle Sympathisanten«, setzte er hinzu. »Wir müssen lernen, uns nichts anmerken zu lassen.«
»Welchen Grund gibst du an, dass du jetzt schon an den Hof gekommen bist?«, fragte der Barde. »Ich meine, als offiziellen Grund?«
»Aber hör mal«, sagte Bertran wieder mit normaler Stimme und lächelte. »Ich habe ein Lied für meine domna geschrieben, das keinen Aufschub duldete. Und du musst es bis heute Abend lernen.« Dann setzte er flüsternd hinzu: »Ich werde dasselbe Lied an die Höfe im ganzen Süden bringen, und manch ein joglar wird es ebenso schnell lernen müssen.«
+++
Sobald die Tanzstunde vorüber war, schlich sich Elinor nach unten in die Küche, um herauszufinden, was es zu dem großen Schmaus am Heiligenfest gab. Hugo der Koch schwitzte über den Töpfen, brüllte den Küchenjungen Anweisungen zu, mehr Holz herbeizubringen, die Grütze umzurühren und die Spieße zu drehen. Elinor wandte den Blick ab von den sich drehenden Schafen und Rindern; sie liebte ihren Anblick nicht gerade, obwohl der würzige Duft, der von dem gebratenen Fleisch aufstieg, ihr das Wasser im Munde zusammenlaufen und ihren Magen knurren ließ.
Über dem Rufen und dem Scheppern und dem allgemeinen Küchenlärm konnte sie die klagenden Klänge des Rebeks hören. In einer düsteren Ecke saß die vertraute Gestalt von Huguet, dem Spielmann. Sein Name bedeutete »kleiner Hugo«, damit man ihn von Hugo dem Koch unterscheiden konnte. Der joglar verbrachte so viel Zeit in der Küche – vor allem im Winter, weil ihm die Kälte so zusetzte –, dass Hugo und alle anderen Bediensteten ihn als selbstverständlich hinnahmen. Er gehörte so zur festen Einrichtung wie der »Pulverer«, der seine Tage damit zubrachte, Salzbrocken in feine Salzkristalle zu zerstoßen.
Huguet und Elinor waren seit Jahren gute Freunde; der joglar war nur ein paar Monate älter als sie.
Elinor schlängelte sich durch zu Huguet, wobei sie automatisch die Röcke anhob, weil der Boden mit Fett und Blut verschmiert war. Kaum erblickte er sie, da erhob er sich und verneigte sich förmlich.
»Ach, hör nicht auf zu spielen, Huguet«, sagte sie. »Tu einfach so, als sei ich nicht da.«
Das war für Untergebene nicht möglich, wie Elinor nur zu gut wusste. Ihre Anwesenheit allein reichte, um Anspannung in der Küche zu verbreiten, so dass alle ihren Aufgaben noch sorgfältiger nachgingen. Hugo wischte sich den Schweiß von der Stirn, ehe er den Teig für die Kapaunpasteten ausrollte. Die Jungen an den Bratspießen standen gerade und drehten die Spieße regelmäßiger, als hätten sie Angst, Elinor könnte ihre Arbeit begutachten.
Huguet fing wieder leise zu spielen an.
»Was ist das für eine Melodie?«, fragte Elinor, die überlegte, wie sie das Gespräch auf Bertran bringen konnte.
»Es ist die Begleitung für den neuen canso, das Minnelied«, sagte Huguet. »Eine alte Weise, neu herausgeputzt, so, als ob eine Maid ein altes Kleid mit einem neuen Band verziert. Perrin und ich haben keine Zeit, eine neue Weise zu schreiben. De Miramont will sie für sein neues Lied heute Abend.«
»Ach«, sagte Elinor wie beiläufig. »Ist er denn schon da? Sehr früh im Jahr, jetzt schon den Hof zu wechseln.«
Huguet grinste. Er und jeder andere Musikant, Sänger, Tänzer und Artist im gesamten Schloss wusste nur allzu gut, dass das Fräulein Elinor nur für den gut aussehenden Troubadour Augen hatte. Aber sie war jung, und de Miramont war ein schmucker Anblick. Nur wenige wussten, was sein Geheimnis bedeutete: Dass er wohl nie heiraten würde, auch wenn seine Lieder alle von unsterblicher Liebe handelten. Es war ein Geheimnis, das Huguet und Perrin mit ihm teilten, denn auch sie waren Andersgläubige.
»Ganz recht, Fräulein, Bertran ist hier. Er hat Perrin erzählt, dass er es nicht erwarten könne, Eurer Mutter, der edlen Clara, sein neuestes Lied vorzutragen.«
»Und bleibt er länger? Hat er den Hof in Arles ganz verlassen?«
Huguets Blick schweifte ins Ungewisse, als müsse er sich gerade auf einen schwierigen Tonartwechsel konzentrieren. »Ich glaube nicht. Er sprach davon, noch andere Höfe besuchen zu müssen.«
»Andere Höfe?«, fragte Elinor spitz. »Liebt er die Damen anderer Seigneurs so sehr, dass er ihnen allen sein neues Lied vorstellen will?«
Huguet fluchte stumm vor sich hin. Er vergaß immer, dass Elinor, jung, wie sie war, einen rasiermesserscharfen Verstand hatte, vor allem, wenn es um Bertran de Miramont ging. Er nahm sich vor, in Zukunft zurückhaltender zu sein.
Er hätte sich nicht aufzuregen brauchen. Elinor war ganz und gar fixiert auf die Ungerechtigkeit, die Tochter des Burgherrn zu sein, die donzela des Schlosses, an die man nie ein Liebeslied richten würde. Alle Troubadoure schrieben Lieder immerwährender Ergebenheit für ihre Mutter, die domna des Hauses, also die Herrin; es entsprach einfach nicht dem Brauch, jungen, unverheirateten Frauen ein Lied zu widmen.
Jedermann wusste, dass weder Bertran noch irgendein anderer Troubadour sich wirklich in Liebe zur edlen Clara verzehrte. Sie war schließlich eine alte Frau – schon über dreißig! Aber sie mussten so tun als ob, und Seigneur Lanval verstand das und hatte gar nichts dagegen. Er hätte sich in seiner Gastfreundschaft missachtet gefühlt, wenn ein Sängerpoet sich an seinem Tisch labte, ohne seine Frau zu lobpreisen.
Natürlich würde Bertran das Lied nicht persönlich singen; er war selbst von Adel, wenn auch ein armer Edelmann. Perrin würde das Lied vortragen müssen, auf dem Rebek begleitet von Huguet. Bertran würde jedoch neben ihm stehen, der edlen Clara sehnsuchtsvolle Blicke zuwerfen und vielleicht sogar seufzen. Und Elinor wollte doch, dass er ihretwegen seufzte.
Bertran war ebenfalls über dreißig, aber bei einem Mann machte das nichts aus. Ihm verdarben keine Kindsgeburten die Figur, noch bekam er andere Frauenkrankheiten, die die Farbe seiner Wangen, die Kraft seiner Stimme oder das Funkeln seiner Augen verblassen ließen. Er war einfach der bestaussehende Mann, den Elinor kannte, und sie war so verzaubert von ihm, dass sie fast genauso gerne er gewesen wäre, wie sie wollte, dass er sie wahrnahm und ein Gedicht über ihre Schönheit schrieb.
Sie musste über den Gedanken lächeln, und Huguet merkte, dass der gefährliche Augenblick vorüber war. Die Tochter seines Herrn war viel zu sehr mit ihren eigenen Wünschen beschäftigt, um seinen Versprecher in Bezug auf Bertrans Reisen zu bemerken.
+++
»Kommt nicht in Frage«, sagte die edle Clara, als Elinor fragte, ob sie dem Tanz fernbleiben und ihren Platz an Alys abtreten dürfe.
Sie blickte ihre ältere Tochter forschend an, und was sie sah, gefiel ihr nicht, wie üblich. Es war schwer für eine ehemals schöne Frau, erkennen zu müssen, dass sie ihren Platz bald an ihre Töchter abtreten musste. Clara fragte sich oft, ob es leichter wäre, wenn Elinor ihr auf irgendeine Art ähnlich wäre, stattdessen war es ihre jüngere Tochter Alys, die mehr an ihr hing. Alys war von Natur aus züchtig und vergaß nie, den Blick zu senken, wenn ein Höfling oder Ritter im Schloss an ihr vorüberging. Sie war blond und hatte graue Augen wie ihre Mutter, während Elinor eigentlich überall nussbraun war – Haare, Augen und Haut. Vergebens ermahnte ihre Mutter sie immer wieder, die Sonne zu meiden; Elinor war bei jedem Wetter draußen auf den Burgmauern. Doch die Sonnenstrahlen, die ihre Haut bräunten, taten nichts, um ihr Haar zu bleichen.
Sie hätte ein Junge werden sollen, dachte Clara, wie Aimeric, der ebenfalls dunkelhäutig und dunkelhaarig war. Beide ähnelten ihrem Vater, was jedoch bei einem Sohn nichts ausmachte. Clara sah den Teint ihres Sohnes gerne als ein Zeichen wetterfester Männlichkeit. Mädchen sollten jedoch blond und still sein, und Elinor war nicht nur ein dunkler Typ, sondern auch ungebärdig und undamenhaft. Wenn sie doch wenigstens die jüngere Tochter gewesen wäre!
»Du musst tanzen, Elinor«, sagte die edle Clara. »Wozu unterhält dein Vater denn einen Tanzlehrer? Und heute Abend hast du deine erste Gelegenheit, zu zeigen, wie die donzela des Schlosses tanzt.«
»Aber Mutter«, sagte Elinor verzweifelt, »ich verstehe mich doch gar nicht darauf!«
»Dann musst du eben üben, bis es besser wird«, sagte Clara. »Sieh her – es ist gar nicht schwer.«
Sie begann eine muntere Weise zu summen, machte ein paar Seitschritte und dann zwei zierliche Sprünge.
»Siehst du?«, sagte sie. »Ganz leicht.«
»Für Euch, Mutter«, sagte Elinor und sah auf ihre eigenen Füße hinunter. »Aber die Musik ist so schnell!«
»Du darfst nur nicht nach unten sehen, Elinor«, sagte Clara. »Höre einfach auf die Musik, fühl dich ein in den Rhythmus des Tambours und lasse dich davon leiten. Schließe dabei die Augen, das hilft vielleicht.«
Es klang vergnüglich, sogar wonnevoll, wie ihre Mutter es beschrieb. Sie hatte den Kopf zurückgeworfen, die Augen halb geschlossen und einen ganz verträumten Ausdruck auf dem Gesicht. Aber Elinor konnte sich nicht vorstellen, es selbst zu machen.
Trotzdem, sie merkte, dass sie mit ihrem Protest nichts ausrichtete.
Die edle Clara öffnete die Augen und betrachtete den widerspenstigen Ausdruck ihrer Tochter. Ihre Miene wurde milder.
»Du musst es versuchen, Elinor«, sagte sie freundlicher als gewöhnlich. »Tanzen, singen, Stickarbeit, das alles kommt dir schwierig vor, aber was kannst du denn sonst machen? Du brauchst die Fertigkeiten einer Edelfrau, wenn wir jemals einen Mann für dich finden sollen. Dein Aussehen allein wird nicht ausreichen.«
Elinor war froh über das »allein«.
»Ich kann lesen und schreiben«, sagte sie. »Und vielleicht muss ich ja gar nicht heiraten?« (Wenn ich nicht Bertran, den Troubadour, heiraten kann, fügte sie stumm hinzu.)
»Kommt nicht in Frage«, sagte Clara und wurde wieder unwirscher. »Heiraten muss sein. Du kannst aus deinen Fähigkeiten mit Pergament und Feder keine Ländereien und keinen Zins erwerben, verstehst du? Du bekommst einen Ehemann, der bereit ist, einen guten Brautpreis zu zahlen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
Nur, dass du nicht diejenige bist, die es tun muss, dachte Elinor verbittert.
+++
In der großen Halle waren lange Reihen hölzerner Tische auf Böcken aufgestellt, und hinter dem einen, der am Kopf des Raumes stand, hingen grüne Zweige von Fichten, Stechpalmen und Schierlingstannen von den Deckenbalken. Perrin, Huguet und die anderen joglars hatten mit ihren Instrumenten bereits ihre Plätze eingenommen, bereit, während des Mahls und zum Tanz danach aufzuspielen. Sie würden erst essen, wenn alle Gäste fort waren, aber zu ihren Füßen stand schon eine Kanne Wein, die im Lauf des Abends des Öfteren aufgefüllt werden würde.
Bertran würde an einem Tisch in der Nähe des Burgherrn sitzen, zwischen Lanvals Rittern und Ziehsöhnen. Allmählich strömten jetzt alle in die Halle. Erst als die Musikanten eine kleine Fanfare hören ließen, nahm jeder seinen Platz ein und stellte sich auf zum Einzug des Burgherrn und seiner Familie.
Seigneur Lanval, die edle Clara und ihr Sohn Aimeric betraten die Halle mit der typischen Haltung der Grundbesitzer, gewöhnt an die Ehrerbietung der restlichen familha – der Familie –, zu der alle Bewohner der Burg gerechnet wurden. Ihnen folgte zum ersten Mal an einem Heiligenfest die donzela des Hauses. Sie sah ungewöhnlich sittsam aus, denn sie hatte den Blick nach unten auf ihre Füße gerichtet, etwas, das sie normalerweise nicht tat.
Aber Elinor schreckten die Blicke aller, die auf sie gerichtet waren. Als die Familie bei ihren Plätzen ankam, riskierte sie einen kurzen Blick nach oben und sah, wie ihr Bertran ermutigend zulächelte. Gerade noch rechtzeitig bedachte sie, nicht zurückzulächeln – was als undamenhaft angesehen worden wäre –, sondern neigte ihren Kopf so langsam, dass es als anständig angesehen werden konnte.
Dann begann Perrin auf seiner Laute eine lebhafte Weise zu spielen, und der Moment war verflogen. Während des gesamten Mahls merkte Elinor, wie ihre Blicke unwillkürlich wiederholt zu Bertrans Platz huschten, aber er sah sie kaum noch einmal an. Wenn sie ganz vorsichtig war, konnte sie ab und zu einen Blick auf ihn werfen, ohne dass ihre Mutter es merkte. Außer der engeren Familie saßen noch mehrere ältere Ritter an ihrem Tisch, zusammen mit einigen adligen Damen und Herren aus den benachbarten Orten, und außerdem ein Besucher, den Elinor noch nie gesehen hatte, der in ein höfisches Geplänkel mit ihrer Mutter vertieft war.
Elinors Tischherr war Aimeric, und nach einer Weile entspannte sie sich. Es wäre zu schrecklich gewesen, neben einem Fremden sitzen zu müssen. Ihr Bruder war jedoch nicht zu einschüchternd, zumindest, wenn er sie nicht aufzog.
»Du siehst hübsch aus heute Abend, Schwester«, sagte er. »Das Kleid steht dir.«
Sie war erleichtert; sie hatte nämlich schon befürchtet, dass der roséfarbene Samt sie aussehen ließ wie einen Pudding aus Beeren und Sahne aus Hugos Küche. Und Aimeric hatte wohl gemerkt, dass sie gerade heute Abend, bei ihrem ersten öffentlichen Auftreten als donzela, empfindlich auf Neckereien reagiert hätte. Aber auch er durfte nicht merken, dass Elinor den Troubadour beobachtete.
Bertran aß mit gewählten Tischsitten. Er nahm sein Essen aus den gemeinschaftlichen Schüsseln mit seinem Messer oder einem Löffel, nicht mit den Fingern. Er wischte sich die Finger auch nicht an seinem Holzbrett ab, und als die Fleischspeisen abgetragen wurden, riss er das Brot, das von Soße getränkt war, für die Hunde in kleine Stücke, wie ein wahrer Edelmann, und schlang es nicht selbst hinunter wie ein Bauer.
Alles in allem verlief das Mahl besser, als Elinor befürchtet hatte, auch wenn sie viel zu nervös war, um Hugos Kapaunpastete oder seinen Wildbraten und die Grütze richtig zu würdigen. Aber als all die vielen Platten abgetragen waren, konnte sie noch etwas Ingwergebäck und Mandeln naschen. Und dankbar trank sie von dem gewürzten Wein, den ihr Vater zum Abschluss des Festessens hatte auftragen lassen.
Und dann erhoben sich Lanval und Clara, und die Diener kamen herein, um die Tische zu entfernen. Das bedeutete, dass der Tanz gleich beginnen würde. Hastig trank Elinor ihren restlichen Wein, denn sie wurde wieder von Panik erfasst.
Vor der gefürchteten estampida traten noch Gaukler und Akrobaten auf, sogar einer mit einem Äffchen, das auf den Hinterbeinen tanzte. Doch der Augenblick konnte nicht ewig hinausgezögert werden, und schließlich hörte Elinor, wie der vertraute Rhythmus auf dem Tamburin geschlagen wurde. Die joglaresas – die weiblichen Musikanten – fingen an, ihre Röcke fliegen zu lassen.
Adlige Herren und Damen versammelten sich auf dem freigeräumten Tanzboden, und schon wurde Elinor von Aimeric getrennt. Eigentlich hatte sie gehofft, dass er ihr Partner würde. Stattdessen stand sie Gui gegenüber, einem der noiretz – der Ziehsöhne ihres Vaters. Er war ein guter Tänzer, das wusste Elinor vom heimlichen Zuschauen aus einer der Nischen, vor dem sie ihre unbeholfenen Schritte eigentlich nicht zeigen wollte.
Doch der Wein schien etwas Seltsames mit ihren Füßen angestellt zu haben, als Perrin mit der ersten Strophe von Kalenda Maia begann, mit dem Maienlied. Es war zwar mitten im Winter gar nicht angebracht, aber seit Perrin es von einem italienischen Troubadour gelernt hatte, waren alle an Lanvals Hof verrückt danach. Es war ein Lied, das ein Troubadour namens Raimbaut für seine geliebte Dame Beatrice, Schwester seines Herrn, geschrieben hatte.
Jeder im Saal kannte es, und es gab einige, die in den Text einfielen.
Ma bell’amia, sang Gui stumm mit. Meine schöne Freundin.
Elinor wurde rot; er brachte sie fast aus dem Schritt. Doch sie schaffte es bis zum Ende der letzten Strophe: Bastida, Finida, N’Engles, ai l’estampida!,was so viel bedeutete wie »Genug, meine Weise ist beendet, Seigneur Engles, meine estampida.«
Elinor fragte sich, wer Seigneur Engles wohl sein mochte; vielleicht ein Adliger aus Italien, aus Monferrato, wo Raimbaut sein Lied komponiert hatte. Sie rang nach Atem und war froh, dass sie sich vor Gui nicht blamiert hatte.
Aber die anderen Tänzer bewegten sich weiter, und Huguet spielte einen lebhaften saltarello, einen italienischen Hüpftanz, auf seiner Fidel. Elinor war entsetzt, obwohl sie schon gehört hatte, dass dieser Tanz oft direkt auf eine estampida folgte. Ihre Füße begannen zu straucheln, denn die Musik war jetzt viel schneller, und Guis Gesicht verschwamm vor ihren Augen bei den Drehungen und Pirouetten des Tanzes. Sie würde fallen, bei ihrem ersten Auftreten als erwachsene Frau am Hof ihres Vaters. Und die jungen Ritter und Ziehsöhne würden hinter vorgehaltener Hand lachen. Sie wollte am liebsten sterben.
Doch dann tauchte wie durch ein Wunder aus dem verschwommenen Wirbel ein Gesicht auf, das von Bertran! Sein Lächeln beruhigte sie, und obwohl sie immer noch Angst hatte, war es so wunderbar, mit ihm zu tanzen und seine Hand zu ergreifen, als sie die Position wechselten, dass ihre Füße die Angst vergaßen und sie auf einmal verstand, was ihre Mutter mit dem Lauschen auf die Musik gemeint hatte.
Als der saltarello endete und Bertran sie um die Taille fasste und hochhob, löste sie sich erst einen winzigen Moment zu spät von ihm, um auszukosten, wie seine Arme um sie lagen.
»Vergebt mir, Fräulein«, sagte Bertran und entzog sich ihr sanft. »Es wird Zeit für mein neues Lied.«
Er stellte sich zu Perrin, der in Bertrans Namen ein leidenschaftliches Lied für die edle Clara vortrug. Es war ein recht seltsames neues Liebeslied, ein canso, in dem es mehr um Krieg als um Liebe ging. Elinor nahm es allerdings kaum auf; sie musste noch daran denken, wie es sich anfühlte, von Bertran umfasst zu werden. Doch allmählich bekam sie wieder einen kühlen Kopf und achtete mehr auf die Worte, die er geschrieben hatte.
Wer auf höfische Weise liebt, will nicht von den Schmerzen der Liebe geheilt werden, so süß ist es, zu leiden.
Und ihr Herz wurde von solch tiefem Schmerz durchbohrt, wenn sie daran dachte, dass keines von Bertrans Liedern für sie war oder jemals sein würde, dass sie, als sie in das Bett stieg, das sie mit Alys teilte, Stunden in der Dunkelheit wach lag und stumm weinte, um ihren Kummer nicht nach außen dringen zu lassen.
Kapitel zwei
Abschied
Es war noch vor Sonnenaufgang, als Bertran sein Pferd sattelte, um von der Burg zu reiten. Nur Perrin war früh genug auf, um ihn zu verabschieden. Ehe der Troubadour aufs Pferd stieg, löste er die Brosche von seinem Hut und gab sie dem Spielmann.
»Ein Geschenk?«, fragte Perrin grinsend.
»Nicht für dich«, sagte Bertran. »Nimm es mit und gib es Fräulein Elinor, wenn keiner zusieht.«
»Ein Liebespfand?«
»Du weißt, dass es das nicht sein kann. Aber es würde keinen großen Schaden anrichten, wenn sie es dafür hielte«, sagte Bertran.
»Ihr müsst verrückt sein!«, sagte Perrin. »Keinen Schaden? Ihr wisst, wie die donzela zu Euch steht. Das ermutigt sie doch nur.«
»Sie tut mir leid«, sagte Bertran ernst. »Sie hat keine Ahnung, wie sich ihr Leben und das Leben von uns allen verändern wird. Vielleicht sehen wir uns niemals wieder. Würde es denn schaden, wenn sie ihre Schwärmerei ein wenig länger pflegt? So lange, bis ihre Familie in Blutvergießen und Krieg gestürzt wird?«
Perrin neigte gehorsam den Kopf und nahm die Brosche. Gegen diese Argumente konnte er nichts vorbringen. Bertran klopfte ihm freundlich auf die Schulter.
»Pass auf dich auf, mein Freund«, sagte er. »Und geh nach Osten, wenn es Frühling wird. Möge dich dein Weg nach Italien führen.«
»Und Ihr?«, fragte Perrin, überwältigt von der Furcht, dass sich der Sängerpoet in Gefahr begeben könnte.
»Mein Weg liegt gen Westen«, sagte der Troubadour. »Ich muss unsere Brüder und Schwestern warnen vor dem Sturm, der aufzieht.« Er umarmte Perrin herzlich, dann trat er zurück, legte die Handflächen mit nach oben gerichteten Fingerspitzen aneinander – das heimliche Zeichen des Begrüßens und Abschiednehmens in ihrem Glauben. Der joglar tat dasselbe.
Dann sprang der Poet in den Sattel und verließ die Burganlage von Sévignan.
Elinor sah trockenen Auges durch einen Fensterschlitz zu, wie sein Pferd den Weg bergab nahm. Es war ein Bild, das sie über Jahre vor Augen haben sollte.
+++
Es dauerte einige Wochen, bis die Nachricht von der Ermordung von Pierre de Castelnau den Papst in Rom erreichte. Innozenz III. empfing gerade eine Gesandtschaft aus Navarra, als der Bote hereingeführt wurde, und er schob unwillig die Lippen vor wegen der Unterbrechung. Der Mann war jedoch so erregt, dass Innozenz die Überzeugung gewann, es müsse sich um eine dringende und verheerende Nachricht handeln.
Wie verheerend sie war, hatte er sich allerdings nicht träumen lassen. Er ließ den Kopf in die Hände sinken, sobald er begriff, was passiert war.
Er bedeutete dem Gesandten von Navarra mit einer Geste, sich seinem Gebet anzuschließen, und die beiden Männer knieten sich ohne weitere Zeremonie auf den Boden.
»Möge seine Seele in Frieden ruhen«, sagte der Papst und kam ächzend auf die Füße. Und das war für sehr lange Zeit sein letzter friedlicher Gedanke.
»Was den Grafen von Toulouse angeht: Du hast gesagt, dass er nichts getan hat, um den Mörder zu fassen?«, wandte er sich an den Boten.
»Nein, Eure Heiligkeit«, erwiderte der Mann. »Es geht das Gerücht, dass er den Schuldigen kennt, aber nichts gegen ihn unternehmen will.«
»Und es gab außer dem Fährmann und den Mönchen keine Zeugen?«
»Einen, Eure Heiligkeit, einen Adligen, aber der ist dem Angreifer nachgeritten. Man hat seither nichts mehr von ihm gehört.«
»Und wer war derjenige?«
»Darüber weiß ich nichts.«
»Lass in Erfahrung bringen, was man da herausfinden kann. Ich würde mich gerne mit diesem Mann unterhalten.« Der Papst saß gedankenverloren da, dann fragte er unvermittelt: »Und wo ist der Leichnam von Pierre jetzt?«
»In Saint-Gilles, Eure Heiligkeit. Die Mönche hielten es für das Beste, ihn dorthin zurückzubringen. Es gab eine feierliche Totenmesse, die der Bischof zelebriert hat, und Pierre ist mit allen Feierlichkeiten in der Abtei beigesetzt worden.«
»Er soll bald der heilige Pierre werden«, gelobte der Papst. »Und Raimund von Toulouse wird erneut exkommuniziert.«
Indem er nach allen Seiten Befehle ausgab, eilte der Papst aus seinen Räumen, um in der Kirche in Rom, die nach dem ersten heiligen Petrus benannt war, zu beten. Doch sein Herz war erfüllt von Hass auf die Ketzer und ihre Anhänger.
+++
Es war eine einfache Zinnbrosche mit einem Stein, der wie rotes Glas aussah. Doch es hätte der schönste Rubin sein können, so selig war Elinor, als sie sie erhielt.
Perrin hatte nicht lange nach einer Gelegenheit suchen müssen, ihr die Brosche zu überreichen; Elinors schlaflose Nacht hatte in ihr das Bedürfnis nach einem scharfen, schmackhaften Bissen geweckt, und sie war schon bald in der Küche und bettelte Hugo ein Stück gepökelten Wildbrets ab. Als sie ging, um es heimlich auf den Zinnen der Burg zu verspeisen, hatte sie der joglar gesehen. Er schlüpfte nach ihr hinaus, um ihr Bertrans Andenken zu geben.
»Aber was hat er denn gesagt?«, fragte sie ganz aufgeregt.
Perrin improvisierte. »Er hat gesagt … dass er auf lange Zeit fort muss und … dass Ihr ihn nicht vergessen sollt.«
»Ihn vergessen?« Elinor drückte die Brosche trotz des spitzen Verschlusses an sich. »Niemals könnte ich das. Aber wird er denn sehr lange fortbleiben? Kommt er nicht im Frühjahr, wie üblich?«
Perrin schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, Fräulein.«
»Fräulein Elinor! Fräulein Elinor!«, hallte eine schrille Stimme über die Anlage. Es war die Zofe der edlen Clara. Schnaufend stieg sie herauf zur Burgmauer. »Ah, da seid Ihr ja, Fräulein. Eure Mutter hat gesagt, dass ich Euch wohl hier finden könnte. Sie möchte Euch auf der Stelle sprechen.«
Die Zofe lehnte sich an die Brustwehr, um wieder zu Atem zu kommen. Sie war weder jung noch schlank, und Elinor wusste, dass ihre Mutter sie teilweise deshalb beschäftigte, weil sie eitel war. Die Zofe bot einen ziemlich krassen Kontrast zur immer noch bewunderten Schönheit ihrer Herrin.
Elinor war schuldbewusst zusammengefahren und versuchte, die Brosche im Ärmel zu verbergen. Doch die Augen der Zofe waren scharf, selbst wenn ihr Körper träge war.
»Ihr seid ertappt, Fräulein«, sagte Perrin unbeschwert und griff nach dem Stück Wild. Dabei verdeckte er mit dem Körper, was sie mit der Brosche machte. Elinor errötete bis unter die Haarwurzeln. Die Zofe inspizierte das Stück Fleisch aufmerksam, und die Gefahr war vorüber.
»Ich weiß gar nicht, warum ich nicht jederzeit von den Speisen meines Vaters essen dürfen sollte«, sagte Elinor mürrisch und spielte das Spiel mit. »Alles was in der Küche ist, gehört doch ihm.«
»So, aber jetzt ist keine Zeit mehr, um weiterzuessen«, sagte die Zofe bestimmt. »Die edle Clara wartet.«
Perrin zuckte die Schultern, als Elinor auf dem Abstieg über die Steinstufen an ihm vorbeikam, und fing an, auf dem Stück Wild herumzukauen. Was die Herrin wohl jetzt wieder für Ränke schmiedet?, dachte er.
+++
»Dein Benehmen gestern Abend war völlig inakzeptabel«, sagte Clara zu ihrer Tochter.
In der langen Geschichte ihrer Auseinandersetzungen hatte Elinor nie erlebt, dass ihre Mutter so kalt klang. Und diesmal wusste sie überhaupt nicht, was sie angestellt haben sollte.
»Aber ich habe es doch so gemacht, wie Ihr mir geraten habt«, wehrte sie sich. »Ich bin kein einziges Mal gestolpert. Ich habe auf die Musik gehört und mich ihr hingegeben.«
Ihre Mutter seufzte vor Verzweiflung.
»Mit Bertran de Miramont! Mit dem Troubadour!«, sagte sie.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















