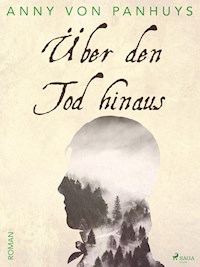
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht nur bei den Einwohnern des kleinen Residenzstädtchens ist Professor Berner, Direktor der Gemäldegalerie, sehr beliebt. Man schätzt ihn auch bei Hof. Sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum soll, wie es der Brauch ist, mit einem Porträt geehrt werden. Eine kleine Wette entspinnt sich aus der launigen Unterhaltung Berners mit dem Herzog, ob die Eitelkeit, ein Bild eines Verwandten in der Galerie hängen zu haben, die Familienliebe nicht immer in den Schatten stellt. Während des kleinen Disputs, ob Berners Familie nach seinem Tod sein Bild hängen lässt oder zu sich nach Hause holt, platzt Hofrat von Weiden mit der Nachricht, man habe den "alten Thomas" wieder gesehen. Über diese seit Jahrhunderten erzählte Spukgeschichte erschrickt Berner zutiefst, kündigt der "alte Thomas" doch seit jeher den Tod des aktuellen Direktors an. Voller Panik beginnt der Herzkranke, seine Dinge zu ordnen. Besonders am Herzen liegt ihm die Verlobung seiner Tochter Else mit dem Ingenieur Walter Zernikoff, auch wenn seine geliebte Frau dem zukünftigen Schwiegersohn misstrauisch begegnet. Als ihn die spukhafte Erscheinung überall verfolgt, erliegt der nervöse Mann einem Nervenfieber. Weil sich herausstellt, dass der Professor kurz vor seinem Tod die Hälfte seines Vermögens von der Bank abgehoben und er den letzten Abend mit Walter verbracht hatte, gerät dieser in den Augen seiner Schwiegermutter in Verdacht. Für Else will Walter beweisen, wer in Wirklichkeit schuldig ist am Tod ihres Vaters. Denn auch er hat das allerdings ziemlich lebendig wirkende Spukwesen an jenem Abend gesehen.Eine nicht standesgemäße Liebe, Neid auf Erfolg und Ansehen, Misstrauen und ein perfider Plan: halb Krimi, halb bezaubernde Liebesgeschichte, versteht der Roman von der ersten Seite an, mit Spannung zu unterhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Tod hinaus
Roman
Anny von Panhuys
Über den Tod hinaus
© 1930 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711592281
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel
Über der kleinen Residenzstadt Schneiditz, des Herzogtums Schneiditz-Steiningen, dämmerte der Abend, ein leiser Wind strich durch die herbstlichen Parkbäume des herzoglichen Schlosses und mit feinem Rascheln fielen müde Blätter nieder. Das Schloß war glänzend erleuchtet und Wagen auf Wagen fuhr vor dem Portal vor. Der erste Hofball in der beginnenden Saison fand heute statt. Der erste Hofball! Nur derjenige, der selbst in einer kleinen Residenz lebt oder gelebt hat, kann die Bedeutung dieses Wortes voll und ganz erfassen. Und die Residenzler, die zur Gesellschaft zählen, waren sich der Wichtigkeit dieses Tages auch bewußt. Der erste Hofball! Die sommerliche Zeit mit ihren Reisen lag hinter einem, hinter einem lagen auch die leichtgeknüpften Bekanntschaften, die man so glücklich unüberlegt unterwegs macht und so unverpflichtet wieder lösen kann. Auf Reisen trifft man eben so allerlei Menschen, die man daheim nie kennen dürfte.
Hofball! Da war man ganz unter sich. Irgendein paar neue Familien mochten ja wohl auftauchen, aber die gehörten dann zu den erstklassigen. —
Im blauen Saal hatte sich allmählich eine vornehme Gesellschaft versammelt, man stand in Gruppen herum und erwartete den Eintritt der herzoglichen Familie. In einer Ecke, neben einem hohen Armstuhle, lehnte die Gräfin Wendel. Ihr silberweißes hochfrisiertes Lockenhaupt neigte sich mit leiser, zitternder Bewegung näher zur Oberforsträtin, Frau von Grolius, und ihre Stimme bebte vor Wonne, daß sie etwas Interessantes erzählen konnte.
„Haben Sie‘s schon gehört, liebste Rätin, die Else Berner wird sich verloben.“
„Ah!“ kam es langgezogen zurück, „mit wem denn? Doch, was frage ich noch“, setzte die kleine, dicke, viel zu eng geschnürte Oberforsträtin hinzu, „in Frage kommt doch wohl nur Baron Tomwitz, er war ja der Bevorzugteste bei Schön-Else.“
Die Gräfin schüttelte energisch das Haupt, so daß sich die weißen Locken ein wenig aneinander rieben, wie bewegliche Schneebälle sah das aus: „Vorbeigeraten, kluge Frau von Grolius!“
„Wirklich!“ stieß die dicke Dame erstaunt hervor und zog die Augenbrauen hoch, „also ein anderer? Schön-Else hatte ja allerdings einen großen Hofstaat“, schloß sie mit leichtem Spott.
„Auch von diesem großen Hofstaat ist keiner in Frage gekommen. Doch ich will Ihre Neugier nicht auf die Folter spannen, also vernehmen Sie, Liebste, und staunen Sie, Else Berner wird sich mit einem schlichten Ingenieur verloben, der sich in irgendeiner Fabrikstellung befindet. In Nauheim hat sie ihn kennengelernt.“
„Ist es möglich“, war alles, was Frau von Grolius hervorzubringen vermochte, die Neuigkeit hatte ihr ordentlich den Atem versetzt und ehe sie sich noch zu fassen vermochte, gab der Hofmarschall das Zeichen, daß der Hof erscheine.
Der verwitwete Herzog, sowie der Erbprinz und seine junge Gemahlin, gefolgt von einigen Damen und Herren, traten in den blauen Saal. Männerrücken beugten sich tief, die Damen sanken im Hofknickse zusammen. —
Der Herzog, sowie dessen Sohn und seine Schwiegertochter, sprachen leutselig mit den verschiedenen Anwesenden, der Landesherr winkte mit liebenswürdiger Gebärde einen hochgewachsenen älteren Herrn mit grauem Spitzbart zu sich heran. — Er streckte dem sich ehrerbietig Verneigenden die Hand entgegen: „Nun, Herr Professor, zurück von der Reise, haben Sie in München ein hübsches Stück für unsere Galerie kaufen können?“ fragte er interessiert.
Der Gefragte schüttelte den Kopf: „Leider nein, Hoheit, auf der Versteigerung wurden alle Gemälde bis zu unmöglichen Preisen heraufgetrieben.“
„Nu dann nicht“, kam es gemütlich zurück und sich behaglich den weißen, buschigen Schnurrbart streichelnd, lachte der Regent: „Schließlich haben wir auch hübsche bunte Bilderchen genug. Ich bin damit zufrieden, unsere Residenzstadt auch, nur Ihnen, Professor Berner, dem hochverdienten Direktor unserer Galerie, sind die Wände noch immer zu kahl. Apropos“, fuhr er fort, „wie weit ist‘s denn mit Ihrem Porträt, hat‘s Welschmann fertig? Sie wissen, in wenigen Tagen feiern Sie Ihr fünfundzwanzigstes Jubiläum, da muß das Bild hängen.“
„Mein Bild, Hoheit, ist fertig“, entgegnete Professor Berner.
„Gut, das freut mich. Sie sind ja nun bereits der vierte Direktor, der nach fünfundzwanzigjähriger Tätigkeit der Schneiditzer Bildergalerie sein Porträt überweist, wie es die alte, fast hundertfünfzig Jahre alte Urkunde von dem jeweiligen Direktor wünscht.“
„Ob aber mein Bild der Galerie verbleibt, wie die Bilder meiner Vorgänger, ist sehr die Frage“, lächelte der Professor.
„Wieso?“ Des Herzogs Gesicht drückte Spannung aus.
„Nun, Hoheit, es heißt doch auch in der Urkunde, daß die Familie nach dem Tode des auf dem Bilde Dargestellten das Recht hätte, das Porträt für sich zurückzufordern“, erklärte der Galeriedirektor.
„Ja, ja, stimmt“, nickte der hohe Herr, „aber davon macht doch die Familie keinen Gebrauch, dazu ist jede zu eitel. Das Bild eines Familienmitgliedes, das in der Landesgalerie hängt, repräsentiert doch ganz anders, als eins über dem Sofa im Salon.“
„Das gebe ich zu, Hoheit“, erfolgte die schnelle Antwort, „die meisten Familien mögen allerdings so denken, sonst hingen meine drei Vorgänger, die gleich mir fünfundzwanzig Dienstjahre aufzuweisen hatten, nicht in der Galerie, aber meine Familie empfindet darin anders, davon bin ich überzeugt.“
„Immer langsam, lieber Berner, ich traue der Familieneitelkeit nicht allzuviel zu“, der Herzog machte eine abwehrende Bewegung.
„Sollte ich sterben, Hoheit, so werden meine Frau und meine Tochter sicher mein Bild für sich beanspruchen“, kam es fest aus dem Munde des Professors.
„Das wäre schade — für unsere Galerie“, lachte der alte Herr und wandte sich einigen, in der Nähe stehenden, älteren Offizieren zu. —
Dieses Gespräch mit dem Herzog ging Berner während des ganzen Abends nicht aus dem Kopf, die Worte: „ich traue der Familieneitelkeit nicht“, ließen ihm keine Ruhe, und während sich im blauen Saale die Jugend nach den Klängen des ausgezeichneten Orchesters im Tanze drehte, während es sich die älteren Herren im gelben Zimmer nebenan bei einer guten Flasche und dito Zigarre bequem gemacht hatten und die Ballmütter dem Tanze zusahen und dabei ein bißchen „klatschten“, saß Professor Berner in einem Durchgangsraum, halb hinter einer Portiere versteckt. Allerlei ging ihm durch den Sinn, er mußte mit sich allein sein.
Er war ein sehr nervöser Mann, ein Herzleiden, das ihn in den letzten Jahren quälte, hatte seinen Nerven sehr zugesetzt, er nahm die harmlosesten Dinge oft so bitter ernst. So mußte er jetzt immerfort daran denken, was der Herzog gesagt hatte. Er hing mit geradezu schwärmerischer Liebe an Frau und Tochter und deshalb kränkte es ihn schon, daß jemand denken konnte, die beiden würden nach seinem Tode sein Bild aus der Galerie nicht zurückfordern. Denn sein Porträt war vorzüglich ausgefallen, der Maler Welschmann hatte sich selbst übertroffen. Und dieses Bild, das ihn wiedergab, wie er wirklich aussah, dieses Bild sollte seine Familie im steifen kahlen Direktorenzimmer hängen lassen — aus Eitelkeit! Direktorenzimmer wurde der Raum der Schneiditzer Galerie genannt, in dem die drei Porträts seiner Amtsvorgänger hingen und in Kürze auch das seine. Lange. würde es nicht dableiben, nein, das wußte er genau. Sein Tod würde wohl nicht mehr fern sein — sein Herz plagte ihn doch allzusehr —, dann holten Frau und Tochter sein Bild zurück in die freundliche Villa in der Alleestraße, wo die hohen Ahornbäume im Sommer ihre grünen dichten Zweige hinüberlehnen bis auf das Dach seines Hauses.
Ein Straußscher Walzer erklang vom blauen Saale her. Berner erhob sich langsam und den schmalen Gang durchschreitend, trat er in die Saaltür, um einen Augenblick dem Tanze zuzusehen. Eben flog seine blonde Tochter am Arme des Barons Tomwitz vorüber. Der hübsche Leutnant machte ein so vergnügtes Gesicht und lachte mit dem jungen Mädchen. Er wußte ja noch nicht, daß für seine Liebe keine Hoffnung mehr bestand. Woher sollte er das wissen, was wohl noch keiner in der Residenz wußte, daß sich die vielbegehrte Else Berner in dem lieblichen Nauheim mit einem einfachen Ingenieur versprochen.
Seine Else, sein Sonnenkind, hatte sich entschieden, und er würde ihr kein Hindernis in den Weg legen, wie es seine Frau noch immer versuchte, der ein Baron von Tomwitz als Freier für die schöne Tochter begehrenswerter erschien. Ein Ingenieur Zernikow wollte ihr nicht recht behagen. Aber sie würde sich wohl damit abfinden müssen, er lächelte leicht, denn Else hatte seinen eigensinnigen Kopf geerbt. Da, jetzt kam sie noch einmal an ihm vorbeigewirbelt, ihre Augen fanden ihn und grüßten ihn. Herrgott, wie schön das Mädel war! Voll stolzer Vaterfreude sah er den Davontanzenden nach. Sein Mädel, sein Liebling, die sollte einmal recht, recht glücklich werden, das war sein heißester Wunsch.
Hofrat von Weiden klopfte ihm auf die Schulter: „Na, Professor, sehen Sie auch ein bißchen dem Herumgehüpfe zu? Glückliche Jugend!“ seufzte er mit einem Blick auf die Tanzenden und dann seinen Arm leicht unter den Berners schiebend, setzte er hinzu: „Kommen Sie mit, wollen ein wenig die Büfette plündern, ich habe ‘nen Mordshunger.“
Nachdem man sich an einem der kleinen Tische neben den riesigen Büfetten niedergelassen, winkte der Hofrat einen der Lakaien heran und gab ihm eine Bestellung auf. Bald standen einige appetitliche Brötchen und ein paar Glas Sekt vor den Herren.
„Sagen Sie, Professor, fürchten Sie sich nicht ein bißchen vor all den Ehrungen, die in wenigen Tagen über Sie hereinbrechen werden“, meinte Herr von Weiden behaglich kauend.
„Man muß es eben ertragen“, gab der andere freundlich zurück.
„Die Stunde geht auch durch den schlimmsten Tag“, zitierte der Hofrat lachend, „nicht wahr, so denken Sie?“
„Ungefähr so“, bestätigte der Professor. Einige andere Herren traten herzu und man redete über allerlei. Plötzlich sagte der Hofrat unvermittelt: „Wissen Sie übrigens schon, daß man den alten Thomas wieder am Eingang zur Galerie gesehen haben will?“
„Was?“ Professor Berners Gesicht veränderte sich jäh, als zeige sich ihm ein Medusenhaupt, so starrte er den Sprecher an.
„Aber Professorchen, wie sehen Sie denn aus!“ Hofrat von Weiden blickte verwundert: „Sie werden doch nicht etwa solche Ammenmärchen glauben.“
„Ammenmärchen! Sie haben recht“, lachte der Professor, aber es klang seltsam erzwungen. Was war‘s nur, was ihm bei den Worten des Hofrats plötzlich fast den Atem geraubt hatte, auch sein Herzklopfen setzte schmerzhaft ein.
„Was heißt das, man will den alten Thomas wieder am Eingang zur Galerie gesehen haben?“ fragte einer der Herren.
Der Hofrat zog die Augenbrauen hoch: „An dieser Frage merkt man, daß Sie erst seit kurzem bei uns leben, Herr von Pettow, denn unsere Residenzler wissen alle, wer der alte Thomas ist.“
„Darf man es, wenn man recht schön bittet, nicht auch erfahren?“ sagte der mit dem Namen „von Pettow“ Angesprochene.
„Warum nicht? Ich wenigstens wüßte keinen Hinderungsgrund“, war die Erwiderung.
Der Professor erhob sich: „Ich will einmal nach Gattin und Tochter sehen, mich entschuldigen die Herren wohl gütigst, wenn ich keine Lust verspüre, mein eigenes Todesurteil mitanzuhören.“ Wieder lachte er gezwungen und fort war er.
„Sein eigenes Todesurteil?“ sagte Herr von Pettow in gedehnter Frage und machte ein kurioses Gesicht, als ob er an dem Verstand des Fortgegangenen zweifelte.
Der Hofrat zuckte die Achseln: „Hätte ich gewußt, daß der gute Professor ein Ammenmärchen tragisch nimmt, hätte ich geschwiegen, doch nun ist‘s egal. Also hören Sie die Geschichte vom alten Thomas.“ Er lehnte sich bequem in seinen Stuhl zurück. „Der erste Schneiditzer Galeriedirektor hieß Baron Thomas, er soll mit dem damaligen Herzog die Urkunde aufgesetzt haben, die verlangt, daß der jeweilige Direktor nach fünfundzwanzigjähriger Dienstzeit sein Porträt zu stiften habe, das aber nach dem Tode des Direktors von der Familie desselben beansprucht werden kann. Drei Direktoren hängen jetzt in der Galerie, die fünfundzwanzig Jahre in ihrer Stellung erreicht haben. Den Anfang mit seinem Bild machte Baron Thomas selbst. Sein Bild zeigt ein liebes, altes, faltiges Männergesicht, in zopfgeschmückter Puderperücke, und nun geht hier die Sage, einige Tage vorher, ehe der derzeitige Direktor stirbt, würde der alte Thomas am Eingang zur Galerie gesehen, so, wie er auf seinem Bilde dargestellt ist. Jetzt will man ihn wieder gesehen haben, also —“ er schwieg.
„Also wäre jetzt an den Professor die Reihe gekommen, zu sterben“, vollendete einer der Herren.
Pettow schüttelte den Kopf: „Ein Ammen märchen, gewiß, nicht mehr, aber ich, Herr Hofrat, hätte dem Professor nicht erzählt, daß der alte Thomas wieder spuken soll.“
„Ich bitte Sie, warum nicht“, wehrte sich der Hofrat, „er ist doch kein bleichsüchtiger Backfisch.“
„Das allerdings nicht, aber ein nervöser, herzleidender Mann.“
Der Hofrat zuckte nachlässig die Achseln, als hielte er es nicht der Mühe wert, darauf etwas zu erwidern. —
Der Professor hatte inzwischen seine Frau aufgesucht. Es war nicht so leicht, ihrer habhaft zu werden. Er fand sie in ein lebhaftes Gespräch mit einigen bekannten Damen vertieft, und sie schaute verwundert auf, als ihr Mann plötzlich vor ihr stand. „Laß dich nicht stören, liebste Magda“, lächelte er, „ich will dir nur sagen, daß ich jetzt nach Hause gehe, mich quält mein Kopfweh wieder so arg, daß ich mich gerne bald zur Ruhe begeben möchte. Du brauchst dich aber meinetwegen nicht zu sorgen“, fuhr er fort, „bleib du nur mit Else noch hier, der Wagen holt euch ja zur bestimmten Zeit ab.“
„Armer Alex, du tust mir sehr leid“, Frau Magda Berners schönes Gesicht blickte ihn voll Teilnahme an, „aber wenn du jetzt fort willst, müßtest du ja zu Fuß heimkehren und es ist doch schon ziemlich spät.“
„Auf dem Schloßplatz stehen heute sicher ein paar Taxis, aber ich will gar nicht fahren, das Zufußgehen wird für mich besser sein, denke ich“, gab er zurück, „übrigens ist ja das Wetter wundervoll, und frische Luft ist für meine Kopfschmerzen ein gutes Linderungsmittel. Von Else will ich mich lieber gar nicht verabschieden, um ihr nicht vielleicht die Tanzfreude zu vergällen.“
Seine Frau nickte: „Das ist recht, Alex, man soll der Jugend ihr Vergnügen nicht stören“, sie reichte ihm die Hand: „Ich wünsche dir vor allem gute Besserung.“
Als sich der Professor in der Garderobe Hut und Mantel geben ließ, stürzte plötzlich Hofrat von Weiden mit flüchtigem Gruß an ihm vorüber und den Paletot über den Arm nehmend, eilte er hinaus.
„Man meint, beim Herrn Hofrat tät‘s brennen“, flüsterte ein Diener seinem neben ihm stehenden Kollegen zu.
Langsam trat Berner aus dem Schlosse. Dunkel lag der große Schloßpark, in der Ferne verklang Wagenrollen. Jedenfalls saß der Hofrat in diesem Wagen, mußte der Professor denken. Der hatte es wahrhaftig allzueilig gehabt und dabei fiel ihm dessen Bemerkung ein, daß man den alten Thomas wieder am Eingang zur Galerie gesehen haben wollte. Das alte Märchen tauchte wieder auf. — Wahrscheinlich, es war lachhaft und doch, — nein, er vermochte nicht darüber zu lachen und es war jedenfalls taktlos von Weiden, derartiges in seiner Gegenwart zu erwähnen. — Natürlich, dem Hofrat konnte es schon angenehm sein, wenn die Sage vom alten Thomas recht hatte, dann wurde ja der gutbezahlte Posten des Galeriedirektors frei für den Maler Hans Welschmann, des Hofrats ein wenig leichtlebigen Schwiegersohn, der sich schon vor einem Jahre mit Erfolg darum beworben hatte. Damals, vor einem Jahre, bekundete er selbst einmal die Absicht, zurückzutreten, er fühlte sich in jener Zeit sehr leidend und den Anforderungen seiner Stellung nicht recht gewachsen. Aber dann, als sich sein Leiden besserte, blieb er doch; Frau und Tochter überredeten ihn wieder und auch der Herzog tat das möglichste, seinen bewährten Professor Berner festzuhalten.
Ruhig und gemessen wanderte der Professor durch die nächtlich stillen Residenzstraßen, die frische Luft wehte mit kühlem Hauch um sein entblößtes Haupt. Den Hut trug er in der Hand und dumpf hallten seine Schritte auf dem Pflaster wider. Jetzt bog er aus der Marktstraße in die Alleestraße ein. An der Ecke, wo die beiden Straßen zusammenliefen, erhob sich, gleich einem riesigen Steinkasten, die Galerie. Wie eine breite, dunkle Mauer stand das unförmige Gebäude da. Über dem rechten Giebel lief, wie ein helles Wasser, ein lichter Streif, der Mond stand in seiner leuchtenden vollen Pracht am Himmel. —
Der Professor verlangsamte seinen Gang und gedankenlos sahen seine Augen auf den mächtigen massiven Bau, ganz gedankenlos. Immer näher kam er ihm und dabei fielen ihm wider Willen die Worte des Hofrats ein: „Wissen Sie übrigens schon, daß man den alten Thomas wieder am Eingang zur Galerie gesehen haben will?“ Als senkten die Gedanken seine Augen, so blickte der Professor starr auf den Eingang zur Galerie und — Himmel, wachte oder äffte ihn ein böser Traum! — da stand, mitten in der breiten altmodischen Tür, eine kleine, dürre, gebeugte Gestalt in Wadenstrümpfen und langschwänzigem Rock. Zitternd schob sich der helle Streif des Mondlichtes ein wenig vor, und deutlich vermochte der fieberhaft erregte Mann ein schmales verrunzeltes Gesicht erkennen in Zopfperücke und Dreispitz.
Ganz still stand die unheimliche Erscheinung, keine Bewegung verriet, daß Leben in ihr war. Ein Schauer durchrann des Professors Glieder und wie festgebannt hafteten seine Füße am Boden. Er griff sich mit der Hand nach der Stirn, denn er konnte und konnte doch nicht glauben, daß es Wirklichkeit war, was er da vor sich erblickte. Eine Ausgeburt seiner erregten Phantasie war‘s und nichts weiter. Er schloß einen Moment die Augen, um sie gleich darauf wieder voll und ganz zu öffnen. Doch immer noch stand die Gestalt, in der alten verschollenen Tracht, am Eingang zur Galerie. Der Professor spürte verstärktes Herzklopfen und plötzlich stürzte er in atemloser Hast davon, und ohne daß er es eigentlich selbst wollte, gleichsam der Macht eines fremden, stärkeren Willens gehorchend, blieb er noch einmal stehen und wandte den Kopf zurück, um gleich darauf mit zitternden Knien seinem Heim zuzujagen. Denn immer noch konnte er die Gestalt erkennen und noch etwas sah er, was ihm das Blut in den Adern gerinnen ließ, die Gestalt winkte ihm, winkte. — In Schweiß förmlich gebadet, kam er zu Hause an und sein alter, treuer Diener Maurer, der ihm die Haustür öffnete, erschrak, als ihm sein Herr fast entgegenfiel.
„Um Gottes willen, Herr Professor, was ist Ihnen denn nur“, fragte er hastig und griff mit beiden Armen zu, den Ermatteten zu stützen.
Der Klang der wohlbekannten Stimme schien den aufgeregten Mann wieder zu sich zu bringen. Seine Haltung ward aufrechter und ein schnell wieder verschwindendes schemenhaftes Lächeln huschte um seine Lippen, als er leise erwiderte:
„Ach, Maurer, nur mein altes Leiden hat mich unterwegs überfallen, Sie wissen, der Herzkrampf.“
Von dem Diener geleitet, suchte der Professor sofort sein Schlafzimmer auf. Ermüdet sank er auf einen niedrigen bequemen Lehnstuhl, und während Maurer ihm ein beruhigendes Pulver mischte, beschäftigten sich Berners Gedanken mit dem Erlebten, das ihm hier, in der gewohnten heimischen Umgebung, wie ein wüster, häßlicher Traum erscheinen wollte. Es konnte ja doch auch keine Wirklichkeit gewesen sein, denn an Gespenster zu glauben, dazu wollte sich sein Verstand nicht hergeben, nein. Aber wiederum hatte er die Erscheinung doch gesehen.
Hatte er sie wirklich gesehen? Oder sollte es möglich sein, daß sein krankhaft erregtes Gehirn ein Wahngebilde für eine direkte Sinneswahrnehmung hielt? — Ja, möglich war das schon, beantwortete sich der Professor seine eigene Frage, denn Halluzinationen gab es und bei Fieberzuständen waren sie keine Seltenheit und in ihm brannte ja das Fieber, seine trockenen Lippen, die sein heißer Atem dörrte, bestätigten es ihm. Maurer hielt ihm ein großes Glas entgegen und gierig trank es der Sitzende bis zum letzten Tropfen aus.
„Danke“, er wollte das Glas zurückgeben, doch seine Hand zitterte plötzlich und mit Klirren fiel das dünne Gefäß zu Boden. Boshaft glitzerten die weißlichen Scherben beim Schein des elektrischen Lichtes, und der Professor ließ matt den Kopf sinken. Was war er eigentlich noch? Ein alter, kranker Mann, mürbe von jahrelangem Herzleiden, nervös und mit allem fertig. Für ihn war‘s wohl das Beste, sich bald auf den Weg zu machen, der von der Erde hinüberführt zur Ewigkeit. Für Frau und Tochter war sein Leiden in letzter Zeit Anlaß zu ständiger Angst und Sorge. Sein Amt, an dem er mit ganzer Seele hing, das würde wohl ein anderer ebenso versehen, gewiß sogar besser versehen, ein jüngerer, frischerer Mann würde seinen Platz einnehmen. Vielleicht Hans Welschmann, der sein Porträt gemalt, ja, wahrscheinlich sogar der, denn der wartete ja schon so lange darauf, Galeriedirektor zu werden.
Während der Professor sich solchen Gedanken hingab, sammelte der alte Diener sorgfältig die Glasscherben auf und als er damit fertig war, meinte er bittend: „Kommen Sie, Herr Professor, begeben Sie sich zur Ruhe, Sie wissen, Ruhe ist die beste Medizin für Sie.“ Und der Professor gehorchte dem Getreuen, wie ein Kind ließ er sich von ihm entkleiden.
„Sagen Sie meiner Frau und Tochter, wenn sie heimkommen, nichts von meinem Anfall, es würde sie nur unnütz erschrecken“, befahl Berner und der Diener nickte, er wußte, daß sein Herr Frau und Tochter gern eine Sorge ersparte.
„Übrigens können Sie nun gehen, Maurer, und in Ihrer Stube ein Nickerchen machen, bis der Wagen meine Damen vom Hofball heimbringt“, fuhr Berner fort und reckte sich ein wenig in den frischen, kühlen Kissen, „ich will nun zu schlafen versuchen, also gute Nacht, Maurer.“
„Gute Nacht, Herr Professor“, der Diener drehte beim Verlassen des Zimmers das Licht aus und zog die Tür leise hinter sich zu.
Unruhig warf sich der Professor in dem Bette hin und her, die Erinnerung an die Halluzination, die er gehabt, wollte nicht von ihm weichen, immer wieder vermeinte er das kleine, alte Männchen zu erblicken, das aussah, als sei es im Direktorenzimmer der Galerie aus dem Rahmen gestiegen, in dem das Bild des ersten Schneiditzer Galeriedirektors hing. Der Baron Thomas, oder wie er allgemein hieß, der alte Thomas. Und Todesahnungen stürmten auf den schlaflosen Mann ein. Für Frau und Tochter war ja gesorgt, wenn sein Leben verlöschte, eine Viertelmillion hatte er in Berlin auf der sicheren Spreebank deponiert, also Angst um seine Lieben brauchte er nicht zu haben. Und nun irrte sein Denken wieder hin zu der Unterhaltung, die er heute mit dem Herzog gehabt. Von der Familieneitelkeit hatte der Herzog gesprochen und so getan, als glaube er nicht, daß seine Frau und Tochter nach seinem Tode sich sein Bild aus der Galerie zurückerbitten würden. Oh, da kannte der Herzog eben die beiden nicht, die beiden, die ihn liebten, deren Herz an ihm hing. Sein wohlgetroffenes Bild, das ihn so lebendig wiedergab, das würden sie beanspruchen, das war völlig sicher.
Ja, war das völlig sicher? Der einsame Mann, in dessen Adern Fieberglut brannte, verstrickte sich immer tiefer in ein Netz selbstquälerischer Gedanken.
Der Diener, dem der Zustand seines Herrn doch etwas bedenklich vorgekommen war, lauschte mit angehaltenem Atem am Türspalt. Er vernahm, wie sich der Professor unruhig im Bette wälzte, und als nun gar ein banger zitternder Seufzer zu ihm drang, da öffnete er leise die Tür und fragte sanft: „Soll ich nicht lieber den Arzt holen, Herr Professor, ich laufe schnell über die Straße zu ihm, Doktor Murtag kommt sicher sofort.“
„Nein, nein“, kurz und bestimmt klang‘s aus dem dunklen Zimmer zurück, „ich bin ja schon im Begriff einzuschlafen.“
Da schloß Maurer wieder die Tür. Aber trotzdem er fast noch eine Viertelstunde angespannt lauschte, vernahm er keinen Laut mehr aus seines Herrn Zimmer, der Professor schien jetzt wirklich eingeschlafen zu sein.
*
Am nächsten Morgen stand Alex Berner schon früh auf. Frau und Tochter ruhten noch von den Anstrengungen des Balles, da saß der Professor schon beim Frühstück. Es mußte ihm heute wieder besser gehen, wie Maurer befriedigt feststellte, denn der Professor aß mit bestem Appetit ein paar Eier und trank mehrere Tassen Tee.
Nach dem Frühstück meinte er dann zu Maurer: „Ich muß für zwei Tage nach Berlin reisen, packen Sie mir, bitte, sogleich meinen Handkoffer, ich fahre mit dem Zehnuhrzuge.“
Maurer sah seinen Herrn sehr erstaunt an, als glaubte er falsch gehört zu haben, dann fragte er langsam, jedes Wort betonend: „Sie wollen nach Berlin reisen, Herr Professor?“
„Gewiß“, schnell erfolgte die Antwort. „ich will nach Berlin reisen, respektiv ich muß, es handelt sich um den Ankauf eines Bildes für die Galerie“, setzte er rasch hinzu.
„So!“ Ganz langgezogen brachte Maurer dieses „so“ hervor, „aber Sie fühlten sich doch gestern gar nicht wohl, Herr Professor und“ — er stockte eine Sekunde, um dann rasch fortzufahren: „da wäre es doch besser, Sie schöben die Reise noch einige Tage auf.“ Er sah dabei den Professor an, als hätte er soeben eine besondere Weisheit verkündet. Daß er sich aber in dieser Ansicht entschieden getäuscht hatte, verriet ihm die Antwort seines Herrn.
„Sie müssen doch eigentlich wissen, Maurer, daß sich solche Reisen nicht aufschieben lassen. Ganz unter der Hand bekam ich einen Wink, daß ich Gelegenheit hätte, ein wertvolles Gemälde aus einer Privatsammlung zu erstehen. Wenn erst andere Interessenten Witterung von der Sache erhalten, komme ich natürlich zu spät.“
Schuldbewußt senkte Maurer den Kopf. Gewiß, was Professor Berner da zuletzt sagte, das hätte er wissen müssen, wozu war er denn seit zwanzig Jahren Diener bei einem Galeriedirektor. Und ohne noch ein Wort zu sagen, ging er daran, den Koffer zu packen.
Der Professor blieb allein im Eßzimmer zurück. Er goß sich noch ein Täßchen Tee ein und las dabei ein paar Briefe, die mit der ersten Post bestellt worden waren.
Hinter ihm ging plötzlich die Tür, rauschten leichte Frauengewänder und mit fröhlichem „Guten Morgen, Papa!“ reichte ihm seine blonde Tochter die Rechte. „Ich war eine rechte Langschläferin heute“, plauderte der kleine, rote Mädchenmund und dem Vater gegenüber Platz nehmend, strichen die hübschen, schlanken Hände ein Brötchen. „Ich habe einen Wolfshunger“, lachte Else Berner und biß mit sichtbarem Behagen in das Gebäck. „Mama schläft noch ganz fest“, berichtete sie und dann von einem Gedanken erfaßt, sagte sie, den Vater besorgt ansehend: „Wie geht es dir, Papa, Mama erzählte mir gestern, daß du den Ball so früh verlassen, weil du Kopfweh gehabt hättest?“
„Danke, mein Kind, es ist vorüber, ich bin wieder ganz auf dem Damm“, er sah das reizende Gesicht ihm gegenüber lächelnd an, „so wohl fühle ich mich, daß ich sogar heute nach Berlin fahren will, eines Gemäldeankaufs wegen.“
„Ah!“ Else ließ die gehobene Hand, die das kleine Täßchen zum Munde führen wollte, wieder sinken, „davon hast du uns ja gestern gar nichts gesagt?“
„Gestern?“ — Er schien einen Augenblick bestürzt über die Frage, doch gleich darauf lächelte er: „Ja, Fräulein Tochter, gestern wußte ich selbst noch nichts von dieser Reise, wenigstens erfuhr ich es erst spät abends.“
„Das ist etwas anderes, dann bist du natürlich entschuldigt.“ Else machte ein drollig wichtiges Gesicht.
„Heißen Dank!“ Der Professor verbeugte sich neckend.
„Hat denn der Herr Galeriedirektor noch nicht Schätze genug in der Schneiditzer Galerie hängen?“ forschte das junge Mädchen.
„Nein, mein Mädelchen, immer noch nicht genug und unser Ländchen besitzt genügend Mammon, sich noch eine Menge Schätze zuzulegen“, ein wenig abwesenden Tones sagte es der Professor, und dann sprach er plötzlich und sah Else dabei ernst in die Augen: „Sag mal, mein Kind, wenn ich sterben sollte, würdest du mein Bild aus der Galerie beanspruchen?“
„Aber Papa, wie kommst du nur darauf?“ lautete die maßlos erstaunte Gegenfrage.
„Gott, Kindchen, man kann doch nicht wissen, wie lange man lebt, — es ist ja auch nur so eine Frage“, er rückte verlegen an dem vor ihm stehenden Teller, „es ist so eine müßige Frage, deren Beantwortung von Interesse für mich ist, weil ich gestern mit dem Herzog über dieses Thema sprach.“
„Und was sagte der Herzog?“
„Er meinte, die Familieneitelkeit sei größer als die Familienliebe, und das Bild eines Familienmitgliedes, das in der Landesgalerie hängt, repräsentiere doch ganz anders, als eins über dem Sofa im Salon.“
Else warf in drolligem Schmollen die Lippen auf: „Der Herzog, der sich zwanzigmal von berühmten Malern abkonterfeien läßt, um jedem Mitglied seines Hauses ein Bild zu spenden, redet wie der Blinde von der Farbe. Wenn man bloß ein so famoses Bild von seinem Väterchen besitzt, läßt man das, wenn man nicht dazu gezwungen ist, nicht in der Galerie hängen, wo es allen neugierigen, fremden, teilnahmlosen Menschenaugen preisgegeben ist, und Mama denkt sicher ebenso wie ich.“ Ihre Stimme bebte ein wenig, als sie schloß: „Doch, wozu davon sprechen, noch bist du ja bei uns, Papa, und wirst auch hoffentlich noch recht lange bei uns bleiben“, sie lächelte zwar, doch in ihren Augen war ein verdächtiges Leuchten wie von niedergezwungenen Tränen.
Gerührt bemerkte es Professor Berner und um das Thema abzubrechen, er wußte ja nun, was er wissen wollte, sagte er leichthin: „Wenn die Mama nicht bald zum Vorschein kommt, muß ich abfahren, ohne ihr Adieu zu sagen.“
„Vorhin schlief sie noch sehr fest.“
„Da ist‘s besser, sie nicht zu stören, bestelle ihr meine besten Grüße und ich sei übermorgen mittag wieder zurück“, der Professor stand auf, „ich will mich nun zurechtmachen, mit dem Packen wird Maurer inzwischen auch wohl fertig sein.“
„Darf ich dich zur Bahn begleiten, Papa?“ fragte das junge Mädchen, sich gleichfalls erhebend.
„Gewiß, Else“, erwiderte er und nickte ihr freundlich zu.
Else Berner hatte sich schnell angekleidet. Ein schlichtes, tadellos sitzendes Jackenkleid hob die Vorzüge ihrer schlanken, geschmeidigen Figur noch besonders hervor und der große Filzhut, mit dem graziösen gelbgetönten Reiher, brachte das zarte, feingeschnittene Gesicht, um das sich das blonde Haar in tiefen Scheiteln legte, zu entzückender Geltung. Arm in Arm mit ihr wanderte der Professor dem Bahnhof zu. Es war ein sommerheller, herrlicher Herbstmorgen, eine köstliche Frische war in der Luft und ein feiner, hellgrauer Reif lag auf den letzten Blättern der Alleebäume.
Rauhreif schimmerte auf den Ästen und in der Sonne blitzte es auf wie unzählige Funkelkristalle.
Auch von den Dächern glitzerte die kristallene Pracht und zauberte über schlichte Ziegelsteine oder regenverwaschene Schiefer ein Mosaik von abertausend von kleinen Brillanten.
Maurer war bereits mit der Handtasche vorangegangen. Der Professor warf einen Blick auf seine Uhr und trotzdem er feststellte, man habe nicht mehr allzuviel Zeit, wurden seine Schritte langsamer. Man ging gerade an der Galerie vorüber und Berners Augen suchten den Ort, wo er diese Nacht den alten Thomas gesehen zu haben vermeinte.
In dem großen Haupteingang hatte die Erscheinung gestanden. Jetzt, bei dem klaren Tageslicht, sahen die Ereignisse der Nacht völlig verwandelt aus. Eine Wahnvorstellung hat mich erschreckt, sagte sich der Professor, wie er es sich schon gestern gesagt, aber heute war mehr Sicherheit in seiner Feststellung. An einem so klaren, heiteren Herbstmorgen mußte auch der letzte Rest von gespenstersehendem Aberglauben zerflattern. Ein Frohgefühl erfüllte des Professors Brust, wovor er sich erschreckte, war wirklich nur eine Ausgeburt seiner überreizten Nerven und des erregten Blutes gewesen. Ein ernster, sinnender Ausdruck trat jäh in sein Gesicht. War der Grund, deswegen er die heutige Reise unternahm, vielleicht auch nichts weiter als eine Ausgeburt seiner überreizten Nerven, diese plötzliche Reise, die er mit einem Bilderkauf zu erklären versucht hatte. Er dachte ja gar nicht daran, ein Bild zu erstehen, seiner Reise nach der Reichshauptstadt lag eine andere Absicht zugrunde. Vielleicht war es eine Torheit, die er im Begriffe war zu tun.
Vielleicht? Aber er konnte nicht anders. Seit dem Gespräch mit dem Herzog verfolgte ihn ein Gedanke und er mußte diesen Gedanken, dem die schlaflose Nacht erst Form gegeben, aüsführen. Und weshalb sollte er es nicht tun, konnte sein Tun doch für seine Familie gar keine schlimmen Folgen haben, denn Frau und Tochter liebten ihn ja und in der Sicherheit dieser Überzeugung brauchte er nicht zu schwanken, seinen Plan in die Tat umzusetzen.
Am Bahnhof verabschiedeten sich Vater und Tochter sehr zärtlich voneinander, der Professor bestieg ein Abteil zweiter Klasse, in das der Diener bereits den Handkoffer hineingestellt.
„Ihre Tabletten habe ich auch eingepackt, Herr Professor“, flüsterte Maurer seinem Herrn noch zu, dann trat er auf den Bahnsteig zurück. Eben rückte der Zug an. Else holte ihr Taschentuch hervor und winkte, solange sie die dahinrollenden Wagen sehen konnte. Das junge Mädchen hing mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit an dem Vater, es war eine andere Liebe wie die Liebe, die sie für die Mutter empfand, die, eine schöne, gefeierte Frau, sich meist nicht allzuviel um das heranwachsende Mädchen gekümmert hatte. Desto mehr aber saß Else von je mit dem Vater zusammen. Professor Berner war früher ein bekannter Landschaftsmaler gewesen, bis er, nach einem unglückseligen Sturz beim Schlittschuhlaufen, die Bewegungsfähigkeit des rechten Armes verlor, da mußte er seine Malkunst beiseitelegen. Ein Gilück war es, daß er aus gutsituierter Familie stammte, er brauchte die Malerei nicht zum Broterwerb. Er hatte genug, um sorgenfrei zu leben. Durch Vermittelung seiner Frau, einer geborenen Baronesse Stormberg, die Hofdame bei der verstorbenen Herzogin gewesen, übertrug man ihm den zufällig frei gewordenen Posten des Galeriedirektors, der ihm auch ein hübsches Einkommen sicherte und den er zu vollster Zufriedenheit nun seit fünfundzwanzig Jahren versah. Bei seinen Gängen in die Galerie war Else immer des Vaters treue Begleiterin gewesen, sie kannte alle Bilder und wußte von den meisten ihre Geschichte zu erzählen. Woher die Bilder stammten und in wessen Händen sie vordem gewesen.
„Du bist ein lebendiger Nachschlagekatalog der Schneiditzer Galerie“, sagte der Professor oft scherzend zu seiner Tochter und Else war stolz auf diesen Ausspruch ihres Vaters. Auch jetzt noch, nachdem Else längst eine junge Dame und die Ballkönigin der Schneiditzer Hofgesellschaft geworden, verbrachte sie gar viele Stunden in der Galerie. Und sie war wirklich neugierig, welchem neuen Juwel der Vater jetzt nachjagte. Es muß sich um etwas ganz Besonderes handeln, sonst wäre er nicht so wenig mitteilsam gewesen, dachte Else. Ja, gar zu gerne hätte sie gewußt, was für ein Bild in Frage kam.
Mit leichtgeröteten Wangen schritt die Sinnende heimwärts, in der Nähe des Marktplatzes begegnete ihr Hofrat von Weiden, in Gesellschaft seines dicken asthmatischen Dackels, den er zuweilen des Morgens ausführte. Er zog mit beinahe übergroßer Höflichkeit den Hut und, stehenbleibend, reichte er Else die Rechte: „Guten Morgen, mein gnädiges Fräulein, darf ich mich erkundigen, wie Ihnen der gestrige Ball bekommen ist?“
„Ausgezeichnet, Herr Hofrat“, erwiderte Else liebenswürdig.
„Nun ja, meine Frage war auch völlig überflüssig, denn einer so strahlenden Schönheit kann eine halbdurchtanzte Nacht nichts anhaben“; Hofrat von Weiden war immer sehr galant zu Frauen.
„Dürfte ich auch nach dem Befinden der Frau Mama Nachfrage halten“, fuhr der Hofrat in süßlichem Tone fort.
„Mama schläft noch“, gab Else zurück, „oder richtiger, sie schlief noch, als wir von Hause weggingen.“
„Wir?“ der Hofrat sagte es fragend.





























