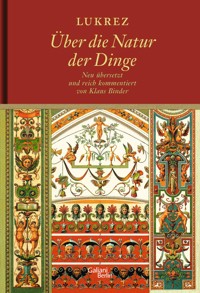
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Klaus Binders Neuübersetzung der Bibel der Sinnlichkeit – Lukrez' Über die Natur der Dinge. Fast unglaublich war, was der italienische Humanist Poggio Bracciolini in einem deutschen Kloster entdeckte – kurz nachdem in Konstanz Johannes Hus als Ketzer verbrannt worden war: ein Gesang aus der Römerzeit, der in wunderbarer Poesie vom Bau der Welt erzählt und wie die Menschen darin ein glückliches Leben führen können – ohne Angst vor dem Tod und ohne falsche Furcht vor Göttern. Die nämlich – so Lukrez – sollen den Menschen getrost egal sein. Eine philosophisch fundierte Feier der Natur, des Lebens und der Liebe. Es dauerte Jahrzehnte, bis das Buch im Druck erschien, und noch Giordano Bruno, der sich auf es berief, wurde wegen Ketzerei verbrannt. Aber der Siegeszug dieses unendlich schönen, freien und unvoreingenommenen Textes war nicht mehr aufzuhalten: Bruno, Galilei, Montaigne, Shakespeare, Gassendi, die Enzyklopädisten, Sterne, Wieland, Friedrich II., Goethe, Kant und Karl Marx, Nietzsche, Albert Einstein und Camus gehörten zu den Kennern und Verehrern des Buchs.Der Übersetzer Klaus Binder bemerkte bei seiner Arbeit an Stephen Greenblatts Bestseller über Lukrez , dass keine der vorliegenden deutschen Übersetzungen für ihn Schönheit und inhaltliche Raffinesse des Lukrez'schen Gedichts zufriedenstellend wiedergibt. Also machte er sich selbst an die Arbeit und legt hier – wie einst z. B. Wolfgang Schadewaldt mit Homer – eine verständnisfördernd kommentierte, rhythmisierte Prosaübersetzung vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 795
Ähnliche
Lukrez
Über die Natur der Dinge
In deutsche Prosa übertragen und kommentiert von Klaus Binder Mit einer Einführung von Stephen Greenblatt
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Lukrez
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Alfred Schmidt postum gewidmet, meinem philosophischen Lehrer, der mich begreifen ließ, dass Materialismus Leben heißt und offene Sinne.
Einführung
von Stephen Greenblatt
Wohl um 60 v. u. Z. von einem Römer namens Titus Lucretius Carus geschrieben, ist das philosophische Poem De rerum natura eines der großartigsten und zugleich merkwürdigsten Werke der klassischen Antike. Seine poetische Kraft ist offenbar sofort erkannt worden. Erst mit dem Untergang der Welt, so prophezeit der Dichter Ovid, würden auch die Verse des unvergleichlichen Lukrez vergehen. Und Cicero bestätigt seinem Bruder (in einem Brief aus dem Jahr 54 v. u. Z.): »Mit Lukrez’ Gedichten ist es, wie du schreibst: manch schöner Geistesblitz, aber doch auch bemerkenswerter Kunstsinn.« In seinem Lehrgedicht Georgica schließlich fand Vergil ehrenvolle Worte für den, dem es gelang, »der Dinge Ursprung zu ergründen, und der jegliche Furcht … niedertrat«. Keiner von Lukrez’ Zeitgenossen jedoch – zumindest in keinem der uns überlieferten Zeugnisse – hat sich um Nachrichten zum Leben des Dichters bemüht oder diese aufgezeichnet. Aus einer literarischen Welt, der Neugierde, Rivalitäten und Klatsch durchaus nicht fremd waren, fehlen uns ausgerechnet Nachrichten über die Person des Lukrez.
Das ist umso verwunderlicher, als der Name Lucretius nahelegt, dass der Dichter einem altehrwürdigen, hoch angesehenen römischen Geschlecht entstammt. Zudem hat er, im Ton vertrauter Freundschaft, sein Gedicht Gaius Memmius gewidmet, dem Spross eines angesehenen Adelsgeschlechts, der damals gerade politisch Karriere machte. Aus welchem Grund also hat sich ein solcher Schleier über De rerum natura und seinen Autor gelegt? Sofern dies nicht schlicht den Zufälligkeiten historischer Überlieferung geschuldet ist, ist die Antwort wohl darin zu suchen, dass Lukrez’ Gedicht den Werten des damaligen Rom und seiner Bürger zuwiderläuft.
Zu diesen Werten gehörten die Achtung der Götter und religiöser Gebräuche, kriegerische Tapferkeit und Bürgerstolz, zudem schätzten die Römer öffentliche Spektakel der Grausamkeit, sahen Kriege als Möglichkeit, reiche Beute zu machen, politische Ämter und Ruhm zu erwerben, der das kurze Leben des Einzelnen überdauern sollte. Zumindest auf einige dieser Werte spielt Lukrez an, wenn er seinen Helden, den griechischen Philosophen Epikur, überschwänglich als den Mann preist, den nichts schrecken konnte, schon gar nicht, »was erzählt wurde über die Götter, Blitze nicht und kein vom Himmel grollendes Getöse« (1.68), der vielmehr ausfuhr in die Welt und den Menschen reiche Beute brachte. Dieser Mann müsse ein Gott genannt werden, schrecklichere Monster habe er besiegt als sogar der heroische Herkules. Doch waren diese Beute und auch die besiegten Schrecken nicht gerade das, was Römer sich für gewöhnlich darunter vorstellten; und der Dichter machte keinen Hehl daraus, wie nichtig er praktisch alle Werte und Überzeugungen fand, die seine Zeitgenossen in Ehren hielten. Fromme Verehrung der Götter sei vergeblich und wahnhaft. Frieden sehnte er herbei, nicht militärische Eroberungen. Das sinnlose Töten von Tieren verachtete er ebenso wie die blutigen Gladiatorenkämpfe der Arena. Hinter dem Streben nach übermäßigem Reichtum, ganz gleich ob für die eigene Person oder für die Stadt, sah er nichts anderes als fehlgeleitete Suche nach Sicherheit, denn diese lasse sich unmöglich erreichen. Und angesichts der einfachen, unausweichlichen Tatsache, dass alles Irdische vergänglich ist, konnte ihm das ehrgeizige Streben nach ewigem Ruhm nur absurd erscheinen. Insofern sollten wir uns wohl eher über die wenigen Zeugnisse zeitgenössischer Bewunderer wundern als über den Schleier des Schweigens, der uns die Person Lukrez’ verbirgt.
Schon zu der Zeit, als mit der Konversion von Kaiser Konstantin im Jahr 312 der Aufstieg des Christentums in Rom begann, waren auch die Spuren der Bewunderung verschwunden. Die frühen Christen hätten durchaus einige von Lukrez’ Ansichten teilen können. Immerhin weigerten sie sich, den heidischen Göttern zu opfern, sie verachteten das obsessive Anhäufen irdischer Güter, priesen den Wert des Friedens, und niemand hatte mehr Grund als sie, die Gewalt der Arena zu verabscheuen. Doch die Motive, die sie dazu trieben, waren ganz andere als die des heidnischen Dichters. Christen träumten von einem Leben nach dem Tod – malten es aus als Reich der Strafen und des ewigen Lohns – und sie beteten zu einem allgewaltigen Schöpfergott, dessen Existenz Lukrez kategorisch bestritten hat.
Darum sind Hinweise auf Lukrez, die aus der Spätantike überliefert sind, sehr spärlich, und das wenige, das wir kennen, ist generell feindselig. Aus diesem Grund sollten wir die einzige biographische Skizze, die überliefert ist, mit aller Vorsicht genießen, jenen knappen Eintrag für das Jahr 94 v. u. Z. in der Chronik des Kirchenvaters Hieronymus, in dem es heißt: »Der Dichter Titus Lucretius wurde geboren. Nachdem ihn ein Liebestrank in den Wahnsinn stürzte, und er in den Pausen seines Wahns mehrere Bücher geschrieben hatte, die später Cicero durchsah, tötete er sich in seinem vierundvierzigsten Lebensjahr mit eigener Hand.« Selbst wenn an den Fakten, die Hieronymus nennt, etwas dran sein sollte, es wäre einigermaßen kühn, wollte man mehr für bare Münze nehmen als die kaum verhüllte Polemik.
Zu Hieronymus’ Zeiten hatte der Prozess bereits eingesetzt, mit dem nicht nur Lukrez’ Gedicht zum Verstummen gebracht wurde, sondern viele andere Stimmen aus der antiken Welt auch. In den folgenden Jahrhunderten beschleunigte sich der Prozess des Totschweigens noch. Kriege, Chaos, Zusammenbruch des Handelsverkehrs, der Zerfall des Bildungssystems, Einfälle barbarischer Völker ins ehemals römische Imperium, die Indifferenz, wo nicht Feindseligkeit der christlichen Autoritäten gegen alles Heidnische – all das forderte seinen Tribut von einer gesellschaftlichen, politischen und geistigen Ordnung, die sich selbst nicht länger verteidigen konnte. Besonders schwer traf dies die philosophische Schule, für die sich Lukrez eingesetzt hatte: den Epikureismus. Der hatte in philosophischen Debatten eine bedeutsame Rolle gespielt, doch waren, von Lukrez abgesehen, seine römischen Anhänger, die Cicero in einigen seiner Dialoge zu Wort kommen ließ, längst in Vergessenheit geraten. Die Schriften von Leukipp und Demokrit, den Begründern des antiken Atomismus, waren verschollen, ebenso die allermeisten Epikurs, Zentralfigur und Stifter dieser Lehre.
Angesichts dieser Verluste wurde Lukrez’ De rerum natura zur nuanciertesten und vollständigsten Darstellung dessen, was einst eine bedeutende philosophische Tradition gewesen, nun aber fast völlig vergessen war. Gelegentliche Hinweise zeigen, dass dieses Gedicht auch während des Mittelalters noch immer gelesen wurde – am interessantesten sind vielleicht etliche Zitate im Werk des bemerkenswerten Bischofs und Gelehrten Isidor von Sevilla. Doch blieben die wenigen Hinweise stets so flüchtig, dass dem Gedicht nur das Vergessen drohen konnte. Möglicherweise war es nur eine einzige, in Norditalien entstandene Handschrift, die über das siebte Jahrhundert hinaus erhalten blieb. Und diese wiederum ist im neunten Jahrhundert offenbar zweimal abgeschrieben worden. Ein Brand, ein zufälliger Akt des Vandalismus, auch bewusste Akte der Unterdrückung hätten genügt, um diesen Text für immer zu begraben, und mit ihm ein umfassendes Bild des Universums. Irgendwie aber hat De rerum natura dann doch überlebt, und 1417, völlig unerwartet, wurde das Poem erneut in Umlauf gebracht.
Verantwortlich dafür war der päpstliche Sekretär und Humanist Poggio Bracciolini. Poggio war ein außergewöhnlich begabter, ja faszinierender Mann – der größte Bücherjäger einer Epoche, in der wie besessen nach Texten, nach Spuren der klassisch-antiken Vergangenheit gesucht wurde. Ein Geistesriese freilich war er nicht, eher ein Bote, der Anreger, durch den etwas Bedeutsames in Gang geriet. Inspiriert durch sein Vorbild, den großen Dichter und Gelehrten Petrarca, unterwiesen von Coluccio Salutati, dem berühmten und hoch gebildeten Kanzler der Republik von Florenz, widmete Poggio seine freie Zeit dem Stöbern in Klosterbibliotheken, stets auf der Suche nach antiken Texten, die er dann kopierte und unter seinen humanistischen Freunden zirkulieren ließ.
Im Jahr 1417 befand sich Poggio in einer merkwürdigen Situation. Er hatte seinen Dienstherren, den mit allen Wassern gewaschenen, korrupten (Gegen)Papst Johannes XXIII. (Baldassare Cossa), nach Deutschland, zum Konzil von Konstanz begleitet. Die Ereignisse dort nahmen einen unerwarteten Verlauf. Von seinen Gegnern ausmanövriert, wurde der Papst abgesetzt, und Poggio war plötzlich seine Stellung los. Der einfallsreiche Bücherjäger nutzte die erzwungene Muße und besuchte Klöster in der Schweiz und in Deutschland, wo ihm einige bemerkenswerte Funde glückten.
Viele der Bücher, die Poggio »entdeckte«, standen natürlich in den Verzeichnissen der Klosterbibliotheken, doch für die Humanisten und ihre Freunde war es stets, als befreiten sie die antiken Texte aus der Gefangenschaft von Barbaren. Hier eine Briefstelle, in der Poggio über ein Manuskript des römischen Rhetorikers Quintilian schreibt, das er in Sankt Gallen aufgespürt hatte:
Er war traurig und in Trauer gehüllt, wie es Menschen sind, die zum Tod verurteilt sind; sein Bart war verdreckt, sein Haar voller Schmutz, und so machten sein Ausdruck und seine ganze Erscheinung deutlich, dass er zu einer unverdienten Strafe einbestellt war. Es schien, als strecke er die Hände aus und bitte um die Treue des römischen Volkes: Es solle verlangen, ihn vor dem ungerechten Urteil zu bewahren.
Tatsächlich hatten die Mönche die antiken Texte gerettet, denn sie hatten diese abgeschrieben und bewahrt; die Humanisten aber brachten diese Texte erneut in Umlauf und fühlten sich als Befreier.
Poggio hat nicht näher erläutert, wo genau er die Abschrift von Lukrez’ De rerum natura gefunden hat, vermutlich war es die Bibliothek der Benediktiner-Abtei in Fulda. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, ob ihm selbst die Bedeutung des Textes bewusst war, den er aufgespürt hatte, abschreiben ließ und nach Italien schickte; es wird auch seinen unmittelbaren Zeitgenossen nicht wirklich bewusst gewesen sein. Genau allerdings können wir das nicht wissen, denn damals wäre es ziemlich riskant gewesen, sich zu ausführlich, gar noch enthusiastisch über den Inhalt des lukrezschen Gedichts auszulassen.
Denn es machte Lesern außerhalb der Kirche ein Gedankengebäude wieder zugänglich, das damals jedem rechtgläubigen Christen Anathema war und das auch heute noch, selbst wenn es in vielen Punkten wissenschaftliche Bestätigung fand, heftig umstritten ist. Das Universum, legt Lukrez dar, besteht aus Atomen und Leere und aus sonst nichts. (Mit a-tomos bezeichneten die Griechen das, was nicht weiter teilbar ist, Lukrez allerdings verwendet dieses Wort nicht, sondern findet neue lateinische Worte wie »Urelemente«, »erste Dinge« oder »Keime der Dinge«.) Diese Urelemente sind unsichtbar, doch rein körperlich – und denkt man dies zuende, dann sind in der Welt keine mysteriösen geistigen Kräfte am Werk. Es gibt unendlich viele dieser Urelemente, sie haben verschiedene Gestalten – diese wiederum sind zählbar –, und sie sind, als Körper, unvergänglich. Indem sich verschiedene Atome miteinander verbinden, entstehen alle sichtbaren Dinge, die sich jedoch, da sie Atomverbindungen sind, auch wieder auflösen. Der Stoff aber, aus dem die Dinge gemacht sind, ist ewig und vergeht niemals. Abgesehen von den Atomen selbst bleibt nichts unverändert, denn alle Dinge, auch solche, die vollkommen fest erscheinen und unbeweglich, bestehen aus Materiepartikeln, die unablässig in Bewegung sind. Diese Bewegung bleibt uns zumeist verborgen, so wie wir auch die Atome niemals direkt wahrnehmen können, gleichwohl existiert diese Bewegung und wir können sie uns vorstellen, wenn wir winzige Stäubchen im Licht eines Sonnenstrahls tanzen sehen.
Warum sollte diese Theorie – und bis vor nicht allzu langer Zeit war der Atomismus nicht mehr als eine Theorie, eine brillante Hypothese ohne jede empirische Verifikation – beunruhigend gewesen sein? Aus irgendetwas muss das Universum schließlich aufgebaut sein. Und können die Menschen nicht selbst sehen (wenn sie, zum Beispiel, winzige Insekten beobachten), dass es erstaunlich kleine Partikel geben muss, die ihrerseits aus noch kleineren zusammengesetzt sein müssen? Beunruhigend war die Theorie, weil Lukrez, darin Epikur folgend, daraus den Schluss zog, ein Universum, das aus unendlich vielen unsichtbaren, unvergänglichen Elementen besteht, die sich ununterbrochen bewegen, brauche weder einen Schöpfer noch einen Designergott, der das Ganze vorausgedacht und geplant hat. Götter mag es geben – Lukrez hat wohl an ihre Existenz geglaubt –, aber damit, wie die Dinge sind, haben sie nichts zu schaffen. Die Natur selbst experimentiert, ununterbrochen. Und dafür braucht es nichts weiter als eine minimale seitliche Abweichung der Atome von der geraden Bahn, auf der sie nach unten fallen – Lukrez’ lateinisches Wort für diese Abweichung ist clinamen. Ohne sie würden die Atome niemals aufeinanderprallen. Die meisten dieser Zusammenstöße bleiben ohne Spuren, doch in der unvorstellbaren Dauer der immerwährenden Zeit wird alles, was wir sehen, entstehen – und weitaus mehr, denn das Universum ist unvorstellbar weit ausgedehnt.
Es ist schwer, sich etwas vorzustellen, das der großen Schöpfungsgeschichte, wie sie uns die Genesis erzählt und wie sie zu Beginn des Johannesevangeliums nochmals rekapituliert wird, fremder wäre. Und mit seiner Kosmologie hat Lukrez nur angerissen, was aus dieser Theorie alles folgt. Das Universum, so denkt er weiter, wurde nicht um der Menschen willen geschaffen, und auch das Schicksal der menschlichen Gattung hat keine einzigartige Bedeutung. Wir sind nicht anders entstanden als alles andere in dieser Welt auch: als Resultat einer langen Folge zufälliger Experimente. Die Lebewesen, die in diesen Experimenten entstanden sind und die sich ihrer Umwelt anpassen können, in der Lage sind, sich das notwendige Futter zu suchen und sich zu reproduzieren, werden für eine gewisse Zeit existieren, jedes nach seiner Art, bis nämlich gewandelte Umweltbedingungen oder eigenes Ungeschick und Dummheit zu ihrem Verschwinden führen. Es waren andere Arten auf der Welt, bevor wir kamen, und es werden, so unsere Welt bestehen bleibt, andere entstehen, nachdem wir längst vergangen sind. Unsere besondere Art zu leben – unsere Fähigkeit zu sprechen, die für uns charakteristischen Strukturen von Familie und Gemeinschaft, unsere Technik – sind entstanden im Zug einer langen, langsamen Entwicklung, haben sich durch Anpassung und Erfindung aus primitiveren Verhältnissen herausentwickelt. Doch ist diese Entwicklung kein eindeutiges Zeichen von Fortschritt: im Gegenteil. Vieles spricht dafür, dass die menschliche Gattung gefährlich selbstdestruktiv ist, vor allem in unserer Militärtechnik und in unserem aggressiven, verschwenderischen Umgang mit unserer Umwelt.
Unsere selbstdestruktiven Züge äußern sich auch, wie Lukrez dachte, in unserer Neigung, uns an Phantasien zu klammern, wie sie die Religionen bieten. Erschreckt durch Donner oder Erdbeben oder Krankheiten stellen die Menschen sich gemeinhin vor, bei solchem Unheil seien Götter am Werk. Dabei ließen sich für alle diese Phänomene natürliche Ursachen ausmachen, selbst wenn wir diese, all unserem Wissen zum Trotz, bis heute nicht völlig begreifen. Priester locken Gläubige mit Träumen ewiger Glückseligkeit im Jenseits, dem Lohn für Frömmigkeit, schrecken sie zugleich mit Visionen ewiger Strafen. Doch alle diese Bilder sind ein Gewebe von Illusionen. Denn die Seele ist, wie der Leib auch, ein materielles Gebilde, das sich mit dem Tod auflöst: Was also soll uns ein Leben nach dem Tod? Oberflächlich betrachtet ist religiöser Glaube eine Form der Hoffnung, seine untergründige psychologische Struktur aber ist ein Gebilde aus Drohung und Angst, und seine charakteristischen heiligen Rituale sind zutiefst grausam. Darum, so Lukrez, ist es allemal besser, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen – alles, was wir haben, ist dieses Leben im Hier und Jetzt –, besser auch, die Freuden dieses Lebens anzunehmen, entschlossen auf das Wirkliche zu blicken, auf seine Endlichkeit, auf den Tod.
Wäre der Epikureismus, den Lukrez so wortgewaltig ausbreitet, während des Mittelalters, so wie viele Schriften des Aristoteles, mehr oder weniger kontinuierlich im Umlauf geblieben, christliche Theologen, Gelehrte und Künstler hätten wahrscheinlich Wege gefunden, zentrale epikureische Vorstellungen in ihre eigene Weltsicht aufzunehmen. Doch als, nach über einem Jahrtausend fast vollständiger Stille, die Lukrezsche Theorie plötzlich zurückkehrte in die Welt, da erschien sie den meisten christlichen Lesern entweder absurd oder verrückt oder frevelhaft. Denn die Kultur, in die dieses Denken zurückkehrte, war geradezu besessen vom Bild des geschundenen und blutenden Christus und vom Versprechen ewiger Freude und Verdammnis.
Doch die leidenschaftliche Kraft des lukrezschen Denkens, die ungeheure Sprachgewalt seiner Dichtung, ihre wunderbaren Metaphern, ihre stilistische Raffinesse machten es schier unmöglich, diesen Text einfach zu übergehen. Eine Handvoll Menschen, zunächst in Florenz, dann in Italien, schließlich in ganz Europa, zeigten ihr Interesse, aber sie mussten sich vorsehen. Marsilio Ficino, der große Philosoph im Florenz des fünfzehnten Jahrhunderts, wagte sich an einen Kommentar, doch er verbrannte ihn, offensichtlich erschrocken darüber, auf welch gefährliches Terrain ihn der Text führte. Niccolo Machiavelli, der das Gedicht für den eigenen Gebrauch sorgfältig kopierte, hütete sich, Lukrez jemals namentlich zu erwähnen. Der ketzerische Dominikaner Giordano Bruno wiederum übte diese Klugheit nicht. Er vertrat Ansichten zur Natur des Universums, die denen ganz nahe waren, die er in De rerum natura kennengelernt hatte, er wurde bei der Inquisition angezeigt, verhaftet und 1600, nach Jahren der Kerkerhaft und unablässigen Verhören, in Rom auf dem Campo dei Fiori verbrannt.
Doch nachdem es einmal in Umlauf gebracht worden war, und vor allem, nachdem es die Druckerpressen erreicht hatte, war Lukrez’ Gedicht nicht mehr zu unterdrücken. Die interessantesten Hinweise auf seine frühe Rezeption finden sich in Werken von Künstlern, die nicht so leicht in Kollision gerieten mit den Autoritäten. Botticellis Primavera (um 1482) war direkt inspiriert von Versen aus De rerum natura, ebenso mehrere bemerkenswerte Darstellungen des Lebens der frühen Menschheit, die Piero di Cosimo schuf. Auch Michel de Montaigne fand in seinen Essais einen Weg, sich Lukrez – den er an Dutzenden Stellen zitiert – anzueignen und dessen Denken zu würdigen, ohne dass er die katholische Orthodoxie direkt herausfordern wollte. Dennoch sollten die Essais auf den Index gesetzt werden.
Gleichwohl machte Montaigne den Weg frei für den katholischen Priester und Mathematiker Pierre Gassendi, der im siebzehnten Jahrhundert den anspruchsvollen Versuch unternahm, Epikurs Lehre und christlichen Glauben zu versöhnen. Gegen Ende dieses Jahrhunderts dann wurden Stimmen vernehmbar, die sich von weniger frommen Motiven leiten ließen. Lukrez’ Atomismus hatte bereits das Interesse von Galileo geweckt, und trotz aller Angriffe von Jesuiten und anderen Verteidigern der Orthodoxie wurde der Atomismus als wissenschaftliche Theorie immer zwingender. Am entfernten Ende einer langen Kette naturwissenschaftlich-physikalischer Spekulationen, die die antike Naturphilosophie befeuert hatte, finden wir Isaac Newton und über Newton hinaus zuletzt Einstein. Die von Lukrez entwickelten Ideen zur Entwicklung der Menschengeschichte und zur menschlichen Psychologie fanden schließlich, auf allerhand gewundenen Wegen, auch Eingang ins Denken von Darwin, Freud und Marx.
Lukrez war wohl bewusst, dass seine Lehre manchen seiner Leser bitter erscheinen musste – und er scheute sich nicht, sein Gedicht mit einer erschreckenden Darstellung der Pest von Athen zu beenden –, seine alles durchdringende Absicht jedoch war therapeutisch. Es gibt viele falsche Ziele, viele Wege, die Zeit, die uns durch den merkwürdigen und wundervollen Zufall unserer Existenz gegeben ist, zu verschwenden. Tatsächlich aber ist das höchste Ziel eines Menschen kein anderes als das aller anderen Lebewesen: das Streben nach Lust.
Auch in diesem Streben stecken Täuschungen und Irrtum, die obsessiven Phantasien eingeschlossen, die um die natürlichen Freuden des Geschlechtsverkehrs gesponnen werden. In einer berühmten Passage untersucht Lukrez diese Phantasien und beklagt den vergeblichen Traum völliger Vereinigung. An keiner Stelle jedoch verurteilt er das Streben nach Lust, auch nicht das nach sexueller Lust. Im Gegenteil. Dies zeigt sich gleich zu Anfang seines Gedichts, wenn er die Göttin zur metaphorischen Zentralgestalt seines Gedichts macht, die alle Lebewesen unserer Welt zusammenführt im leidenschaftlichen Begehren und in der puren, kostbaren Lust am Leben selbst.
Warum Lukrez lesen und wie
von Klaus Binder
Man soll in vielen Stücken nicht denken wie Lucrez, ja man kann es nicht einmal, wenn man wollte; aber man sollte erfahren, wie man sechs bis acht Dezennien vor unserer Ära gedacht hat: als Prologus unserer christlichen Kirchengeschichte ist dieses Document höchst merkwürdig.
– Johann Wolfgang von Goethe[1] –
So kann ich davon träumen, dass ich einmal gehen lernte. Doch das hilft mir nichts. Nun kann ich gehen, gehen lernen nicht mehr.
– Walter Benjamin, »Lesekasten«[2] –
Aber es war der Ernst des Lebens, der aus ihnen [den Lesefibeln] sprach, und der Finger, der ihre Zeilen entlangfuhr, hatte die Schwelle eines Reichs überschritten, aus des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt: er war im Bannkreis des Schwarzweißen, von Recht und Gesetz, des Unumstößlichen, des für die Ewigkeit gesetzten Wissens. Wir wissen heute, was wir von dergleichen zu halten haben.
– Walter Benjamin, »Grünende Anfangsgründe«[3] –
Wie sollen wir so ferne Texte lesen? Wie vor allem Titus Lucretius Carus’ De rerum natura? Wir: Gefangene im Bannkreis des Schwarzweißen, des Unumstößlichen? Wie lesen, im Bann einer Geschichte, niedergelegt auch als Geschichte des Denkens und der Naturbeherrschung, in der bis heute Descartes’ Bannspruch gilt, Materie sei das schlechthin Raumfüllende, res extensa? Eine tote Masse also, tauber Stoff, die von sich aus keiner Form fähig ist und nur durch eines zum Leben zu erwecken, zu Form und Erfahrung zu bringen: durch res cogitans, das Denken.
Können wir uns derart unbefangen auf das Sehen und Tasten, auf unsere Sinne, ihre offene Rezeptivität verlassen wie Lukrez, der uns in über 7400 Versen einen wahren Sinnenrausch erleben lässt? Dieser Text nimmt uns mit, und unversehens vermögen wir das Höchste, den unendlichen Raum des Himmels über uns, zu erfassen: nicht als Begriff oder Idee, als flüchtiges Bild vielmehr, gespiegelt in einer Pfütze, die kaum einen Finger hoch vom letzten Regen stehen blieb. Und plötzlich eine Tiefe gewinnt, dass sie unter uns fasst, was sich hoch über uns wölbt. Und da, erschauernd, spüren wir, wir sind mittendrin, ein Punkt nur im Unendlichen (4.414).
Ein Bild, sagen wir, misstrauisch: Sinnestäuschung und Kopfgeburt. Dichterlatein. Vielleicht haben wir wirklich zuviel Kant gelesen oder – seit wir Lesen gelernt haben – sonstwie das abendländische Denken und sein Schwarz-Weiß in uns aufgesogen, diesen Vorgang dann aber vergessen. Sodass es uns selbstverständlich, ja rational scheint, den Sinnen zu misstrauen. Hat uns nicht Kopernikus demonstriert, Galilei mit seinem Fernrohr gezeigt, dass unseren zwar rezeptiven, doch ungenügend ausgestatteten Sinnen eben nicht zu trauen ist? Irgendwann haben wir gelernt, mit dem Widerspruch zu leben zwischen unseren Sinnen und dem Wissen, in dem sich verfestigt hat, wie wir praktisch, in historisch-gesellschaftlich bestimmter Form also, umgehen mit Natur und Welt. Mögen uns, jeden Tag aufs Neue, unsere Augen zeigen, wie die Sonne aufgeht, sich über den Himmel bewegt und schließlich tiefrot hinter dem Horizont verschwindet: Unser Wissen widerspricht ihnen. Was hilft uns, fragt der Verstand, das Staunen über einen Sonnenuntergang, wenn wir zum Mond fliegen wollen? Das »Wissen« verweist auf seine Erfolge: Fliegen wir nicht zum Mond, schauen wir den Leuten nicht ins Gehirn, sind nicht die Bausteine des molekularen Lebens identifiziert, warten sie nicht darauf, dass wir sie neu zusammenzusetzen? Auf res cogitans, auf das natur- und weltbeherrschende Denken ist wohl Verlass. Und dem haben die Sinne sich zu beugen. Nur im Zügel des Verstandes, versehen mit dessen Apparaturen, gegenständlich geworden im naturwissenschaftlichen Experiment, nur so glauben wir, Kinder der abendländischen Moderne, Welt »wirklich« sehen zu können. Sinne und Sinnlichkeit sind uns in ihrer offenen Rezeptivität fremd geworden.
Wie also De rerum natura, diesen weltoffenen, sinnenfrohen Text lesen, ohne dass wir seinem Autor immer wieder in Wort und Gedankenbewegung fallen, so wie weiland Hegel,[4] der den Vorrang des Sinnlichen im epikureischen Atomismus anstößig fand, Epikurs Denken gewissermaßen liederlich,[5] pure Küchenpsychologie: Beim Ding, dem bloßen »Diesda« bleibe es stehen, weil ihm der die Sinne schärfende Begriff fehle. Man hätte, rät Hegel, weitergehen müssen, aber das »wäre ein Verfallen ins Begreifen gewesen, was nur das epikureische System verwirrt hätte«. Vom Katheder eines ausgefuchsten Idealismus herab wird der begrifflich unbewehrte Sensualismus dieses frühen Denkens heruntergeputzt.
Zum Glück hat Lukrez sich von dergleichen nicht schrecken lassen.[6] Widersacher hatte auch er – der fairste war Cicero[7] –, und auch Lukrez selbst hat ordentlich ausgeteilt. Dogmatisch oft im Sinne seines Meisters Epikur, meist ohne seine Gegner zu nennen. Niemals aber ist er derart »ins Begreifen verfallen«, dass er, was die Sinne melden, aufgelöst hätte ins Begreifen des Begreifens und daraus eine Philosophie im uns vertrauten Sinn gemacht: Erkenntnistheorie, die, gleich nach welcher Schule sie operiert, ihr System noch stets zur Voraussetzung dessen verselbständigt, überhöht hat, was wir überhaupt von Natur und Welt wissen können, womit die Sinne herabgewürdigt sind zu bloßen Zuträgern von sinnlichen Daten.[8]
Fachphilosophen mag die Naivität des frühen Atomismus als Schwäche erscheinen, ich empfinde sie als Glück. Denn wenn sich die Suche nach der Wahrheit so sehr in sich verbohrt, dass ihr die Welt aus dem Blick gerät, ist es gut, einen Schritt zurückzutreten. Bei Lukrez ist alles Natur, auch das Denken und seine Bewegungen, die Sinne zumal, und indem wir diesen folgen, in denen Natur gleichsam sich selbst begegnet, scheint es, als befreie sich unser Blick von all den Bindungen, mit denen wir an unseren kulturellen Erzeugnissen hängen – fester als Lukrez dies für den Aberglauben seiner Zeitgenossen beobachtet hat –: am Schwarz-Weiß des Scientismus, an der Unumstößlichkeit eines Begreifens von Materie, das eben das »Greifen«, das »Berühren«, die Sinne, auslässt, der Quantifizierung und der Ordnung des Begriffs zuliebe. Wir hängen an einem Wissen, das irgendwann vergessen hat, dass zum Erkennen zweierlei gehört, Berühren und Berührt-Werden. Ein Austausch, Stoffwechsel. Lukrez entfaltet ihn in all seinen Variationen. Lukrez lesen heißt, diesen Stoffwechsel erleben. Dahin nimmt dieser Text uns mit.
Die Tür also ist nicht vollends zugeschlagen; zu unserem Glück haben wir diesen Text zur Hand, der gleichsam »auf der Schwelle« steht. Vielleicht können wir doch, um es mit Walter Benjamin zu sagen, noch einmal »Sehen« lernen, nicht nur träumend: sondern indem wir uns diesem, weil durch und durch poetischen, so überaus genauen Text überlassen, der die Dinge geradezu aufsaugt, sie zum Sprechen bringt und ihnen ihr Eigenes lässt. Berühren und Berührt-Werden, darum geht es: »Ja, Berühren weckt die Sinne des Leibes« (2.434). So geraten wir selbst auf diese Schwelle: Wenn wir den uns fremden Bewegungen dieses Textes folgen, den Bildern und Bildketten, seinen Abschweifungen und Assoziationen, den Beweisen aus Analogien. Nur eine Regel stellt Lukrez (mit Epikur) dafür auf: Es darf, was wir denken und uns vorstellen, dem nicht widersprechen, was uns die Sinne melden. Das klingt wie »Empirismus«, ist es aber nicht; im Gegenteil: Lukrez verteidigt mit seiner Regel einen Punkt, den der Empirismus zunehmend verloren hat: den Punkt, an dem wir mit unseren Sinnen und ihren Bewegungen an den Bewegungen der Natur teilhaben. Und er zeigt uns den Zugang zur Welt, der durch die Dichotomien, die unser Denken prägen und beherrschen, blockiert ist. Öffnet einen Raum möglicher Erfahrungsbewegungen, denn, mit Lukrez: »Die Dinge sind es, die einander beleuchten.« (1.1118)
Raum für Bewegungen, die zum einen zur Vorstellung des unendlich Großen führen, uns selbst da noch fühlen lassen, dass wir nicht draußen stehen, der Natur und der Welt gegenüber, sondern mit unseren Sinnen, mit unserem Sinnen und Denken, in dieser Welt, die zur zweiten (gesellschaftlichen) Natur wurde, in der sich aber doch Risse, Durchblicke auftun. Sodass wir nochmals einen gleichsam kindlichen Blick riskieren können und von dieser Reise reicher zurückkommen, »siegreich«, wie Lukrez von Epikur sagt: »So hat sich die Lage verkehrt: Niedergetreten, am Boden liegt der Aberglaube.« (1.79) Was uns betrifft, unser Aberglaube ist der Scientismus, der nun, und sei’s für diesen Augenblick, seinen Alleinherrschaftsanspruch verloren hat. Nicht Maschinensturm ist damit angesagt, der Streik gilt dem scientistischen Alleinvertretungsanspruch in Sachen Wissen und Wissen-Können, gilt den Folgen des »Techniker-«, des »Beherrschungswissens« (Michel Serres).[9] Auch der Arbeitsteilung, die sich daraus entwickelt hat: hier die Wissenschaft, dort die Poesie, das Ästhetische; hier der Verstand, da das Gefühl, etc.[10] Lukrez’ Text lässt uns ahnen, dass wir, um es mit Wolfgang Welsch[11] zu formulieren, keineswegs »weltfremd« sind und uns die Natur darum zurichten müssen; dass wir nicht Fremde in dieser Welt sind, sondern »Weltwesen«: in und mit dieser Welt geworden, in ihr leben, sie auch wieder verlassen.
Bewegungen zum anderen, die zum Allerkleinsten führen: zum Atom, das »niemand je zu Gesicht bekommen wird«. Mehrfach, in immer neuen Anläufen, führt uns Lukrez diesen Weg entlang, und stets ist das Sichtbare, Tastbare, auch zu Schmeckendes, zu Riechendes, zu Hörendes nachspürbarer Ausgangspunkt. In der Tat stößt man beim Lesen immer wieder auf Stellen, an denen man ausrufen möchte: »So habe ich das noch nie gesehen!«
Und stets bleibt die Grundregel bewahrt, bei welchem Gedankending wir auch landen, ob hoch oben bei den »himmlischen Feuern« oder im Mikrokosmos der »Urelemente«, dem Allerkleinsten – beim, wie wir sagen würden, Atom, das er uns begreifbar macht nach Gestalt, Bewegung, Lage.[12] Nichts an solchen Gedankendingen darf dem widersprechen, was sinnlich vorstellbar ist. (Anders würden wir den Korrespondenzpunkt, den Punkt des Austauschs verfehlen.) Halten wir uns daran, dann sehen wir als Gewebe, was uns für gewöhnlich auseinanderfällt; spüren förmlich, es muss sie geben, diese durchgehende Einheit der Natur. Eine flüchtige Erfahrung nur, mit Sinnen und Affekten erfasst, aber sie entwischt uns nicht grundsätzlich – wir müssen sie nicht im Begriff verdinglichen und fixieren.
Atome, Urelemente: sinnlich vorstellbar? Lukrez hat diesen Einwand gewiss gehört – und geantwortet mit der so genauen wie hochpoetischen Darstellung der in einem Lichtstrahl tanzenden Sonnenstäubchen:
Sieh nur genau hin, wenn die Sonne in einen dunklen Raum zu dringen vermag und ihr Licht in einzelnen Strahlen durch diesen sendet: Viele winzige Stäubchen wirst du sehen, wie sie sich im leeren, vom Licht hellen Raum mischen auf vielerlei Weise: Als lägen sie in endlosem Streit, kämpften pausenlos miteinander in immer neuen Verbänden, angetrieben zu immer neuer Verknüpfung und wieder Trennung. Dies mag dir eine Vorstellung davon geben, wie es sich verhält mit den Urelementen, die im leeren Raum in unaufhörlicher Bewegung begriffen sind. (2.114f.)
Lukrez lesen heißt, (wieder) lernen, sich solchem Taumel und Tanz zu überlassen.
Einfach freilich macht er uns das nicht. Wer sich einlässt auf das, was Lukrez immer wieder das »wahre Denken« nennt, sollte wissen, was er tut. Einer der gewaltigsten von vielen gewaltigen Sätzen, die uns in De rerum natura begegnen, ist gewiss das berühmte »Der Tod aber geht uns nichts an«. Auch das apodiktische »Körper und Leere, sonst nichts« ist nicht ohne. Der ganze Epikureismus, wie Lukrez ihn präsentiert, ist eine Zumutung. Bei allem, was in der Natur geschieht – immer schon, gegenwärtig, zukünftig – soll der Zufall die Finger im Spiel haben, grundlegend. Leer sei die Welt, ohne Götter zudem, ohne vorfabrizierten Sinn, eine Welt vielmehr, die für uns nicht gemacht ist, zu vieles läuft falsch darin. Ein Tanz der Atome ohne Ziel und Zweck, eine Natur, die sich um uns nicht kümmert, in der wir noch nicht einmal zwingend vorgesehen sind – das soll die Basis abgeben für eine Ethik, die doch auf Lustgewinn aus ist? Kann dies die Welt sein, in der es uns möglich wäre, ataraxia, Seelenruhe, zu erreichen, und diese gar als höchstes Glück?
Ja, genau das. Ein fröhliches »Augen auf und durch!«. So jedenfalls sieht es Michel de Montaigne, Epikureer und Lukrezleser, der seinen Spaß daran hat, »den Philosophen die Ohren mit einem Wort vollzudröhnen, das sie derart anwidert«, mit dem Wort Lust, denn: »Was immer die Philosophen sagen – selbst in der Tugend trachten wir letzten Endes nach Lust.« Die aber vermiese uns die Todesfurcht. Und diese ist nichts anderes als Furcht vor der Leere, dem Nicht-Sein, das Lukrez hereinholt in Sein und Geschehen der Natur. Man müsse sich, schreibt Montaigne im Essai »Philosophieren heißt sterben lernen«, auf den Tod vorbereiten: Er sei unausweichlich, da helfe weder Flucht noch anderer Harnisch, es bleibe nur: »Berauben wir ihn seiner Unheimlichkeit, pflegen wir Umgang mit ihm. … Reißen wir uns dann zusammen, spannen wir die Muskeln!«
Der Tod geht uns nichts an – spannen wir die Muskeln. Kein Widerspruch, eher ein Verständnis vom Leben in der Welt, das uns abhandengekommen ist, rund 600 Jahre nach Montaigne, gut 2000 Jahre nach Lukrez’ Tod. Und wer über diesen Stachel nicht hinwegkommt, der bedenke, dass in diesem Widerspruch alles steckt, was in dieser Zeitspanne gesellschaftlich, historisch, kulturell geschah, auch mit uns, alltäglich. Wir heute müssen den Punkt tatsächlich suchen, von dem aus Muskelanspannen nicht nur in Muckibuden und zu Bodyshape führt, oder sonst zu Protzgehabe. Wir »gönnen« uns was, »genießen«, sind doch »nicht blöd«: auch »Geiz ist geil«. Hören immer häufiger die Frage, ob etwas »Sinn macht«, stellen sie selbst. Viele dieser Zeitgeistformeln bringen grammatisch verquer, wie sie daherkommen, zum Vorschein, was wir gar nicht gerne hören. Dass nämlich »Sinn«, nehmen wir dies ernst: sinnlich ernst (dringen also auf Befriedigung), nichts sein kann, was nur jeden für sich etwas angeht. Doch so wie unsere Gesellschaften verfasst sind, erkaufen wir jedes Glück mit Nicht-Glück, gar Unglück anderer. Das mögen wir nicht hören. Darum: Wenn es keinen Sinn gibt, »machen« wir uns eben einen. Die unsere Tage immer aufs Neue überschwemmenden Wellen der Sinnstiftung und Seelenmassage, Frustkonsum und Burnouts, Orientierungslosigkeit, sonntäglich beklagter »Werteverlust« – das alles freilich spricht eher für die Vergeblichkeit solcher Unterfangen privathedonistischer Sinnproduktion und des eiferndem Pochens auf Lustgewinn, auf das Recht auf »Schnäppchen«.
Ich bin nicht der Meinung, dass wir, dass unsere Sinne all dem gegenüber hilflos sind. Glaube auch nicht, dass uns Epikur oder Lukrez, wie ausgerechnet Herbert Marcuse[13] argwöhnte, eine »Seelentechnik« hinterlassen hätten, Verfahren des Lustgewinns, der Schmerzvermeidung, des Rückzugs, den abgeklärten Rat des sich Fügens ins Unvermeidliche. (Immerhin war der Stoizismus Lukrez’ größter Gegner.) Nicht der neue Tag, sagt Lukrez, allein das Studium der Natur kann uns das Wissen geben, das aufgestörten Seelen Ruhe, Befreiung bringt. Und »Natur« ist hier alles, umfasst auch die Welt der Menschen und der Moral.
Wir müssen sehen lernen. Das ist Ziel dieser fulminanten Reise in Natur und Welt. Lukrez’ Ausflüge in Himmel und Erde, in Naturgeschichte, Menschengeschichte, Gesellschaftstreiben, das, wozu sein Text uns bis heute einlädt, ist dabei alles andere als kontemplativ: Er unternimmt diese Reise in praktischer, ja therapeutischer Absicht. Denn wer erkannt hat, dass alles in Natur und Welt aus sich heraus geschieht, der braucht keine Götter mehr, muss ihren Ratschluss nicht fürchten, braucht keine Religion; der sieht zuletzt, dass auch die Todesfurcht gegenstandslos ist: Es droht kein Leben nach dem Tod. Das ist die gute Nachricht.
Sie hat ihren Preis. Lukrez ist das nicht entgangen. Denn sehr genau beschreibt er, dass es Angst ist, die zur Projektion der Götterwelt führt. Und im schon erwähnten Blick in die Pfütze, die, zu unseren Füßen, die ganze Welt enthält, die Welt aus Atomen und Leere, lässt er uns den Schauer spüren, den ein unverhoffter Blick ins Bodenlos-Leere auslöst. So fest ist der Boden gar nicht, auf dem wir stehen, kontemplationsfördernd gemütlich jedenfalls ist eine Welt nicht, in der der Zufall herrscht und »alles was entsteht, [auch] zugrunde geht« – doch hören wir genau hin: Anders als bei Mephisto-Goethe kein Wort davon, es sei, was entstanden ist, auch »wert, dass es zugrunde geht«.
Insofern überzeugt mich die Debatte nicht, die unter Philologen und Kommentatoren von De rerum natura darüber entbrannt ist, dass dieses so sinnenfrohe Lehrgedicht ausgerechnet mit der Pest in Athen endet.[14] Sie wird nüchtern beschrieben, als Seuche, Naturgeschehen, nicht als Heimsuchung oder Strafe der womöglich sündigen Athener. Weil diese aber, unvorbereitet, wie sie sind, dem Ansturm des Todes nicht standhalten können, darum zerreißt in ihrem, von panischem Schrecken bestimmten, Handeln alles, was ihre Gesellschaft bis dahin zusammenhielt: Empathie, Mitmenschlichkeit, Moral, Sitten, der Glaube. Gleichwohl: Diese Pest ist eine Seuche, nicht mehr – aber auch nicht weniger.
Man hat darüber gerätselt, ob Lukrez nicht Melancholiker war, rückte sogar der Legende näher, die einer der Kirchenväter in Welt gesetzt hat, der Schauergeschichte des zuletzt wahnsinnig gewordenen Lukrez.[15] Will sagen, man stellte sich vor (nicht ohne hämisches »Siehste wohl«), Lukrez habe nicht ausgehalten, was er als Verfall seiner Welt beobachten konnte, dem er dann auch noch ein quasi theoretisches Fundament verpasst habe, die Vergänglichkeit entsprechend zum Kennzeichen unserer Welt gemacht. Man solle, schrieb Goethe, ja man könne, selbst wenn man wolle, gar »nicht so denken wie Lucrez«. Der Geheimrat konnte sich schlicht nicht vorstellen, dass einer, der doch so ergreifend über die Schönheiten der Natur zu schreiben verstand, sich nicht vorweg dessen sicher war, ja, sein musste, dass die Welt in Einheit, Ordnung und Schönheit »für uns eingerichtet« sei.
Insofern: Ein »Grübler« (Montaigne) mag Lukrez gewesen sein, ein Melancholiker war er nicht. Die blicken anders in Natur und Welt, alles Tätige ist ihnen vergangen. Lukrez aber hat ernst genommen, was sich seinen Sinnen bot, und durchaus praktische Schlüsse, wenn nicht gezogen, so uns doch nahegelegt.
Das Leben vor dem Tod findet hier und heute statt, oder gar nicht. Darauf läuft alles hinaus. Doch läge falsch, wer sich von De rerum natura eine Art Lebensfibel, ein Kompendium des guten oder richtigen Lebens erwartete. Es geht nicht um Dogmen und Sentenzen, nicht um »Lektüre für Minuten«, Erkenntnisse, die man getrost nach Hause tragen könnte. Dazu ist uns dieser Text wirklich zu fern, manches wissen wir trotz unserer historisch kastrierten Sinnlichkeit tatsächlich besser, vieles ist nicht für unsere Zeit geschrieben. Lukrez ist Römer, Ritter, vermutlich Sklavenhalter. Es geht einzig und allein um den Bewegungs-, den Vorstellungsraum, der sich öffnet, wenn man sich mit Lukrez auf die Reise begibt. Es geht um die Bilder, die uns beim Lesen auftauchen; es geht um lebenspraktische Schlüsse, die wir ziehen, mal von Leselust und ästhetischem Vergnügen angestoßen, dann auch erschreckt; es geht zuletzt darum, dass wir unseren Sinnen, ihren Affekten und Defekten, nicht mehr in jedem Augenblick allein mit Misstrauen oder, von unseren Fetischen geblendet, mit blinder Hingabe begegnen.
Der Tod geht uns nichts an. Das Leben schon. Ein anderes haben wir nicht, keine Ausweichstation, keinen Fluchtort in dieser global verdichteten Welt. Und wenn im leeren All niemand ist, der uns an die Hand nimmt, wer, wenn nicht wir selbst, könnte das tun? Darum: Spannen wir die Muskeln, sehen wir zu, dass diese Tür nicht vollends zufällt. Schlagen wir dieses Buch auf.
Vom Übertragen: Bemerkungen zu Prosatext und Kommentaren
Bei weitem nicht alle Aspekte, die uns an diesem fernen Text fesseln können, sind damit genannt. So viel aber sollte klar werden: Ich verstehe meine deutsche Prosafassung von De rerum natura als Reiseführer, der nicht »modernisieren« will, sondern das Fremde respektieren und damit das uns Eigene kenntlich machen: Ursprünge unserer Geschichte, unserer Beunruhigung, ja Orientierungslosigkeit. Dem dienen auch die Kommentare, die zunächst sachlich notwendige Erläuterungen liefern, innertextliche Zusammenhänge und Argumentationsbögen aufdecken. Darüber hinaus aber immer wieder Korrespondenzen zwischen dem Fremden und dem Eigenen sichtbar machen, Denkräume öffnen sollen.
Wir könnten es uns leicht machen, könnten aus den 2000 Jahren, die zwischen Lukrez und uns liegen, einen Abwehrschirm fabrizieren, uns amüsieren darüber, was der alles noch nicht weiß, wie er um die Ecke denkt, in vielem schön und erhaben, gewiss, aber irgendwie auch kurios, oder? Und könnten uns derart gestärkt selbst auf die Schulter klopfen, aus De rerum natura ein Märchen aus uralter Zeit machen oder ein Gedicht, feierlich fernen Gesang, so überaus begeisternd zu hören.
Die meisten Kommentare, die ich gelesen habe, können sich dieser Tendenz zur Entrückung im Grunde nicht entziehen, auch bisherige Übersetzungen sind nicht frei davon. Sie ergibt sich aus einem gewissen Historismus ihrer Autoren: aus der ziemlich unbeirrt verfolgten Frage, was Lukrez denn »eigentlich« hat sagen wollen (einer Frage, der die »Textkritik« dienstbar gemacht wird). Was hat dieser Mann, der rätselhaft aus dem Dunkel der Geschichte tritt, bedenkt man seine Zeit, überhaupt wissen können? Und, erstaunlich, was hat er nicht alles gewusst! Und so lässt sich, verwundert und durchaus gönnerhaft, feststellen, wie »modern« er doch in vielem gewesen sei. Unter der Hand wird dieser Geist aus fremder Zeit zum »Vorläufer«. Und wenn Lukrez gerade nicht dahin wollte? Nicht dahin, wo wir uns ihm gegenüber so sicher wähnen, mit allen Wassern der Wissenschaft gewaschen?
Mit all dem wird Lukrez »in seine Zeit« gestellt, ausgeblendet, dass dies von heute her geschieht. Man zementiert besserwissend die Distanz, armiert sie mit dem, was wir für Fortschritt halten. Meine Kommentare wollen das nicht. Sie setzen da an, wo mich beim Lesen, Rätseln, Aufschlüsseln, Verstehen, Übertragen etwas getroffen hat, wo eine Resonanz entstand, gerade an »kuriosen Stellen«. Was zum Beispiel geht da vor, wenn im Zweiten Buch die mal rot, mal türkis schillernde Taube, der weiße Rabe, der schwarze Schwan ins Rennen geschickt werden, in den Streit um das, was Farbe ist und Farbwahrnehmung? Viele derart merkwürdige Stellen gibt es, Beobachtungen am Unscheinbaren; dort setzen Gedankenexperimente an, die aufs Ganze zielen – und Verwirrung stiften: Bewegung. Darauf muss man sich einlassen, dann setzen sie unsere Gewohnheiten und Vorsichtsmaßnahmen augenblicklich außer Kraft. Lukrez mit seinem sensualistischen Materialismus ist, aus dem Mainstream der abendländischen Philosophie ausgebürgert, zum Wegelagerer geworden. Plötzlich bricht er aus den Büschen, und wir stehen direkt vor diesen Versen. Die Distanz ist weg. Wir sehen die Welt mit anderen Augen. Und sehen, indem wir das Andere sehen, auch unsere Welt neu.
Die Neuübertragung ist ein Experiment. Ich wollte mich diesem Wegelagerer stellen: wegen der Fragen, die ich mitgebracht habe aus unserer Zeit und die gerade dann virulent werden, wenn plötzlich Wegezoll gefordert wird und wir unsere Habe mustern müssen. Zweifel meldet sich, darin die Ahnung, dass etwas nicht stimmt, wenn nicht mit unseren Fragen, so doch mit der Art, in der wir zu fragen gewohnt sind. Das bewirken der Schock des Überfalls, die Reibungen am Fremden und scheinbar Verqueren.
An diesen Stellen gehen die Erläuterungen über in Kommentare. Diese habe ich bewusst subjektiv gehalten, aus dem Horizont meiner Erfahrungen formuliert. Dogmatisches wäre hier fehl am Platz. Denn ich wollte die Schwelle sichtbar machen, die dieser Text markiert, dessen Autor alle Vorsichtsmaßnahmen trifft, dass ihn sein Denken und Sinnen nicht aus dieser, aus seiner Welt katapultiert. Denn das will er am wenigsten, Zuflucht suchen vor den Fragen, die ihn und seine Zeitgenossen bedrängen, Zuflucht bei höheren Wesen, bei teleologischen Hoffnungen. Denn den praktischen Horizont allen Wissen-Wollens wollte er keinesfalls aus den Augen verlieren, die Frage nach dem guten, dem rechten Leben; nach dem Sinn, der, wie Ernst Bloch sehr viel später gesagt hat, »noch nicht ist«, aber werden kann.
So sind meine Kommentare hin und wieder umfangreicher geraten, als bei solchen Gelegenheiten üblich. Man könnte mich fragen, ob ich nicht besser einen konsistenten Essay geschrieben hätte. Meine Antwort: Ich will am Text, im Lesefluss bleiben, dem langsamen Prozess treu, in dem sich dieser fremde Möglichkeitsraum öffnet; habe darum kommentierend auch Neuansätze, Wiederholungen, Denkschleifen in Kauf genommen. Nur so kann ich Leser an meinem Übertragungsprozess teilhaben lassen, sie ihrerseits zum fragenden Lesen anregen. Auf keinen Fall wollte ich »über« De rerum natura schreiben, sondern vorführen, wie ich mich, von diesem Text bewegt, »in« ihm bewegt habe.[16] Wenn ich davon ausgehe, dass wir es mit einem Text zu tun haben, der »auf der Schwelle« steht und dass diese mit gleichsam linearem Zugriff nicht zu erreichen ist, dann, denke ich, gibt es nur diesen Weg, die fragmentarische, im Fluss des Textes immer wieder neu ansetzende Annäherung.
All das gilt auch fürs Übertragen. Natürlich hätte ich meine Übertragung ohne die seit Langem unter Philologen geführte Debatte zu Textüberlieferung und Lesarten niemals zustande gebracht. Ebensowenig ohne die vorauslaufenden Übersetzungen. Die ungeheure Arbeit, die darin akkumuliert ist, ihre Standpunkte, Ergebnisse, Fragen und ungelösten Probleme kann ich aufnehmen und entsprechend fühle ich mich wie Robert K. Mertons sprichwörtlich gewordener »Zwerg auf den Schultern von Riesen«, auch dankbar wie dieser. Ich kann den Korpus der Lukrez-Philologie nur als »gegeben« voraussetzen; mich in diese Debatten einzumischen, lag nicht in meinem Interesse.
Zuletzt aber sind auch alle philologischen Mühen[17] nur Interpretationen: Versuche, Lukrez zu verstehen. So wie meine Übertragung auch. Insofern: Ich beziehe mich auf die bisher geleistete Arbeit, halte aber Abstand. In meinem Blick auf den Text steckt auch all das, was mich an diesen Debatten unbefriedigt ließ.
Kurz: Ich will Lukrez’ Bild »unserer Welt« in deutscher Prosa sichtbar machen: für Leser heute. Ich hatte nicht das Interesse, zu einem »verbindlichen« Text zu gelangen (wenn es den überhaupt gibt). Ich weiß, dass man an vielen Stellen zu anderen Lösungen und Entscheidungen kommen kann. Doch als Ganzes entsteht ein solcher Text immer im Kopf der Lesenden, darum auch immer wieder neu, was nicht zuletzt die lange Rezeptionsgeschichte zeigt.
Rechtfertigung für mein Vorgehen finde ich bei Lukrez selbst. »Getäuscht werden sie, doch nicht getrogen«, schreibt er, wo es ihm um das geht, was der Dichter will und kann (1.942) – ein Leitfaden auch beim Übertragen. Ich täusche meine Leser insofern, als ich ihnen einen möglichst »fertigen« Text liefere, an Lesbarkeit gedacht habe und diesen Text so eingänglich, so kräftig und so schön wie möglich machen wollte, natürlich im Sinn seines Urhebers. Es geht um die in seine Worte gefasste Vorstellung von Welt – aber so, wie mich diese Vorstellungswelt erreicht, wie ich sie verstehe und was mir an ihr bedeutsam ist.[18] Das Lateinische, so wie es die Philologen pflegen, ist dabei nicht der einzige Schlüssel. So dicht ich mich an den Originaltext halte, ich kann nur eine Annäherung liefern: Vorschläge, wie zu lesen sei.
Das gilt für jede Übersetzung. Umso mehr aber für eine aus dem Lateinischen (der Sprache einer versunkenen Welt) ins Deutsche. Dabei ist Übersetzung sowieso ein falsches Wort. Denn der Übersetzer ist kein Fährmann, der nur von einem Sprachufer zu einem anderen kommen muss: Sinneinheiten wie Pakete transportieren und abliefern. Will er sie sicher und zugleich so ans andere Ufer bringen, dass sie an ihre Adressaten gelangen, an Leser unserer Zeit, muss er sie öffnen. Übertragen heißt, janusköpfig beide Ufer im Blick haben. Wobei das Zielufer, die Zielsprache und ihre Bedeutungshorizonte wohl noch genauer zu beachten sind als der Ausgangspunkt. Denn tatsächlich beginnt die Überfahrt am Zielufer. Da ist der Fährmann (um im Bild zu bleiben) stationiert, da auch fehlt irgendetwas, lockt. Warum sonst sollte er sich aufmachen ans fremde Ufer? Er sammelt ein, was er dort findet, und nimmt es mit zurück. Es wird sich verändern auf dieser Fahrt.[19]
Darum »Übertragung«, das Wort lässt immerhin anklingen, dass sich etwas ändert; dass, was da zwischen den Sprachen und Zeiten unterwegs ist, in einen anderen Horizont gehoben wird. Das gilt umso mehr, als wir es mit einem philosophischen Text tun haben, der wiederum kein Traktat ist, sondern ein hochpoetischer Text, dessen Schönheit und Form, so wollte es der Dichter,[20] Verstehen und Erkennen seiner Zeitgenossen fördern sollten – in therapeutischer Absicht.[21] Auch die lässt sich nur übertragen. Und was wir für verständlich und schön halten, ist nicht unbedingt das, was ein Römer um 60 v. u. Z. für schön und verständlich hielt. So musste ich verhandeln, auch mit den Philologen.
Lukrez selbst schreibt mehrfach, dass er in »unbekannten Gefilden unterwegs« sei, ein Experiment gewagt habe. Schon sein Text ist die Übertragung einer ganzen Gedankenwelt aus dem Griechischen ins Lateinisch-Römische. Auch das ist in unser Deutsch, in unsere Sprache und Erfahrungswelt zu holen, ohne ihm die Fremdheit zu nehmen. Um sie zu bewahren, habe ich an keiner Stelle »erläuternd« übersetzt, sondern stets in den Anmerkungen kommentiert. Habe auch Lukrez’ sprachliche, gestische Eigenheiten beibehalten, all die »wolligen Schafe«, das »Nass des Wassers«, seine Neigung zu Pleonasmen; zugleich seine experimentierende Ungeduld, die hämmernden porro, denique, nunc age, praeterea (weiter, ferner, auf denn etc.), die dem Dichter Christoph Martin Wieland etwa ungelenk schienen: Er meinte, ein Übersetzer möge sie tunlichst weglassen. Nein, das Gehetzte ebenso wie das Ausruhen auf sprachlichen Formeln, auf stereotypen Epitheta, all das, wird es mit übertragen, hilft das Fremde zu bewahren.[22]
Übertragung auch insofern, als ich die Form gewechselt habe. Ich wollte den Text, um den Zwängen des Hexameters zu entgehen,[23] in deutsche Prosa bringen. Womit ich dem Dichter und Sprachkünstler Lukrez eine der Errungenschaften genommen habe, für die er nicht nur von Philologen, auch von (alten wie neuen) Dichtern gefeiert wurde – das Ergebnis einer Verhandlung, in die einzubeziehen war, dass auch seine Wortwahl, seine Satzkonstruktionen bis in Beiwörter hinein dem Zwang des Versmaßes geschuldet sein können. Seine Spracherfindungen und die von ihm entwickelten Denkfiguren waren aber auch darauf zu untersuchen, wie sie vergegenwärtigen, was Lukrez vor langer Zeit bewegt hat – wozu ich auch sie »übertragen« musste.
Eine Sprache war zu finden, Worte und Bilder, Rhythmus und Tempo, in denen das Fremde, Ferne fühlbar bleibt (und nicht nur in ästhetischem Wohlgefallen) und zugleich doch so nahe rückt, dass sich Leser unserer Zeit in ihm gemeint fühlen können. Denn De rerum natura ist ein Text, »der uns etwas angeht«. Scheint dies in der Lektüre auf, habe ich die Leser mit meiner Übertragung nicht getrogen.
im März 2014
Titus lucretius carus de rerum natura Über die Natur der Dinge
Erstes Buch: Von den Urelementen
Die Leitsätze unserer Lehre. Die Welt: Atome und Leere, sonst nichts.
Vorrede
Anrufung der Venus
Mutter der Aeneaden,[1] der Menschen und der Götter Wonne, Venus, Spenderin des Lebens, du bist es, die unter den ruhig gleitenden Zeichen des Himmels das schiffetragende Meer, das fruchttragende Land belebt. Dir verdankt alles Belebte Empfängnis, den ersten Blick auf der Sonne Licht. Dich, sobald du nahest, Göttin, fliehen die Winde, die Wolken des Himmels, dir sendet die vielgestaltig schöpferische Erde liebliche Blumen empor, dir lacht hell die Fläche des Meeres; und der Himmel, ruhig nun, ist durchflossen von gleißendem Licht. |10| Kaum nämlich ist die Pforte des Frühlings aufgesprungen und der Westwind befreit, da bläst frisch sein befruchtender Hauch – und zuerst unter dem Himmel künden die Vögel dich an, von deiner Kraft, Göttin, ins Herz getroffen. Dann toben Wild und Vieh über wuchernde Weiden, schwimmen durch schwellende Ströme: Alle folgen sie dir, von deinem Zauber gefangen, begierig folgen sie dir, willig, wohin du sie führst. Ob in Meeren und Bergen, in fließenden Strömen, im von Vögeln belebten Dickicht, auf grünenden Fluren – wo immer sie leben, allen Kreaturen treibst Du verführende Liebe ins Herz, |20| senkst in sie den leidenschaftlichen Trieb, nach ihrer Art sich zu mehren.
So lenkst du allein den Lauf der Dinge,[2] nichts vermag emporzuwachsen zu den strahlenden Küsten des Licht ohne dich, nichts zu entstehen, was Freude und Liebreiz schenkt. Darum bist du es, die ich mir zur Gefährtin wünsche, nun, da ich es wage, diese Verse über die Natur der Dinge zu schreiben: für den Memmiersohn,[3] meinen Freund, der nach deinem Willen, Göttin, mit allen Gaben geschmückt alle anderen übertrifft. Umso mehr also verleihe meinen Worten beständige Schönheit.
Unterdessen, Göttin, lass einschlafen das wilde Wüten des Krieges, heiß ihn ruhen auf allen Meeren, in jedem Land. |30| Denn du allein vermagst im ruhigen Frieden die Sterblichen zu erfreuen, da sich Mavors,[4] der waffengewaltig die wildtobenden Dinge des Krieges lenkt, oft niedersinken lässt in deinen Schoß, bezwungen von der Wunde unstillbarer Liebe. So, den wohlgeformten Nacken zurückgelegt, schaut er auf, weidet voller Liebe an dir, Göttin, den begehrenden Blick, deinen Mund streift des Zurückgelehnten Atem. Und wie er so liegt, hingestreckt auf deinem heiligen Leib, umfange ihn, Göttin, lass’ süße Koseworte deinem Mund entströmen, |40| erbitte, Herrliche, ruhigen Frieden für deine Römer. Denn weder vermögen wir, in dieser, für das Vaterland stürmischen Zeit,[5] gelassenen Sinns unsere Pflichten zu tun, noch kann, wie die Dinge liegen, der edle Memmiersohn sich den Pflichten fürs Wohl des Staates entziehen.[6]
Liegt es denn nicht im Wesen der Götter[7], dass sie sich ihres unsterblichen Lebens in völligem Frieden erfreuen, weitab und unserer Welt entrückt? Sie leben frei von allem Schmerz, frei auch von jeder Gefahr, stark aus eigener Kraft bedürfen sie unser nicht, lassen sich nicht rühren durch verdienstvolle Taten und werden auch von Zorn nicht bewegt.[8]
Was dies Gedicht will
|50| Du aber, Memmius,[9] löse dich von politischen Sorgen, von allen Ängsten, ein offenes Ohr leihe mir, folge mit wachem Geist der wahren Philosophie[10]. Höre, was ich dir um deinetwillen getreu ausgebreitet habe; sieh, dass du diese Gaben nicht, bevor sie verstanden, unbeachtet verwirfst. Denn nun will ich darlegen, nach welchem Gesetz der hohe Himmel bewegt wird, was das Wesen der Götter ausmacht, will die Urelemente[11] nennen, aus denen die Natur alle Dinge ständig hervorbringt, vermehrt und ernährt, und worein sie das Geschaffene, wenn es vergeht, auch wieder auflöst. |60| Wir nennen sie, wenn wir unsere Lehre entfalten, auch »Materie«, auch »Keime der Dinge«, die »ersten Körper«: denn aus ihnen, als Uranfängen, sind alle Dinge.
Für Epikur
Schmachvoll, so konnten es alle sehen, lag das Leben, lagen die Menschen im Staub, niedergedrückt unter der Last des Aberglaubens,[12] der aus erhaben himmlischen Regionen das Haupt herabreckt und mit schreckender Fratze den Sterblichen droht. Gegen sie den sterblichen Blick zu erheben, erstmals dagegen aufzustehn, hat ein Grieche[13] gewagt. Nichts konnte ihn schrecken, nicht, was erzählt wurde über die Götter, Blitze nicht[14] und kein vom Himmel grollendes Getöse; das vielmehr steigerte seinen Mut noch, sein Verlangen, der Erste zu sein, |70| der die Riegel aufbricht, die das Tor zur Natur der Dinge verschlossen hielten. Es obsiegte die feurige Kraft seines Denkens, und er machte sich auf, drang weit mit seinen Gedanken, bis hinaus über die flammenden Zinnen unserer Welt[15], durchzog mit seinem Denken und Empfinden das ohne Maß weite Universum und kam von dieser Ausfahrt siegreich zurück: Er konnte uns sagen, was werden kann, was nicht, kurz: Wie eines jeden Dinges Kraft begrenzt ist und allem, was ist, ein Grenzstein[16] tief eingepflanzt. So hat sich die Lage verkehrt: Niedergetreten, am Boden liegt der Aberglaube, völlig besiegt; uns aber hebt dieser Sieg zu den Himmeln.
Wider den Aberglauben
|80| Dies aber, Memmius, fürchte ich nun: Du könntest womöglich glauben, mit solch gottlosem Denken frevelnden Pfad zu betreten. Dabei hat oft schon gerade heiliger Aberglaube zu verruchten, unheiligen Taten geführt. Wie haben doch in Aulis die Danaerfürsten, die Ersten der Männer, den Altar der Diana schimpflich geschändet mit Iphianassias Blut.[17] Sie spürte, wie das ihr um die jungfräulichen Locken gelegte Band[18] beidseits der Wangen in gleicher Länge sich herunterringelte, sah zugleich vor dem Altar gramgebeugt den Vater stehen, sah neben ihm die Hüter des Altars, die suchten, das Messer zu verbergen, sah Tränen vergießen das Volk bei ihrem Erscheinen – da brach schreckensstumm sie in die Knie. Unglückselige Tochter! Es half ihr nicht, dass sie die Erste war, die diesen König ihren Vater genannt hat. Denn von Männerhänden gepackt, wurde sie dem Altar zugeführt, bebend vor Furcht. Nicht, um nach festlichem Opfer unter hell klingendem Hochzeitshymnus geleitet zu werden, nein, in ihrer Brautzeit sollte sie hingeschlachtet werden, die Unschuldige in schuldvollem Verbrechen, ein Opfer des besorgten Vaters[19] – |100| nur um einer Flotte günstige und glückliche Ausfahrt zu wirken. Zu derart Bösem konnte Aberglaube raten.[20]
Selbst du wirst eines Tages, bedrängt von schreckender Prophezeiung, wie sie die Weissager[21] erfinden, von unsrer Lehre dich entfernen wollen: Bedenke nur, wie zahlreich solche Gaukelbilder, Truggeschichten sind, die von wohlbedachtem Plan des Lebens dich ablenken, mit Angst dein ganzes Lebensglück verdunkeln können! Und das nicht ohne Grund: Könnten die Menschen nur erkennen, dass es für ihre Mühsal ein sicheres Ende gibt, dann, ja dann fänden sie wohl zu einem Denken, das ihnen Kraft gibt, |110| abergläubischen Ängsten ebenso zu trotzen wie dem, womit die Fabeldrescher drohen. So aber, wie die Dinge stehen, sehen sie den Weg nicht, Widerstand zu leisten, noch fühlen sie sich dazu ermächtigt, fürchten vielmehr mit dem Tod endlose Strafe. Nichts wissen sie von der Seele und ihrer Natur: Entsteht sie bei der Geburt oder findet sie nicht doch mit diesem ersten Augenblick ihren Weg in die Menschen? Vergeht auch sie, wenn der Tod alles auflöst, mit uns oder schaut sie doch die Düsternis des Orkusschlundes,[22] schlüpft sie vielleicht sogar, auf göttliches Geheiß, in andre Kreaturen?[23] Das sang uns einst Ennius[24], der als Erster von den lieblichen Höhen des Helikon den Kranz aus immergrünem Laub herabgebracht, worauf sein Ruhm zu allen italischen Völkern drang. |120| Doch selbst er, in unsterblichen Versen, singt uns von Gefilden des Acheron, von unterirdischen Welten, wohin die Seele nicht und auch der Körper nicht gelangt, wohin, von wunderlichem Ansehn, nur bleiche Trugbilder dringen. Dorther, so erzählt er uns, sei ihm der Schatten des immerblühenden Homer erschienen, in salzige Tränen sei er ausgebrochen und habe begonnen, in Worten die Natur der Dinge zu entfalten.
Was dies Gedicht will (Fortsetzung)
So ist’s an uns, nicht nur von den Dingen des Himmels[25] unbeirrt Bericht zu geben, zu erläutern, wie die Bahnen von Sonne und Mond entstehen |130| und durch welche Kraft alles auf der Erde geschieht, sondern vor allem auch mit scharfem Verstand aufzudecken, was die Seele ausmacht und den Geist;[26] was uns Schrecken verbreitend befällt,[27] wenn wir wach liegen, womöglich auch krank daniederliegen oder versunken im Schlaf, und Menschen zu sehen, ja zu hören meinen, Menschen uns gegenüber, die doch lange schon tot sind und deren Gebein in der Erde ruht.
Ich verkenne nicht, wie schwer es ist, der Griechen dunkle Erkenntnisse[28] in lateinischen Versen erhellend zu klären. Vor allem anderen, weil unsere Sprache arm, die Gegenstände aber neu sind, sodass ich zu alledem auch noch neue Worte prägen muss. |140| Doch dein hoher Sinn, Memmius, und das Vergnügen süßer Freundschaft[29], die ich zu gewinnen hoffe, treiben mich, diese Arbeit, so mühsam sie sein mag, zu vollenden; und dies treibt mich dazu, manch ungestörte Nacht zu durchwachen, Worte zu suchen und nach Versen, mit denen es mir gelingt, deiner Erkenntniskraft ein klares Licht zu entzünden, auf dass du vermagst, den Grund zu sehen, der im Ganzen der Dinge verborgen.
1. Teil: Die Leitsätze
Aus Nichts entsteht nichts – der erste Leitsatz, seine Beweise
Nicht die Strahlen der Sonne, nicht am Tag die Pfeile des Lichts vertreiben, was dunkel schreckend den Geist umfangen hält, dies gelingt nur dann, wenn wir den Blick auf die Erscheinungen der Natur richten und auf ihr inneres Gesetz.[30] Erkenntnis der Natur darum muss mit diesem Leitsatz beginnen: Kein Ding entspringt durch göttlich wundersame Kraft jemals dem Nichts. |150| Noch aber hält Angst die Sterblichen zu fest im Griff: So viele Dinge haben sie geschehen sehn in der Welt, am Himmel, und haben doch so gar nichts in der Hand, was deren Grund erklären könnte; vermuten also, sie geschähen durch göttlich numinose Kraft. Haben wir aber einmal begriffen, dass aus Nichts nichts entspringen kann, dann tritt schon deutlicher hervor, wonach wir suchen: Dasjenige nämlich, woraus ausnahmslos alle Dinge entstehen können und auch, wie sich alles gebildet hat – ganz ohne Wirken der Götter.
Auf denn. Ließen sich Dinge aus Nichts erschaffen, dann könnte aus jedem beliebigem |160| jegliches andere werden, keines brauchte einen Keim.[31] Da könnten sich Menschen aus dem Meere bilden, könnten der Erde schuppige Fische entsteigen, Vögel wie einem Ei auch dem Himmel entschlüpfen. Rinder und anderes häusliche Vieh und wilde Tiere aller Arten bevölkerten plötzlich unterschiedslos wüstes Brachland und gepflügte Felder, niemand wüsste, wo sie entstehen. Auch würden Bäume nicht nach ihrer Art die immer gleichen Früchte tragen; nein, alle könnten alle tragen und jedesmal auch andere. Doch: Gäbe es nicht für alles den eignen Keim, wie sollten Dinge dann stets die gleiche Mutter[32] haben? Alle aber entstehen aus ihren festen Keimen, |170| nur darum entspringt, was je dem Licht entgegenstrebt, der eigenen Materie,[33] dem jeweils eignen Urkörper. Es kann eben nicht aus allem alles werden, denn in jedem wirkt die jeweils eigne Kraft.[34]
Und weiter. Wie anders könnten wir in jedem Frühjahr überall im Land die Rosen üppig blühen sehen, in der Sommerhitze Korn reifen und, wenn der Herbst herannaht, den Wein? |180| Das hat nur einen Grund: Jeweils zu ihrer Zeit müssen die je bestimmten Keime zusammenfließen. Nur wenn das geschieht, kann alles, was sich aus ihnen bildet, wachsen – wenn denn auch die Witterung der Leben spendenden Erde hilft, ihre noch schwachen Keimlinge sicher emporzutreiben, den Küsten des Lichts entgegen. Kämen die aber aus dem Nichts, so entstünden sie urplötzlich in ungewissem Abstand, und eben nicht zur ihnen bestimmten Zeit: in ungünstigen Monaten also. Kein Wunder, denn es gäbe ja die uranfänglichen Keime nicht, die verhindern könnten, dass sich zu widriger Zeit Werdendes zusammenfügt.
Entstünden die Dinge aber aus Nichts, wären das Wachstum befruchtende Zeiten gar nicht nötig, die Zeiten, in denen die Keime sich zueinander fügen.[35] Dann würden aus kleinen Kindern mit einem Mal junge Erwachsene, im Augenblick würden Bäume aus dem Boden emporschnellen. Nichts dergleichen jedoch geschieht. Wir sehen vielmehr: Alle Dinge wachsen, wie erwartet, Schritt um Schritt aus je eigenem Samen; und auch indem sie größer werden, |190| bewahren sie die ihnen eigene Art. Eine jede, das kannst du dem entnehmen, sprießt und nährt sich aus eigener Materie.
Ferner: Fiele nicht Regen zu bestimmten Zeiten des Jahres, niemals könnte die Erde ihre üppigen Früchte hervortreiben. Und bliebe die belebte Natur dann ohne Nahrung, könnte alles Lebende die eigene Art nicht fortpflanzen, geschweige das Leben erhalten. Darum ist leichter einzusehen, dass viele Elemente[36] vielen Dingen gemeinsam sind – so wie ja auch viele Buchstaben vielen Worten –, leichter als jene Vorstellung, auch nur ein Ding könnte ohne uranfängliche Keime existieren.
Und noch eins. Warum konnte die Natur nicht Menschenwesen |200|

![Über die Natur der Dinge. [Was bedeutet das alles?] - Lukrez - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9469aed2ee1eb07284751d6558f10a69/w200_u90.jpg)



























