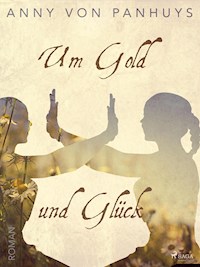
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie viel kann man für das eigene Glück riskieren? Mit dieser Frage beschäftigt sich dieser liebevoll geschriebene Roman von Anny von Panhuys. Die junge, hübsche Trude Berger kann sich mit dem Nähen von Kleidungsstücken für die Nachbarschaft gerade so über Wasser halten. Gerne würde sie hübsche Kleider und teuren Schmuck tragen. Doch das ist ein Traum, den sie sich wohl niemals wird erfüllen können. Oder vielleicht doch? Durch eine Verwechslung gelangt Trude an einen Brief, der eigentlich für ihre Mitbewohnerin Charlotte Bürger bestimmt ist. In diesem Schreiben bietet Charlottes wohlhabender Vetter der Cousine im Namen ihres Onkels an, zu ihnen zu ziehen. Denn Charlottes Cousine ist verstorben und der Onkel wünscht sich Charlotte als nahe Verwandte und Trost bei sich. Doch Trude will der Mitbewohnerin dieses Glück nicht gönnen und schmiedet einen Plan: Sie such die Familie auf und gibt nun sich selbst als Charlotte Bürger aus. Wird dieser Betrug auffliegen? Ein spannender Roman, der uns zeigt, dass das Glück jedem gehört und am Ende doch immer das Gute und die Liebe siegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Um Gold und Glück
Roman
Saga
Um Gold und Glück
© 1937 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570111
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
I
Trude Berger warf das wollene Kinderkleidchen, an dem sie noch eben emsig genäht hatte, in einem Anfall ganz schlechter Laune auf den Fußboden.
Es war gräßlich, so von morgens bis abends an der Nähmaschine sitzen zu müssen und für die Hausbewohner und die Frauen und Kinder der Nachbarschaft Blusen und Kleider zu nähen, nur um sich von der kargen Bezahlung notdürftig ernähren zu können. Wirklich nur notdürftig. Die Leute, die hier im östlichsten Osten Berlins wohnten, mußten mit jedem Groschen rechnen, die handelten um jedes Fünfpfennigstück.
Es klingelte draußen an der Korridortür. Anscheinend war die Inhaberin der Wohnung, Frau Klockow, nicht zu Hause, denn das Klingeln wiederholte sich.
Trude Berger verließ ihr schmales, nach dem Hof zu gelegenes Zimmer und überzeugte sich durch das Guckloch der Korridortür, wer draußen stand. Sie sah eine Postmütze und öffnete.
„Wohnt hier Fräulein Bürger?“ fragte sie ein Briefträger. Er sprach ein bißchen leise. Es war ein älterer, kränklich aussehender Mann.
Das junge Mädchen verstand anstatt „Bürger“ ihren eigenen Familiennamen „Berger“, und erwiderte hastig: „Die bin ich selbst.“
Sie nahm den Brief mit einer gewissen Erregung in Empfang. Wer schrieb an sie?
Sie vermochte es sich wirklich nicht zu denken, denn sie kannte niemand, der Interesse daran hatte, ihr zu schreiben. Verwandte besaß sie nicht mehr, sie stand mutterseelenallein in der Welt, und auch sonst fiel ihr niemand ein, der ihretwegen die Feder angesetzt haben könnte. Sie hatte keinen Freund, keinen Schatz, trotzdem sie doch hübsch war. Hübscher als manche andere, die nicht so fleißig war wie sie.
In ihrem Stübchen angekommen, riß sie mit der Spitze einer Schere den länglichen Briefumschlag auf und entfaltete den ziemlich großen Bogen.
Sie las zuerst „Frankfurt am Main“ sowie das Datum des vergangenen Tages, und dann: „Sehr verehrtes Fräulein Bürger, oder richtiger, liebe Kusine Lotte!“
Trude Berger ließ das Papier, ohne weiterzulesen, in den Schoß sinken. Na, da hatte sie ja eine nette Unannehmlichkeit für sich heraufbeschworen. Der Brief war gar nicht für sie bestimmt.
Sie betrachtete jetzt erst den Umschlag, den sie vorhin so überschnell geöffnet. Da stand ganz deutlich die Adresse: „Fräulein Charlotte Bürger.“
Trude hätte am liebsten geweint. Sie war heute gerade schon verstimmt genug, sie konnte Ärger entbehren.
Also Lotte Bürger gehörte der Brief! Lotte Bürger bewohnte ebenfalls ein Zimmer bei Frau Klockow. Aber eins nach der Straße zu. Sie war Klavierlehrerin und fast den ganzen Tag auf den Beinen, um ihren billigen Unterricht zu erteilen. Sie war elternlos, wie sie selbst. Von dem Geld, das sie mühsam verdiente, sparte sie sich noch die Miete für ein Klavier ab und nahm Gesangstunden, weil ihr von mehreren Seiten versichert worden war, sie besitze eine ungewöhnlich schöne Stimme.
Trude Berger beruhigte sich etwas über ihr Mißgeschick, lächelte mit einer Beimischung von Spott. Jetzt war es schon ganz gleich, jetzt konnte sie den Brief auch ruhig zu Ende lesen, denn die etwas merkwürdig anmutende Briefanrede hatte ihre Neugier angeregt.
Sie riegelte für alle Fälle die Tür ab. Man konnte nicht wissen, vielleicht kam Frau Klockow von ihren Morgeneinkäufen zurück und zu ihr ins Zimmer, wie sie es manchmal tat.
Nun setzte sie sich und las, nachdem sie noch einmal die Überschrift angesehen, das Folgende:
„Zuerst stelle ich mich vor, wie das wohl nötig ist. Ich, der Schreiber dieses Briefes, heiße Lothar Bürger, bin der Sohn von Ihrem Onkel Hubert Bürger, an den sich Ihr Vormund nach dem Tode Ihrer Eltern wandte durch Vermittlung der Behörden, die seinen Aufenthalt auskundschafteten. Vater, obwohl reich, lehnte damals schroff ab, Ihnen irgendwie zu helfen. Es spielte da eine alte Geschichte zwischen meinem Vater und dem Ihren. Eine Geschichte, die meinen Vater aus Deutschland fortgetrieben, die ihn hart gemacht.
Vor kurzem starb nun meine einzige Schwester. Sie war jünger als Sie, und dem Vater fehlt sie überall, mir auch. Meine liebe Mutter ist schon länger tot. Ich mußte jetzt aus geschäftlichen Gründen für meinen Vater nach Deutschland, und da schrieb er mir, ich solle Erkundigungen nach Ihnen einziehen, und wenn diese gut ausfallen würden, Ihnen den Vorschlag machen, zu uns zu kommen, er wolle Ihnen den Platz meiner toten Schwester Charlotte geben.
Wir wohnen in Tyssa, das früher deutsch-böhmisch war, jetzt zur Tschechoslowakei gehört. Ich ließ durch ein gutes Detektivbüro die gewünschten Erkundigungen einziehen und kann Ihnen danach jetzt den Wunsch und Vorschlag meines Vaters unterbreiten.
Erst wollte ich sofort zu Ihnen reisen, aber ich überlegte mir dann, es wäre wohl besser, Sie vorzubereiten, damit Sie bis zu meinem persönlichen Kommen Zeit haben, sich alles zu überlegen. Ich kann mir ja denken, daß Sie sich gar nicht so schnell zu einem ‚Ja‘ werden entscheiden können, weil mein Vater vordem jede verwandtschaftliche Unterstützung verweigerte. Aber wir wollen darüber sprechen, wollen uns, wenn ich dort sein werde, kennenlernen. Ich werde noch einige Tage, vielleicht eine Woche, hier in Frankfurt zu tun haben und mir erlauben, Sie dann zur persönlichen Rücksprache zu besuchen.
Antworten Sie mir ein paar Zeilen, ob Sie mich erwarten. Ich wohne hier im Hotel Bristol. Ich hoffe, Sie werden nicht nachtragend sein, und freue mich schon darauf, Sie kennenzulernen. In der Erwartung einer baldigen Antwort, grüßt Sie vielmals Ihr Cousin
Lothar Bürger.“
Truder Berger faltete den Brief wieder zusammen, und ihr schmales Gesicht färbte sich mit der Röte des Neides. „Welch ein Glück diese Klimperliese hat!“ durchfuhr es sie.
Der Briefschreiber erwähnte, daß sein Vater reich sei. Reich! Trude Berger empfand das Wort förmlich körperlich. Für sie gab es nichts Schöneres, nichts Erstrebenswerteres auf der weiten Welt als Reichtum.
Lotte Bürger würde nun in ein Haus des Reichtums kommen, und sie mußte hier weiter die Maschine treten, um für allerlei armselige Menschen armselige Blusen und Kleider zu nähen. Wenn es hoch kam, heiratete sie später irgendeinen Mann aus dem östlichsten Osten Berlins, so einen, der im Tagesfrondienst schaffte. Und nebenbei durfte sie weiter Maschine treten, treten, treten, treten bis an ihr Ende. Herrgott, warum hatte sie kein solches Glück wie Lotte Bürger?
Trude Berger faltete die Hände zu Fäusten. Ach was, sie gab den Brief gar nicht ab. Lotte Bürger wußte nichts davon, und Frau Klockow auch nicht, und wenn dieser Herr da in Frankfurt keine Antwort erhielt, nahm er wohl an, seine Cousine, an die man sich so plötzlich erinnerte, wollte nichts mehr von seiner Familie wissen.
Sie gönnte einer anderen kein Glück! Mochte sich Lotte Bürger nur so weiter plagen wie bisher. Ordentlich wohl war ihr bei dem Gedanken, die Macht in Händen zu halten über das Geschick eines anderen Menschen.
Nein, den Brief würde sie nicht aushändigen. Sollte wider Erwarten dieser Lothar Bürger eines Tages selbst antreten, so konnte sie das allerdings nicht verhindern, dann würde man eben annehmen, der Brief wäre verlorengegangen. Aber wahrscheinlich kam er nicht, glaubte, seine Cousine antworte absichtlich nicht.
Trude Bergers sehr hübsches, nur zu stuben-blasses Gesicht konnte einen fast tückischen Ausdruck annehmen. Sie verbarg den Brief in einem verschließbaren Köfferchen, wo sie Familienpapiere und ein paar ärmliche Schmucksachen aufhob, dann riegelte sie die Tür wieder auf.
Eben hörte sie Frau Klockow von ihrem Ausgang zurückkommen. Im nächsten Augenblick saß sie schon wieder an der Nähmaschine, säumte ein blauwollenes Kinderkleid. Und während die Maschine ihren einförmigen Singsang ertönen ließ, spann Trude Berger sich in allerlei Träume ein, was sie tun würde, wenn der eigenartige Brief für sie bestimmt gewesen wäre.
Sie sah sich in einem eleganten Hause, in prachtvollen Kleidern, sah Brillanten an ihren Fingern funkeln. Natürlich, vor allem würde sie sich schmücken und eine Rolle zu spielen versuchen, wenn sie reich wäre. „Kleider machen Leute!“ pflegte ihre Mutter immer zu sagen, die auch ihr Lebelang nicht aus dem muffigen Gemüsekeller in der Langen Straße herausgekommen war, bei der die Ablagestelle für allen Klatsch und Tratsch der Straße gewesen.
Der Vater war lange vor der Mutter gestorben. Er hatte sich zu Tode getrunken.
Trude Berger atmete bedrückt. Erst war sie Dienstmädchen gewesen, und dann, als sie vor einem Jahre majorenn geworden, hatte sie sich selbständig gemacht. Die Herrschaft, bei der sie von ihrem sechzehnten bis einundzwanzigsten Jahre gewesen, hatte sie nähen lernen lassen, und die Frauen dieser Gegend waren zufrieden mit ihrem Können, das besseren Ansprüchen nicht standzuhalten vermocht hätte.
Starker Kohlgeruch füllte mit einem Male das Zimmerchen, er drängte sich durch die Türspalte, durch das Schlüsselloch, und Trude schüttelte sich wie in einem Anfall von Ekel. Fast jeden Tag gab es Kohl zum Mittag, ihr graute schon davor. Rotkohl, Weißkohl, Wirsing oder Kohlrüben. Ihr Magen sehnte sich nach einem in Butter gebratenen Beefsteak, aber ihr Geldbeutel reichte nur dazu, die Kost zu bestreiten, die Frau Klockow ihren Mietern vorzusetzen pflegte.
Sie wollte versuchen, aus dieser Kohldunstatmosphäre herauszukommen. Vielleicht gelang es ihr, als Probierdame unterzuschlüpfen. Sie hatte eine schlanke, gute Figur. Ein Mannequin konnte es zu etwas bringen. Man hatte Gelegenheit zu zeigen, daß man hübsch gewachsen war und ein nettes Gesicht hatte.
Klavierspiel begann. Trude Berger hob ein wenig den Kopf. Ah, Lotte Bürger war nach Hause gekommen. Eben setzte ihre glockenklare Stimme ein, sang ein Lied vom Glück und von der weiten Welt. Trude Berger lächelte spöttisch, dachte, wenn die andere ahnte, wie nahe ihr das Glück gewesen und wie nahe die Aussicht, ein Stückchen von der weiten Welt kennenzulernen. Wenn Frau Klockow nicht einholen gegangen wäre, hielten die schmalen Finger Lotte Bürgers jetzt wohl den Brief, den sie nun unterschlagen, weil sie es nicht ertrug, daß jemand aus ihrer Nähe der Armut so plötzlich entrann.
Die glockenklare Stimme jubelte, und Trude Berger hatte halb wie im Unterbewußtsein das Gefühl, diese Stimme blieb nicht in den Umkreis des östlichsten Ostens von Berlin gebannt, die schmetterte wohl einmal in den lichtdurchfluteten Sälen vieler großen Städte.
Sie empfand das nur instinktiv, denn sie verstand nichts von Musik.
Eine bellende Glocke raste auf, verstummte jäh, hatte aber den Gesang zum Schweigen gebracht. Trude Berger legte lässig die Näharbeit beiseite. Es hatte zum Mittagessen geläutet, und Frau Klockow liebte es nicht, lange auf ihre „Pensionäre“ zu warten, wie sie die drei bei ihr wohnenden Mieterinnen nannte.
Trude besah sich in dem kleinen, stumpfen Spiegel, der über dem Waschständer hing, und lächelte sich an. Große, tiefblaue Augen hatte sie, und mattblondes Haar legte sich leichtwellig um das blasse Gesicht, darin der Mund ein wenig zu üppig und rot stand. Die schmalen Brauen über den Augen waren sehr dunkel. Trude färbte sie immer noch etwas mit einem frischabgebrannten Streichholz nach. Sie dachte flüchtig in einer kleinen Aufwallung von Eitelkeit, daß vielleicht doch noch irgendwo ein besonderes Glück auf sie wartete, weil sich einem hübschen Mädchen immer mehr Glücksmöglichkeiten bieten als einem häßlichen. Sie zupfte ein wenig an ihrem Haar und betrat einige Sekunden später die sogenannte „Berliner Stube“, in der auch während der Tagesmahlzeiten Licht brennen mußte.
Lotte Bürger saß schon an ihrem Platz, auch die bucklige Buchhalterin Fräulein Merkel. Trude grüßte: „Mahlzeit!“ Die beiden brummten gleichfalls: „Mahlzeit!“
Charlotte Bürgers etwas großzügiges Gesicht zeigte den Ausdruck starker, unverhüllter Freude. Trude Berger stellte das mit Bestürzung fest. Sollte Charlotte Bürger noch auf irgendwelche andere Weise eine Mitteilung von ihrem Cousin aus Frankfurt erhalten haben oder er seinem Briefe auf dem Fuße gefolgt sein und sie gar schon gesprochen haben? Das Gesicht war ja wie in Glückseligkeit getaucht. Sie konnte sich eine Frage nicht verkneifen.
„Man meint, Sie hätten das große Los gewonnen, Fräulein Lotte, so strahlen Sie!“
Die bucklige, ältliche Buchhalterin zeigte eine grämliche Miene. „Blödsinn, so glücklich auszusehen, daß es jedem auffällt. Es freut sich doch keiner ehrlich mit, man fordert dadurch nur Neid und Bosheit heraus.“
Trude fühlte sich unwillkürlich getroffen. Sie erwiderte mit etwas gequältem Lächeln: „Selbsterkenntnis ist auch was wert! Ich jedenfalls freue mich immer mit, wenn ich sehe, jemand hat was Gutes erlebt.“
„So siehst du aus!“ höhnte die leicht etwas giftig werdende Verwachsene.
Trude Berger warf den Kopf ein wenig zurück. „Wenn Sie schlecht gelaunt sind, Fräulein Merkel, gönnen Sie wenigstens anderen die gute Laune. Jedenfalls habe ich Fräulein Lotte noch nie so strahlend gesehen wie heute.“ Sie machte ein schelmisches Gesicht. „Gewiß haben Sie sich heimlich verlobt, Fräulein Lotte. Gestehen Sie es nur ein!“ Sie mußte wissen, ob Charlotte Bürger nun auch ohne den von ihr unterschlagenen Brief zu ihrem Glücke kam.
Die dicke Frau Klockow erschien mit einer großen Schüssel Wirsingkohl auf einem Tablett. Sie ging sofort wieder, holte einen Teller mit gekochtem Rindfleisch, das in sehr dünne Scheiben geschnitten war. Sie nahm am oberen Ende des Tisches Platz, faltete die fetten Hände, plapperte automatisch:
„Komm, Herr Jesu, sei unser Jast,
und sejne, was du uns bescheret hast!“
Der Kohl dampfte, er war noch zu heiß, man mußte mit dem Beginn des Essens warten. Nur Frau Klockow tat es nicht. Sie pustete sehr energisch auf den großen Suppenlöffel, mit dem sie den Kohl zum Munde führte.
Charlotte Bürger bemerkte, wie Trude Bergers Augen auf ihr ruhten. Sie hielt es für Teilnahme an ihrer so offen zur Schau getragenen Freude und nickte ihr zu.
„Ich wurde heute von meiner Gesanglehrerin sehr gelobt. Sie versprach mir, den berühmten Opernsänger Norbert Hermanek auf mich aufmerksam zu machen. Sie meint, er würde bestimmt meine weitere Ausbildung übernehmen, und das bedeute für mich eine sichere, große Zukunft.“ Ihre klaren, grauen Augen leuchteten. „Soll ich mich da nicht freuen, Fräulein Trude?“
„Natürlich!“ antwortete anstatt der Gefragten die Buchhalterin, und ihr schmallippiger Mund war hämisch verzogen. „Dadurch ist ja der Auftakt zur großen Laufbahn gegeben, und die Hempel, Farrar oder Massary werden glücklich sein, sich Ihre Kolleginnen nennen zu dürfen. Unsereins hat dann natürlich kein Recht mehr, mit Ihnen zu sprechen. Oder schicken Sie uns armen Luders gelegentlich mal Freibilletts, wenn Sie in Gold und Brillanten schwimmen?“
Trude Berger dachte, daß die Verwachsene genau so ein Neidhammel sei wie sie selbst, begriff nur nicht, wie sie ihren Neid so deutlich merken lassen konnte. So dumm war sie nicht. Sie nickte Charlotte Bürger über den Tisch zu.
„Ich gratuliere Ihnen von Herzen! Sollten Sie das erreichen, was Fräulein Merkel für Sie erhofft, würde ich mich freuen, Ihnen als Publikum Beifall klatschen zu dürfen.“
Sie begannen zu essen.
Frau Klockow blickte ihre drei Mieterinnen der Reihe nach an. „Ich meine, die Damens sind in Krakeelstimmung, oder irre ich mir?“ Mit der deutschen Sprache stand Frau Klockow auf etwas gespanntem Fuß.
Charlotte Bürger lachte. „Ja, Sie irren sich, Klockowchen, denn Sie hörten doch eben, daß ich noch eine ganz berühmte Sängerin werde.“
Das Doppelkinn Lina Klockows bewegte sich hin und her, als sie kopfschüttelnd sagte: „Dazu gehört viel Protestion, un ich meine, Ihre Gesanglehrerin macht sich woll bloß wichtig.“
Die drei Mieterinnen lächelten. Frau Klockow hatte „Protektion“ sagen wollen.
Nach dem Essen erhob sich die Buchhalterin zuerst. Sie schlief stets nach Tisch ein halbes Stündchen. Trude Berger aber folgte Charlotte in deren Zimmer, setzte ihr liebenswürdigstes Gesicht auf.
„Bitte, erzählen Sie mir doch, was Ihre Lehrerin noch geäußert hat. Ich freue mich so sehr über Ihre gute Nachricht, Fräulein Lotte; denn Sie sind so fleißig und haben es verdient, hier herauszukommen.“
Charlotte Bürger war, ebenso wie Trude Berger, zweiundzwanzig Jahre alt und besaß in der Figur Ähnlichkeit mit ihr. Auch ihr dichtes Haar war blond, nur lag ein leichter, rötlicher Schein in dem Blond Charlottes, ihr Gesicht war geistig belebter.
Die zwei Mädchen saßen nun beisammen und plauderten. Endlich gelang es Trude Berger, das Gespräch dahin zu lenken, wo sie es hin haben wollte.
„Und Sie besitzen, wie ich, keine Verwandten mehr auf der Welt?“ fragte sie voll Teilnahme, nachdem das Thema „Verwandtschaft“ berührt worden war.
Charlotte Bürger zuckte die Achseln, blickte gedankenvoll vor sich hin. „Ich vermag die Frage eigentlich nicht mit einem direkten Nein zu beantworten. Mein Vater hatte nämlich einen Bruder, aber er verließ Deutschland in jungen Jahren. Als meine Eltern starben, erkundete mein Vormund seine Adresse. Doch er lehnte es ab, sich meiner anzunehmen.“ Sie atmete tief auf. „Nun, es ist, wenn auch manchmal mit Schwierigkeiten, so doch ohne seine Hilfe gegangen. Die kleine Hinterlassenschaft meiner Eltern hat gereicht, bis ich selbst verdienen konnte. Seit mein Vormund vor einem halben Jahre starb, hat niemand mehr Interesse für das, was ich tue und treibe, außer meiner Gesanglehrerin.“
„Warum ist denn Ihr Onkel so häßlich zu Ihnen gewesen?“ fragte Trude Berger.
Charlotte Bürger neigte ein wenig den Kopf.
„Was weiß ich? Aber ich glaube, nach dem, was ich früher aufschnappte und mir so zusammenreimte, mein Onkel hat meine Mutter liebgehabt, und als sie dann meinen Vater vorzog, sich mit ihm verlobte, hat es zwischen den Brüdern böse Worte gegeben.“
Trude Berger schwieg ein Weilchen, sagte dann: „Vielleicht verweigerte Ihr Onkel damals seine Hilfe nur, weil er selbst nichts hatte?“
Charlotte lehnte am Klavier, dem gemieteten Prunkstück dieses sehr nüchtern und geschmacklos eingerichteten Zimmers. „Mein Onkel Hubert ist reich, er hat in der Tschechoslowakei, in dem Teil, der früher Deutsch-Böhmen hieß, die Tochter eines Knopffabrikanten geheiratet. Ich glaube, er war Buchhalter in der Fabrik. Sehr reich soll er sogar sein.“ Sie brach ab, vollendete leiser: „Er hat nichts von mir wissen wollen. Es ist schade! Von aller Selbstsucht abgesehen, hätte ich mich gefreut, ihn kennenzulernen. Weil er doch meines Vaters Bruder ist, weil er der einzige Mensch auf der Welt ist, der mir noch blutsverwandt ist. Und es muß doch schön sein, irgend jemand zu besitzen, der zu einem gehört.“ Sie lächelte weich. „Lange Zeit denke ich gar nicht an ihn, aber dann kommt irgendein Tag, der bringt einen Anlaß, wo ich sehr, sehr an ihn denken muß. Und das ist immer dann, wenn wichtige, entscheidende Fragen an mich herantreten, wenn ich einer zuverlässigen Hilfe, eines Schutzes bedarf.“
„Sentimentale Zimperliese!“ dachte Trude Berger. Laut sagte sie: „Ich kann das verstehen, weil ich ja auch niemand habe, an den ich mich in der Not wenden kann.“ Und nach einer kleinen Pause fügte sie die Frage an: „Wollen Sie es denn nicht noch einmal selbst versuchen, Beziehungen mit Ihrem Onkel anzuknüpfen? Vielleicht ist er jetzt weniger hart.“
Es war ein lauernder Unterton in der Frage, der Charlotte aber entging, den sie auch nicht begriffen haben würde.
„Nein, o nein,“ wehrte sie lebhaft ab. „Ich habe auch meinen Stolz. Und nun bin ich mit den Sorgen des Vorwärtskommens ja fast über den Berg, nun ist es mir Ehrensache, auch das Ziel allein zu erreichen.“ Sie hob die Arme, breitete sie weit aus, wie im Übermaß eines inbrünstigen Empfindens. „Ich muß mein Ziel erreichen, muß eine Künstlerin werden. Ich fühle, daß es mir gelingt, wenn ich nicht ruhe und raste!“ Ihre Arme sanken nieder. „Seit heute, seit meine Gesanglehrerin mir versprochen, mit dem großen Meister meinetwegen zu reden, ist in mir ein Etwas erwacht, das sich mit Worten gar nicht schildern läßt. Es ist wie ein Brand, oder wie eine ungeheure glückselige Unruhe. Es ist, als müsse ich rennen, bis ich ermattet umsinke. Aber dann bin ich auch im Land meiner Sehnsucht.“ Sie wiederholte leise: „Im Land meiner Sehnsucht! O, wie lag es einst so weit, so märchenweit, und wie liegt es nun, seit heute, so nahe, so erreichbar!“ In ihrer Stimme war es wie unterdrücktes Schluchzen, das ihr die Erregung erpreßte. „Ich weiß ja nicht, ob Sie mich verstehen können. Aber es ist wundervoll und berauschend, das Land der Sehnsucht erreichbar zu wissen. Künstler und alle, die danach streben, es zu werden, verstehen mich.“
Trude Berger hätte am liebsten gegähnt. Beim Himmel, war diese Person überspannt! Kein vernünftiger Mensch begriff, was sie davon dem Lande der Sehnsucht zusammenfaselte. Total meschugge! hätte sie ihr am liebsten entgegengerufen. Sie saß aber ganz still und schnitt ein andächtiges Gesicht, weil sie das für angebracht hielt. Aus irgendeinem Gedanken heraus, der mit dem vorhin von Charlotte Erzähltem zusammenhing, fragte sie dann: „Besitzen Sie ein Bild von Ihrer Mutter? Ich möchte gern wissen, wie sie aussah, weil —“
Sie vollendete den Satz nicht. Charlotte tat es an ihrer Stelle. „Sie möchten es gern wissen, weil sich zwei Brüder ihretwegen fürs ganze Leben veruneinigten, nicht wahr?“ Sie lächelte. „Ich soll das Ebenbild meiner Mutter sein. Aber ich will Ihnen gern eine Photographie von ihr zeigen.“
Sie ging an die Kommode, steckte den in der untersten Schublade steckenden Schlüssel in die oberste. Unwillkürlich verfolgte Trude Berger von ihrem Platz aus alles, was die andere tat. Sie sah, wie Charlotte die Schublade aufschloß, ihr einen Kasten aus Laubsägearbeit entnahm und auf den Tisch stellte. Jetzt saßen die beiden Mädchen am Tisch, zwischen ihnen, auf der scheußlich grellgrünen Wollplüschdecke mit der roten Kurbelumrandung, stand der Kasten, der durch einfachen Druck zu öffnen war. Trude äugte voll Neugier, was das Kästchen, das innen mit lila Glanzpapier beklebt war. barg. Viel enthielt es nicht. Vor allem war da ein Ledertäschchen, das Charlotte auf den Tisch legte.
„Meine Legitimationspapiere sind da drinnen,“ erklärte sie, „Geburtsschein und so weiter, auch die Sterbepapiere der Eltern.“
Nun langte sie ein paar Photographien heraus, reichte sie nacheinander über den Tisch. Trude Berger hielt zuerst ein Bild in Händen, das Charlotte Bürger darstellen konnte, wenn man nicht stutzig geworden wäre durch die Kleidung, die der Mode von vor zwanzig Jahren angehörte.
„Sie haben wirklich sehr große Ähnlichkeit mit Ihrer Mutter,“ bestätigte Trude.
„Als das Bild aufgenommen wurde,“ erklärte Charlotte, „war meine Mutter gerade so alt wie ich heute. Sie verlobte sich damals, hat aber erst viele Jahre später geheiratet, weil Vater und Mutter das Geld dazu zusammensparen mußten.“
„Was ist Ihr Vater gewesen?“ fragte Trude.
„Bankbeamter,“ erfolgte die Antwort, und gleichzeitig zeigte ihr Charlotte die Photographie eines breitschultrigen Mannes mit dickem Schnurrbart und sehr kräftig geschnittenen Zügen. „Mein Vater sieht auf dem Bild wie ein Ringkämpfer oder Boxer aus, nicht wahr?“ lächelte sie. „Und dabei lag ihm alles Energische, alles Drauflosgängertum völlig fern. Er war ein stiller, nur dem Glück seiner kleinen Familie lebender Mensch.“
Trude Berger konnte ihr Estaunen nicht verhehlen. „Wie doch das Äußere täuschen kann. Ihren Vater hätte ich für einen Mann gehalten, der sich in jeder Lebenslage vordrängt, um überall die erste Rolle zu spielen.“
Charlotte strich mit der Rechten in leiser Zärtlichkeit über das Bildchen. „Nein, mein Vater war keine sich vordrängende Kraftnatur. Das aber soll sein Bruder gewesen sein. Ist’s wohl auch noch. Ich weiß ja allerdings nicht, ob er noch lebt.“ Sie legte die Photographien wieder in das Kästchen zurück. „Die Brüder sollen einander sehr ähnlich gesehen haben. Meine Mutter erzählte mir einmal, daß ihr aber Vater wegen seines bescheidenen Wesens viel besser gefallen hätte als der immer gleich rabiate Hubert Bürger.“
Truder Berger erhob sich. „Ich will nicht länger stören, und dann muß ich auch an meine Arbeit. Bis zum Sonntag ist noch eine Menge Fertiggenähtes abzuliefern.“
Charlotte Bürger reichte ihr die Hand. „Kommen Sie doch ab und zu ein wenig in mein Zimmer, wenn ich zu Hause bin. Es war lieb von Ihnen vorhin bei Tisch, daß Sie meine für mich so frohe Mitteilung so völlig anders auffaßten als Fräulein Merkel, die mir durchaus die Freude vergällen wollte. Vielleicht bin ich aber auch überempfindlich. Vielleicht meinte Fräulein Merkel ihre Worte gar nicht so, wie ich sie auffaßte.“
Trude schnitt eine Grimasse. „Die Merkel meint alles, was sie losläßt, noch viel giftiger, als es sich anhört. Sie ist eine unausstehliche Person, die alle Menschen mit geraden Gliedern haßt.“
Charlotte Bürger blickte nachdenklich. „Wer weiß, ob wir an ihrer Stelle anders wären. Möglicherweise noch schlimmer.“
Trude lachte kurz auf.
„Darüber zerbreche ich mir den Kopf nicht. Ich bin gerade gewachsen!“
Es klang herzlos. Charlotte Bürger fühlte sich plötzlich von der ihr noch eben so sympathisch scheinenden Trude Berger abgestoßen. Sie wiederholte ihre Einladung von vorhin nicht mehr.
Nachdem Trude gegangen, öffnete Charlotte noch einmal das Kästchen aus Laubsägearbeit, betrachtete die Bilder der Eltern. Vater und Mutter! Wie aufrichtig würden sie sich mit ihr gefreut haben über die frohe, hoffnungsfreudige Botschaft, die sie heute erhalten hatte! Sie drückte die Bilder an die Lippen, und in ihrem Herzen war das heiße, heilige Gelöbnis, der Empfehlung ihrer Lehrerin keine Schande zu bereiten. Würde sie der berühmte Meister als Schülerin aufnehmen, dann wollte sie vor keiner Mühe und keiner Entbehrung zurückscheuen. Irgendwo, in heute noch nicht erreichten Höhen, schwebte die Krone des Ruhmes für sie. Zu diesen Höhen mußte sie streben und nach der Krone langen mit fester Hand.
Tränen traten ihr in die Augen vor tiefinnerster Bewegung. Eine Auserwählte sollte sie werden, eine Ruhmgekrönte, und es drängte sich ihr auf die Lippen: „Vater im Himmel, der du mir die schöne Stimme schenktest, hilf mir, daß ich das mir anvertraute Gut richtig verwalte.“ In ihr war ein so wundervolles Empfinden, als hätte sie soeben das herrlichste Gebet gesprochen, das in seinem über alles gläubigen Wort schon die Sicherheit der Gewährung trug.
Nun setzte Charlotte Bürger den leichten Regenhut auf, den sie alltags immer trug, und ging, um ihre Nachmittagsklavierstunden zu erteilen. Von zwei bis drei in einer Eckwirtschaft der Friedenstraße, dann bei Zugführer Mewes in der Frankfurter Straße und danach bei Zahntechniker Stempel. Sie erhielt für jede Stunde eine Mark fünfzig und das Fahrgeld für die Elektrische. Es war draußen schon herbstlich. Sie fröstelte ein wenig, aber auf ihrem durchgeistigten, großzügigen Gesicht lag es wie heller Sommersonnenschein.
II
Trude Berger saß untätig vor ihrer Nähmaschine. Sie hatte gar keine Lust zur Arbeit. Es war widerwärtig, immer eine stumpfsinnige Naht nach der anderen zu nähen. Sie hatte das satt und übersatt.
Nicht nur von der buckligen Merkel wurde Charlotte Bürger beneidet, sie selbst beneidete sie noch viel mehr. Wenn diese armselige Klavierlehrerin wirklich eine berühmte Sängerin würde, verlor sie ja gar nichts dadurch, daß sie ihr den Brief vorenthielt. Es wäre wahrlich zuviel des Guten, wenn ihr zu der Aussicht auch ganz urplötzlich noch ein reicher Onkel beschert würde.
Sie erhob sich. Vor allem wollte sie den Brief vernichten. Verbrennen wollte sie ihn. Dadurch beseitigte sie ihn sicher und endgültig. Sie hielt das Schreiben dann in den Händen, konnte der Versuchung nicht widerstehen, es noch einmal durchzulesen. Ihre Augen blieben an dem letzten Satz haften: „In der Erwartung einer baldigen Antwort grüßt Sie vielmals Ihr Cousin Lothar Bürger.“
Sie wurde sehr nachdenklich. Vielleicht nützte es gar nichts, daß sie den Brief unterschlug? Vielleicht machte dieser Herr Lothar Bürger, wenn er keine Antwort erhielt, eines Tages einen Besuch bei der Cousine? Dann stellte sich heraus, es war ein Brief verlorengegangen, was ja schließlich vorkommen konnte, und die beiden einigten sich dahin, daß Charlotte mitreiste in ein reiches, vornehmes Heim, um dort ihre Gesangstudien in aller Sorglosigkeit zu vollenden.
Charlotte Bürger hatte ihr nichts getan, aber sie gönnte ihr ein solches Glück nicht. Sie selbst mußte sich plagen, mochte die sich auch weiterplagen, bis sie so müde wurde vom Klavierstundengeben, daß ihre blödsinnigen, verstiegenen Träume von Ruhm einschliefen.
Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke. Sie wollte einem eventuellen Besuch dieses Cousins vorbeugen. Sie wollte nach Frankfurt am Main an die angegebene Adresse schreiben, als ob Charlotte es schrieb: Sie verzichte ein für allemal auf ein Kennenlernen mit ihm und der Familie von ihres Vaters Bruder. Er würde keinen Augenblick daran zweifeln, daß Charlotte die kurze, schroffe Antwort selbst geschrieben habe. Sie konnte sogar noch besser jede Möglichkeit eines Kennenlernens zwischen Charlotte Bürger und ihrem Cousin verbauen, wenn sie selbst mit dem Briefschreiber sprechen würde. Sie wollte ihm also lieber mitteilen, sie sei zu einer Unterredung bereit und erwarte die Antwort, wann und wo man sich treffen könne, postlagernd, da sie in ihrem sehr einfachen Stübchen keinen Besuch empfangen möchte, besonders weil ihre Wirtin eine sehr böse Zunge hätte.
Trude Berger lachte laut auf. Sie fand ihre Idee originell. Auf diese Weise würde sie sich Herrn Lothar Bürger einmal ansehen und ihm dann deutlich erklären, daß sie, seine Cousine Charlotte, nichts von ihm und seinem Vater wünsche. Daraufhin würde wohl die wirkliche Charlotte Bürger nie mehr etwas von ihren Verwandten hören.
Immer fester nahm der Gedanke von Trude Berger Besitz. Ihr Vorhaben erschien ihr wie ein drolliger Spaß. Sie besaß eine ganz nette Schrift, und als sie den fertigen Brief vor sich liegen hatte, war sie äußerst zufrieden mit sich. Sie überflog die wenigen Sätze noch einmal und fand nichts daran zu verbessern. Sie holte sich vom Grünkramhändler im Nebenhause eine Marke und trug den Brief sogleich in den nächsten Kasten. Ein bißchen bedrückt war ihr doch zumute, nachdem der Brief in den Spalt des blauen Kastens verschwunden war, wenn auch die Anwandlung nicht lange dauerte. Die ganze Geschichte blieb sehr komisch, war nichts als ein famoser Witz.
Sie konnte kaum die drei Tage abwarten, die sie sich als Frist für die erste Nachfrage auf der Post gesetzt. Sie hatte die Antwort Lothar Bürgers postlagernd auf ein Postamt im Zentrum Berlins erbeten. Für alle Fälle muß man vorsichtig sein, dachte sie. Sie fragte keck, ob etwas angekommen sei für „Lotte 22“. Der Schalterbeamte lächelte die sehr hübsche, blonde Fragerin vertraulich an und reichte ihr nach kurzem Suchen einen schmalen Brief. Trude Berger verließ hastig das Postamt. Im Torweg eines nahen Hauses las sie dann:
„Meine liebe und verehrte Cousine! Ihre Zeilen, die ich mit bestem Dank bestätige, sind zwar sehr kühl, aber ich hoffe dennoch, eine persönliche Unterredung zwischen uns überzeugt Sie, daß mein Vater es wirklich gut und aufrichtig mit Ihnen meint und es sehr bereut, Ihnen damals, als Sie elternlos wurden, nicht verwandtschaftlich geholfen zu haben. Er hat unsäglich unter dem Tode meiner Schwester gelitten und wird Sie väterlich bei sich aufnehmen. Ich bin ab Donnerstag in Berlin, aber da Sie keine Briefe und keinen Besuch in Ihrer Wohnung wünschen, bitte ich Sie, mich kurz zu benachrichtigen, wann ich Sie im Hotellesezimmer oder sonstwo erwarten darf. Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung, liebe Cousine. Nachricht erbitte ich an das dortige Hotel Exzelsior.“
Nun folgte noch ein Gruß. Trude Berger barg den Brief in ihrer Handtasche. Die Sache fing an ihr immer mehr Vergnügen zu bereiten. Ihr war es, als ob sie ein interessantes Stelldichein vor sich hätte. Sie antwortete am nächsten Tage, schrieb an Lothar Bürger, sie würde am Freitagabend gegen sechs Uhr beim Portier des Hotels nach ihm fragen.
Von nun an saß sie oft bei ihrer Näharbeit, ohne zu wissen, was sie tat. Manche Naht mußte wieder aufgetrennt werden, weil ihre Gedanken sich fortstahlen und sich die Zusammenkunft mit Lothar Bürger ausmalten. Spät abends saß sie dann etwas weniger unaufmerksam über ihrer eigenen Garderobe, denn sie beabsichtigte, möglichst hübsch zu erscheinen bei der Zusammenkunft. Darauf konnte ihre weibliche Eitelkeit nicht verzichten, wenn sie auch die Rolle einer anderen spielen wollte.
Charlotte Bürger traf sie nur noch am Mittagstisch. Frühstück und Abendbrot brachte Frau Klokkow jeder Mieterin aufs Zimmer. Trude empfand jetzt Scheu vor Charlotte, ging ihr möglichst aus dem Wege, als fürchtete sie, diese könnte ihr das, was sie vorhatte, vom Gesicht ablesen. Charlotte aber spürte es wie einen Hauch von Feindseligkeit von Trude Berger zu sich herüberwehen. Man paßte doch nicht zusammen, die kurze, warme Stimmung von letzthin war sehr flüchtig gewesen, war schon verflogen, ehe Trude Berger noch ihr Zimmer verlassen hatte, dachte Charlotte.
Am Freitagnachmittag stand Trude in heller Erregung vor ihrem kleinen Spiegel. Sie fand sich immer noch nicht hübsch genug. Aber wie sollte man auch hübsch aussehen, wenn man sich nur billige Kleidung anschaffen konnte. Das dunkelblaue Jackenkleid hatte sie selbst geschneidert, aber wenn sie auch einfache Blusen und Röcke fertigbrachte, fehlte ihr doch die leichte Hand, um den richtigen Sitz und Schick in so ein Kostüm hineinzubringen. Dennoch sah sie darin, da ihre schmale Figur selbst über den schlechten Schnitt des Jackenkleides triumphierte, nicht übel aus. Darunter trug sie eine weiße Tuchbluse in Jumperform, und auf dem Blondhaar einen kleinen, dunkelblauen Seidenhut.
Erst fuhr sie bis zum Potsdamer Platz mit der Elektrischen, und von dort zog sie es vor, zu Fuß zu gehen. Sie mußte doch ein Stückchen laufen, denn je näher der Augenblick des Treffens heranrückte, desto stärker klopfte ihr Herz. Sie wanderte ganz langsam die Stresemannstraße hinunter, und immer zögernder wurde ihr Schritt. Schließlich war sie, angesichts des großen Hotels, so weit umzukehren. Ihr Vorhaben dünkte sie jetzt ungeheuerlich, unausführbar und gefährlich.
Sie blieb vor dem Hotel stehen, sah hinüber nach dem Anhalter Bahnhof. Die Uhr drüben wies gerade auf sechs. Um keinen Preis würde sie in das Hotel hineingehen! Sie hatte plötzlich gar keinen Mut mehr. Lieber Himmel, wie hatte sie überhaupt so etwas Blödsinniges anstiften können — nur weil sie es einer Mitschwester nicht gönnte, daß sie es besser haben sollte als sie! Wenn sie aber nicht kam, würde Lothar Bürger morgen bei Frau Klockow nach seiner Cousine Charlotte Nachfrage halten, und dann würde sicher ihr plumpes Spiel ans Licht gezerrt werden, weil der Brief vorhanden war, den sie ihm geschrieben.
Sie biß nervös auf ihrer Unterlippe herum, machte eine unschlüssige Bewegung und sah dann, wie aus der Erde gewachsen, einen ziemlich großen Herrn, Mitte der Zwanzig, vor sich stehen, der, den Hut lüftend, mit leichtem Lächeln fragte: „Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich in Ihnen Fräulein Charlotte Bürger vermute, nicht wahr?“
Über Trudes blasses Gesicht schoß jähe Röte wie eine Flamme. Sie starrte den vor ihr Stehenden, obwohl er ein Mann war, der Frauen gefallen konnte, mit einem Ausdruck des Entsetzens an. Was sollte sie jetzt tun, wie sich verhalten? Sie stammelte irgendetwas Unverständliches. Alle kecke Sicherheit, über die sie im allgemeinen verfügte, hatte sie verlassen.
Der sehr elegant gekleidete Herr machte eine etwas belustigte Miene. „Sie sind meine Cousine Lotte, ich brauchte gar nicht zu fragen. Und nun bitte ich Sie, mit mir ins Konversationszimmer zu kommen oder vielleicht ins Hotelcafé, wo wir uns so weit anfreunden können, daß Sie mich mit weniger mißtrauischen Augen betrachten.“ Er berührte leicht ihren Arm, führte sie. „Ich freue mich ja so sehr, daß Sie gekommen sind, und glaube Ihnen, nun ich Sie sehe, gar nicht mehr, daß Sie so kühl und schroff zu sein vermögen, wie es mir Ihr Brief vorzutäuschen beabsichtigte.“
Mechanisch ließ sich Trude Berger durch den Hoteieingang geleiten und begriff kaum, daß sie es war, die dann in einem bequemen Sessel einem fremden Herrn gegenübersaß und dabei angestrengt überlegte, wie sie sich weiter verhalten müßte. Es blieb ihr jetzt eigentlich nichts weiter übrig, als ihre Rolle weiterzuspielen, sonst beschwor sie allerlei Unannehmlichkeiten für sich herauf. Sie mußte also so tun, als wäre sie Charlotte Bürger, und erklären, sie wünsche ernstlich weder jetzt noch später irgendwelche Beziehungen zu dem Bruder ihres Vaters und seiner Familie. Sie blickte Lothar Bürger an, der eben dem Kellner seine Bestellung gemacht hatte. Sie wollte sprechen, doch ihr Gegenüber verhinderte sie daran.
„Liebe Cousine, Sie sind viel reizender und blonder, als ich Sie mir vorgestellt habe. Es würde Sie nicht kleiden, wenn Sie etwas sagen wollten, was den Worten Ihres Briefes ähnelt. Vater hat sein Unrecht gegen Sie spät erkannt, aber immerhin noch erkannt. Ich bitte Sie recht, recht herzlich, lassen Sie das Böse vergeben und vergessen sein. Meine Mutter starb schon vor Jahren, nun folgte ihr meine Schwester, ich schrieb es Ihnen ja. Unserm Hause fehlt ein weibliches Wesen, das zu uns gehört, zu Vater und mir, das unseres Blutes ist.“ Seine braunen Augen blickten bittend. „Seien Sie Vaters Tochter, seien Sie meine Schwester. Glauben Sie mir, es wird Ihnen bei uns gefallen.“
Das Café war um diese Zeit fast leer, die beiden saßen außerdem noch abseits und konnten sich ungestört unterhalten. Der Kellner brachte Kaffee und Gebäck.
Trude Berger fühlte jedes warme Wort wie einen scharfen Stein, der gegen sie geschleudert wurde. Wie gern hätte sie laut gerufen: Ja, ja, ich bin zu allem bereit! Aber sie konnte es nicht tun, weil sie ja gar nicht Charlotte Bürger war, zu der dieser Mann zu sprechen glaubte. Und wie er ihr gefiel, dieser fremde Mann, den sie belogen durch ihren Brief und ihr Erscheinen! Wie sehr er ihr gefiel! Gut nur, daß er so viel sprach, daß sie wenigstens noch ein Weilchen seine tiefe, angenehme Stimme hören durfte, ehe sie wieder gehen mußte. So eigen war ihr zumute, so glücklich und unglücklich zu gleicher Zeit. O, was hätte sie dafür gegeben, wenn sie in Wahrheit die gewesen wäre, für die sie sich ausgab.
Der Kellner war wieder gegangen. Trude saß wie unter einem Bann. Irgendeine Macht ging von Lothar Bürger aus, die sie in einen eigenartigen Zustand versetzte. Es war ihr, als müsse sie ihm bekennen: Ich bin ja nur ein mißgünstiges Frauenzimmer, eine Lügnerin, die einem fleißigen, strebsamen Mädel das Glück nicht gönnt, aus dem Alltagsfrondienst herauszukommen! Aber sie war zu feige zu dem Bekenntnis. Sie fürchtete sich davor, die jetzt so freundlich blickenden Männeraugen kühl und befremdet auf sich gerichtet zu sehen, fürchtete sich vor dem verächtlichen Lächeln, das sich dann um den scharfgeschnittenen Mund festsetzen würde.. Nein, den Mut zur Offenheit brachte sie nicht auf!
Lothar Bürger betrachtete das wechselnde Mienenspiel auf dem hübschen Gesicht, das er sehr reizvoll fand. „An was denken Sie, Cousine Lotte? Ich darf Sie doch so nennen? Eigentlich darf ich es doch, nicht wahr? Wir sind doch so nahe verwandt, wenn wir uns auch heute erst kennenlernen.“
„Sagen Sie zu mir, was Sie wollen,“ erwiderte sie mit gequältem Lächeln.
Was kam es darauf an, wie er sie nannte? Heute nannte. Nur jetzt nannte. Denn bald würde sie wieder zu Hause sein und beim Licht der summenden Gaslampe Naht auf Naht an irgendeinem armseligen, billigen Fummel nähen. Heute abend schon, und morgen vormittag wieder, und auch am Nachmittag und so weiter Tag für Tag, Woche für Woche. Vielleicht lernte sie dann Sonntags beim Tanz irgendeinen biederen Handwerker kennen und ward seine Frau. So sah ihre Zukunft aus. Diese Stunde hier in dem eleganten Café würde dann ihre schönste und beste Erinnerung sein fürs ganze Leben. Sie hob den Kopf. Deshalb aber wollte sie diese Stunde auch ausnützen, wollte die Rolle, in die sie sich gesteckt, bis zu Ende spielen. Lothar durfte nicht wissen, wie schlecht sie war.
Der Mann sprach lebhaft auf sie ein. „O, liebste Cousine Lotte, Sie werden sich wirklich sehr wohl bei uns fühlen, wir wohnen herrlich. Das Dörfchen, in dem unsere Fabrik liegt, wird von hohen Felswänden vor allzu rauhen Stürmen geschützt, und wir fahren oft nach Dresden oder nach Wien, damit wir auch Großstadtluft atmen, Theatervorstellungen und Konzerten beiwohnen können. Wir haben allerdings auch daheim nette, liebe Geselligkeit. Warten Sie nur ab, Cousinchen, Sie werden sich sehr wohl bei uns fühlen. Zur Zeit ist’s ja ziemlich still und kalt im Hause, weil mein Schwesterchen gestorben ist, aber gemütlich und traulich wird es wieder werden, wenn Sie bei uns sind. Vater und ich brauchen jemand, der unserem Daheim wieder Sonnenschein gibt. Es ist so traurig, wenn man nur auf bezahlte Hände angewiesen ist.“ Er unterbrach sich. „Aber unser Kaffee wird kalt, weil ich plausche und plausche.“ Er schob den mit einer reichen Auswahl versehenen Kuchenaufsatz näher an Trude Berger heran. „Bitte, essen Sie doch, Cousinchen.“
Trude naschte gern, aber ihr Geldbeutel gestattete ihr nicht oft, sich etwas Gutes zu gönnen. Die Törtchen lachten sie an, und sie nahm sich einen glänzenden Mohrenkopf auf das Tellerchen, vergaß über dem süßen Genuß für ein Weilchen alle Seelennöte von vorhin und konnte nicht widerstehen, auch noch einen zweiten Mohrenkopf zu nehmen. Der Kaffee regte sie an, erfrischte sie, die sie an Frau Klockows Zichorienbrühe gewöhnt war.





























