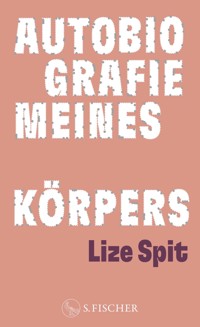9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, das alles gibt und alles verlangt. Mit geschlossenen Augen hätte Eva damals den Weg zu Pims Bauernhof radeln können. Sie könnte es heute noch, obwohl sie viele Jahre nicht in Bovenmeer gewesen ist. Hier wurde sie zwischen Rapsfeldern und Pferdekoppeln erwachsen. Hier liegt auch die Wurzel all ihrer aufgestauten Traurigkeit. Dreizehn Jahre nach dem Sommer, an den sie nie wieder zu denken wagte, kehrt Eva zurück in ihr Dorf – mit einem großen Eisblock im Kofferraum. Die junge Bestsellerautorin Lize Spit wagt sich mit ihrem ersten Roman »Und es schmilzt« an die Grenzen des Sagbaren. Preis des niederländischen Buchhandels für den besten Roman des Jahres Das radikalste Update zu »Der Fänger im Roggen«! Pressestimmen: »Dieser Roman ist eine Granate, die erst nur einen dunklen Schatten wirft und dann mit kaltblütiger Präzision einschlägt.« De Standaard »Geschrieben mit der Treffsicherheit eines Messerwerfers. Ein Todesstoß.« Bregje Hofstede »Diese Geschichte packt Sie an der Kehle.« De Standaard »Übertrifft alle Erwartungen!« De Morgen »Aufregend, manchmal lustig, am Ende beängstigend und ergreifend.« Het Nieuwsblad »›Und es schmilzt‹ besetzt eine besondere Stelle in Ihrem Kopf – irgendwo zwischen Behaglichkeit, Unruhe, Vertrautheit und Entsetzen.« Saskia de Coster »Dieses Buch knistert vor Spannung. Vertraut, überraschend, einfallsreich, erbarmungslos.« De Standaard Stimmen aus dem Buchhandel »Wow! Was für ein Buch. Ich habe es zugeschlagen und hätte es am liebsten gleich noch einmal von vorn begonnen. Das ist großartig erzählt, hat einen unglaublichen Sog. … Tesje werde ich sicher nie mehr vergessen. « Juliane Barth, Dussmann, Berlin »Lize Spits Erzählkraft ist beispiellos und treibt dem Leser mitunter Schweißperlen auf die Stirn. ›Und es schmilzt‹ ist ganz großes beklemmendes Kopfkino! Thomas Bleitner, Buchhandlung Lüders, Hamburg. »Das Buch hat mich überrascht, beeindruckt, abgeschreckt, fasziniert, begeistert! ... Mutig und kompromisslos! Eine Sogwirkung, der man sich nicht entziehen kann … es haut einen einfach um! Brigitte Drees, Buchhandlung Köhl, Erftstadt »Ein Meisterwerk mit einer ganz eigenen Stimme und Stimmung, das man gelesen haben muss.« Alex Schütz, Pieper Bücher, Saarlouis »Man wird über dieses Buch reden, reden müssen, weil man sich nach der Lektüre austauschen will.« Frank Menden, Stories! Die Buchhandlung, Hamburg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Lize Spit
Und es schmilzt
Roman
Über dieses Buch
Mit geschlossenen Augen hätte Eva damals den Weg zu Pims Bauernhof radeln können. Sie könnte es heute noch, obwohl sie viele Jahre nicht in Bovenmeer gewesen ist. Hier wurde sie zwischen Rapsfeldern und Pferdekoppeln erwachsen. Hier liegt auch die Wurzel all ihrer aufgestauten Traurigkeit. Dreizehn Jahre nach dem Sommer, an den sie nie wieder zu denken wagte, kehrt Eva zurück in ihr Dorf – mit einem großen Eisblock im Kofferraum.
Preis des niederländischen Buchhandels für den besten Roman des Jahres
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Lize Spit wurde 1988 geboren, wuchs in einem kleinen Dorf in Flandern auf und lebt heute in Brüssel. Sie schreibt Romane, Drehbücher und Kurzgeschichten. Ihr erster Roman ›Und es schmilzt‹ stand nach Erscheinen ein Jahr lang auf Platz 1 der belgischen Bestsellerliste und gewann zahlreiche Literaturpreise, darunter den Bronzen Uil Preis für den besten Debütroman und den Dutch National Bookseller Award.
Impressum
Dieses Buch wurde mit Unterstützung von Flanders Literature herausgegeben (www.flandersliterature.be).
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Het Smelt«
bei Das Mag Uitgevers, Amsterdam
© 2016 Lize Spit
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro für visuelle Kommunikation KOSMOS; Münster
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490395-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
9.00 Uhr
4. Juli 2002
Vier Schatten
9.30 Uhr
6. Juli 2002
Drei Musketiere
10.00 Uhr
8. Juli 2002
Windows 95
10.15 Uhr
11. Juli 2002
Muschel
10.30 Uhr
12. Juli 2002
Elisa
11.00 Uhr
15. Juli 2002
Die Luftverkäufer
11.15 Uhr
17. Juli 2002
Gewissen
12.30 Uhr
18. Juli 2002
Kampieren
12.45 Uhr
19. Juli 2002
Millennium-Bug
13.00 Uhr
21. Juli 2002
Schwalbe
13.45 Uhr
22. Juli 2002
Fettkopf
14.00 Uhr
24. Juli 2002
Encarta 97
14.15 Uhr
31. Juli 2002
Im Glauben gefestigt
15.00 Uhr
1. August 2002
Das Vereinsquiz
16.30 Uhr
2. August 2002
Zweistühlerestaurant
17.00 Uhr
5. August 2002
Brach liegen
17.45 Uhr
7. August 2002
Pfote durchnagen
18.30 Uhr
10. August 2002
Jauchegrube
19.00 Uhr
10. August 2002 (2)
Pastazange
19.30 Uhr
10. August 2002 (3)
Beschädigungen
20.00 Uhr
Dank
Für Tilde, Jornt & Saar
9.00 Uhr
Die Einladung traf vor drei Wochen ein und war übertrieben frankiert. Das Gewicht der Marken, das ja zusätzliches Porto gekostet haben musste, stimmte mich zunächst hoffnungsvoll: Es gibt immer noch Dinge, die einander möglich machen.
Ich fand den Umschlag zuoberst auf einem der beiden Posthäufchen – einem Dutzend Briefe und Flyer, die gleich hoch gestapelt vor meiner Tür lagen. Die Handschrift meines Nachbarn; ein Türmchen pro Gegenleistung, die noch erbracht werden musste. Unter dem überfrankierten Umschlag befanden sich das Angebot eines französischsprachigen Hellsehers und das Reklameblatt eines Spielzeuggeschäfts, das für die Familie über mir bestimmt war – in meinem Briefkasten verschwindet häufiger Post, die Kinder zum Quengeln veranlasst. Außerdem gab es noch die Rechnungen und vier Prospekte eines Billigsupermarkts mit jeweils dem gleichen spärlich gefüllten Truthahn, einer Mokkaeistorte, preisgünstigem Wein. Ich hatte tatsächlich noch keine Pläne für Silvester.
Ich löste diesen Versuch einer Barrikade auf, ging in meine Wohnung und machte, die Post in der Hand, meine übliche Runde, auf der ich jede Tür öffnete und dabei nicht wusste, was schlimmer war: ein Mal einen Eindringling vorzufinden oder jedes Mal alle diese leeren Zimmer.
Nachdem ich meinen Mantel und die Fausthandschuhe weggeräumt hatte, machte ich mich ans Abendessen. Schälte eine Kartoffel, schnitt ihr die Geweihe ab, die ihr im Sonnenlicht gesprossen waren. Ich füllte den Wasserkocher, drehte die Flamme unter dem leeren Kochtopf schon mal voll auf, um dem Kocher zu zeigen, dass er sich beeilen musste.
Während ich wartete, sah ich mir den Brief genauer an.
Mein Name und meine Adresse waren mit schwarzem Stift in einer Handschrift geschrieben, die ich erkannte, aber nicht gleich zuordnen konnte. Mit der Spitze des Kartoffelschälers schlitzte ich den Rand auf. Eine weiße Karte kam zum Vorschein, ein Babyfoto und ein Name. Sogar ohne einen gründlicheren Blick auf das Bild, den Namen oder das Datum wusste ich, dass dies ein Foto von Jan war und die Karte keine Geburtsanzeige. In diesem Jahr, am 30. Dezember, wäre er dreißig geworden.
Ich sah mir noch einmal meine Adresse an, den Straßennamen. Die Buchstaben waren tief ins Papier gegraben, die Ober- und Unterlängen kamen kaum über die Zeilen hinaus. Natürlich war das Pims Handschrift. Jahrelang hatte ich neben ihm in der Klasse gesessen, gesehen, wie er seine Arbeitsblätter ausfüllte. Ich hatte nie verstanden, weshalb er den Stift so fest aufsetzte. Seine Antworten waren dadurch nicht richtiger geworden.
Pim hatte also meine Adresse herausgesucht. Er hatte sie fehlerfrei abgeschrieben, Buchstaben für Buchstaben. Die Einladung selbst war gedruckt. Auf der Innenseite stand ein Textblock mit näheren Angaben.
»Liebe …« Die gepunkteten Linien ließen Platz für meinen handgeschriebenen Namen.
»Wie Ihr wisst, wäre in diesem Monat nicht nur Jan dreißig geworden, auch unsere fast vollautomatische Melkanlage wird eingeweiht. Zeit, um noch einmal bei Drinks und Häppchen zusammenzukommen.«
Ich zog mir die Schuhe aus, um den weichen Parkettboden unter meinen Füßen spüren zu können. Aus Jans posthumem Fest war ein Werbegag geworden, der Versuch, möglichst viele Leute zum Start-up eines neuen Betriebs zusammenzubekommen.
Ich las nicht weiter. Warf die Karte zusammen mit dem Rest der Post und den Kartoffelschalen in den Abfalleimer. Ich drehte den Hahn auf, hielt meine Handgelenke unter den kalten Strahl, schöpfte Wasser in mein Gesicht.
Der leere gusseiserne Topf knackte, bettelte um ebenfalls etwas Wasser. Und obwohl der Kocher gerade fertig war, drehte ich die Gasflamme wieder aus. Mein Hunger war verschwunden.
Natürlich wusste ich noch bevor ich mir die Wangen mit dem Küchenhandtuch getrocknet hatte, dass ich es hierbei nicht würde bewenden lassen können.
Ich fischte die Karte aus dem Abfall.
Das Foto von Jan war von der Stärke in den Kartoffelschalen verschmutzt. Von seinem Mund ging eine schwarze Spur ab, die Lippen waren bis über die Stirn ausgelaufen. Mit einem Zipfel des Küchenhandtuchs versuchte ich, Jans Lächeln wieder an den richtigen Platz zu bekommen.
»15.00 Uhr: Öffnung der Stalltüren. 15.15 Uhr: Kleine Vorführung des Melkroboters, danach wird gefeiert. P.S. An warme Kleidung denken. Keine Blumen mitbringen, sondern ein Foto oder eine gute Erinnerung an meinen Bruder. Die können vorweg an [email protected] gemailt oder auf Jans Facebookseite gepostet werden. Wegbeschreibung siehe umseitig.«
Auf der Rückseite der Karte, unter einer vereinfachten Wegskizze, stand ein abgeschmacktes Zitat. Ich las es ein paarmal laut, wie von Pim vermutlich beabsichtigt. Es blieben Sätze, die sich zu sehr bemühten.
Inzwischen ist es kurz nach neun, an Vilvoorde bin ich gerade vorbei. Die Uhr in meinem Auto flackert alle paar Sekunden und geht im Vergleich zu meinem Handy ein paar Minuten vor. Vielleicht liegt das an der Kälte. Solange ich auf der Autobahn fahre, bleibt Jans Gesicht ausdruckslos neben mir auf dem Beifahrersitz liegen.
Ich habe die Karte nicht wegen des Fotos dabei. Auch die exakten Zeitangaben und die Wegbeschreibung muss ich mir nicht noch einmal ansehen.
Ich brauche lediglich die dicke Briefmarkenschicht auf dem Umschlag. Die Marken beweisen, Pim wollte sichergehen, dass die Einladung mich auch erreicht. Natürlich weiß ich, sie ist nicht an diejenige gerichtet, die ich jetzt bin, sondern an die Person, die ich war, als wir noch miteinander sprachen, die Eva vor dem Sommer 2002. Darum tue ich heute genau das, was ich damals getan hätte: widerwillig doch aufkreuzen.
4. Juli 2002
Die Stimme des Nachrichtensprechers kommt aus dem Garten. Es ist Donnerstag. Es gibt so viele Staus, dass es praktischer wäre, die Orte aufzuzählen, an denen der Verkehr reibungslos fließt. Dann folgt ein Hinweis, demzufolge die nächsten Tage heiß werden. Nach dem Wetterbericht läuft »Underneath your clothes«. Die Klänge werden vom Flügelflappen auffliegender Vögel übertönt.
Vielleicht liegt es daran, dass ich endlich mal gut geschlafen habe, oder an der Musik, die jede Bewegung stimmig macht, jedenfalls scheint es zum ersten Mal seit dem Winter so, dass ich am richtigen Ort aufwache. Vor mir liegt ein noch unberührter Sommer. Die Kirchturmuhren werden über die Dauer jeder Stunde wachen, niemand wird die Zeiger beschleunigen oder verlangsamen, nicht einmal Laurens und Pim. Zum ersten Mal seit Jans Beerdigung beruhigt mich dieser Gedanke. Ich muss einfach dem angegebenen Tempo folgen, und alles wird gut.
Ich setze mich in meinem Hochbett auf. Sehe erst jetzt Tesje neben ihrem Bett stehen. Das kurze struppige Haar klebt ihr am verschwitzten Kopf. Sie inspiziert ihr Oberlaken, schaut, ob es zu beiden Seiten des Betts exakt gleich lang überhängt.
»Hast du heute Nacht geschlafen?«, frage ich.
Sie nickt.
Es ist ein perfekter Tag für Monsterbälle.
Auf dem Weg zu meinem Fahrrad begegne ich Vater. Er raucht, während er mit einigem Stolz den Elf-Uhr-Nachrichten lauscht, die klar und laut aus dem Radio kommen, das er vorhin in die Krone des Kirschbaums gehängt hat, um die Krähen zu verjagen. Er lehnt am Anbau hinter dem Haus, den wir »das Arbeitshaus« nennen, obgleich dort nie gearbeitet wird.
Der Stau Richtung Küste hat sich wegen zwei schwerer Unfälle auf der E 40 noch nicht aufgelöst, ich habe inzwischen in beiden Socken eine Fünfzig-Cent-Münze versteckt. Mit jedem Schritt rutscht das Geld weiter nach unten.
Vater nimmt die bis zum Filter heruntergerauchte Kippe aus dem Mund, tritt sie mit dem Pantoffel aus, hebt sie auf.
Er trägt eine schwarze Jeans. Früher war dies seine Arbeitshose, aber jetzt hat sie keine gute Passform mehr. Gleich oberhalb der Knie beult sie sich, die Folge seines bevorzugten Sitzes, in der Hocke, neben der Bierkiste.
»Eva«, sagt er.
Er dreht sich um und bedeutet mir, ihm zu folgen. Aus seinem Mund hört sich mein Name manchmal wie ein Befehl an, manchmal wie eine Frage, selten wie etwas, das zu mir gehört.
Ich folge Vater ins Arbeitshaus. Die Münzen rutschen an meinen Knöcheln entlang zu den Füßen.
Mutter hatte die Bezeichnung »Arbeitshaus« vorgeschlagen, als sie dieses Haus kauften und jedes leere Zimmer noch die Freiheit hatte, alles zu werden, solange sie es nur oft genug wiederholten. Vater würde hier großartige Dinge verrichten. Den Garten pflegen, die Hecke schneiden, einen Komposthaufen anlegen, das Badezimmer umbauen. Letzteres war von den Vorbesitzern als Kinderschlafzimmer genutzt worden und hatte eine Tapete mit kleinen Bären. In der Mitte des Raums hat Vater eine halbhohe Wand aus Hohlblocksteinen gemauert, um ein Waschbecken daran aufzuhängen. Die Wände sollten gefliest werden, sobald Geld dafür da war. Jolan fand heraus, dass die Löcher in den Backsteinen prima Halter für Zahnbürsten abgaben.
»Sehr praktisch, für die Zwischenzeit«, beschloss Mama.
Jolan hatte damals bereits berechnet: Es gibt keine Zeit zwischen Zeit.
Überall in der Werkstatt liegen leere Bierdosen und anderes Gelump herum. Die Innenwände sind mit Pilzen überzogen. Die meisten wachsen schief auf ihrem Stiel, so dass sie unter dem Hutrand hervorlugen können, um mit eigenen Augen zu sehen, was hier in all den Stunden eigentlich getrieben wird.
Vater wirft seine ausgetretene Kippe in eine der Dosen, in denen noch eine Pfütze steht.
»Sonst beschwert die sich wieder.« Er deutet auf die Tür, die ins Haus, in die Küche führt.
Vaters Schultern sind oben eingedellt, es erweckt den Eindruck, dass seine Achseln zu schwer sind. So stehen wir da und sehen uns an, in einem Arbeitshaus, das übersät ist mit allen möglichen Werbegeschenken, die der Getränkehandel Peters beim Kauf von Maes-Pils-Kisten dazugibt – blaue Schirmmützen, blaue aufblasbare Biertabletts, blaue Strandbälle.
Ob Vater sieht, was ich sehe: dass dies zu einem Warenlager mit potentiellen Tombolapreisen geworden ist?
Mein Blick fällt auf die Bohrmaschine, die nicht bei den anderen Geräten an der Decke hängt, sondern auf einem Regal liegt, das erst kürzlich zusammengeschraubt und in der Wand verankert worden ist. Es war das einzige Mal, dass die Maschine benutzt wurde. Schwer zu sagen, was was möglich gemacht hat: der Bohrer das Regal oder das Regal den Bohrer.
Alle diese Geräte sind nicht aus der Luft gefallen. Wir wohnen nicht weit vom ALDI entfernt – etwas zu weit zu Fuß, aber gut erreichbar mit dem Rad. Jedes Jahr gibt es dort etwas, was Väter noch nicht besitzen. Auf der Brücke über die Autobahn, die unser Dorf vom Nachbardorf trennt, kann man sie regelmäßig dahinschlingern sehen: Mütter mit Laubsägen, MEDION-Massagearmen, Heckenscheren und Grillzangen am Fahrradlenker.
Diese Bohrmaschine haben wir Vater vor einem Jahr geschenkt. Seine Freude war besonders groß, solange das Ding noch eingepackt auf dem Büfett lag. Nach dem Auspacken hat er sie auf einen Stapel gebügelter Küchenhandtücher gelegt. Dort blieb sie liegen, bis sich die Vorbereitungen für seinen nächsten Geburtstag nicht länger aufschieben ließen.
»Eine Bohrmaschine wird während ihrer gesamten Lebensdauer im Durchschnitt nur elf Minuten lang benutzt«, sagt Vater.
»Das ist wenig«, sage ich.
Ich schaue, ob das Preisschild noch am Karton klebt, um die Kosten pro Sekunde berechnen zu können. Das kann ich dann Pim und Laurens erzählen. Es könnte sie interessieren.
»Schau, Eefje. Das wollte ich dir zeigen.«
Vater deutet auf eine Schlinge, die am mittleren Holzbalken unter dem Dach baumelt, neben der Heckenschere.
»Man sieht nicht, wie schwierig es ist, so etwas richtig aufzuhängen, oder?«
Ich reagiere mit einem Achselzucken. Sowohl bei Dingen, die ihnen egal sind, als auch bei solchen, die ihnen alles andere als egal sind, für die sie aber nicht die richtigen Worte finden, reagieren Menschen mit einem Achselzucken. Jedes Mal denke ich, dafür müsste unbedingt ein anderer Körperteil gewählt werden, notfalls eine andere Gebärde. In der Anatomie der Achseln gibt es, im Gegensatz zu den Augenbrauen, nicht genug Spielraum für Nuancen.
»Das kann nicht jeder knüpfen«, sagt er, »es muss in genau der richtigen Höhe hängen.«
»Das sehe ich«, sage ich. »Und was ist die richtige Höhe?«
Meine Frage findet kein Gehör.
»Bei einem falschen Knoten muss man leiden. Du willst doch nicht, dass ich leide?«
Ich blicke wieder auf die Schlinge und schüttele den Kopf.
»Falls man nicht tief genug fällt, bricht das Genick nicht. Dann dauert es lange. Und falls man aus zu großer Höhe fällt, zerreißt es einem das Genick, das will man den Menschen, die einen finden, nicht antun. Oder?«
»Nein, will man nicht«, sage ich.
Vater hat eine Kappe auf. Der Schweiß der letzten Tage ist in sie eingezogen und getrocknet. Das Salz hat weiße Schlangenlinien in Höhe seiner Stirn hinterlassen. Je wärmer die Tage, umso höher die Linie, die zurückbleibt.
Er sieht mich schweigend an, setzt die Kappe ab, kontrolliert, ob etwas Besonderes an ihr ist. Er sieht es nicht. Die Kappe landet wieder auf seinem Kopf, jetzt mit dem Schirm nach hinten.
Ich kann nur denken: Dieser Mann ist mein Vater. Er ist älter als Durchschnittsväter, weil er erst spät eine Frau kennenlernte, die Kinder von ihm wollte. Er arbeitet bei einer Bank, macht da Dinge, über die er nie im Detail spricht und nach denen andere auch nie fragen, weil die Leute nun mal davon ausgehen, solange jemand von sich aus nichts sagt, gebe es auch nichts zu erzählen. Um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, muss er jeden Tag – auch bei Regen – zu einer Bushaltestelle radeln, um dann eine halbe Stunde im Bus zu sitzen. An diesen Tagen verdient er gerade genug, um seine Familie, die keine Fragen stellt, unterhalten und das Dach über ihren Köpfen bezahlen zu können, an dem er die Geschenke aufhängen kann, die sie von seinem Geld kaufen, ohne dass er das wollte.
Ich bin die älteste Tochter dieses Mannes, also darf ich jetzt nicht einfach nicken oder irgendeine Antwort geben, ohne zu wissen, was genau er vorhat.
Ich zwinge etwas auf mein Gesicht. Kein Lächeln. Kein Mitleid. Verständnis vielleicht, obgleich ich nicht weiß, wie das, in eine Grimasse übertragen, aussehen müsste.
»Du denkst genau wie deine Mutter, dass dieser alte Trottel nie ernst meint, was er sagt. Dass dieser alte Trottel hier nicht den Mut dazu hat?«
Vater sagt immer »deine Mutter«, und Mama tut das Gleiche, wenn sie von Papa spricht, dann sagt sie »dein Vater«. Das ist nicht ganz fair. So versuchen sie, sich aus der Affäre zu ziehen, indem sie so tun, als wäre ich diejenige, die sie ausgesucht hat.
»Möchtest du, dass ich es dir demonstriere?«
Er greift nach der wackligen Leiter, klappt sie genau unter der Schlinge auseinander und steigt die Stufen hinauf. Nach der dritten beginnt die Leiter gefährlich zu kippeln. Ich trete näher, stelle mich seitlich daneben, um das Ding zu sichern. Die Münzen rutschen ganz nach unten, bis unter meine Fußsohlen. Die Elf-Uhr-Nachrichten sind zu Ende, es folgt Werbung.
»Zahlen Sie nicht zu viel. Wenn Sie das gleiche Gerät woanders billiger finden, erstatten wir Ihnen die Differenz.«
Vater ist oben angelangt. Er balanciert mit beiden Füßen auf der obersten Stufe, steht jetzt genau unter der Schlinge. Das Seil schwingt zur Seite, kommt zurück und schlägt ihm kurz an den Hinterkopf. Fast verliert er das Gleichgewicht. Ich halte die Leiter fest. Ich kann nur dafür sorgen, dass er nicht fällt. Ich kann nicht dafür sorgen, dass er nicht springt. Weil ich jetzt so fest auftrete, brennen die hinuntergerutschten Münzen noch stärker. Der Kopf von König Albert II. wird für den Rest meines Lebens in meine Fußsohlen geprägt sein.
Vater ruckt kurz an der Schlinge – sie hängt fest genug. Er legt sie sich um den Hals. Wirft einen Blick auf sein eigenes, blaues Imperium. Er nickt. Es wirkt sehr zufrieden.
»Menschen, die sich aufhängen, kratzen sich oft die Haut vom Hals. Ein Zeichen von Reue. Bereuen darf man nicht«, sagt er.
Ich nicke.
»Hast du gehört, Eva?«
Ich nicke wieder.
»Was habe ich denn gesagt?«
»Dass man nie bereuen darf«, sage ich.
»Ich verstehe dich nicht.«
»Bereuen darf man nie«, wiederhole ich, lauter.
Erst jetzt schaut er in meine Richtung, sieht mich dastehen, wie ich die Leiter stütze.
Er schweigt für einen Moment.
»Du musst mal was mit deiner Frisur machen, Eva«, sagt er dann. »Das sieht nach nix aus.«
Meine Haare haben, wie ich finde, genau die richtige Länge: kurz genug, um sie bei kaltem Wetter offen zu tragen, lang genug, um sie an warmen Tagen zusammenzubinden. Vater muss sich erst noch daran gewöhnen. Vor einer Woche habe ich mir selbst ein paar Zentimeter abgeschnitten, weil sich die Spitzen spalteten. Ich habe es vor dem Spiegel im schimmligen Badezimmer gemacht, über dem altmodischen Möbelstück, das dort steht, mit der Schere, mit der Mama manchmal Stoff schneidet.
»Danke, dass du die Leiter gehalten hast, Eva«, sagt Vater. Er hat inzwischen die Schlinge vom Hals genommen und steht schon wieder zwei Stufen tiefer.
»Du bist die Einzige, die jetzt im Bilde ist. Selbst deine Mutter weiß hiervon nichts. Das soll auch so bleiben.« Er tastet in seiner Hosentasche, zündet sich, den unteren Teil des Rückens an die mittleren Stufen gelehnt, eine neue Zigarette an. »Dass ich dir das gezeigt habe, ist vermutlich ein gutes Zeichen.« Er saugt seine Wangen ein. Vorsichtig steigt Vater die restlichen Stufen hinunter. Unten angekommen, haut er mir so fest auf die Schulter, dass ich das Gleichgewicht verliere, ein Schlag von der Art, wie Väter sie ihren Söhnen versetzen sollten.
»Rauchen ist nicht gut für dich«, sage ich.
Im Schaufenster von »Das Lädchen« liegen ein paar Raider auf einer Unterlage aus künstlichem Gras. Eigentlich gibt es diese Riegel nicht mehr – sie sind inzwischen in Twix umbenannt worden –, aber niemand traut sich, Agnes das zu sagen. Sie führt den kleinen Laden schon länger, als sich die meisten erinnern können.
In dem schmalen, tiefen Haus findet man so ungefähr alles, was ein kleiner Kramladen haben muss. Trotzdem kommen die meisten hier nur wegen Sachen her, die nicht verfallen, schrumpelig werden oder austrocknen können. Laurens’ Cousin hat mal die Stirn besessen, mit einem abgelaufenen Paket Nudeln in den Laden zurückzugehen.
»Das ist nicht das Verfallsdatum, guter Junge, sondern das Datum, an dem das Produkt hergestellt wurde«, blaffte Agnes ihn an. Nach einer kurzen Diskussion wurde die Pasta gegen ein Päckchen Alkoholstifte getauscht. Ein paar Stunden später stand auf ihrer Aushängetafel neben HIER ALLE TROCKENNAHRUNG: DIE NOCH PRODUZIERT WERDEN MUSS. Agnes hat nie versucht, es wegzuwischen. Im Gegenteil. Sie hat sich seitdem darauf spezialisiert, die Verfallsdaten zu manipulieren. Mit einem feinen Stift macht sie aus einer Drei eine Acht oder Neun, aus Januar zaubert sie mit lediglich einem kleinen horizontalen Strich Juli. Sie weiß, die Dorfbewohner werden trotzdem weiter kommen: Wer wählerisch sein will, muss zehn Minuten im Auto sitzen, nur um im nächsten Ort ein Paket Mehl zu kaufen. Auch Prinzipien haben ihre Grenzen. Sogar Laurens’ Cousin soll später seine Nudeln wieder bei Agnes gekauft haben.
Ich gehe hinein. Dieser Tag hat gut angefangen. Ich bin ihm noch Monsterbälle schuldig. Meine Anwesenheit wird von einer kleinen Glocke registriert, nicht der gleichen wie im Schlachterladen, hier klingt sie beinahe wie ein Schrei.
Die Rollläden sind fast ganz heruntergelassen, drinnen ist es schummrig. Zwischen den vollgestopften Regalen hängt muffige Kühle. Ein zu lange aufbewahrter Morgen. Ich warte und behalte die Tür zum hinten gelegenen Wohnraum im Auge. Dort verbirgt Agnes sich, füllt Kopien von Kreuzworträtseln aus. Möglicherweise stehen ein Sessel und ein Tisch darin, gibt es eine Küche. Niemand weiß das.
Ich warte weiter, denn Agnes mag keine Kunden, die in ihrer Abwesenheit schon herumzustöbern beginnen. Ich binde den Schnürsenkel auf, fische die Münzen aus der Socke. Heute Morgen hätte ich das Geld nicht zu verstecken brauchen. Mama hat mich nicht weggehen sehen.
»Hallo Eva«, ertönt es. Ich binde den Schnürsenkel zu und richte mich wieder auf.
Agnes eilt zur Theke, sie geht leicht gebeugt. Ihr Rücken ist verwachsen und hat die Form eines Beistelltischs. Laurens hat mal zum Scherz die Frage aufgeworfen, wie viele Biergläser sie wohl, ohne etwas zu verschütten, auf ihren Schulterblättern tragen könne. Heute zähle ich acht. Das muss ich mir merken, das kann ich ihm demnächst vielleicht erzählen.
Ich folge Agnes zwischen den grauen Regalen mit Schwämmen, Zahnstochern, Monatsbinden und Plastikblumen hindurch. Sie weiß, weswegen ich gekommen bin. Die Süßigkeiten stehen im mittleren Gang.
»Wo sind die beiden anderen Musketiere, der Schlachtersohn und der Bauernsohn?«, fragt sie. Ich zucke mit den Achseln.
Seit Agnes’ Mann mit einem anderen Mann durchgebrannt ist, seit dem neuen Slogan auf ihrer Aushängetafel, erlaubt sie den Kunden nicht mehr, sich die Süßigkeiten selbst zu nehmen, nicht einmal mir.
Ich bitte höflich um zwanzig saure Hostien, fünf Matten und zwei Päckchen Monsterbälle. Sie lässt die Süßigkeiten in eine spitz zulaufende Papiertüte fallen.
»Ziehst du heute noch mit Jans Bruder los? Teilst du das mit ihm?«, fragt sie.
Ich nicke voller Überzeugung, obwohl ich mir nicht sicher bin.
Sie gibt mir von allem ein bisschen mehr.
Mit der Tüte am Lenker fahre ich durchs Dorf. Ich scanne die leeren Straßen in der Hoffnung, wenn ich lange genug geschaut habe, werden Laurens und Pim aus den Collagen alter Erinnerungen auferstehen. Nach einer Stunde sind die Süßigkeiten alle. Meine Mundhöhle brennt von der Säure. Mein Magen ist schwer. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Es könnte sein, dass sie versucht haben, mich anzurufen.
Ich fahre am Schlachterladen vorbei.
Laurens’ Rad lehnt nicht an der Hauswand. Vielleicht hat er neue Freunde oder Hobbys, von denen er mir nichts gesagt hat, vielleicht ist er weggefahren. Vielleicht steht sein Fahrrad heute einfach in der Garage, sieht er bei diesem Wetter lieber fern, als bei mir zu sein.
Durch das große Schaufenster spähe ich in den Laden. Der Pfarrer sucht Fleisch- und Wurstwaren aus. Er deutet auf die Schinkenwurst. Laurens’ Mutter klatscht den Klumpen auf die Schneidemaschine. Durch die offene Ladentür höre ich, wie die Messer sich langsam bewegen. Das Schneiden von Fleisch hört sich nicht nach Zertrennen an, sondern nach Zerfasern.
Laurens hatte recht. »Eine Kuh besteht aus einer Million Fasern«, hat er einmal während der Mittagspause in der Schule gesagt, während er aus dem schwammigen Teil seines Brots Kügelchen formte, ein Stück Wurst in Fasern auffieselte und jedes Bällchen einzeln damit belegte. »Wenn du das erkannt hast, findest du es nicht mehr schlimm, sie zu zerschneiden.« Das hörte sich nicht wie etwas an, was er sich selbst ausgedacht hat, aber dass er es behalten hat, fand ich auch schon stark.
Laurens’ Mutter zuzuschauen beruhigt mich fast immer. Sie redet vom Wetter, das kurz vor dem Umschlagen ist, das sehe ich daran, wie sie ihre Hände bewegt. Dann stapelt sie einzelne frische Salamischeiben auf die Waage.
Hier, mit Blick auf den Pfarrer, der das Fleisch begutachtet und bezahlt, überkommt mich ein Trübsinn, der schon eine Weile weggeblieben war und von dem ich dachte, hoffte, er sei vielleicht für immer verschwunden.
Inzwischen weiß ich, dass nichts gegen dieses Gefühl ankommt. Es kommt, wenn ich rechtzeitig auf einem Stuhl in der richtigen Klasse sitze, in einem Outfit, das alle an mir zu sehen gewöhnt sind, auch wenn ich dastehe und Fleisch betrachte, auch wenn ich nicht dastehe und Fleisch betrachte. Dann fehlt mir etwas. Alles. Als wäre ich einmal vollständiger gewesen und etwas in mir erinnerte sich noch an dieses Gefühl.
Es überkommt mich auch jedes Mal, wenn ich in der Badewanne stehe und mich wasche. Dann legt sich etwas auf meine Haut. Es schließt mich ein, spannt sich an, zeigt mir deutlich, dass ich mich am falschen Ort befinde.
Vielleicht ist das entstanden, weil ich kurz nach Zwillingen zur Welt gekommen bin, aus einer Gebärmutter, die noch etwas ausgeleiert war, dachte ich neulich. Vielleicht saß Mama die ersten neun Monate zu locker um mich herum.
Noch bevor Laurens’ Mutter merkt, dass ich sie beobachte, bin ich schon wieder aus ihrem Blickfeld verschwunden.
Das Gewitter bricht los, als ich auf dem Weg nach Hause bin. Die ersten Regentropfen sind lau. Das ist unvermeidlich, die letzten Tage kam sogar aus dem kalten Hahn warmes Wasser. Ich suche einen Baum, der mir Schutz bietet, stelle mich unter die Koniferen, die an unseren Garten grenzen, schaue zu, wie es rings um mich wütet. Windstöße brechen die Regenstrahlen.
Wir hätten Vater niemals Werkzeug schenken dürfen, schon gar keine Heckenschere. Seit zwei Jahren bereits hängt sie reglos unter dem Dach, die beiden Griffe plump nach unten. Wenn Wind weht, erwacht das Ding zum Leben. Vielleicht hat ihn das auf Ideen gebracht.
Zunächst hält das Nadeldach den Regen ab, doch schon bald sickern dicke, unregelmäßige Tropfen durch. Dass ich nass werde, ist nicht schlimm.
Vier Schatten
Wir waren zu dritt, hatten aber vier Schatten. Jolan, mein älterer Bruder, wäre Teil eines gesunden Zwillingspaars geworden, wenn seine Nabelschnur sich nicht um den Hals seiner Schwester gewickelt hätte.
Anlässlich ihrer Geburt ’85 – vier Wochen zu früh – wurden unendlich viele Fotos gemacht, die mit doppelseitigem Klebeband in ein Album geklebt wurden. Darunter Datum, exakte Uhrzeit, Namen unbekannter Onkel, Vermerke über hochfliegende Träume – scheinbar erreichbar, weil sie zum Teil nie realisiert zu werden brauchten.
JOLAN DE WOLF UND TES DE WOLF. Auf der Geburtsanzeige stand neben dem zweiten Namen ein kleines Kreuz, eine Todesanzeige wurde gespart.
Ungefähr zu der Zeit, als Jolan den Brutkasten verlassen durfte – so übertrieb Vater –, wurde ich geboren.
Das geschah irgendwann Mitte ’88, um Mitternacht. Ich war ein Mädchen. Mein Name war Eva. Auch ich kam allein. Vater war gerade draußen und rauchte.
Im Vergleich zu Jolans kleinem, in der Entwicklung etwas zurückgebliebenem Körper war ich von Anfang an kräftiger. In meinem ersten Lebensjahr wurden höchstens fünfzig Fotos gemacht. Bei keinem davon standen Uhrzeiten, es kamen keine unbekannten Onkel und Tanten zu Besuch.
»Elefantenbeine« schrieb Vater unter das Bild, auf dem ich zum ersten Mal auf einem Topf saß. Aus den anderen Unterschriften glaubte ich ableiten zu können, dass sie erst später hinzukamen, und zwar, weil sie etwas zeitlich Befristetes benannten, bereits eine Auswertung der Situation enthielten. »Eva, hier noch ein Flachskopf.« Oder: »Januar, da konnte sie noch lachen.«
Drei Jahre später, ’91, folgte Tesje. Von ihr machte Vater nur eine Handvoll Fotos, die nicht einmal mehr in einem Album landeten. Tesje war von Geburt an zarter und kleiner als wir. Sie hatte eine dünne, dichtgeäderte Haut und feine blonde Haare.
»Was willst du? Nach zwei Kindern war für sie nicht mehr genug Material übrig«, hatte Vater laut Mutter am Wochenbett gescherzt. Möglicherweise hatte das selbstbewusst klingen sollen, vielleicht war er von Emotionen überwältigt. Dennoch muss es sich für die Krankenschwestern nach einer Entschuldigung angehört haben, wie bei einer Frau, der das Gericht nicht ganz gelungen ist.
»Genauso hat mein Vater verdammt nochmal auch rumgetönt. Außerdem, du hast vier Kinder, nicht drei«, hatte Mama gesagt. An der Art und Weise, wie sie das immer wieder einmal aufs Tapet brachte und dann auch das »verdammt nochmal« wieder bemühte, wusste ich, dass es hiermit angefangen hatte. Dies war ihr Urvorwurf.
Der Namenswahl war eine lange Diskussion vorausgegangen: Mama wollte »Tesje«, Vater einen anderen Namen, am liebsten »Lotte«, notfalls »Lotje«. Letzten Endes fügte er sich aber doch Mamas Vorschlag, vielleicht in dem Versuch, etwas wiedergutzumachen. Tesje wurde ein Ehrenerweis.
Als sie zwei Jahre alt war, erhielt sie den Spitznamen »Scheißerle« – wobei das ß weich ausgesprochen wurde. »Scheißerle« war der Kosename für das jüngste Kind einer Familie, eine Bezeichnung, die Mutter aus ihrer Heimat mitgebracht hatte, aus einer Familie mit einem tyrannischen Vater, in der sie das älteste Kind war. Das Wort hatte etwas Tragisches – erinnerte an Meerschweinchen, die auf der einen Seite ihres Käfigs scheißen und auf der anderen schlafen. Uns war völlig klar, dass dieser Spitzname nicht aus Nostalgie entstanden war, sondern aus Reue über die Wahl von Tesjes Namen, was Mutter Vater gegenüber aber nicht zugeben wollte. Dennoch hatten wir ihn alle übernommen: Sprache war das Einzige aus Mutters eigener Kindheit und Jugend, worauf sie mit Stolz verwies.
Durch Tesjes Ankunft landete ich auf dem Mittelplatz in der Familie, wurde ich zu derjenigen, die sich bei der Bildung von Fronten immer noch auf jede Seite schlagen konnte, je nachdem, ob ich Koalition oder Opposition bilden wollte.
Noch vor Jolans Geburt waren Mutter und Vater von einem nahe gelegenen größeren Dorf nach Bovenmeer gezogen, in ein Haus mit drei Schlafzimmern.
Bovenmeer war eine jener Ortschaften, in denen es, damit Angebot und Nachfrage gut austariert blieben, von allem nur eines oder keines geben konnte: einen kleinen Laden, einen Friseursalon, einen Bäcker, einen Schlachter, kein Fahrradgeschäft, eine Bücherei, die man auf einen Rutsch auslesen könnte, eine kleine Grundschule.
Jahrelang sollten wir alles, was im Dorf zu finden war, mit »der«, »die« oder »das« bezeichnen, als gehörte es uns, als ließe es sich zwischen Daumen und Zeigefinger fassen. Als hätten wir nach einem langen Krieg gegen große Städte und umliegende Dörfer die Prototypen eines Krämerladens und einer Schlachterei erbeutet und diese dann fest in der Nähe der Kirche und des Gemeindesaals verankert, fußläufig von überallher, für jeden erreichbar.
Die Ladenbesitzer spielten mit; aus Bequemlichkeit oder Hochmut machten sie sich nicht die Mühe, sich einen originelleren Namen für ihr Geschäft auszudenken als »Die Schlachterei« oder »Das Lädchen«, in seltenen Fällen mit einem Zusatz versehen, dem eigenen Familiennamen.
Ein paar Ausnahmen gab es in Bovenmeer. Wir hatten zwei Kneipen. Oft verließen Männer »Die Nacht«, um nach kurzem Zögern, sich am Türpfosten hochziehend, doch noch »Willkommen« anzusteuern, wo in den frühen Stunden schon wieder Bier ausgeschenkt wurde.
Es gab häufig vorkommende Namen: Tim, Jan und Ann. Sowohl Pim als auch Laurens hatten einen Bruder, der Jan hieß, obgleich es ab dem Winter 2001 einen Unterschied bei diesem »haben« geben sollte. Laurens hatte da noch einen Bruder; Pim hatte lediglich einen Bruder gehabt.
Es gab einen leeren Hühnerstall, der »Kosovo« genannt wurde. Er lag genau zwischen »Willkommen« und dem Gemeindesaal. Monatelang hatte eine albanische Flüchtlingsfamilie darin gewohnt. Nachdem sie ausgewiesen worden war, brachten verschiedene Vereine dort ihren Krempel unter.
Mir war lange nicht klar, was Mutter und Vater in Bovenmeer finden wollten. Ob sie jemals geglaubt hatten, sie würden in einem Dorf zurechtkommen, in dem jedes Jahr Gemeindefeste organisiert wurden und sich niemand wunderte, wenn jemand in den Kosovo geschickt wurde, um eine Packung Servietten zu holen.
9.30 Uhr
Vor sechs Tagen, zwei Wochen nachdem die Einladung gekommen war, ging ich mit einer Curver-Box zu meinem Nachbarn und fragte, ob ich eine große Menge Wasser einfrieren dürfe. Der Mann wohnt nicht neben, sondern unter mir und ist daher nach seiner eigenen strengen Definition kein Nachbar, sondern ein Unterbewohner. Er ist zwölf Jahre älter als ich. Zufällig unterrichten wir beide: er Geographie und Biologie an einer französischsprachigen weiterführenden Schule, ich Kunsterziehung im niederländischsprachigen Schulwesen.
Wir wohnten beide schon vier Jahre in dem Haus, als wir das erste Mal miteinander sprachen. Er hatte an dem Tag, ungefähr ein Jahr ist es jetzt her, einen durchsichtigen Sack voll großer roher Fleischstücke dabei – ein Herz, ein Entrecote, Rinderfilet, Zunge, Rippchen, Suppenfleisch. Ich kam mit ein paar liegen gebliebenen Bastelobjekten auf dem Arm nach Hause, von Schülern, denen ich aufgetragen hatte, alte Atlanten zu zerschneiden und aus diesen Schnipseln ihre ideale Welt zusammenzustellen. Fast alle hatten die Bastelmesser und das Styropor ignoriert und sich mit einem beklebten DIN-A4-Blatt aus der Affäre gezogen. Die meisten hatten ihr Werk am Ende des Schuljahrs nicht einmal abgeholt.
Der Nachbar hatte mich angesprochen und aufgefordert, den Schülern besser beizubringen, akkurat mit den Fakten umzugehen, Respekt vor der Geschichte zu zeigen.
Ich gab vor, kein Französisch zu verstehen. Von dem Geruch, der aus seinem Sack drang, wurde mir übel.
Weil es ihm schwerfiel, mir Vorhaltungen auf Niederländisch zu machen, erzählte er mir stattdessen, woher er diese Mengen an rohem Fleisch hatte: Seine Mutter ließ jedes Jahr bei einem Biobauern ein ganzes Rind schlachten und teilte das Fleisch mit ihren drei Söhnen. Sie durften kommen und sich Stücke aussuchen. Es war die einzige Gelegenheit im Jahr, zu der seine Familie wieder mal vollzählig war.
Bevor ich ihn stehenließ und die Treppe zu meiner Tür hinaufging, sagte er noch, dass meine Absätze viel Krach auf dem Holzfußboden meiner Wohnung machten, dass er das aber nicht schlimm fände, weil es sich nach jemandem anhörte, der wusste, was er wollte.
Daraus hatte ich Folgendes geschlossen: Dieser Mann besaß ein großes Tiefkühlgerät und wenig Menschenkenntnis, insbesondere was Frauen anbelangt.
Nach einem halben Jahr wollte er nicht nur reden, sondern auch befriedigt werden. Das empfand ich nicht unbedingt als Plus, aber es störte mich nicht, solange er sich vorher wusch und ich meine Kleider anbehalten durfte.
In den zwei Wochen seit Erhalt der Einladung hatte ich für den Nachbarn und mich jeden Abend ein Stück Biorind aus seiner Tiefkühltruhe zubereitet. Da nun genug Platz frei geworden war, brachte ich die leere Curver-Box mit. Ich füllte sie mit Leitungswasser. Die Box passte so gerade eben in die Truhe.
Der Nachbar erhob keine Einwände und stellte keine Fragen. Dann säuberte er seine Eichel unter der Brause, zwischen Daumen und Zeigefinger, als schraubte er einen Deckel davon ab. Nachdem ich ihm einen geblasen hatte – er mit dem nackten Hintern auf dem Badewannenrand, ich mit den Knien auf dem Vorleger –, tranken wir schweigend Tee mit frischer Minze. Ich tat wie üblich sehr viel Zucker hinein.
Vor einer Stunde hat er mir geholfen, die schwere Box mit dem Eis aus seiner Tiefkühltruhe zu meinem Auto zu tragen. Draußen war es noch dunkel. Kurz vor dem Kofferraum blieb er einen Moment lang stehen und fragte in seinem mangelhaften Niederländisch, wo ich hinzufahren gedächte. Sein Blick wanderte über meine Beine, die dank der Strumpfhose makellos glatt und brauner als für gewöhnlich waren, über mein hochgestecktes Haar, meine getuschten Wimpern. Ich konnte spüren, dass er mich hübscher als sonst fand, hatte aber keine Ahnung, ob es daran lag, dass ich mir mehr Mühe gegeben hatte, oder daran, dass ich im Begriff war, mit einem großen Eisblock im Kofferraum wegzufahren, ohne anzugeben, wohin.
»Zu meinen Eltern«, sagte ich.
»Deinen Eltern«, wiederholte er, ihm ging erst jetzt auf, dass ich nicht vom Himmel gefallen war.
»Was meinst du, wie lange hält sich so ein Eisblock?«, fragte ich.
»Hängt davon ab, wie viel heiß du das Auto machst, und wofür du ihn brauchst«, sagte er.
Ich verbesserte ihm den sprachlichen Fehler nicht, so würde ich auch nicht weiter darauf eingehen müssen.
»Du kommst heute Abend wieder für Tee zu trinken?«, fragte er, während er die Box Eis mit einem Schwung in den Kofferraum hievte.
»Türlich«, sagte ich.
Ich sah zu, wie der Nachbar wieder ins Haus ging, seine mageren Beine, sein Rücken. Ich schaute noch lange, nachdem er verschwunden war.
Bevor ich den Motor anließ, wählte ich Tesjes Nummer, unterbrach die Verbindung aber, noch bevor es bei ihr klingelte, so dass sie den entgangenen Anruf nicht sehen würde. Rasch checkte ich die Facebookseite des Events. Die war ein paar Tage nach Eintreffen der Einladung angelegt worden, von Pim. Daran hatte ich mit Sicherheit erkennen können, dass er selbst das Ganze organisiert hatte und nicht seine Eltern. Auf der Seite stand, anders als auf der Karte, dass wir »ab« fünfzehn Uhr erwartet würden, nicht »um« fünfzehn Uhr. Typisch seine Ausdrucksweise. Leute daran hindern, pünktlich zu erscheinen, sich bereits im Vorfeld gegen mögliche Kritik wegen noch nicht gefüllter Chipsschälchen absichern.
Das Coverfoto zeigte dasselbe Babybild wie die Einladungskarte. Die Leute meldeten sich rasend schnell an. Ich hatte gewartet. Nach ein paar Tagen hatte ich mich bei »vielleicht« eingetragen.
Für kurze Zeit lebte die Seite auf, Freunde posteten Anekdoten und Fotos. Ich verfolgte jeden neuen Eintrag. Jan selbst hatte nie irgendwo ein Profil besessen – er war bereits tot, noch bevor er die Gelegenheit bekommen hatte, sich irgendwo besser darzustellen, als er in Wirklichkeit war. Darum taten andere das jetzt für ihn. Ausschließlich schöne, fröhliche Fotos von Jan tauchten auf, Fotos, von deren Existenz ich nichts wusste.
Meiner Meinung nach hatten alle auf der Seite sehr schnell angegeben, keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten zu wollen. Ein paar Tage nach dem Start starb das Ding schon wieder. Alle brauchbaren Fotos waren bereits geteilt.
»Hallo mein Name ist Karin Peters, bin 39 und komme aus Belgien. Der Grund warum ich Ihnen das alles erzähle ist, weil ich ein Produkt habe, das ich Ihnen anbieten kann. Es befinnt sich wörtlich in dem Zustand wo ich Ihnen beschreib!!!! bitte sofort zahlen. Mailen Sie mir Ihre Daten und ich schick Fotos!!« war der letzte Post. Er blieb oben auf der Seite stehen. In dieser Nacht habe ich ihn noch als anstößig melden wollen, aber ich führte die Prozedur nicht bis zu Ende durch, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was denn genau unangebracht daran war.
Ich habe nun die Hälfte der Strecke hinter mir. Die Verkehrsdichte nimmt langsam ab. Regelmäßig schaue ich in den Rückspiegel, kontrolliere den Eisblock. Die kalte Masse senkt die Temperatur im Auto beträchtlich. Ich fahre nicht zu schnell und schalte die Heizung nicht ein, um den Schmelzprozess nicht zu beschleunigen.
Auf dem Display meines Handys ist noch immer die Facebookseite des Events geöffnet. 45 Teilnehmer. Jolan ist auch eingeladen, Tesje ebenfalls, aber keiner von beiden hat sein Kommen bestätigt.
Ich bin noch immer die einzige »vielleicht«.
6. Juli 2002
Ich hebe die Decke hoch, um nachzusehen, ob sie noch da sind. Meine beiden Brüste könnten ja über Nacht, wenn niemand zuschaut, von meinem Leib verschwunden sein, auf der Suche nach einem geeigneteren, glaubwürdigeren Körper. Im Schlaf hat sich mein Tanktop verdreht. Meine Nippel lugen aus Hals- und Achselöffnung hervor.
Diese Brüste erinnern mich an Onkel Rudy, Vaters Bruder, der jedes Mal, nachdem er einen Raum betreten hat, hölzern stehen bleibt, obwohl ihn irgendwer immer auffordert, sich doch zu setzen. Wenn er dann sitzt, lehnt er sich nie an – so kann er mitten im Familienfest doch noch unangekündigt verschwinden.
Meine Brüste sind im Vergleich zu denen anderer Mädchen nicht richtig rund und hängen auch nicht, sondern sind spitz und stehen gerade ab. Wie kann ich ihnen sagen, dass sie gern bleiben dürfen?
Ich rücke das Tanktop wieder zurecht und bleibe bis halb elf im Bett. Ich lausche den Nachbarn, die vom Einkaufen zurückkommen, Rasenmähern, den Kirchenglocken, einem Flugzeug, einem Schrottjäger, der unverständliche Mitteilungen in ein übersteuertes Megaphon brüllt und dadurch nicht merkt, dass der Reichtum über seinem Kopf vorbeifliegt.
Beim Anblick des Betts, das Tesje hinterlassen hat, das dünne Oberlaken symmetrisch zur Form eines geöffneten Umschlags gefaltet, fühle ich mich formlos und unbestimmt.
Noch bevor ich das Esszimmer betrete, weiß ich, dass Vater dort sitzt. Überall wo er geht und steht, riecht es nach Tabak.
Erst kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass der Betrag, den ein Raucher pro Jahr für Zigaretten ausgibt, reicht, um davon in Urlaub zu fahren. Niemand hat untersucht, ob es auch Menschen gibt, die rauchen, um nicht mit ihrer Familie verreisen zu müssen.
Auf dem Frühstückstisch stehen noch ein paar Sachen. Brot, Schokocreme, Sirup.
»Deine Mutter ist zur Agrargenossenschaft, Hundefutter kaufen. Jolan ist früh weg, der will Vögel beobachten«, sagt Vater, ohne aufzuschauen. Er sitzt am Tisch, liest die Zeitung. In der Hand hält er einen Kugelschreiber. Heute lohnt nichts, unterstrichen zu werden.
Ich könnte mich entscheiden, nicht zu frühstücken, obwohl es keinen Unterschied macht; Vater wird das, was gestern geschehen ist, ja doch nicht mehr zur Sprache bringen, das macht er nie, morgens schon von Vergangenem sprechen. Dafür braucht er einen kleinen Schubs.
Ich setze mich. Vater schaut noch immer nicht auf. Neben ihm auf dem Tisch liegt ein auseinandergefaltetes Taschentuch und daneben ein fluorgrüner Läusekamm. Auf dem Taschentuch sind kleine rotbraune Punkte – plattgedrückte Leiber, ein paar ausgerissene struppige Haare mit daran klebenden Nissen.
»Wo ist Tesje?«, frage ich.
Vater klickt sein Gebiss rein und raus. Murmelt »irgendwo«, was ohne Schneidezähne klingt wie »nirgendwo«.
Ich nehme eine Brotscheibe und schmiere dick Sirup drauf. Trotzdem fragt Vater nicht, was das sein soll: »Brot mit Sirup oder Sirup mit Brot?«
Er hört auf, sein Gebiss rein- und rauszuschieben, und schaut auf mein Haar, meinen Hals. Ich lege mein Messer hin und greife nach der Schnitte, sie hängt durch unter dem Gewicht des Aufstrichs. Vaters Blick senkt sich, ruht auf meinen Armen. Je länger er schaut, umso schwerer werden sie.
Sogar an den heißesten Tagen trage ich gewöhnlich lange Ärmel. Die Einzigen, die nie ein Wort darüber verlieren, sind Laurens und Pim. Das letzte Mal, als ich mit bloßen Armen herumgelaufen bin, war vor drei Jahren. Es fühlte sich nicht leicht und frei an, nur schrecklich nackt.
Vaters Blick sinkt jetzt noch tiefer, zu meiner Taille, klettert dann wieder nach oben, zu seiner Zeitung. Er nimmt einen Schluck lauwarmen Tee.
»In diesem Pulli sieht man gut, dass du Brüstchen bekommst«, sagt er.
Ich klappe mein Butterbrot zusammen. Der erste Bissen klebt mir am Gaumen und schmeckt nicht nach Birnensirup. Erst als das Telefon klingelt, traue ich mich, ihn hinunterzuschlucken.
Die drei Sekunden Stille nach dem Abheben verraten mir, dass es Pim ist. Es hat sie immer gegeben, und jedes Mal schäme ich mich wegen der Dinge, die ich ihm irgendwann von mir erzählt habe. In drei Sekunden kann man sich alles vorstellen, was man nur will. Obgleich die Stille auch einfach die Zeit sein könnte, die der Ton braucht, um sich durch die langen, dünnen Hochspannungsleitungen fortzupflanzen, die unsere Häuser miteinander verbinden.
»He, Pim«, sage ich noch bevor er selbst etwas äußert.
»Laurens und ich gehen heute zur Schule«, sagt er. Seine Stimme klingt rau. Ich weiß nicht, ob er in den Stimmbruch kommt oder nur einen Frosch im Hals hat. »Das war Laurens’ Idee. Aber wenn du willst, darfst du mit.«
»Wann?«, frage ich.
»Jetzt gleich«, sagt er.
»Soll ich dich abholen?«, frage ich. »Übrigens, Laurens sagt, du fährst eine Honda? Stimmt das?«
Pim ist einen Moment lang still.
»Die Honda hat ’ne Panne. Und abholen musst du mich nicht, kannst aber, wenn du willst.«
Ich fahre denselben Weg zur Grundschule wie noch vor zwei Jahren, mit dem kleinen Umweg über den Bauernhof. Pim wohnt abseits, auf der anderen Seite des Dorfs, ebenfalls am Rand. Wer eine Linie zwischen unseren Häusern ziehen würde, würde feststellen, dass die Gerade zwischen der Schlachterei von Laurens und der Schule im rechten Winkel dazu liegt, und trotzdem ist dieser Umweg für mich einfacher und selbstverständlicher als für Pim.
Früher füllte ich mir manchmal eine Trinkflasche mit Wasser, um diese zwei Kilometer gut zu schaffen. Jetzt, wo ich jeden Tag 24 Kilometer runterstrample, zu meiner neuen, weiterführenden Schule, scheint das Dorf lachhaft klein und die Grundschule lächerlich nahe.
Kurz bevor ich aus dem Bulksteeg biege, fahre ich an dem von Vater angenagelten Schild VERBOTEN WILD ZU PINKELN vorbei.
Natürlich wissen sie, dass das eine falsche Formulierung ist, dass stattdessen dastehen müsste WILDPINKELN VERBOTEN – sie sind nicht dumm, das weiß ich schon, aber jedes Mal, wenn ich daran vorbeiradle, kann ich nur hoffen, dass auch die Nachbarn das im Zweifelsfall zu ihren Gunsten annehmen.
Als meine Eltern dieses Haus kauften, war der Bulksteeg ein kleiner Sandweg, an dem drei Gärten lagen, ein Weg, der zufällig auch die Autobahnauffahrt mit dem Dorf verband. Er läuft genau zwischen unserem von einer Hecke umgebenen Garten und der Wiese der Nachbarn durch. Vor gar nicht so langer Zeit kamen Gemeindearbeiter und gossen den Teer darauf aus, der nach der Instandsetzung der Hauptstraßen übrig geblieben war. Der Weg wurde Meter um Meter befestigt, nicht mehr rückgängig zu machen, geeignet für Schleichverkehr. Obwohl drei Gärten an ihn grenzen, benutzen Wildpinkler immer unsere Hecke.
Habe ich den Bulksteeg hinter mir gelassen, geht es auf einer chausseeartigen Straße weiter, der am stärksten befahrenen des Dorfes. Hier darf man siebzig fahren, doch für gewöhnlich hält sich keiner daran. Die Geschwindigkeit der Autos kann ich inzwischen von meinem Bett aus schätzen. Während der Ferienzeit fahren die Leute langsamer.
Neben mir auf der Fahrbahn folgt mein Schatten, eine Spukgestalt, die mir nicht von der Seite weicht und nicht länger meine Konturen besitzt. An sich war mir das schon im letzten Schuljahr aufgefallen. Bestimmte Kleidungsstücke kniffen, Tops passten nicht mehr, Hosenknöpfe ließen sich mühsamer schließen. Meine Nippel waren erst eine Zeitlang rot und warm. Dann bildeten sich harte Scheiben darunter, die sich im Folgenden von den Rippen lösten, um für etwas Platz zu machen, was dazwischen wachsen konnte, etwas, das weicher war. Ich hatte von einem Tag auf den anderen gespürt, wie sie sich bewegten, und wusste nicht, was eher zutraf: dass sie plötzlich da waren oder dass sie mir plötzlich auffielen.
Jetzt, seit Vaters Bemerkung, gehören sie mir nicht länger allein, sondern markieren eine bleibende, bedeutsame Veränderung.
Ich nähere mich Pims Haus. Der Bauernhof liegt weit vom Straßenrand entfernt, die Einfahrt ist ungefähr zwanzig Meter lang, führt geradewegs zum größten Stall, ist ausreichend breit für schwere Geschütze, Mähdrescher, Pferdewagen, Kuhherden.
Halb verloren auf diesem breiten Stück Asphalt liegt eine Türmatte mit dem Wort WILLKOMMEN. Der Aufdruck hat sich abgetreten. Ich kann ihn vielleicht deshalb noch lesen, weil dies mal mein zweites Zuhause war.
Seit Jans Beerdigung habe ich Pim kaum noch gesehen oder gesprochen. Zu den Gemeindefesten ist er nicht gekommen, Geburtstage wurden nicht mehr gefeiert. Ein paarmal habe ich neben dem Hof haltgemacht, den Hund an der Leine, aber ich habe mich nie getraut zu klingeln. Jedes Mal fuhr ich wieder weg und beschloss, die Stille habe nichts zu bedeuten. Wir konnten nicht von einem Ende sprechen, solange der Sommer noch nicht vorbei war.
Ich spähe die lange Einfahrt entlang, auf der Suche nach einem Lebenszeichen.
Die Einfahrt überbrückt zum ersten Mal keine Entfernung, sondern Leere. Pim wartet nicht mit seinem Fahrrad im Vorgarten, wie er es früher tat, wenn ich kam, um ihn abzuholen. Ich traue mich nicht, einfach über den Hof zur hinteren Tür zu gehen, also nehme ich den Plattenweg zur Haustür, von der ich bis zum letzten Sommer geglaubt hatte, sie sei nur Zierde, sei nie dazu bestimmt gewesen, geöffnet zu werden, und daher ohne Angeln eingebaut worden. Der Vorgarten des Bauernhofs ist von einer violett-weißen Blume überwuchert, die nach Urin stinkt. Das konnte ich schon drei Häuser entfernt riechen. Die Steinplatten zwischen Straße und Haustür bilden eine schludrige Linie, wie ein Übergang, den die Natur selbst geschaffen hat.
Gerade als ich klingle, taucht Pim in der Einfahrt auf. Erst sein Vorderrad, dann sein Kopf.
»Die Klingel geht nicht«, ruft er. »Das weißt du doch inzwischen.«
Er stellt sich auf die Pedale, fährt langsam an, bis auch ich wieder auf dem Rad sitze. Bevor ich ihn eingeholt habe, tritt er fester und schießt vor mir los ins Steegeinde.
Die Entfernung beträgt exakt einen Kilometer. Das hat uns Juf Ria von der Grundschule mal während des Erdkundeunterrichts demonstriert. Mit einem geeichten Stock von einem Meter Länge ging sie mit uns vom Schulhof los, und nach tausendmaligem Anlegen der Messlatte landeten wir beim Bauernhof. Das hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Bei jeder Entfernung, die ich seitdem zurücklegte, zählte ich, wie viele Messlatten hineinpassten, und nach jedem Kilometer dachte ich: Jetzt hätte ich genauso gut auf dem Bauernhof sein können.
Den Weg mit Pim zurückzulegen geht schneller als mit irgendwem sonst. Er fährt immer ein kleines Stück vor mir, und wenn ich ihn einzuholen versuche, sorgt er wieder für Vorsprung.
Seine kräftigen blonden Locken wehen im Wind. Pim hat die Frisur, die jeder gern hätte. Schwer zu sagen, ob das daran liegt, dass man immer das Haar anderer Leute haben will, oder daran, dass sie wirklich gut aussieht.
Pim hat, wie ich, keinen Rucksack dabei. Er sorgt dafür, dass andere mitbringen, was er braucht. Das hat er schon auf der Grundschule getan: meine Karoblätter und Laurens’ Stifte benutzen. Neben Pims Kettenschutz kreisen seine sehnigen Knöchel, die in Socken stecken. Ich sehe erst jetzt, dass er sie auf links gedreht hat. Das Motiv, ein Gewirr durchgezogener Fäden, ist dadurch nicht zu erkennen. Es könnte sein, dass er die Socken schon ein paar Tage trägt. Dass er sie umgedreht hat, um sie nicht waschen zu müssen.
Pims Rücken verrät nicht, was er denkt oder fühlt. Er tritt nur in die Pedale. Vielleicht zu entschlossen für jemanden, der vor etwas über einem halben Jahr seinen Bruder verloren hat.
Nach ein paar Minuten gebe ich es auf, mit ihm mithalten zu wollen.
Es wird sowieso noch etwas dauern, bis wir wieder aufeinander eingespielt sind. Vielleicht ist das nicht schlimm. Wir haben noch den ganzen Sommer, und in der Ferne taucht Laurens auf, der Retter, der Spielverderber. Er steht mit seinem Rad auf dem Parkplatz des Schlachterladens neben dem Schild SOMMERANGEBOT: ALLES GRILLFLEISCH ZWEI PLUS EINS GRATIS.
Laurens’ Äußeres charakterisiert ihn vor allem aus der Ferne: ein breiter Rücken, eine große Nase, ein hoher Rindfleischanteil. Er bewegt sich plump und gleichgültig, wie ein Kind, das keine Lust hat, einen kleinen Auftrag zu erledigen, und ihn schlecht ausführt in der Hoffnung, dass Mutter die Sache doch wieder übernimmt.
»Ha, die Männer«, sagt er. Er trägt Socken mit aufgesticktem Wochentag am Rand. Rechts ist es erst Montag, links schon Freitag. Er dreht an der Gangschaltung, auf der Suche nach dem langsamsten Gang, mit schwerem Widerstand.
Pim bremst nicht, also gibt Laurens Gas, schließt in vollem Tempo zu uns auf. Auch ich habe Pim inzwischen eingeholt, aber zusammen mit Laurens verändert sich unsere Konstellation: Wir passen nicht länger auf diesen schmalen Weg mit den überhängenden Zweigen. Wir sind eine unteilbare Zahl, einer muss sich zurückfallen lassen. Pim ist es völlig egal, neben wem er fährt, noch lieber fährt er allein, das sehen wir, so war es früher auch, genau deswegen landete er schon damals in der Mitte, solange die Wegbreite dies zuließ. Wieder beschleunigt er, um vor uns zu fahren, Laurens folgt ihm. Ich schließe mich hinter ihnen an.
Pim, links, fährt im niedrigsten Gang. Laurens, rechts, im höchsten. Dadurch scheint es, selbst ohne Worte, als würden sie doch miteinander kommunizieren.
Jedes Mal, wenn Laurens den Kopf dreht, um zu Pim zu schauen, sehe ich die Schramme in seinem Gesicht, unter der Nase, dort, wo das Spannband an seinem Gepäckträger ihn vor einer Woche traf, an dem Tag, an dem ich ihn in der Schule stehenließ. Die Wunde heilt gut. Auf einer Seite hat sich die Borke gelöst. Sie steht fast im rechten Winkel von seinem Gesicht ab, ein falsch befestigter kleiner Flügel.
Pim fährt in Schlangenlinien vor uns her über den Schulhof, lockere Steinplatten klappern unter seinen Reifen. Er versucht, die Linien der Hüpfkästen nicht zu berühren. Ich weiche dem Gitter eines Gullys aus, der früher als zweidimensionales Gefängnis diente.
Ohne zu bremsen kommt Pim zum Stillstand, das Vorderrad an der roten Backsteinmauer der Schule, unter dem überdachten Pausenhof.
Ohne Schüler ist die Schule nichts weiter als ein Gebäude. In einem der Flügel wohnen zwei Nonnen. Sie haben diese Einrichtung einst gegründet und dürfen deshalb weiter auf dem Gelände wohnen. Außer für das Gießen der violetten Blumen in den Kästen auf dem Schulhof sind sie kaum mehr zu etwas nütze.
Als wir noch auf diese Schule gingen, lebte hier noch eine dritte, übereifrige Nonne. Sie schmierte Pausenbrote für Kinder, die ihre zu Hause vergessen hatten. Einzig und allein damit sie sich nützlich machen konnte, ließ jeder seine Brotdose gelegentlich daheim, sogar Laurens, der übermäßigen Wert auf die abwechslungsreichen Lunchpakete legte, die seine Mutter zusammenstellte. Sie versah ihn immer mit der dreifachen Menge an Keksen, wohl damit er sie mit Pim und mir teilte, doch das tat er nie.
Laurens und ich führen ungefähr die gleichen Manöver aus wie Pim, kommen links und rechts von seinem Rad zum Stehen, vor dem breiten Fenster auf der Vorderseite des Gebäudes. Die mattierte Scheibe gehört zum leeren Klassenzimmer des sechsten Schuljahrs.
Die Möbel stehen sortiert, Pulte links, Stühle, aufeinandergestapelt, rechts. Ich erkenne die Bank, die mal meine war, die mit der beschädigten Arbeitsplatte, etwas heller als alle anderen, Bein an Bein von Juf Emmas dunklem, schwerem Schreibtisch flankiert.
Die Klasse sieht genauso aus wie an unserem letzten Schultag, jemand hat sich große Mühe gegeben, eine Tanzfläche daraus zu machen. Das versetzt mir einen Stich, denn ich muss sofort wieder daran denken, wie Juf Emma uns das Abschiedsfest präsentiert hatte – »ein einmaliges Privileg für die drei Musketiere, die ich vermissen werde« –, und wie ich es hinterher geschafft hatte, ihr Leben zu verpesten.
Pim entdeckt rasch, dass die Tür zum Turnsaal nicht abgeschlossen ist. An sich nichts Besonderes – in Bovenmeer schreckt man Gauner für gewöhnlich durch Gastfreiheit ab. Wir spazieren ins Schulgebäude, ohne zu schleichen, ohne zu klettern, ohne zu wissen, was wir hier eigentlich wollen.
Laurens hüpft quer durch den Saal, wobei er die Knie abwechselnd mit steifen Bewegungen hochzieht, wie im Unterricht bei Meester Joris: ein altes, hohe Anforderungen stellendes Männchen im Trainingsanzug, das kein Schüler für fähig hielt, die von ihm gestellten Aufgaben selbst noch ausführen zu können, so dass sich auch keiner um die erwartete Perfektion scherte.
Pim nimmt schnell Anlauf, springt gegen die dicksten Matten, die an der Wand lehnen. Sie plumpsen mit lautem Knall auf. Als Erstes berührt der weiche Mittelteil den Boden, die Ränder folgen mit einigen Sekunden Verspätung, wie die Mundwinkel bei einem vorgetäuschten Lächeln.
Wir bauen eine Anordnung aus den gefährlichsten Geräten, die wir finden können, Material, das uns Meester Joris nie zu benutzen erlaubte. Springen vom Sprungbrett über den Lederbock auf das Trampolin, auf das nächste Trampolin, lassen uns mit einem Salto auf die dicke, weiche Matte fallen.
»Schön, Reise um die Welt«, sage ich.
»Nein, das ist schöner als Reise um die Welt«, sagt Pim.
Plötzlich läutet die Schulklingel. Schrill und lang gibt der Ton uns der Lächerlichkeit preis. Während der Schulzeit ist dies der Beginn einer fünfzehnminütigen Pause. Heute könnten wir endlos lange weitermachen, keiner, nicht einmal eine Nonne, würde uns erwischen.
Pim bleibt auf der Matte liegen. Ich lande mit einem missglückten Rad neben ihm. Er hebt zwischen Daumen und Zeigefinger sein verschwitztes T-Shirt an, lässt es los, die Luft stiebt davon, als der Baumwollstoff sich wieder an seine Brust schmiegt. Ich liebe den sauren Geruch seines Schweißes. Es muss auch der Geruch von Jans Anstrengungen gewesen sein.
Ich liege auf dem Rücken. Auch mir klebt das T-Shirt am Bauch. Ich sehe, wie Pim auf die Ausbeulungen meines Shirts schaut, was mir an sich nicht unangenehm ist, allerdings sehe ich plötzlich beim Gedanken daran, wie Vater sie heute Morgen als »Brüstchen«, nicht »Brüste« bezeichnet hat, und in Pims Blick, was er gemeint hat: Eigentlich habe ich noch immer keine richtigen Brüste. Die hier sind nur zur Hälfte welche, irgendwas zwischen Haben und Nicht-Haben.
»Was machen wir jetzt?«, frage ich. Ich schaue zu Laurens, erwarte aber keine Antwort von ihm.
»Ich muss nach Hause«, sagt Pim. »Ich fahre nach Lier.«
»Was machst du in Lier?«, fragt Laurens.
»Mama bei meiner Tante besuchen.«
»Wie geht’s deiner Mama?«, frage ich.
»Schlecht.«
Dagegen traut sich nicht einmal Laurens etwas zu sagen.
Pim steht auf und geht ohne ein Wort hinaus zu seinem Rad. Er sprintet davon, quer über den Schulhof. Laurens und ich schauen ihm nach, bis sein Rücken in Höhe des kleinen Klosters zu einem Punkt wird und erlischt.
»Man sieht es ihm nicht an«, sagt Laurens.
»Was hättest du denn erwartet zu sehen?«
»Ach, du weißt schon.«
Der Geräteaufbau im Turnsaal, der vor einer halben Stunde noch lebensgefährlich schien, ist jetzt nur noch ein Haufen Plunder.
Ganz kurz, aber doch lange genug, kann ich aus einem bestimmten Winkel in Laurens’ Wunde schielen, unter die Borke. Ich schaue schnell und vorsichtig, wie an Orten, an denen ich eigentlich nicht sein darf.
Die Haut ist wieder heil, rosa und schimmernd.
Wir schieben den Bock an die Wand und die anderen Geräte, bis alles wieder an seinem Platz steht.
»Ich fahr auch nach Hause«, sagt Laurens.
Wie er über den Schulhof schlurft, das Bein über den Sattel schwingt, wegfährt, verfolge ich von der Gymnastikbank aus, die gerade noch, in die Sprossenwand eingehängt, die Eigenschaften einer Rutschbahn hatte. Ich beobachte weiter, wie auch Laurens zu einem Punkt wird, allein schon weil es mir leidtäte, wenn er später, irgendwie, dahinterkäme, dass ich Pim nachgeschaut habe, ihm aber nicht.
Als Laurens endlich ganz verschwunden ist, spaziere ich in dem in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzten Saal umher. Dieser Nachmittag hätte genauso gut nicht stattfinden können. Die Wolken über dem Schulhof ziehen hastig vorbei, die Uhr im Turnsaal läuft unermüdlich. Wieder geht die Klingel. Ich weiß nicht, ob sie den Anfang von etwas ankündigt oder das Ende.
Drei Musketiere
Im Sommer 1993, kurz bevor Laurens, Pim und ich von der dritten Vorschulklasse ins erste Schuljahr wechseln sollten, wurde ein Brief an alle Lehrkräfte der Grundschule und an unsere sechs Eltern verschickt: die Einladung zu einer Versammlung, bei der alle anwesend sein sollten.
Während dieser Zusammenkunft trug die Rektorin, Beatrice, ihre Überlegungen vor: Wie konnte es sein, dass 1988 nur drei Kinder geboren worden waren? War der kalte Winter, der heiße Sommer oder der schwarze Montag im Oktober des Vorjahrs verantwortlich dafür, dass sich alle gebremst hatten, dass niemand zu einem Kind gekommen war? Ihre Schule war die kleinste im gesamten Kempen-Land, die Zahl der Schüler pro Klasse lag bei durchschnittlich zehn, in dieser Kleinheit bestand auch ihr größter Charme, aber – möglicherweise schob sie an dieser Stelle ihre Brille auf die Nase, womit deutlich war, dass sie keinen Widerspruch duldete – für weniger als eine Handvoll Kinder wurde keine Klasse aufgemacht.
Die einzige Lösung sei eine »Beistellklasse«: drei zusätzliche Pulte hinten im Raum. Die Lehrerinnen würden ganz normal unterrichten und diese drei Schüler mit entsprechend angepasstem Lehrstoff versehen, mal schwerer, mal leichter als für die Klasse, der die drei Bänke »beigestellt« würden.