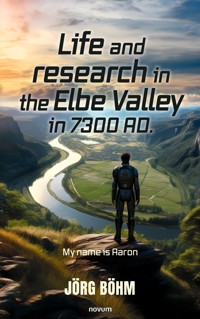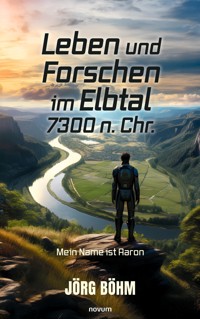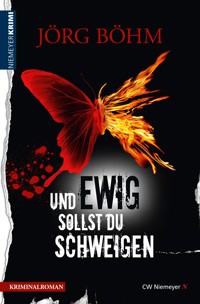7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
ER KENNT DICH. ER BEOBACHTET DICH. ER VERFOLGT DICH – BIS IN DEN TOD. Emma Hansens vierter Fall Kaum ist Emma Hansen nach ihrer längeren Auszeit wieder im Dienst, fordert eine mysteriöse Mordserie ihre volle Aufmerksamkeit. In der Vorderpfalz wurden zwei alleinstehende Junggesellen Anfang 50 bestialisch erstickt – mit Ostseesand. In der Hand hielten sie jeweils eine Muschel. Doch warum wurden sie auf diese sadistische Weise getötet und welches dunkle Geheimnis versteckt sich hinter dieser Botschaft? Als wenig später auch auf Bornholm eine berühmte Künstlerin mit Ostseesand ermordet wird, ahnt Emma, dass sie es mit einem perfiden Serientäter zu tun hat. Und dieser hat sein Werk noch lange nicht vollendet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Über die Autor
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Epilog
Danksagung
Jörg Böhm
Und süß wird meine Rache sein
Im Verlag CW Niemeyer sind bereits folgende Bücher des Autors erschienen:
Moffenkind
Und nie sollst du vergessen sein
Und die Schuld trägt deinen Namen
Und ich bringe dir den Tod
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2017 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
Der Umschlag verwendet Motive von 123rf.com
eISBN 978-3-8271-8325-5
EPub Produktion durch ANSENSO Publishing
www.ansensopublishing.de
Der Journalist Jörg Böhm (*1979) war nach seinem Studium der Journalistik, Soziologie und Philosophie unter anderem Chef vom Dienst der Allgemeinen Zeitung in Windhoek/Namibia. Danach arbeitete Jörg Böhm als Kommunikationsexperte und Pressesprecher für verschiedene große deutsche Unternehmen. Seit 2014 widmet er sich nur noch seinen schriftstellerischen Tätigkeiten. Neben dem 1. Kreuzfahrtkrimi „Moffenkind“, den er exklusiv in Kooperation mit der Reederei AIDA Cruises geschrieben hat, sind mittlerweile vier Krimis um seine dänisch-stämmige Kriminalhauptkommissarin Emma Hansen erschienen. Als bester Nachwuchsautor wurde er für seinen ersten Krimi „Und nie sollst du vergessen sein“ mit dem Krimi-Award „Black Hat“ ausgezeichnet.
Mehr über Jörg Böhm und seine Aktivitäten erfahren Sie unter jörgböhm.com
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
„Glück ist, das zu mögen, was man muss und das zu dürfen, was man liebt.“
Unbekannt
Für Heribert Stuppy – in Dankbarkeit
Prolog
8. Mai 1985
Sie wussten, was sie erwarten würde, wenn sie es nicht schafften. Es würde schlimmer werden als die Hölle, vor der die Alten immer so gerne warnten. Und auch wenn noch niemand aus dieser beschriebenen Hölle zurückgekehrt war, um über jene Gräuel zu berichten, so würden diese doch nichts sein gegen die Grausamkeiten, denen sie ausgesetzt sein würden. Man kannte eben keine Gnade mit ihresgleichen. Davon hatten sie längst erfahren.
Aber selbst davor fürchteten sie sich nicht. Denn sie hatten einfach keine andere Wahl. Sie mussten es tun. Das wussten sie, als sie sich noch einmal fest umarmten. Sie konnten die Entschlossenheit des jeweils anderen spüren. Den Willen, endlich frei zu sein.
Der Mond hatte sich hinter einer dicken Wolkendecke versteckt. Nur schwach konnten sie den Weg erahnen, der sich durch die Dünen, die Hagebuttensträucher und das sich sanft im Wind hin- und herwiegende Schilf schlängelte. Ihre Anspannung stieg, als sie den Dünenkamm erreichten und der Strand jetzt dunkel vor ihnen lag.
Seit Tagen war genau dieser Strandabschnitt zu ihrem zweiten Zuhause geworden. Sie kannten jede Bodenwelle, jede Unebenheit, eigentlich jedes Sandkorn, denn seit einer knappen Woche suchten sie genau hier nach den blau-schwarz schimmernden Miesmuscheln. Es war ihre Tarnung gewesen, um nicht aufzufallen.
Vorsichtig schauten sie sich noch einmal um. Der Strand war auch in dieser Nacht menschenleer. Nirgendwo bewegte sich etwas. Kein Lichtkegel einer Taschenlampe war zu sehen, kein Bellen eines Hundes zu hören. Sie waren ganz allein. Dann liefen sie in die Dünen. Als sie an ihrem Versteck angelangt waren, warfen sie die Decken zur Seite, ehe sie mit geübten Handgriffen die Faltboote zusammenbauten und sie anschließend zum Wasser trugen.
Die See war ruhig in dieser Nacht. Sanft verliefen sich kleine Wellen an den Strand.
Sie verstauten ihr Gepäck, das in kleinen Flaschen abgefüllte Trinkwasser und etwas Proviant in den Booten. Dann zogen sie ihre Schuhe aus und legten diese ebenfalls hinein. Das Wasser war eiskalt, als sie die Boote barfuß durch die schwache Brandung ins Wasser schoben. Aber sie spürten weder den aufkommenden Wind noch die Kälte an ihren Füßen, die langsam immer höher wanderte.
Als das Wasser ihnen fast bis an die Hüfte reichte, stiegen sie in die Boote und begannen, mit gleichmäßigen Bewegungen aufs offene Meer hinaus zu paddeln.
Um sie herum war tiefste Finsternis. Einzig die weißen Kreidefelsen hoben sich milchig vom schwarzen Passepartout aus Himmel, Meer und Küste ab.
Schweigend trieben sie die Boote immer weiter auf die offene See hinaus. Sie würden einen anderen Weg nehmen als den, den man ihnen empfohlen hatte. Dieser war zwar deutlich weiter und sie würden viel länger auf der offenen See sein. Aber hier würde man sie nicht suchen. So hofften sie.
Sie waren noch keine Stunde unterwegs, als der Wind mehr und mehr auffrischte. Die vormals ruhige, sich in sanft schaukelnden Wellen bewegende See zeigte jetzt ihr anderes, ihr raues Gesicht.
Mit dem Wind kam auch der Regen auf. Schutzlos den Salven ausgeliefert, klebten ihre Haare im Nu wie feuchte, kalte Lappen, die man vergessen hatte auszuwringen, an ihren Köpfen. Auch die Regenjacken, ihre Stritex-Pullis und die dünnen Skihosen, die sie wärmen sollten, boten längst keinen Schutz mehr. Sie waren nass bis auf die Haut. Und sie froren.
Hatte der Wetterbericht nicht etwas anderes vorausgesagt? Doch zum Fluchen war jetzt keine Zeit, als plötzlich zwei Lichtpunkte hinter ihnen auftauchten. Wie zwei springende gelbe Bälle.
Sie verharrten still und duckten sich tief in die Boote hinein, auch wenn sie wussten, dass das nicht mehr von Belang war, wenn man sie erst entdeckt hatte.
Also mussten sie weiterpaddeln, wollten sie nicht zurückgetrieben werden. Dahin, von wo sie gekommen waren. Und wo sie nie mehr hinwollten.
Sie mussten sich auf die gleichmäßigen Schläge konzentrieren, um gegen den immer stärker werdenden Wellengang anzugehen.
Er war allein in seinem Boot und hatte ein wenig den Anschluss an die kleine Gruppe verloren. Mit schnellen Paddelschlägen versuchte er, wieder zu den anderen aufzuschließen, als ihn eine Welle plötzlich seitlich erwischte und sein Boot zum Kentern brachte.
Er konnte sich gerade noch rechtzeitig aus dem Boot befreien, während er von den Wassermassen nach unten gezogen wurde. Gefangen in tiefster Finsternis verlor er völlig die Orientierung. Dennoch schaffte er es irgendwie, sich durch den eiskalten Wasserstrudel zurück an die Oberfläche zu kämpfen.
Aber wo war sein Boot? Und wo die anderen? Auch die gelben Punkte waren verschwunden. Als hätte es sie nie gegeben.
Er schrie. Immer lauter. Bis er irgendwann kein Wort mehr herausbekam. Er ruderte wie wild mit den Armen, um sich irgendwie bemerkbar zu machen. Aber alles um ihn herum war dunkel. Schwarz. Wie tot.
Er tauchte kurz ab, als er meinte, eine weitere Welle in der Dunkelheit heranrollen zu sehen. Als er wieder aus der dunklen See auftauchte, sah er die anderen endlich. Sie hatten ihn gefunden!
Immer und immer wieder schrie er in die tiefe, dunkle Nacht hinein, damit sie ihn nicht noch einmal aus den Augen verlieren würden.
Und dann schwamm er um sein Leben.
Kapitel 1
30 Jahre später
Irgendwo auf der Autobahn A 8
Mittwoch, 8. April 2015
Die junge Frau kauerte in einer Ecke auf dem Boden und zitterte am ganzen Körper. Soweit sie das in ihrer Position überhaupt konnte. Das durchweichte Stofftuch in ihrem Mund, mit dem sie geknebelt worden war, schmerzte. Ihre Augen waren verbunden. Gefesselt an Händen und Füßen war sie an der Innenwand des Transporters angekettet worden. Wie ein räudiger Hund.
Es roch feucht. Oder vergoren. Nach Kohl und Zwiebeln. Genauer hätte sie den penetranten Geruch nicht beschreiben können. Auf jeden Fall würde sie nie mehr in ihrem Leben Weißkohl essen. Wenn es überhaupt noch einmal dazu kommen sollte.
Mit dem Knebel im Mund konnte sie kaum atmen. Sie versuchte mit schnellem Schlucken gegen den aufsteigenden Würgereiz anzukämpfen. Doch das Tuch war ihr so fest in den Mund gepresst worden, dass sie Angst hatte zu ersticken, wenn sie weiter würgen musste.
Sie versuchte sich zu beruhigen. Als sie sich wieder etwas gefangen hatte und gleichmäßiger durch die Nase atmen konnte, spürte sie erneut das Jucken, das wie Ameisensäure auf ihrem Nacken brannte und das sie bereits seit mehreren Stunden schier wahnsinnig machte. Doch ganz gleich, wie sie sich auch drehte und bewegte, sie schaffte es einfach nicht, die obere Rückenpartie an der Innenwand des Fahrzeugs entlangzuscheuern, um so endlich Linderung zu erfahren.
Sie hatte Durst, und sie schwitzte. Es war heiß und stickig in dem Transporter, in dem sie seit mindestens 24 Stunden gefangen war. Wenn nicht sogar schon länger. Sie hatte das Zeitgefühl verloren, seitdem sie hier eingesperrt worden war.
Dabei hatte sie doch die Hölle endlich hinter sich gelassen. Das Heulen der Sirenen, wenn der nächste Luftangriff auf die Stadt zu erwarten war. Die Gasbomben, die in die Bunker und Keller geworfen wurden, in denen sie Schutz gesucht hatte. Oder wenn wieder eine Einheit der IS-Terroristen durch die Straßen zog und alles „säuberte“, was ihnen „unrein“ erschien. Wobei säubern in Wirklichkeit abschlachten bedeutete.
Sie würde diese Bilder nie mehr aus ihrem Kopf bekommen. Die Bilder jener Gräuel und die erbärmlichen Schreie, wenn wieder ein Andersdenkender oder Ungläubiger den Umarmungen seiner Familie entrissen wurde, um wenig später auf dem Marktplatz als Mahnung an alle anderen enthauptet zu werden. Oder gesteinigt. Oder lebendig verbrannt.
Die Schreie verschwanden nie. Sie waren der Takt, der seitdem ihr Leben bestimmte. Wie das Ticken einer Uhr. Gleichmäßig, verlässlich, unumkehrbar.
Sie erinnerte sich heute noch, wie ihr Bruder eines Tages zu ihr in die provisorisch eingerichtete Küche gekommen war. Schon der Blick in seine Augen hatte ihr damals verraten, was er von ihr wollte. Und dass es für sein Vorhaben keine Alternative gab.
Sie wohnten immer noch im Haus ihrer Eltern in einem südlichen Vorort von Rakka, auch wenn nur noch zwei Räume wirklich bewohnbar waren, nachdem mehrere Granateneinschläge den ersten Stock sowie den vorderen Bereich des Hauses zerstört hatten. Bei einem dieser Angriffe waren vor wenigen Wochen ihre Eltern getötet worden.
Mit der Trauer im Herzen und einer ungewissen Zukunft vor Augen hatten sie und ihr Bruder versucht, das Haus, soweit es ging, wieder aufzubauen. Doch es fehlte an schwerem Gerät, um das eingestürzte Obergeschoss abzutragen. Steine und Mörtel waren seit Kriegsbeginn kaum zu bekommen. Und sie hatten zu wenig Geld, um jemanden zu engagieren, ihnen zu helfen. Viele ihrer Verwandten und Freunde hatten die Stadt längst verlassen, weil es nahezu keinen Tag gab, an dem keine Mörsergranaten auf die Stadt niedergingen. Oder die Islamisten mit einer weiteren öffentlichen Hinrichtung für Angst und Schrecken sorgten.
Das Wohnzimmer war seitdem der Raum, in dem sich ihr gesamtes Leben abspielte. Hier schliefen sie und schauten fern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein oder trafen sich ab und zu und nur unter strengster Geheimhaltung mit einem entfernten Onkel oder einem Freund ihres Bruders, um wenigstens für ein paar Stunden mit einem Brettspiel oder leisem Gesang der Hölle des Tages zu entfliehen.
„Heute Nacht ist es so weit!“, hatte ihr Bruder zu ihr gesagt, während sie gerade dabei war, das Hühnchen, das sie mit viel Geschick auf dem Markt ergattert hatte, zu rupfen, um es anschließend zu zerteilen und in der Pfanne über der Kochstelle im Boden zu braten. Früher hatten sie eine voll ausgestattete Küche gehabt, mit Gasherd, Mikrowelle und einem Kühlschrank. Früher. Heute war das Loch im Boden ihre Feuerstelle, die einzige Möglichkeit, einen Topf oder eine Pfanne zu erhitzen.
Sie hatte ihn mit ihren großen rehbraunen Augen angestarrt, während sie dem toten Tier weiter die Federn ausriss.
„Wir müssen vorher noch etwas essen“, hatte sie nur geantwortet. Auch dieser eine Satz schoss ihr jetzt, gut zwei Wochen später, wieder ins Gedächtnis zurück, als würde sie die damalige Szene in ihrem Elternhaus gerade wieder erleben.
So hatte sie dann das beste Abendessen seit Langem gekocht. Fatet Dajaj. Hühnerfleisch mit Joghurt und Reis. Es war nicht einfach gewesen, auf dem Markt ein Huhn zu bekommen. Aber sie hatte ihre letzten Ersparnisse zusammengekratzt, um sich und ihrem Bruder ein finales Festmahl zuzubereiten.
Sie hatte noch abgewaschen und das Geschirr weggeräumt. Kurz nach 23 Uhr hatten sie ihre Taschen geholt, die sie bereits seit Wochen für diesen einen Tag gepackt hatten. Sie wollten gerade das Haus durch die schmale Tür, die auf den Hinterhof führte, verlassen, als sie plötzlich stehenblieb.
„Was hast du?“, hatte ihr Bruder gefragt. Er nahm sie in den Arm, als er sah, wie ihr die Tränen die Wangen hinunterliefen. „Es wird alles gut werden. Das verspreche ich dir. Komm jetzt“, waren die letzten Worte, die sie in ihrem Elternhaus hören sollte.
Sie liefen, ohne sich auch nur noch einmal umzudrehen, in das Schwarz der Nacht hinein.
Immer mit der Angst im Rücken, von denunzierenden Nachbarn, die mit der IS-Miliz sympathisierten, gesehen, von Patrouillen, die die Außengrenzen der Stadt kontrollierten, erwischt oder aus dem Hinterhalt einfach kaltblütig erschossen zu werden.
Noch nie in ihrem Leben war sie so schnell gelaufen wie in dieser Nacht. Nach knapp zehn Kilometern hatten sie endlich den Treffpunkt erreicht, an dem ein großer Lastwagen bereits auf sie wartete. Mitten im Nichts, in einer Wüstenlandschaft, die lebensfeindlicher nicht hätte sein können und in der man allem und jedem ausgeliefert war, wenn man erst einmal entdeckt worden war.
Die Ladefläche war voll mit Menschen. Dort saßen verschreckte Frauen, die ihre verängstigten Kinder fest an sich drückten, kriegsgezeichnete Greise, die unentwegt Allah oder den Heiligen Vater anriefen, und junge Männer mit Kalaschnikows unterm Arm, die bereit waren, jeden zu töten, der sich dem Lkw näherte.
Sie sah noch, wie ihr Bruder dem Fahrer ein Bündel Geld zusteckte, dann fanden sie sich selbst auf der Ladefläche wieder, während der Fahrer den Motor anwarf und das Fahrzeug langsam und nur mit eingeschaltetem Standlicht in Bewegung setzte.
Die Fahrt dauerte lange, dabei war das rettende Ziel selbst von Rakka aus gesehen nicht weit entfernt. Kurz hinter der Kreuzung nach Tell Abiad, dem Grenzort zur Türkei, verließ der Lastwagen die Hauptstraße und bog rechts ab auf einen kleineren Schotterweg, der sie an die grüne und unbewachte Grenze zur Türkei bringen sollte, irgendwo zwischen Tell Abiad und Kobane.
„Ab da müsst ihr selber sehen, wie ihr weiterkommt.“ Das hatte ihnen der Fahrer erklärt, bevor er ihr auf die Ladefläche geholfen hatte. Aber dafür hatte ihr Bruder schon gesorgt. Das wusste sie. Sie waren frei und sie lebten.
Mit einem Lächeln auf den Lippen wurde sie jäh aus ihren Erinnerungen gerissen, als der Transporter plötzlich bremste.
Ja, damals hätte es in ihrem Leben kein schöneres Gefühl geben können. Doch hätte sie geahnt, dass die wahre Hölle erst noch auf sie warten würde, dann wäre sie niemals aus ihrer Heimat aufgebrochen.
Sie hörte, wie jemand die Wagentür öffnete und ausstieg. Sie schreckte zusammen, als die Tür donnernd zugeknallt wurde. Dann war wieder Stille. Totenstille.
Sie drückte sich noch tiefer in das schwarze Loch hinein, als wollte sie darin verschwinden. Sich unsichtbar machen. Doch dafür war vom Leben noch zu viel Körper übriggelassen worden.
Sie versuchte, leise zu summen, doch es klang wie das Wimmern eines geschlagenen Hundes, der schon seit Tagen nichts mehr zu fressen bekommen hatte.
Sie hörte, wie das Rauschen in ihren Ohren, das sie an den tosenden Bekhal-Wasserfall erinnerte, wieder stärker wurde. So laut, dass sie nicht mitbekam, wie jemand die hintere Ladetür des Transporters öffnete. Sie kniff die Augen zusammen, als das gleißende Sonnenlicht in den Laderaum flutete und sie blendete.
Es dauerte einige Sekunden, bis sich ihre Augen nach vielen Stunden schwärzester Dunkelheit an die Helligkeit gewöhnt hatten.
Ihr Blick wanderte nach vorne. Erst als sie in das entschlossene Gesicht sah, wusste sie, dass jetzt alles vorbei war.
Kapitel 2
Samstag, 2. Mai 2015
Er hätte alle Zeit der Welt gehabt, lebend davonzukommen. Hätte. Aber Achim Jahn war kein Mann, dem man so schnell Angst einjagen konnte. Der einfach abhaute, anstatt sich einer möglichen Gefahr zu stellen. Dafür hatte er selbst viel zu viel erlebt, und eigentlich war er derjenige, der anderen Respekt einflößte.
Und doch hätte er heute einfach auf sein Bauchgefühl hören, die Tür abschließen und über sein Handy, das neben ihm auf dem Nachttisch lag, die Polizei verständigen sollen, als er aus dem Schlaf hochgeschreckt war.
Das klirrende Geräusch, das sich nach dem Einschlagen einer Scheibe angehört hatte, war aus dem Verkaufsraum seines Hofladens gekommen, der sich gleich neben der Küche befand. Wie immer hatte er die Tür zwischen den beiden Räumen offen gelassen. Er lebte allein auf dem Spargelhof, und der Hofladen war seit mehr als zwölf Stunden geschlossen. Es gab also keinen Grund, den Verkaufsraum vom privaten Bereich durch das Schließen einer Tür zu trennen.
Er war jetzt hellwach. Sein Gehör tastete alles ab, wie das Sonar einer Fledermaus. Es war mitten in der Nacht, kurz vor halb drei. Achim schaute aus dem Fenster, während er sich aus dem Bett schwang. Draußen war nichts zu sehen. Nur tiefe, schwarze Dunkelheit.
Er lief zur Tür, nahm das Jagdgewehr vom Haken und huschte durch die Schlafzimmertür, die ebenfalls wie üblich offen stand.
Im Treppenflur war es still. Er hörte nur das monotone Brummen der Kühlung im Hofladen.
Er hätte immer noch umkehren und die Polizei rufen können. Doch er wollte niemanden unnötig zum Herumschnüffeln einladen, falls es ein Fehlalarm war. Es war einfach nicht gut, zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das war damals schon so gewesen, und daran hatte sich bis heute nichts verändert.
Er umklammerte das Jagdgewehr fester, während er sich vorsichtig die Treppe hinuntertastete. Die Waffe diente einzig und allein der Abschreckung. Und seinem eigenen Schutz. Bisher hatte er jeden Konflikt oder körperlichen Angriff wie ein Mann gelöst. Und überhaupt wusste er nicht mal, ob die Waffe überhaupt noch funktionieren würde. Er hatte sie vom Vorbesitzer gleich mit übernommen. Wie den Hof, die Spargelfelder und die Erntemaschinen.
Achim war ein Hüne von einem Mann. Trotz seiner 1,85 Meter und einem Körpergewicht von an die 100 Kilogramm schlich er lautlos die Marmorstufen der offenen Treppe hinunter. Der Flur des Erdgeschosses lag ruhig, wie schlafend, vor ihm. Zum Brummen der Kühlschränke gesellte sich nur das gleichmäßige Ticken der Standuhr im Wohnzimmer. Ansonsten hörte er absolut nichts. Mittlerweile hatten sich auch seine Augen an das Schwarz um ihn herum gewöhnt.
Schwach zeichnete sich links von ihm die Haustür ab, die er fest verschlossen hatte. Rechts führte der Flur an der Treppe entlang ins Wohnzimmer. Geradeaus ging es in die große Küche mit ihren zwei Türen, durch eine kam man in den Hofladen und durch die andere gelangte man in den Garten.
Die alte Terrassentür! Sie hatte einen großen Sprung, der sich wie ein Spinnennetz über das untere Drittel der Scheibe zog. Auch sie hatte er so übernommen, als er den Hof damals gekauft hatte. Er hatte sie schon längst erneuern wollen, aber irgendwie war immer etwas dazwischengekommen. Die Erweiterung des Anbaus für die neue Zugmaschine, die Renovierung des Badezimmers, das undichte Dach. Es wäre wirklich eine Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet die Terrassentür nun die Achillesferse seines Hauses sein würde!
Doch ein erneutes Geräusch ließ es nicht zu, dass er sich weitere Gedanken über die alte Tür machen konnte. Schon wieder vernahm er ein Klirren. Nur dieses Mal hörte es sich an, als würde jemand auf Glasscherben treten. Ein Geräusch, das perfekt zu dem Laut passte, der sich in seinen Schlaf geschlichen hatte.
Es war also jemand im Haus! Spätestens jetzt hätte er den Rückweg antreten und die Polizei rufen sollen. Doch stattdessen entsicherte er das Gewehr und schlich langsam weiter in Richtung Küche. Als er die Tür fast erreicht hatte, blieb er stehen.
Achim Jahn spürte, wie sich sein Puls fast überschlug. Jetzt bloß nicht die Kontrolle verlieren, dachte er und lehnte sich gegen die Wand. 21 ..., 22 ..., 23 ... zählte er in Gedanken langsam vor sich hin, während er versuchte, wieder gleichmäßig ein- und auszuatmen. Er wusste, er musste seinen Puls beruhigen und seine Muskeln lockern, wollte er den Einbrecher auf frischer Tat ertappen und ihn mit einem Angriff überraschen.
Als sich sein Herzschlag endlich wieder etwas gelegt hatte, gab er sich den alles entscheidenden Ruck und betrat vorsichtig die Küche.
Wie automatisch fiel sein Blick auf die offen stehende Terrassentür und das zerborstene Glas der Scheibe, das in Hunderten Splittern auf den Fliesen vor der Türschwelle verteilt lag.
Und dann ging alles ganz schnell. Die Faust krachte so plötzlich und unerwartet in seinen Magen, dass er schon gar nicht mehr mitbekam, wie er die Kontrolle über seine Knie verlor und sein gesamter Körper in sich zusammensackte. Das Gewehr fiel zu Boden und blieb mit einem lauten Scheppern auf den Fliesen liegen. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er versuchte, den Kopf zu heben, als ein weiterer Faustschlag seine Schläfe traf. Jetzt kippte sein Körper vollständig nach vorne.
Sterne flimmerten vor seinen Augen. Er hatte mittlerweile jeden Orientierungspunkt in seiner gewohnten Umgebung verloren. Wo bin ich?, fragte er sich, als der Sternenregen langsam nachließ. Langsam und äußerst mühevoll versuchte Achim sich aufzurappeln und wieder auf die Beine zu kommen, als ihn ein harter Tritt in die Rippen erneut auf den Boden schickte und sein Gesicht auf den Fliesen aufschlug. Er spürte, wie sein linkes Auge anschwoll. Seine Unterlippe war aufgeplatzt. Er wollte das Blut am Ärmel seines Schlafanzugs abwischen, als er von kräftigen Händen gepackt und nach oben gezogen wurde.
Der Angreifer schien ganz genau zu wissen, was er tat, als er das Licht einschaltete und Achim weiter in die Küche schob. Er zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte ihn darauf. Dann zerrte er ihm grob die Arme hinter die Stuhllehne und fesselte ihn mit einem Kabelbinder. Das Gleiche tat er mit Achims Fußknöcheln, die nackt aus seiner Schlafanzughose herausschauten. Die Plastikfesseln saßen so fest, dass sie in seine Haut schnitten.
„Wer ... sind ... Sie?“, fragte Achim, als sich sein Angreifer vor ihm aufgebaut hatte. Es schien, als würde sein Gegner lächeln, dabei trug er eine Strickmütze, die nur die Augen und zwei kleine Löcher in Nasenhöhe aussparte.
Doch sein Gegenüber machte keine Anstalten, ihm die Frage zu beantworten. Dafür ließ der Angreifer erneut seine Faust sprechen, die Achim mitten ins Gesicht traf. Achim Jahn hörte ein knöchernes Knacken, das nichts Gutes bedeuten konnte. Er war kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren.
„Was ... soll ... das?“, stammelte er und versuchte, den Schmerz zu lokalisieren. Sein Kiefer musste gebrochen sein. Oder seine Nase. Oder beides. Als er seinen Mund öffnete, um mehr Luft zu bekommen, merkte er, wie ihm Blut über die Lippen lief. Passierte das alles gerade wirklich? Und wer war dieser Mensch, der ihn gerade so zurichtete? Und der Freude daran empfand, ihn zu quälen?
„Bitte ... nicht! Ich will ... nicht ... sterben“, winselte Achim. Der Fremde stand mittlerweile hinter ihm. Er packte Achims Kopf mit beiden Händen, fast so, als wollte er den Schädel seines Opfers eindrücken, und riss ihn weit in den Nacken.
Achim Jahn hatte das Gefühl, dass nach seinem Kiefer und der Nase nun auch sein Genick gebrochen war, als ein stechender Schmerz die Wirbelsäule hoch- und runterlief. Er versuchte sich zu wehren, doch die Kabelbinder waren so eng gezogen worden, dass sie sich immer tiefer in seine Handgelenke rieben.
Der Angreifer kannte jedoch kein Erbarmen, als er ihm Daumen und Zeigefinger tief in die Wangen bohrte, während er Achim mit der Innenseite seiner Hand die Nase eindrückte. Der Schmerz der gebrochenen Nase durchfuhr Achims Körper, und Tränen schossen in seine Augen, während er versuchte, seine Qualen herauszuschreien. Aber heraus kam nur ein gurgelndes Geräusch, das verstummte, als der Fremde immer fester zudrückte.
Auch wenn sein linkes Auge längst zugeschwollen war, so konnte Achim den gefüllten Messbecher, den sein Gegner jetzt in der anderen Hand über Achims Kopf hielt, mit seinem rechten Auge klar und deutlich erkennen.
Panisch, hektisch und mit letzter Energie versuchte Achim, den Stuhl zu kippen und sich so aus dem Griff des Mannes zu befreien. Aber sein geschundener Körper hatte längst keine Kraft mehr, den Stuhl auch nur einen Millimeter zu bewegen. Er atmete immer hektischer und schneller, um wenigstens so noch ein bisschen Sauerstoff zu bekommen.
Doch der Fremde hatte den Becher bereits leicht gekippt. Achim konnte das frohlockende Lächeln in den Augen seines Feindes sehen, während sich der Inhalt langsam über seinen immer noch weit geöffneten Mund entleerte.
Kapitel 3
Montag, 4. Mai 2015
„Los geht’s!“, rief Emma Hansen laut aus und schob ein schon deutlich leiseres „Endlich“ schnell hinterher. Dann schaute sie ein letztes Mal prüfend in den Rückspiegel ihres schwarzen Minis, den sie zuvor auf dem Parkplatz des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen abgestellt hatte. Sie wurde von blauen Augen angestrahlt, die von einer fein geschnittenen Nase und einer breiten Denkerstirn eingerahmt wurden. Ihre Gesichtsfarbe war in den vergangenen Monaten deutlich blasser geworden, daher hatte sie sich heute etwas stärker geschminkt als gewöhnlich. Während sie sonst die Natürlichkeit ihres zarten Teints nur mit einem leichten Puder unterstrich, hatte sie heute Morgen gleich mehrere Lagen aufgelegt, den Wangenknochen mit Rouge etwas mehr Kontur gegeben und ihre dünnen, blonden Wimpern mit Mascara getuscht. Sie kramte in ihrer Tasche auf dem Beifahrersitz nach einem Lipgloss und zog sich zum wiederholten Male die Lippen nach. Sie wollte sichergehen, dass sie immer noch die Alte war. Zumindest was ihr Aussehen betraf. Und wenigstens für die Kollegen.
Dabei war sie längst nicht mehr die Alte, nach allem, was sie erlebt hatte. Anfangs hatte es nicht wenige Kollegen, Ärzte und Therapeuten gegeben, die sie als Kriminalhauptkommissarin längst abgeschrieben hatten. Die davon ausgegangen waren, dass Emma ihre Karriere an den Nagel hängen und sich fortan nur noch um ihren Pflegesohn Luiz kümmern würde. Die niemals für möglich gehalten hätten, dass sie nach dieser persönlichen Tragödie noch einmal zurückkehren würde. PTBS. Posttraumatische Belastungsstörung. Was für ein Begriff!
Aber Emma wäre nicht Emma, wenn sie so schnell aufgegeben hätte. Wenn sie für dieses Ereignis, und mochte es auch noch so unvorstellbar gewesen sein, ihre Prinzipien verraten hätte. Wenn sie daran zerbrochen wäre.
Und jetzt war sie also endlich wieder da! Es war ihr erster Tag seit neun Monaten. Einer gefühlten Ewigkeit.
Wenn sie ehrlich war, dann fühlte sie sich immer noch etwas müde. Und irgendwie ausgelaugt. Aber auch das sei ganz normal in ihrer Situation, hatten ihr die Ärzte in der Fachklinik für psychosomatische Erkrankungen in Malente versichert. Dort, in der Holsteinischen Schweiz, war sie als akuter Notfall eingeliefert worden, nachdem es bei ihrem letzten Fall zu einem dramatischen Aufeinandertreffen mit einem mehrfachen Mörder gekommen war. Der Mann hatte vor Emmas Augen das Baby ihrer Freundin Rike getötet, ohne dass Emma irgendetwas tun konnte, um das Leben des kleinen Mädchens zu retten. Danach war sie völlig zusammengebrochen.
„Lassen Sie es ruhig angehen“, hatte der Arzt in der Klinik zu ihr gesagt, als er sie vor genau drei Monaten entlassen hatte. Sie hatte dann erst einmal den sich über die Jahre angesammelten Resturlaub sowie die ihr bereits zustehenden zwei Wochen Urlaub des aktuellen Kalenderjahrs genommen – auch das gehörte zu einer geregelten Wiedereingliederung –, ehe sie dann vor zwei Wochen für einen Intensivkurs an die Landespolizeischule in den Hunsrück zurückgekehrt war. Die Theorie beinhaltete Polizeidienstkunde, elektronische Datenverarbeitung, Kriminalistik sowie Kommunikations- und Konfliktbewältigung bis hin zur Erstellung eines Täterprofils. In der zweiten Woche waren dann noch praxisbezogene Unterrichtseinheiten wie Selbstverteidigung, eine erneute Waffeneinweisung und das obligatorische Schießtraining dazugekommen.
Auch der psychologische Gutachter hatte ihr nach dem letzten Gespräch sein Okay gegeben, ebenso wie ihre Therapeutin Maya Kirscher-Kresch, die sie noch am Freitag vergangener Woche in ihrer Praxis aufgesucht und die ihr ebenfalls eine sehr gute Entwicklung bescheinigt hatte. Physisch wie psychisch.
Auch wenn sie als uneingeschränkt dienstfähig eingestuft wurde und alle Tests, Seminare und Gutachten souverän absolviert und bestanden hatte, wusste Emma, dass sie genau das ihrem Chef Joachim Hellmann, den Kollegen im Kommissariat und besonders ihrem Partner Matthias Roth jeden Tag aufs Neue würde beweisen müssen.
Und wie ich es euch zeigen werde, dachte sie entschlossen und nahm beherzt ihren braunen Ledershopper vom Sitz, öffnete die Wagentür und stieg aus. Sie sprühte vor Tatkraft, und sie wollte endlich wieder etwas tun. Sonst würde sie wirklich noch verrückt werden.
So hatte sie auch nicht vor, in den ersten zwei Wochen nur zwei Stunden täglich zu arbeiten, wie es der Plan der Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell vorsah. Danach sollte sie ihre Stundenzahl dann langsam steigern, mit dem Ziel, nach einiger Zeit wieder bei der Regelarbeitszeit von acht Stunden angelangt zu sein. Zumindest in der Theorie. In der Praxis arbeitete sowieso niemand auf der Dienststelle nur acht Stunden am Tag oder 40 in der Woche. Aber das war ein ganz anderes Thema.
Auch ihr Pflegesohn Luiz war nun kein Grund mehr, die Arbeit in der Prioritätenliste hinten anzustellen. Um ihn wurde sich seit dem Tag ihrer Einweisung in die Klinik aufopferungsvoll gekümmert, da Emma nicht imstande gewesen war, diese Aufgabe nach ihrem Zusammenbruch am Eiswoog auch nur annähernd zu erfüllen.
So war dann plötzlich alles ganz schnell gegangen und man hatte Luiz einen Platz in einem katholischen Kindergarten in Freinsheim gegeben. Auch dafür hatte sich ihr Chef Joachim Hellmann eingesetzt. Emmas Mutter war zwar in der Pfalz geblieben, während Emma in der Klinik war, um sich um den kleinen Luiz zu kümmern. Doch sie tat dies nicht für ihren Enkel. Luiz war der Sohn ihres Exmannes, und eine wirkliche Beziehung hatte sie zu dem Kleinkind nie aufgebaut. Und sie hatte es auch nicht wirklich vor. Ihre Mutter war eben genauso stur und dickköpfig wie sie selbst.
Marit Hansen hatte mehrfach in der Klinik angerufen und sich nach den Besuchszeiten erkundigt. Das hatte Emma von einer Schwester erfahren. Aber selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, hätte Emma nicht gewollt, dass ihre Mutter sie in der Klinik besuchte. Sie brauchte Abstand, von allem und jedem. Von den sicherlich gut gemeinten Fragen der Kollegen nach ihrem Wohlbefinden. Von den mitfühlenden Äußerungen ihrer Nachbarin. Dem ihr entgegenbrachten Mitleid der anderen Mütter im Kindergarten. Oder der zu erwartenden Überfürsorge ihres Partners Matthias, mit dem sie seit mehr als zwei Jahren das Büro teilte.
Und ganz besonders von ihrer Mutter.
Das dauernde Rumnörgeln an Emma und ihrer Erziehung des kleinen Luiz, ihre immerwährende Kritik an der Tatsache, dass Emma trotz ihres anstrengenden Vollzeit-Jobs den Sohn ihres toten Vaters großzog, nachdem Luiz’ Mutter plötzlich verschwunden und bis heute nicht wieder aufgetaucht war. Doch am meisten nervte Emma das Unvermögen ihrer Mutter, selbst Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Es war eben immer einfacher und vor allem ja auch so vertraut, das Opfer zu sein, anstatt Rückgrat zu beweisen. Ihre Mutter hatte es immer noch nicht gelernt, für sich und die eigenen Bedürfnisse einzustehen und den Kreislauf des bewährten Mantras „Alle sind gegen mich“ zu durchbrechen.
Und in genau diese Rolle werde ich mich nicht drängen lassen, dachte Emma selbstbewusster, als sie sich das vor wenigen Minuten noch eingestanden hätte, während sie den Flur des Kommissariats zu ihrem Büro entlanglief.
Die meisten Büros waren leer, auch Annegret Bender, die Abteilungssekretärin und gute Seele der Dienststelle, saß nicht an ihrem Platz. Einzig Joachim Hellmann hielt sich – mit dem Rücken zu ihr gewandt – in seinem Büro auf. Emma wollte gerade klopfen und die Türklinke herunterdrücken, als sie sah, dass er anscheinend gerade ein wichtiges Telefonat führte. Er drückte mit der linken Hand den Hörer fest an sein Ohr, während er mit der rechten Hand zur Bekräftigung seiner Worte wild gestikulierte. Dabei redete er ununterbrochen auf seinen Gesprächspartner ein, wie Emma bemerkte. Dann schaue ich später bei ihm rein, dachte Emma. Sie wollte Hellmann bei seinem Gespräch nicht stören.
Da weder Emma noch Hellmann viel Aufhebens um ihre Rückkehr machen wollten, hatten sie vereinbart, dass Emma erst gegen 10 Uhr ins Büro kommen sollte. Dann wären die meisten Kollegen bereits unterwegs, und sie könnte in Ruhe ankommen, ohne alle zehn Minuten mit Fragen über den genauen Hergang des Dramas, den Klinikaufenthalt oder ihre seelische Verfassung bombardiert zu werden.
„Schön, dass du wieder zurückkommst, Emma! Wir brauchen dich hier“, hatte Joachim Hellmann bei ihrem letzten Gespräch gesagt. So nachhaltig der Aufenthalt in der Klinik, die Nachsorge ihrer Therapeutin und das Auffrischen ihrer Kenntnisse an der Landespolizeischule auch gewesen waren, erst Hellmanns Worte hatten dafür gesorgt, dass sie ihre eigenen Zweifel ausräumen konnte. Sein Vertrauen in ihre Fähigkeiten war die Medizin, die sie so dringend benötigte, um vollständig zu genesen.
Wo ist denn Matthias, fragte sie sich, als sie ihr Büro betrat, das genauso aussah, wie sie es vor gut neun Monaten verlassen hatte. Nichts hatte sich verändert. Die beiden Schreibtische dominierten weiterhin den Raum. Auch der Aktenschrank und das Flip-Chart standen noch an derselben Stelle. Einzig die Orchideen auf der Fensterbank blühten und gaben der sonst kühlen Atmosphäre etwas Wohnlichkeit. Matthias schien sich also während ihrer Abwesenheit auch um die Pflanzen gekümmert zu haben!
Sie nahm das Handy aus ihrer Tasche. Vielleicht hatte er ihr ja via WhatsApp Willkommensgrüße geschickt, wenn er sie schon nicht persönlich willkommen hieß. Aber Fehlanzeige!
Enttäuscht legte sie ihr Smartphone wieder in ihren Shopper zurück. War das jetzt die Retourkutsche für seine unzähligen Anrufe und Nachrichten, die sie alle nicht beantwortet hatte? Aber nein, dieser Charakterzug passte nicht zu Matthias. Er war weder kleinlich noch nachtragend. Und es war ja nicht so, dass sie sich nicht über seine lieb gemeinten Lebenszeichen gefreut hatte. Aber sie hatte es einfach nicht geschafft, ihm zu schreiben, ihn zu sprechen oder gar Besuch von ihm zu bekommen.
Sie hatte sich abschotten müssen. Allein sein, mit sich und ihrem Gefühl, versagt zu haben. Ein Gefühl, das für Emma inzwischen in eine unumkehrbare Tatsache übergegangen war. Ein Versagen, das einem kleinen Kind das Leben gekostet hatte. Nur weil sie damals zu viel Nähe zugelassen hatte. Weil sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben schonungslos geöffnet hatte und ausgerechnet dem Mann, der sich später als kaltblütiger Mörder herausgestellt hatte, ihr dunkelstes Geheimnis anvertraut hatte. Wie hatte sie sich nur so irren können!
Emma ging zu ihrem Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. Erst jetzt fiel ihr auf, dass die Sitzhöhe ihres Drehstuhls verstellt worden war. Und am Garderobenständer aus Edelstahl hing ein hellblauer Blazer, der ebenfalls nicht ihr gehörte. Seit wann haben wir denn Praktikanten, fragte sich Emma und legte ihre Ledertasche auf den Rollcontainer, der neben ihrem Schreibtisch stand. Dann ging sie zur Fensterbank hinüber und kippte zwei der drei großen Fenster.
Sie sah auf die viel befahrene Straße hinunter. Die ersten Cabrios hatten bereits das Verdeck geöffnet. Die meisten Fußgänger brauchten längst keine Jacke mehr, und auf der Sonnenterrasse des Eckcafés waren schon um diese Uhrzeit fast alle Stühle besetzt. Seit Wochen kletterten die Temperaturen nahezu täglich über 20 Grad Celsius, und auch dieser Frühlingstag würde da keine Ausnahme machen.
Emma fuhr zusammen, als es an der Tür ihres Büros klopfte. „Guten Morgen, Emma. Schön, dich wiederzusehen“, wurde sie von Linda Meyer begrüßt.
Warum muss ich ausgerechnet ihr als Erstes begegnen, dachte Emma und streckte Linda mit einem leicht gequälten Lächeln ihre Hand entgegen, ohne sich ihre Enttäuschung jedoch allzu sehr anmerken zu lassen. „Hej! Und ich bin froh, wieder hier zu sein.“
Sie konnte nicht sagen, wie sie darauf kam oder woran sie es festmachen konnte, aber irgendwie wurde sie mit der jungen Hauptkommissaranwärterin nicht richtig warm. Sie hatten sich zum ersten Mal im vergangenen Jahr auf der Landesgartenschau kennengelernt. Linda war engagiert, vielleicht sogar etwas übermotiviert und absolut pflichtbewusst, fast schon pedantisch. Doch das war es nicht, was Emma an der 26-Jährigen störte. Es war die Art, wie sie mit Männern umging. Oder wie sie Männer behandelte. Linda tat immer wie ein kleines Mäuschen, das dringend von den großen starken Männern beschützt werden musste. Sie konnte sehr gut diesen bestimmten Blick aufsetzen, den Emma immer den „Bambi-Rehblick“ nannte. Linda wusste ganz genau, wann sie mit den Wimpern zu klimpern hatte, um das zu bekommen, was sie wollte. Ja, Linda war eine Meisterin darin, Männer um den kleinen Finger zu wickeln und sie für ihre eigenen Interessen einzuspannen. Und die Kerle merkten bei ihr oft noch nicht einmal, wie sie manipuliert wurden, wenn Linda ihnen das Gefühl gab, sie hätten eine Chance bei ihr.
„Du bist spät dran ... Wir haben alle schon um 9 Uhr mit dir gerechnet. Nun sind alle ausgeflogen. Ein vermisstes Kind in Neustadt, ein Auftragsmord in Frankenthal – das Übliche eben.“
„Und wie läuft es so in Landau?“, überging Emma Lindas Bemerkung. „Du hast dich verändert.“
Lindas vormals schulterlange Haare waren mit Extensions nicht nur verlängert, sondern auch aufgefüllt worden und hatten so mehr Volumen. Sie schien sich künstliche Wimpern aufgeklebt zu haben und war ebenfalls etwas stärker geschminkt als vor neun Monaten, wie Emma mit einem zweiten intensiveren Blick jetzt feststellte. Wobei stärker geschminkt fast noch untertrieben war. Denn Linda sah aus, als sei sie in einen Farbtopf gefallen. Ihre Augenpartie war nach dem aktuellen „Smokey eyes“-Trend dunkel geschminkt, die Lippen waren dafür knallrot angemalt und Stirn- wie Wangenpartie changierten dank mehrerer Lagen Rouge und Teintpuder zwischen Terracotta und Bronze.
„Die neue Frisur steht dir wirklich gut“, schob Emma schnell hinterher, dann zog sie ihre weiße Sommerjacke aus, die sie immer noch trug, und hängte sie neben den Blazer an den Garderobenständer.
„Danke.“ Linda lächelte etwas verlegen. „Ja, ich wollte mal etwas anderes ausprobieren und schau ...“ Linda zeigte Emma ihre linke Hand. „... ich bin sogar verlobt. Philip und ich heiraten noch diesen Sommer. Kleid und Schuhe sind schon ausgesucht.“
Aha, daher die Veränderung, dachte Emma und lächelte. Sie wollte gerade zu einem Glückwunsch ansetzen, als sie etwas roch. Nein, das konnte einfach nicht sein. Oder doch?
„Hast du eine Fahne?“, fragte Emma geradeheraus.
Linda schaute für einen kurzen Moment betreten zu Boden. Emma konnte förmlich sehen, wie sich Lindas Gedanken um eine adäquate Erklärung bemühten, die man ihr auch anstandslos abkaufen würde. Mit geschlossenen Augen versuchte Linda, gleichmäßig zu atmen und ihren kurzzeitig angestiegenen Puls herunterzuregeln. Nach wenigen Augenblicken schien sie sich endlich wieder gefangen zu haben, auch wenn die Farbe ihres Gesichts etwas anderes verriet, als sie Emma wieder ansah.
„Es war nur ein Bier, vielleicht auch zwei und ein Kurzer. Aber das war gestern Abend und ich war privat unterwegs. Das Dorf meines Freundes, äh, meines Verlobten feiert gerade Frühlingsfest mit Eierschießen, Bullenreiten und Spargelwasserwetttrinken. Und sonntags ist der Umzug. Den darf man nicht verpassen. Das ist nur einmal im Jahr, und da ist es eben etwas später geworden.“
„Du hast auch noch durchgemacht?“ Klinge ich wirklich schon so spießig, fragte sich Emma. Doch die Frage stand bereits im Raum.
Linda nickte nur. „Ich hatte es nicht vor ... Ich hätte sonst Urlaub genommen. Aber irgendwie habe ich völlig die Zeit vergessen. Und als es dann kurz vor sechs war, da dachte ich, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr hinzulegen. Also habe ich mich nur schnell umgezogen und bin dann losgefahren.“ Linda lächelte, dann hauchte sie in ihre Hände. Sie verzog angewidert das Gesicht, als sie die Innenseiten direkt vor ihre Nase hielt. „Bah, ist das eklig. Dabei habe ich mir heute Morgen dreimal die Zähne geputzt. Tja, wirklich geholfen hat es anscheinend nicht. Ich rieche immer noch wie eine Dorfkneipe bei der Fasnacht.“
„Willst du nicht lieber nach Hause gehen?“, fragte Emma, die immer noch nicht wusste, was Linda überhaupt im Kommissariat machte.
„Nein, das geht nicht ... Ich brauche eine gute Bewertung von Hellmann.“
„Von Hellmann?“
„Ja, nach deinem Ausfall ... ähm, sorry ... Also das K11 war ja unterbesetzt, und so hat Hellmann beim KDD angefragt, ob ich sein Team unterstützen kann, bis du wieder da bist.“
„Du warst schon beim Kriminaldauerdienst?“, fragte Emma und schaute ihr Gegenüber noch ungläubiger an, als sie es eigentlich vorgehabt hatte. Die gibt ja ganz schön Gas, dachte Emma und erinnerte sich, wie sie selbst damals als Jahrgangsbeste bereits in Ermittlungen einbezogen wurde, obwohl ihr dafür eigentlich noch die Erfahrung gefehlt hatte. Auch Emma war es damals möglich gewesen, ihre Zeit bei der Bereitschaftspolizei und auf Streife deutlich zu verkürzen. Ein knappes Jahr vor dem eigentlichen Ausbildungsende hatte sie schon beim Kriminaldauerdienst angefangen, der letzten Abteilung vor dem K11. Nach nur einem weiteren Jahr hatte Hellmann sie dann ins Team geholt, was einer Adelung gleichkam. Alle, die zur Mordkommission wollten, mussten sich normalerweise auf einen langwierigen Bewerbungsprozess einstellen. Und dann musste überhaupt erst mal eine Planstelle im Kommissariat für Kapitalverbrechen frei werden.
Linda nickte erneut. „Ja, seit einem halben Jahr. Im K11 bin ich jetzt seit dem 1. Januar.“
„Also ist heute hier dein letzter Tag?“, fragte Emma und versuchte krampfhaft, ein Lächeln zu unterdrücken.
„Nein.“ Linda schüttelte so energisch ihren Kopf, dass ihre Haare hin- und herflogen. „Hellmann hat eine weitere Planstelle bewilligt bekommen, auf die ich mich bewerben will. Daher brauche ich ja auch eine sehr gute Beurteilung – und nicht nur von ihm“, sagte Linda und lächelte Emma milde an, die ihre junge Kollegin mit großen Augen anstarrte. „Du willst hier was?“
„Ich dachte, du wüsstest davon ...“