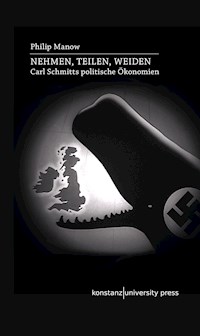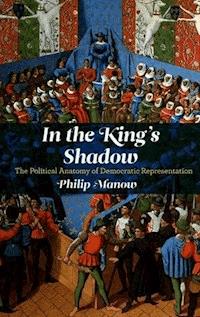17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit wann und aus welcher Interessenlage heraus ist der Begriff der liberalen Demokratie eigentlich politisch sinnfällig geworden? Und wie hängen unsere analytischen Konzepte mit den institutionellen Kontexten sowie mit den Konflikten zusammen, die sie bloß zu beschreiben vorgeben?
Philip Manow skizziert eine mit der jüngsten Entwicklung der politischen Institutionen sowie der dadurch ausgelösten Krise systematisch verwobene Begriffsgeschichte unserer demokratischen Gegenwart. Dabei deutet der Politikwissenschaftler die derzeitige Krise als Konsequenz der Epochenschwelle von 1989/90. Generell zeigt sich: Unsere Ontologien sind immer historisch und deswegen auch immer politisch. Dies gilt im Besonderen, wenn es sich um Ontologien des Politischen handelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
3Philip Manow
Unter Beobachtung
Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2796.
Erste Auflage 2024edition suhrkamp 2796Originalausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Textund Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77996-5
www.suhrkamp.de
Widmung
7Für Flynn
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
1. Warum wir die Demokratie, einschließlich unseres Verständnisses von ihr, historisieren müssen
2. Die Beobachtung der Demokratie
I
: Konzepte & Kontexte
2.1 Komplizenschaft: Warum unsere Begriffe nicht unabhängig sind von dem, was mit ihnen begriffen werden soll
2.2 Konkretionen – oder: Was leistet ein Begriff, wenn er abstrakt wird?
2.3 Konstitutionalisierung: In wessen Interesse liegt sie, etwa in dem ›der‹ Demokratie?
2.4
Known & Knowers:
Wenn die Objekte der Beschreibung sich zu ihren Subjekten machen
3. Die Beobachtung der Demokratie
II
: Kontrolle & Konflikte
3.1 Konkurrenz: Über das geänderte Verhältnis von Politik und Recht nach 1989/90
3.2 Kompetenzen und Kompromisse: Die Politisierung der Justiz als Folge einer Justizialisierung der Politik
3.3 Konfliktintensivierung:
Checks, but no balances
oder Wie Anreize zur wechselseitigen Disziplinierung von Politik und Recht in der
EU
systematisch ausgesetzt sind
3.4 Konspiration: Wenn die Erzählung von der Verschwörung gegen die Demokratie zu einer Verschwörungstheorie zweiter Ordnung zu werden droht
4. Die beobachtete Demokratie
4.1 Konstitutioneller Moment: Wie sich die liberale Demokratie ihren Anfang erzählt
4.2 Konsolidierung und Kanonisierung: Was der Menschenrechtsdiskurs der siebziger Jahre mit der liberalen Demokratie zu tun hat
5. Konsequenzen
Appendix
I
Appendix
II
Anmerkungen
1. Warum wir die Demokratie, einschließlich unseres Verständnisses von ihr, historisieren müssen
2. Die Beobachtung der Demokratie
I
: Konzepte & Kontexte
3. Die Beobachtung der Demokratie
II
: Kontrolle & Konflikte
4. Die beobachtete Demokratie
5. Konsequenzen
Appendix
I
Literatur
Dank
Informationen zum Buch
3
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
251
252
9
1. Warum wir die Demokratie, einschließlich unseres Verständnisses von ihr, historisieren müssen
Hat es eigentlich vor – sagen wir – 1990 Feinde der liberalen Demokratie gegeben? Die Frage mag überraschen oder irritieren, und vielleicht meine Antwort auf sie noch mehr, denn wie ich im Folgenden argumentieren möchte, sollte die Antwort lauten: Nein, die hat es nicht gegeben.
Die erläuterungsbedürftige Ausgangsfrage paraphrasiert den ersten Satz eines einflussreichen Aufsatzes des Philosophen Ian Hacking. Er beginnt seinen ursprünglich 1986 erschienenen Essay »Making up people« (»Leute erfinden«) mit der Frage: »Gab es vor dem ausgehenden neunzehnten Jahrhundert Perverse?« (Hacking 2006b [2002], S. 119) Nun sollen hier keine Parallelen zwischen ›Feinden der liberalen Demokratie‹ und ›Perversen‹ nahegelegt werden. Was aber heißt es, dass es solche Gruppen ›gibt‹? Was bedeutet es, dass es in bestimmten Gesellschaften zu bestimmten Zeiten Trauma, Teenager-Schwangerschaft, Anorexie, Adoleszenz, Fettleibigkeit usw. ›gibt‹? Es gibt keine menschliche Gesellschaft ohne Siebzehnjährige, aber nicht alle fassen sie mit Zwanzigjährigen zur Kategorie der ›Heranwachsenden‹ zusammen. Um also herauszufinden, was eine Gruppe wie eben die der ›Feinde der liberalen Demokratie‹ ist, muss man nicht nach ihren Merkmalen fragen, son10dern nach den Beobachtungen, die sie überhaupt erst erzeugen. Mit dieser Art des Fragens eröffnet sich daher die Möglichkeit, über die Geschichtlichkeit unserer Begriffe und Konzepte und die Konsequenzen der mit ihnen jeweils erfolgten Gegenstandskonstituierung nachzudenken.
Die Antwort auf die Frage, ob es vor dem Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich Perverse gegeben habe, fällt bei Hacking (wie bei Arnold Davidson, auf den er sich an dieser Stelle bezieht) negativ aus: Nein, es gab sie nicht. »Perversion war keine Krankheit, die in der Natur lauerte und auf einen Psychiater wartete, der mit einem besonders scharfen Blick gesegnet war und entdeckte, dass sie überall verborgen lag. Es war eine Krankheit, die durch ein neues (funktionales) Krankheitsverständnis erschaffen wurde.« (Davidson 2001, S. 24) Es hat ohne Zweifel zu jeder Zeit Menschen mit abweichendem, bizarrem (Sexual-)Verhalten gegeben, aber die Kategorie des ›Perversen‹, die ›Perversion‹ als Krankheit, der ›Perverse‹ als kranke Person, sie sind allesamt ein Konstrukt eben jener Zeit, des späten 19. Jahrhunderts, das entlang der zentral werdenden Kategorien ›abweichend‹ und ›normal‹ unzählige Unterscheidungen trifft.
Exakt so verhält es sich mit vielen anderen uns heute ganz selbstverständlich erscheinenden Kategorien. Man konnte zum Beispiel auch erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts im Sinne einer Person, eines Typus von Person, ›homosexuell‹ sein (wie man deswegen auch erst ab dann im eigentlichen Sinne ›heterosexuell‹ sein konnte). Bekanntlich sind gleichgeschlechtliche Praktiken alt, aber the making of the modern homosexual (Plummer 111981) bleibt dennoch ein Ereignis, das erst vor Kurzem, vor etwa 140 Jahren stattgefunden hat.
Doch was bedeutet das für unseren Kontext, für die Diskussion über die aktuelle Krise der (liberalen) Demokratie? Ich möchte argumentieren, dass die Frage, ob es vor 1990 Gegner oder Anhänger der liberalen Demokratie gegeben habe, tatsächlich so verneint werden muss, wie es Hacking in Bezug auf die von ihm gestellte Frage tut: Nein, es hat sie nicht gegeben. Und zwar aus dem analogen Grund, weil es die liberale Demokratie weder als spezifische Vorstellung noch als distinktes institutionelles Ensemble gab. Selbstverständlich kannten auch schon vor 1990 einige Länder, um nur ein besonders prominentes Element (einer Vorstellung von) einer liberalen Demokratie zu nennen, Verfassungsgerichte mit Normenkontrollkompetenzen1 und damit sicher auch ›Gegner‹ dieser spezifischen Konstellation von Institutionen und Befugnissen. Zur explizit gemachten Modellvorstellung der liberalen Demokratie wurde dies jedoch erst später. Ebenfalls erst später hat sich dieses Modell institutionell in einer großen Anzahl von Ländern durchgesetzt. Und beide Entwicklungen hängen auf eine vertrackte Weise zusammen und hören nicht auf, die Konflikte unserer Gegenwart zu prägen.2
Man konnte sich also – zugespitzt formuliert – vor 1990 weder für noch gegen die liberale Demokratie entscheiden, sehr wohl aber für oder gegen die Demokratie. Ein Orbán ›vor seiner Zeit‹, der etwa in den 1970ern verkündet hätte, er strebe eine ›illiberale Demokratie‹ an, wäre wohl lediglich auf Unverständnis gestoßen. Ein solches Bekenntnis wäre eines ohne besonderes Provo12kationspotenzial geblieben, ein politisches Coming-out ohne Referenzpunkt. Dieser Referenzpunkt entstand erst im Kontext spezifischer politischer Konflikte und Brüche, er ist das Resultat einer beschreibbaren historischen Konstellation, in der die illiberale Demokratie als Antwort auf konkrete Problemlagen erscheinen konnte – wie das gleichermaßen zuvor für die liberale Demokratie galt.
Aber was ist zu gewinnen, wenn wir die Frage nach dem historischen Auftritt der Feinde der liberalen Demokratie im Kontext aktueller Krisendiagnosen stellen? Eine der Thesen dieses Buches lautet, dass der mögliche Gewinn einer solchen Fragestellung nicht weniger als die analytische Durchdringung der historischen Auftritts- und Erfolgswahrscheinlichkeit unterschiedlicher Demokratieverständnisse in konkreten Umgebungen mit benennbaren Akteuren in manifesten institutionellen Settings betrifft. Und dass dies die Voraussetzung dafür ist, unsere gegenwärtige politische Krise zu verstehen.
Es ließe sich hiergegen einwenden, dass die historisch differenzierende Unterscheidung von Verständnissen der Demokratie angesichts der ihr gegenwärtig drohenden Gefahren ein bloßes Spiel mit Worten sei. Hat es denn im 20. Jahrhundert nicht genügend ganz grundsätzliche Gegner der Demokratie gegeben, der Demokratie tout court – mit welchen Zusatzattributen wir sie sonst noch versehen mögen (Hanson 1989)?3 Und da unter einen solchen generischen Begriff der Demokratie dann ja auch liberale Spielarten fallen würden, müsste es doch schon immer auch Gegner der liberalen Demokratie ge13geben haben. Und überhaupt und noch grundsätzlicher: Ist es nicht eine in die Irre führende Differenzierung, zwischen Gegnern der Demokratie und Gegnern der liberalen Demokratie unterscheiden zu wollen, wenn für die überwiegende Zahl der Beobachter heute vollkommen evident ist, dass eine Demokratie entweder liberal oder gar nicht demokratisch ist, wenn der Begriff der liberalen Demokratie uns nun als Pleonasmus, der der illiberalen hingegen als Oxymoron erscheint?4
Exakt darum geht es aber gerade – um ein Verständnis der Zeitspezifik eines Konflikts, aus dem heraus die Konzepte geprägt werden und in dessen Kontext sie daher auch zu verstehen sind, verstanden werden müssen, sprich um die Zeitspezifik der Konzepte selber. Denn nur mit einer solchen Einsicht lässt sich über die Beschränkungen und Fixierungen vermeintlich unabdingbarer, starrer Konfliktlinien und Konfliktverläufe hinausgelangen. Anders formuliert: Es geht darum, das vorgeblich Selbstverständliche als das nur für eine gewisse Zeit als selbstverständlich Erscheinende auszuweisen, darum, die Naivität der unmittelbaren, der unvermittelten Anschauung hinter sich zu lassen – die unsere gegenwärtige Debatte über die Krise der liberalen Demokratie prägt. Denn der Satz, dass es sich bei der ›liberalen Demokratie‹ ja eigentlich um einen Pleonasmus handele, wäre um 1970 vermutlich genauso unverständlich gewesen wie Orbáns Satz von der ›illiberalen Demokratie‹.
Daher möchte ich der von Hacking inspirierten Ausgangsfrage folgen und darauf beharren, dass es sinnvoll 14ist, sie zu stellen und zu verneinen, dass sie also nicht nur einer akademischen Lust entspringt, Dinge, die doch eigentlich ganz klar und einfach liegen, unnötig zu verkomplizieren, vermutlich um des intellektuellen Distinktionsgewinns willen. Die Frage kann uns gerade dadurch, dass sie Zeiten und Konzepte auf zunächst kontraintuitive Weise gegeneinanderstellt, auf drei wichtige Umstände aufmerksam machen, die in der aktuellen Auseinandersetzung über die Krise der Demokratie und die Folgerungen, die aus dieser Krise zu ziehen sind, eine Rolle spielen sollten.
Sie macht uns erstens darauf aufmerksam, dass Demokratie sowohl als konkrete Herrschaftsform als auch als unser Verständnis von ihr immer nur historisch zu verstehen ist, eben nicht als abstraktes, zeitloses Konzept, nicht als eine spezifische Institutionalisierung selbst nicht historischer, weil überzeitlicher ›Werte‹, nicht als ein einmal vollständiges, einmal eher unvollständiges Ensemble unerlässlicher Institutionen und Regeln. Wichtiger noch: Wir erkennen, dass unsere ›Klassen‹ und unsere ›Klassifikationen‹ oftmals zugleich entstehen und sich wechselseitig beeinflussen.5 Die liberale Demokratie und unser Verständnis von ihr entstehen zusammen. Für die Demokratie gilt, was laut Hacking für alle unsere Konzepte gilt: Sie ist »historisch und in Entwicklung begriffen« (Hacking 2012 [1995], S. 35f.), und zwar institutionell und gleichzeitig ›begrifflich‹ in Entwicklung begriffen, und schließlich (um alles noch etwas komplizierter zu machen) in diesen beiden Dimensionen in politisch umstrittener und sich wechselseitig beeinflussender Entwicklung begriffen.
15Unsere Ontologien sind historisch und damit auch immer politisch. Versteht man das nicht, versteht man unsere gegenwärtigen Krisendiagnosen nicht – und damit auch nicht unsere gegenwärtigen Krisen. Die Erzählung von der Krise der Demokratie kam in die Welt, bevor es empirische Evidenz für sie gab (Levitsky/Way 2015). Erst im nächsten Schritt formierte und informierte sie die neuen Konzepte und Instrumente, an denen die Krise abgelesen werden sollte – und schließlich auch wurde.6 Kann man sagen, die Krise der Demokratie wurde erst erfunden und dann entdeckt (Kuhn 1996 [1962], S. 79)? Nirgends mehr als bei der Betrachtung der Politik gilt, dass »Wahrheit nicht außerhalb politischer Kämpfe lokalisiert und diesen entgegengesetzt werden« kann (Vogelmann 2022, S. 9).7 Inwieweit die politischen Konflikte der Gegenwart mit den Begriffen der Gegenwart verstanden werden können (wenn diese Begriffe sich wiederum vor dem Hintergrund gegenwärtiger Konflikte ausbilden), ist dann eine Frage, die nicht zu stellen lediglich darauf hinausläuft, dass man diesen Konflikten weiterhin verständnislos gegenübersteht.
Eine Historisierung unserer Konzeptionen öffnet den Blick auch dafür, dass ein neues Konzept jeweils neue Vergangenheiten hervorruft, retrospektiv neue Zuschreibungen impliziert. Briten, die lange von sich gedacht haben mögen, sie würden im Mutterland der Demokratie leben, mussten nach 1990 verwundert lernen, dass sie doch eigentlich bis vor nicht allzu langer Zeit – zumindest wenn man eine Verfassung und Verfassungsrechtsprechung zum Maßstab einer liberalen, reifen Demokratie nimmt – ›nur‹ in einer elektoralen Demokratie gelebt 16hatten (in die sie nach dem Brexit auch wieder zurückgefallen sind).
Zweitens werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass mit ›liberale Demokratie‹ dann doch etwas anderes beschrieben wird als einfach nur mit ›Demokratie‹. Und dass das, was der Begriff beschreibt, erst vor Kurzem und nicht von ungefähr in die Welt gekommen ist – wodurch die Möglichkeit in den Blick gerät, dass die liberale Demokratie sich ihre Feinde erst erschaffen haben könnte. Das wäre eine neue und überraschende Antwort auf die Frage, warum es heute so viele von ihnen gibt (und ihre Zahl täglich zuzunehmen scheint). Erweitert sich das Institutionenensemble, bekommen wir neue Akteurskonstellationen, ändert sich das politische Spiel – und aus diesem veränderten Spiel heraus entstehen dann auch die neuen Konflikte sowie die neuen Begriffe und Konzepte.
Um es abermals zu konkretisieren: Mit einem Verfassungsgericht formieren sich im Regelfall früher oder später Gegner eines Verfassungsgerichts, etwa solche, die gegen einige seiner politisch zentralen Entscheidungen mobilisieren (siehe »Roe v. Wade«). Man erschafft aber auf alle Fälle einen eigenständigen Akteur mit einer eigenen Agenda und einem ›Interesse an sich selbst‹.8 Dieses Interesse mag politisch unterschiedlich effektiv begrenzt werden können (Stone Sweet 1992, 1996; Vanberg 1998, 2001, 2005a, 2005b), aber es besteht immer. Ein Verfassungsgericht, mit der Aufgabe, die Demokratie zu schützen, vor den Anti-Demokraten, ändert damit zugleich diese Demokratie, und nicht notwendigerweise zum Demokratischen (Waldron 2006, 2016a). Die 17wehrhafte Demokratie steht vor dem Problem eines performativen Widerspruchs: »demokratische Verfahren zu perfektionieren, indem man demokratische Institutionen lähmt« (Gardbaum 2001, S. 754).9 Damit aber stellt sich neben die dominant gewordene Erzählung von der Gefährdung, die der Demokratie durch die rohe, uneingeschränkte Dynamik des Politischen (den Demos, den Populismus) droht, eine weniger prominente, aber deswegen nicht minder plausible, nämlich die von der Gefahr des Umschlags bei der Einschränkung des Politischen im Namen seiner umfassenden institutionellen und rechtlichen Beschützung und Begrenzung – gegen die die Populisten zunehmend aufbegehren.
Erst mit dieser erneut historisierenden Perspektive wird diese mögliche Ironie im Verhältnis zwischen der Ausweitung demokratischer Schutzzonen und der Ausweitung politischer Kampfzonen erkennbar. Einem enumerativ-institutionellen Verständnis von Demokratie muss diese Ironie ebenso entgehen wie einem normativ-ableitenden und einem auf ein Idealmodell hinauslaufenden – und zwar weil sie es versäumen, eine Vorstellung der akteurtheoretischen Implikationen eines konkreten Institutionensettings mit Namen ›liberale Demokratie‹ zu entwickeln, eine Vorstellung, die das entsprechende Konfliktpotenzial zwischen spezifischen Akteuren einschließt (Warren 2017). Keine dieser drei Herangehensweisen bekommt strategisches, adaptives Akteurshandeln in den Blick, und damit auch nicht die Möglichkeit, dass das, was heute als ›Krise der Demokratie‹ erscheint, wesentlich als Folge ihres letzten großen Triumphs in den späten 1980er und den 1990er Jahren verstanden wer18den könnte, weil die Demokratie im Zuge dieses Triumphs eine sehr spezifische, konstitutionalistische Gestalt angenommen hat (siehe Abschnitt 3 unten).
Drittens schließlich lenkt die Ausgangsfrage die Aufmerksamkeit darauf, dass unsere Kategorisierungen der Politik immer und unvermeidlich politisch sind, allein schon deshalb, weil sie immer auf den Gegenstand selbst zurückwirken (können), sich dieser Gegenstand zu ihnen immer verhalten kann (»dynamischer Nominalismus«, Hacking 2006b [2002], S. 62), oft muss, sie übernehmen oder ablehnen und sie eigentlich nicht ignorieren kann, was dann die Beziehung zwischen ›Klassifikation‹ und ›Klasse‹ verändert, in sich wiederholenden Schlaufen (looping effects).
Eben das ist mit dem oben genannten Beispiel Orbáns angesprochen: Erst wenn die liberale Demokratie zur dominanten Vorstellung geworden ist, ergibt es Sinn, sich zu ihr zu verhalten, affirmativ oder ablehnend, so dass es auch erst jetzt politisch sinnvoll wird, für ein illiberales Gegenmodell einzustehen. Matteo Salvini lädt auf seinem Facebook-Account ein Selfie hoch, im T-Shirt mit der Aufschrift »Sono un populista«, »Ich bin ein Populist«. Offenkundig ist das etwas, was 2018 keiner weiteren Erläuterung bedarf, aber nicht notwendigerweise bereits 1978 gleichermaßen verstanden worden wäre – insbesondere nicht als positive Aneignung. Unsere Klassen und unsere Klassifikationen sind also nicht nur zeitlich, sondern auch kausal nicht voneinander unabhängig. Eine neue Normalität schafft neue Möglichkeiten und Tatbestände der Abweichung. Wir therapieren nicht mit Hinblick auf eine Krankheit, sondern mit Hinblick auf 19eine (sich aber historisch wandelnde) Vorstellung von Normalität (Foucault 1988, 1994 [1975]). Und das, was wir als Normalität definieren, bildet sich vor allem in den Konflikten mit dem Bestehenden aus, wird in diesen zur Norm.
Das hat spezifische Folgen für die politikwissenschaftliche Beobachtung von Demokratie. Methodisch münden die vorliegenden Überlegungen daher in die Empfehlung an die politikwissenschaftliche Demokratieforschung, sich benachbarten Disziplinen zu öffnen, die eigene, teils naive, teils arrogante, auf alle Fälle aber problematische Selbstgenügsamkeit und Reflexionslosigkeit in Fragen der Kategorienbildung und ›Messung‹ zu überwinden, die Illusion der unschuldigen Fremdbeobachtung aufzugeben, sich einzugestehen – und die methodischen Konsequenzen dieses Eingeständnisses zu ziehen –, dass es sich dabei wohl doch immer nur um Formen der Selbstbeobachtung handelt.10
Die konkreten Beispiele, an denen ich die ersten beiden Zusammenhänge demonstrieren möchte, nämlich (1) die historische Spezifizität der Demokratie und unseres Verständnisses von ihr und das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen, das heißt die Involviertheit jeder Beschreibung in die von ihr beschriebene politische Ordnung und deren Konflikte, sowie (2) die spezifischen akteurtheoretischen Implikationen eines liberalen politischen Institutionensettings mit seinem spezifischen Konfliktpotenzial, das dann wiederum unsere Wahrnehmung von ihm prägt, sind einem weitreichenden Transformationsvorgang entnommen, den man als ›Konstitutionalisierung der Demokratie‹ bezeichnen kann (Elster/20Slagstad 1993; Ginsburg 2009; Tate/Valänder 1995; Waldron 2016c). Gekennzeichnet ist dieser Prozess insbesondere durch die Einführung eines Vorrangs der Verfassung vor dem Gesetz und zugleich einer Institution, die diesen Vorrang sichern soll, nämlich von Verfassungsgerichten mit Befugnissen zur Normenkontrolle, also insbesondere mit einem verfassungsrechtlichen Prüfmandat gegenüber Parlamentsgesetzen als einem, wenngleich besonders folgenreichen und besonders weitverbreiteten Beispiel einer Delegation politischer Entscheidungen an nichtmajoritäre Institutionen (vgl. Ginsburg 2009; Hirschl 2007, 2008; Linzer/Staton 2015; Schäfer/Zürn 2021; Zürn et al. 2021).
Unsere gegenwärtigen Debatten über die Gefährdung der liberalen Demokratie machen sich im Regelfall keine Vorstellung davon, wie umfassend dieser Wandel gewesen ist, von dem die Demokratie vor nicht allzu langer Zeit erfasst wurde. Was üblicherweise als ›Konstitutionalisierung‹ oder auch – wesentlich zutreffender – als ›konstitutionelle Revolution‹ bezeichnet wird, vollzog sich in dem kurzen Zeitraum von Beginn der achtziger bis Ende der neunziger Jahre als »eine, wie man mit gutem Recht argumentieren könnte, der bedeutendsten Entwicklungen, die Regierungssysteme im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert genommen haben« (Hirschl 2007, S. 1). Diese Entwicklung hat erhebliche Folgen für die Funktionsweise moderner Demokratien und das, was wir gegenwärtig als ihre Krisenanfälligkeit wahrnehmen, also sozusagen ihre Dysfunktionsweise. Unter Vorgriff auf die genauere Rekonstruktion dieses Prozesses, der ihm zugrunde liegenden Motive so21wie der politischen Konsequenzen, die er zeitigt (Abschnitt 3), soll hier ein Schaubild das Ausmaß der Veränderung in einer einzigen Dimension verdeutlichen, nämlich jener der Gründung von Verfassungsgerichten – dann im Regelfall mit Normenkontrollrechten gegenüber parlamentarisch beschlossenen Gesetzen (siehe Abbildung 1).
Abb. 1: Zahl der Länder mit Verfassungsgerichten (siehe Elkins/Ginsburg 2022)
Es ist offenkundig, dass um 1990 etwas Substanzielles passiert – man könnte es die Geburt der ›liberalen Demokratie‹ nennen. Mit ihr kommt eine neue politische Konfliktkonstellation in die Welt. Bislang dominiert in der Deutung der Zeit der Blick auf Prozesse der wirtschaftlichen Liberalisierung und Globalisierung (für viele Biebricher 2013; Brown 2015; Fraser 2023; Slobodian 2019), die ebenfalls in den achtziger und neun22ziger Jahren an Fahrt aufnehmen, und auf deren Folgen. Mit dem Fokus auf den enormen Konstitutionalisierungsschub im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wende ich mich gegen die vorherrschende Neigung, alle Krisen unserer Zeit pauschal einem wirtschaftlichen Neoliberalismus zuzurechnen. Die diesbezügliche Beweisführung erscheint wenig überzeugend – weder, was ihr empirisches Fundament betrifft (als seien die meisten Länder in den letzten vierzig Jahren alle einem sehr ähnlichen, gleichgerichteten und dabei grundsätzlichen Prozess der Liberalisierung ihrer Ökonomien gefolgt), noch, was die Charakterisierung unserer gegenwärtigen Konflikte betrifft (als kreisten sie alle um zu viel Markt und zu wenig Staat).
Ein Teil der Erklärung könnte im Selbstverständnis und in der sozialen Wahrnehmung der Interpreten selbst liegen, die emphatisch proliberal in matters constitutional und dezidiert antiliberal in matters economical sind, mit der Tendenz zur Überbewertung der Problematik der ökonomischen bei Unterbewertung der Problematik der politisch konstitutionellen Entwicklung bzw. dazu, jede wechselseitige Verstärkung beider Liberalismen zu übersehen oder abzustreiten.11 Mir scheint das Geschehen in dieser Lesart auf schon dramatische Weise unterschätzt, denn wir haben es doch mittlerweile eher mit dem zu tun, was man die Metaphysik unserer Gegenwart nennen könnte, in der Macht, Recht, unsere moralischen Selbstgewissheiten und unsere Wissensproduktionen (für den Kontext dieses Buches: die neuen Verifikationsverfahren zur Feststellung von ›Demokratie‹) aufs Engste miteinander verflochten sind.
23Ausführlicher rekonstruiert Abschnitt 3 die entsprechenden institutionellen Ursachen und Folgen. Hier muss der Hinweis genügen, dass es unerlässlich ist, sich mit der jüngsten Institutionengeschichte der Demokratie zu befassen, wenn man ihre anhaltende Konfliktgeschichte – und damit auch ihre Begriffsgeschichte – verstehen will. Die Konstitutionalisierung der Demokratie12 bekommt, auch das wird in Abschnitt 3 zu zeigen sein, eine besondere Durchschlagskraft und damit spezifische politische Virulenz, wenn sie sich, wie in Europa, als Etablierung einer suprastaatlichen – und das bedeutet besonders unveränderlichen, oder man könnte auch sagen: ent-positivierten (und damit in einem spezifischen Sinne ent-demokratisierten) – Rechtsordnung vollzieht.13
Zuvor scheint mir jedoch eine abschließende Vorbemerkung notwendig. Vieles von dem Folgenden argumentiert angeregt von und in Parallele zu Argumenten, die Ian Hacking in Bezug auf das gemacht hat, was er human kinds, »Menschenarten«, nennt, in Anlehnung an den Begriff der »natürlichen Arten«, der natural kinds. Demokratie bezieht sich nun ganz offensichtlich nicht auf eine Menschenart – sondern auf ein Kollektiv, in Hinblick auf das so etwas wie Menschenarten unterschieden wurden. Während die human kinds im Regelfall zunächst eine Abweichung von einer unterstellten gesellschaftlichen Normalität bezeichneten, historisch aus einem – wenn man so will – biopolitischen Interesse des Nationalstaats an Normalisierung heraus entstanden sind (vgl. Hacking 2023 [1990]; 2006b [2002], S. 63), es sich dabei also um als Abweichung markierte Phäno24mene handelt, auf die der Staat regelmäßig repressiv, medizinisch, therapeutisch, pädagogisch oder ›reformerisch‹ reagierte,14 war mit dem Kollektiv die oft unausgesprochene, als selbstverständlich vorausgesetzte Normalität einer Gemeinschaft gesetzt, von der jeweils abgewichen wird. Zumindest ist diese Gemeinschaft, und hier liegt ein wichtiger Unterschied zu den human kinds, ursprünglich meist positiv besetzt. Historisch verbunden war mit ihr in der Regel ein Emanzipationsanspruch.
Wichtigster politischer Kollektivbegriff der Moderne ist (oder: war) vermutlich der der Gesellschaft – dessen Attraktivität nicht zuletzt darin begründet lag, dass mit ihm die Spannung zwischen dem universalen Anspruch und der partikularen (nämlich: nationalstaatlichen) Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit verdeckt bleiben konnte.15 Bezeichnend ist aus meiner Sicht allerdings, dass der Begriff der Demokratie ursprünglich mit dem der Nation verbunden war, sich auf ihn bezog, sich zumindest als Praxis auf die Nation beziehen musste (Furet 1989 [1978], 1998; Hont 2010; vgl. Manow 2020), dies aber nun zunehmend nicht mehr der Fall zu sein scheint. Die Konzeption einer liberalen Demokratie bekommt offensichtlich gerade im Kontext dieses Ablösungsprozesses ihre besondere Attraktivität, weil sie es vermeintlich erlaubt, die Demokratie ohne die Nation zu denken, die ja in Misskredit geraten ist. Das Konzept der liberalen Demokratie eröffnet die Möglichkeit, Demokratie nur noch als funktionierende Rechtsordnung zu denken, als effektive Verteidigerin subjektiver Rechte, die von der notwendig strittigen 25Frage ihrer politischen Ausgestaltung nicht länger berührt wird.16 Dieses Verständnis hat für die Demokratie als Modus kollektiver Entscheidungsfindung und als Garant der Teilhabe an der gesellschaftlichen Selbstverständigung tendenziell keinen Platz mehr. In diesem Prozess einer kompletten Umkehrung der Valenzen finden sich jetzt die human kinds unter dem Label ›Minderheit‹ emphatisch positiv besetzt, nicht zuletzt, weil man die Geschichte der Nation nur noch als Geschichte der von ihr zu verantwortenden Unterdrückungsverhältnisse erzählen zu können meint. Eine abstrakte Gemeinschaft der Rechteträger, als Gesellschaft der politischen Singularitäten, offenbart allerdings gegenwärtig ihre besonderen Pathologien.
Auch so verstanden schafft ein politisches Konzept wie das der ›liberalen Demokratie‹ in einem nicht nur tautologischen Sinne zugleich die Feinde der liberalen Demokratie, weil es nun die neue Norm(alität) bezeichnet, die als Folie zur Identifizierung von Abweichungen von einem allgemein anerkannten Zukunftspfad dient. Insofern ist es ungleich wichtiger zu bestimmen, wogegen sich der Begriff der ›liberalen Demokratie‹ wendet, seinen Gegenbegriff zu erkennen. Wie wir sehen werden, ist dieser Gegenbegriff nicht zwingend jener der ›Nicht-Demokratie‹, sondern eher der der ›elektoralen Demokratie‹ (die damit zugleich als defizient – ›defekt‹, ›beschädigt‹, ›fehlerhaft‹, siehe unten Tabelle 1 – markiert wird, als eine instabile Demokratie mit beständiger autokratischer Gefährdung, also dem stets drohenden Umschlag in die elektorale Autokratie) bzw.: der Populismus. Das ist aber ohne Zweifel eine sehr spezifi26sche, vor allem sehr zeitspezifische Vorstellung von Demokratie und ihrem ›Anderen‹ – der Einbruch der Zeit in unsere Begriffe, und damit wiederum in das politische Spiel, das diese Begriffe in Gang setzen. Wir können jetzt den oben zitierten Satz Arnold Davidsons für unsere Zwecke reformulieren: Der Populismus ist eine Krankheit, die von einem neuen (liberalen) Verständnis der Demokratie hervorgebracht wird. Wie wir sehen werden, gilt dieser Satz sowohl konzeptionell als auch real-institutionell wie dann auch in der Rückwirkung der Konzepte auf die in ihnen und mit ihnen handelnden Akteure. Und dieser Satz führt zu einem zweiten, für dieses Buch zentralen Satz: Der Populismus ist nicht der Gegner, sondern das Gespenst der liberalen Demokratie (Manow 2023a) – weil er als Wiedergänger der vom Liberalismus erstickten Politik verstanden werden muss. Das identische Argument als historischer Zusammenhang formuliert: Die Form des Triumphs der Demokratie in den 1980er und 1990er Jahren bedingt die politische Erscheinungsform ihrer gegenwärtigen Krise.
27
2. Die Beobachtung der Demokratie I: Konzepte & Kontexte
2.1 Komplizenschaft: Warum unsere Begriffe nicht unabhängig sind von dem, was mit ihnen begriffen werden soll
Das Wort »Populismus« hatte ein ironisches Schicksal: Es wurde populär.
Taguieff 1995, S. 9
Fragt man also, ob es vor 1990 Feinde der liberalen Demokratie gegeben hat, so folgt daraus eine erste Konsequenz, nämlich die Historisierung anstelle der Essenzialisierung einer bestimmten Vorstellung von Demokratie. Es ist selbstverständlich alles andere als eine grundstürzend neue oder besonders kontroverse Einsicht, dass die Demokratie als ein sich ständig fortentwickelndes System eigentlich nur historisch zu verstehen ist.1 Was aber mit allgemeiner Zustimmung rechnen kann, muss nicht erst zu Bewusstsein gebracht werden, könnte man meinen.
Doch der Gemeinplatz, dass die Demokratie eine beständig herausgeforderte, immer wieder neu zu begründende politische Herrschaftsform sei (»Demokratie […] nicht als gefestigte Ordnung, sondern als ein Projekt mit offenem Ende, das Gesellschaften auf sich nehmen« [Dryzek 2016]; »Demokratie, eine Reise, die nie an ihr Ziel gelangt« [Dunn 1992], Democratia sem28per reformanda;2democracy as a project; promesse indefinie, la démocratie inachevée [Rosanvallon 2000]; »Demokratie als Verkündung, die von keinem Ereignis erfüllt werden kann« [Furet 1989 [1978], S. 14], Demokratie nicht »als eine Gesamtheit von Regeln und Verfahrensweisen, die dazu bestimmt sind, […] die Tätigkeit der öffentlichen Gewalten zu organisieren«, sondern als »Glaubenssystem […] dem zufolge das ›Volk‹ [berufen ist, ] […] die Freiheit und Gleichheit einzuführen, die der Endzweck des kollektiven Handelns sind« [ebd., S. 37f.]), bleibt als Prämisse ihrer Erforschung im Regelfall deswegen proklamatorisch und führt gerade nicht dazu, die spezifisch historische Dimension der Demokratie und unseres Verständnisses von ihr zu erschließen, weil das Unvollendete der Demokratie aus dieser Perspektive in der immer nur unvollkommenen Realisierung ihrer ehernen Werte begründet liegt.
Schlegels Bemerkung, Demokratie könne nur »durch eine ins Unendliche fortschreitende Annäherung wirklich gemacht werden« (1796, zitiert nach Koselleck 1989 [1977], S. 340), und Derridas Formel von der »erst noch kommenden Demokratie«, der démocratie à venir (2004), stehen in der Kontinuität einer Vorstellung, auch wenn mehr als 200 Jahre sie trennen. Diese Perspektive verwandelt die Demokratie in eine Utopie, dazu verurteilt, immer zu werden und nie zu sein, ein sich bei Annäherung stets weiter in die Zukunft verschiebender »Erwartungshorizont« (Reinhart Koselleck), der nach immerwährender intellektueller und praktischer Arbeit am Fundament seiner Voraussetzungen verlangt: »Demokratie ist als Praxis stets eine der Demokratisierung – 29des Prozesses der Ausweitung und Egalisierung von Rechtfertigungsmacht.« (Forst 2015, S. 233) »Die Arbeit der Demokratie ist nie erledigt.« (Saward 1998, S. 146) Das ist die Geschichtsphilosophie vorherrschender Demokratievorstellungen.
Komplementär zu dieser Vorstellung von Werten mit sich stetig ausweitenden und dabei nie endgültig auszufüllenden Geltungsbereichen sind unsere gegenwärtigen Debatten über die Gefährdung der Demokratie von der Sicht geprägt, sie sei vor allem hervorgerufen durch Gegner der Demokratie, ›Feinde unserer Werteordnung‹, denen gegenüber es ›unsere Werte zu verteidigen‹ gelte. Kritik – an dem ewigen praktischen Verfehlen der demokratischen Ideale von Gleichheit und Freiheit – wie Krise – das Szenario der Gefährdung ebendieser Ideale durch jene, die sie nicht zu teilen scheinen – sind geeint im »Blick nach vorn«, leiten aus den aktuellen Erfahrungen weitreichende Erwartungen ab (Geulen 2023, S. 19). Dabei geht es nicht um Demokratie als konkrete institutionelle Ordnung mit einem spezifischen Konfliktpotenzial, sondern um einen »sich in die Zukunft erstreckenden Prozess der Demokratisierung« (Geulen 2023, S. 21; Selk 2023) – ›Wie wir die Demokratie zu unserer Zukunft machen‹3 – oder eben der drohenden Entdemokratisierung, des backsliding, der Regression, der Rezession (Niesen 2023). Dann wird die Gegenwart zu dem Ort, an dem nur noch die ›Trümmerteile eines kommenden Krieges‹ aufzusammeln sind, Sozialwissenschaftler zu ›Archäologen zukünftiger Dinge‹ (Jameson 2007). So entsteht die Einheit der Welt aus der selbstbezogenen Verschränkung utopischer oder dys30topischer Zukunftsentwürfe, nicht aber aus der Geschichte von Institutionen und Akteuren.