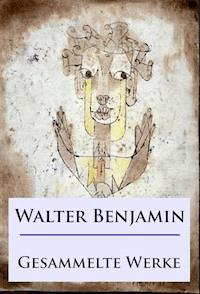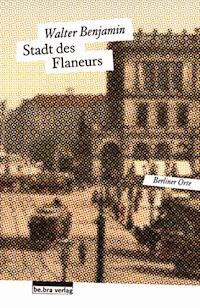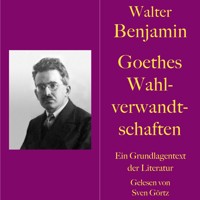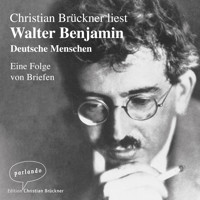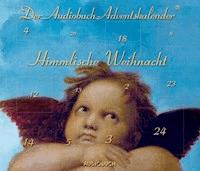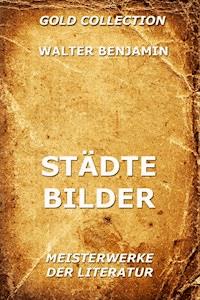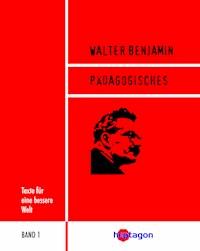Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Ursprung des deutschen Trauerspiels" wirft Walter Benjamin einen faszinierenden Blick auf die Entwicklung des deutschen Trauerspiels im 17. Jahrhundert. Mit seinem analytischen und tiefgründigen Stil untersucht er die komplexen sozialen und kulturellen Einflüsse, die zur Entstehung dieses einzigartigen literarischen Genres geführt haben. Benjamin beleuchtet die Verbindung zwischen barocker Dramatik und der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft und liefert dabei eine tiefgreifende Analyse des Verfalls und der Wiederbelebung des deutschen Trauerspiels. Das Buch stellt einen wichtigen Beitrag zur Literatur- und Kulturgeschichte dar und zeigt Benjamins einzigartiges Verständnis für die philosophischen und ästhetischen Strömungen seiner Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursprung des deutschen Trauerspiels
Inhaltsverzeichnis
Erkenntniskritische Vorrede
Da im Wissen sowohl als in der Reflexion kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innre, dieser das Äußere fehlt, so müssen wir uns die Wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Ganzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Allgemeinen, im Überschwänglichen zu suchen, sondern, wie die Kunst sich immer ganz in jedem einzelnen Kunstwerk darstellt, so sollte die Wissenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen.
Johann Wolfgang von Goethe: Materialien zur Geschichte der Farbenlehre
Es ist dem philosophischen Schrifttum eigen, mit jeder Wendung von neuem vor der Frage der Darstellung zu stehen. Zwar wird es in seiner abgeschlossenen Gestalt Lehre sein, solche Abgeschlossenheit ihm zu leihen aber liegt nicht in der Gewalt des bloßen Denkens. Philosophische Lehre beruht auf historischer Kodifikation. So ist sie denn auch more geometrico nicht zu beschwören. Wie deutlich es Mathematik belegt, daß die gänzliche Elimination des Darstellungsproblems, als welche jede streng sachgemäße Didaktik sich gibt, das Signum echter Erkenntnis ist, gleich bündig stellt sich ihr Verzicht auf den Bereich der Wahrheit, den die Sprachen meinen, dar. Was an den philosophischen Entwürfen Methode ist, das geht nicht auf in ihrer didaktischen Einrichtung. Und dies besagt nichts anderes, als daß ihnen eine Esoterik eignet, die abzulegen sie nicht vermögen, die zu verleugnen ihnen untersagt ist, die zu rühmen sie richten würde. Die Alternative der philosophischen Form, welche durch die Begriffe von der Lehre und von dem esoterischen Essay gestellt wird, ist’s, die der Systembegriff des XIX. Jahrhunderts ignoriert. Soweit er die Philosophie bestimmt, droht diese einem Synkretismus sich zu bequemen, der die Wahrheit in einem zwischen Erkenntnissen gezogenen Spinnennetz einzufangen sucht als käme sie von draußen herzugeflogen. Aber ihr angelernter Universalismus bleibt weit entfernt, die didaktische Autorität der Lehre zu erreichen. Will die Philosophie nicht als vermittelnde Anleitung zum Erkennen, sondern als Darstellung der Wahrheit das Gesetz ihrer Form bewahren, so ist der Übung dieser ihrer Form, nicht aber ihrer Antizipation im System, Gewicht beizulegen. Diese Übung hat sich allen Epochen, denen die unumschreibliche Wesenheit des Wahren vor Augen stand, in einer Propädeutik aufgenötigt, die man mit dem scholastischen Terminus des Traktats darum ansprechen darf, weil er jenen wenn auch latenten Hinweis auf die Gegenstände der Theologie enthält, ohne welche der Wahrheit nicht gedacht werden kann. Traktate mögen lehrhaft zwar in ihrem Ton sein; ihrer innersten Haltung nach bleibt die Bündigkeit einer Unterweisung ihnen versagt, welche wie die Lehre aus eigener Autorität sich zu behaupten vermöchte. Nicht weniger entraten sie der Zwangsmittel des mathematischen Beweises. In ihrer kanonischen Form wird als einziges Bestandstück einer mehr fast erziehlichen als lehrenden Intention das autoritäre Zitat sich einfinden. Darstellung ist der Inbegriff ihrer Methode. Methode ist Umweg. Darstellung als Umweg – das ist denn der methodische Charakter des Traktats. Verzicht auf den unabgesetzten Lauf der Intention ist sein erstes Kennzeichen. Ausdauernd hebt das Denken stets von neuem an, umständlich geht es auf die Sache selbst zurück. Dies unablässige Atemholen ist die eigenste Daseinsform der Kontemplation. Denn indem sie den unterschiedlichen Sinnstufen bei der Betrachtung eines und desselben Gegenstandes folgt, empfängt sie den Antrieb ihres stets erneuten Einsetzens ebenso wie die Rechtfertigung ihrer intermittierenden Rhythmik. Wie bei der Stückelung in kapriziöse Teilchen die Majestät den Mosaiken bleibt, so bangt auch philosophische Betrachtung nicht um Schwung. Aus Einzelnem und Disparatem treten sie zusammen; nichts könnte mächtiger die transzendente Wucht, sei es des Heiligenbildes, sei’s der Wahrheit lehren. Der Wert von Denkbruchstücken ist um so entscheidender, je minder sie unmittelbar an der Grundkonzeption sich zu messen vermögen und von ihm hängt der Glanz der Darstellung im gleichen Maße ab, wie der des Mosaiks von der Qualität des Glasflusses. Die Relation der mikrologischen Verarbeitung zum Maß des bildnerischen und des intellektuellen Ganzen spricht es aus, wie der Wahrheitsgehalt nur bei genauester Versenkung in die Einzelheiten eines Sachgehalts sich fassen läßt. Mosaik und Traktat gehören ihrer höchsten abendländischen Ausbildung nach dem Mittelalter an; was ihren Vergleich ermöglicht, ist echte Verwandtschaft.
Die Schwierigkeit, welche solcher Darstellung innewohnt, beweist nur, daß sie eine eigenbürtige prosaische Form ist. Während der Redende in Stimme und Mienenspiel die einzelnen Sätze, auch wo sie an sich selber nicht standzuhalten vermöchten, stützt und sie zu einem oft schwankenden und vagen Gedankengange zusammenfügt, als entwerfe er eine groß andeutende Zeichnung in einem einzigen Zuge, ist es der Schrift eigen, mit jedem Satze von neuem einzuhalten und anzuheben. Die kontemplative Darstellung hat dem mehr als jede andere zu folgen. Für sie ist es kein Ziel mitzureißen und zu begeistern. Nur wo sie in Stationen der Betrachtung den Leser einzuhalten nötigt, ist sie ihrer sicher. Je größer ihr Gegenstand, desto abgesetzter diese Betrachtung. Ihre prosaische Nüchternheit bleibt diesseits des gebietenden Lehrwortes die einzige philosophischer Forschung geziemende Schreibweise. – Gegenstand dieser Forschung sind die Ideen. Wenn Darstellung als eigentliche Methode des philosophischen Traktates sich behaupten will, so muß sie Darstellung der Ideen sein. Die Wahrheit, vergegenwärtigt im Reigen der dargestellten Ideen, entgeht jeder wie immer gearteten Projektion in den Erkenntnisbereich. Erkenntnis ist ein Haben. Ihr Gegenstand selbst bestimmt sich dadurch, daß er im Bewußtsein – und sei es transzendental – innegehabt werden muß. Ihm bleibt der Besitzcharakter. Diesem Besitztum ist Darstellung sekundär. Es existiert nicht bereits als ein Sich-Darstellendes. Gerade dies aber gilt von der Wahrheit. Methode, für die Erkenntnis ein Weg, den Gegenstand des Innehabens – und sei’s durch die Erzeugung im Bewußtsein – zu gewinnen, ist für die Wahrheit Darstellung ihrer selbst und daher als Form mit ihr gegeben. Diese Form eignet nicht einem Zusammenhang im Bewußtsein, wie die Methodik der Erkenntnis es tut, sondern einem Sein. Immer wieder wird als eine der tiefsten Intentionen der Philosophie in ihrem Ursprung, der Platonischen Ideenlehre, sich der Satz erweisen, daß der Gegenstand der Erkenntnis sich nicht deckt mit der Wahrheit. Erkenntnis ist erfragbar, nicht aber die Wahrheit. Die Erkenntnis richtet sich auf das Einzelne, auf dessen Einheit aber nicht unmittelbar. Die Einheit der Erkenntnis – wenn anders sie bestünde – wäre vielmehr ein nur vermittelt, nämlich auf Grund der Einzelerkenntnisse und gewissermaßen durch deren Ausgleich, herstellbarer Zusammenhang, während im Wesen der Wahrheit die Einheit durchaus unvermittelt und direkte Bestimmung ist. Dieser Bestimmung als einer direkten ist es eigentümlich, nicht erfragt werden zu können. Wäre nämlich die integrale Einheit im Wesen der Wahrheit erfragbar, so müßte die Frage lauten, inwiefern auf sie die Antwort selbst schon gegeben sei in jeder denkbaren Antwort, mit der Wahrheit Fragen entspräche. Und wieder müßte vor der Antwort auf diese Frage die gleiche sich wiederholen, dergestalt, daß die Einheit der Wahrheit jeder Fragestellung entginge. Als Einheit im Sein und nicht als Einheit im Begriff ist die Wahrheit außer aller Frage. Während der Begriff aus der Spontaneität des Verstandes hervorgeht, sind die Ideen der Betrachtung gegeben. Die Ideen sind ein Vorgegebenes. So definiert die Sonderung der Wahrheit von dem Zusammenhange des Erkennens die Idee als Sein. Das ist die Tragweite der Ideenlehre für den Wahrheitsbegriff. Als Sein gewinnen Wahrheit und Idee jene höchste metaphysische Bedeutung, die das Platonische System ihnen nachdrücklich zuspricht.
Hierfür ist vor allem das »Symposion« dokumentarisch. Insbesondere enthält es zwei in diesem Zusammenhang entscheidende Aussagen. Es entwickelt die Wahrheit – das Reich der Ideen – als den Wesensgehalt der Schönheit. Es erklärt die Wahrheit für schön. Einsicht in die Platonische Auffassung vom Verhältnis der Wahrheit zur Schönheit ist nicht nur ein oberstes Anliegen jedes kunstphilosophischen Versuchs, sondern für die Bestimmung des Wahrheitsbegriffes selbst unersetzlich. Eine systemlogische Auffassung, welche in diesen Sätzen nur den altehrwürdigen Entwurf eines Panegyrikus auf die Philosophie sähe, würde damit sich unweigerlich vom Gedankenkreis der Ideenlehre scheiden. Dieser stellt vielleicht nirgends deutlicher als in den gedachten Behauptungen die Seinsweise der Ideen ins Licht. Von ihnen bedarf zunächst die zweite einer einschränkenden Erläuterung. Wenn die Wahrheit schön genannt wird, so ist dies im Zusammenhange des »Symposions« zu begreifen, das die Stufenfolgen der erotischen Begehrungen beschreibt. Eros – so muß verstanden werden – wird seinem ursprünglichen Bestreben nicht untreu, wenn er sein Sehnen auf die Wahrheit richtet; denn auch die Wahrheit ist schön. Sie ist es nicht sowohl an sich als für den Eros. Waltet doch das gleiche Verhältnis im menschlichen Lieben: der Mensch ist schön für den Liebenden, an sich ist er es nicht; und zwar deswegen, weil sein Leib in einer höheren Ordnung als der des Schönen sich darstellt. So auch die Wahrheit: schön ist sie nicht sowohl an sich als für den der sie sucht. Haftet ein Hauch von Relativität dem an, so ist nicht im entferntesten darum die Schönheit, die der Wahrheit eignen soll, ein metaphorisches Epitheton geworden. Das Wesen der Wahrheit als des sich darstellenden Ideenreiches verbürgt vielmehr, daß niemals die Rede von der Schönheit des Wahren beeinträchtigt werden kann. In der Wahrheit ist jenes darstellende Moment das Refugium der Schönheit überhaupt. So lange nämlich bleibt das Schöne scheinhaft, antastbar, als es sich frank und frei als solches einbekennt. Sein Scheinen, das verführt, solange es nichts will als scheinen, zieht die Verfolgung des Verstandes nach und läßt seine Unschuld einzig da erkennen, wo es an den Altar der Wahrheit flüchtet. Dieser Flucht folgt Eros, nicht Verfolger, sondern als Liebender; dergestalt, daß die Schönheit um ihres Scheines willen immer beide flieht: den Verständigen aus Furcht und aus Angst den Liebenden. Und nur dieser kann es bezeugen, daß Wahrheit nicht Enthüllung ist, die das Geheimnis vernichtet, sondern Offenbarung, die ihm gerecht wird. Ob Wahrheit dem Schönen gerecht zu werden vermag? diese Frage ist die innerste im »Symposion«. Platon beantwortet sie, indem er der Wahrheit es zuweist, dem Schönen das Sein zu verbürgen. In diesem Sinne also entwickelt er die Wahrheit als den Gehalt des Schönen. Nicht aber tritt er zutage in der Enthüllung, vielmehr erweist er sich in einem Vorgang, den man gleichnisweise bezeichnen dürfte als das Aufflammen der in den Kreis der Ideen eintretenden Hülle, als eine Verbrennung des Werkes, in welcher seine Form zum Höhepunkt ihrer Leuchtkraft kommt. Diese Beziehung zwischen Wahrheit und Schönheit, die deutlicher als alles andere zeigt, wie unterschieden Wahrheit von dem Gegenstande der Erkenntnis, den man ihr gleichzusetzen sich gewöhnt hat, ist, enthält den Schlüssel des einfachen und dennoch unbeliebten Tatbestandes, der da in der Aktualität auch solcher philosophischer Systeme liegt, deren Erkenntnisgehalt längst die Beziehung zur Wissenschaft eingebüßt hat. Die großen Philosophien stellen die Welt in der Ordnung der Ideen dar. Der Fall ist die Regel, daß die begrifflichen Umrisse, in welchen das geschah, längst brüchig geworden sind. Nichtsdestoweniger behaupten diese Systeme als Entwurf einer Weltbeschreibung wie Platon mit der Ideenlehre, Leibniz mit der Monadologie, Hegel mit der Dialektik sie gab, ihre Geltung. Allen diesen Versuchen ist es nämlich eigen, ihren Sinn auch dann noch festzuhalten, ja sehr oft dann erst potenziert zu entfalten, wenn sie statt auf die empirische Welt bezogen werden auf die der Ideen. Denn als Beschreibung einer Ordnung der Ideen sind diese Gedankenbildungen entsprungen. Je intensiver die Denker das Bild des Wirklichen in ihnen zu entwerfen trachteten, desto reicher mußten sie eine Begriffsordnung ausbilden, die bei dem späteren Interpreten der originären Darstellung der Ideenwelt als der im Grunde gemeinten zugute kommen mußte. Ist Übung im beschreibenden Entwürfe der Ideenwelt, dergestalt, daß die empirische von selber in sie eingeht und in ihr sich löst, die Aufgabe des Philosophen, so gewinnt er die erhobne Mitte zwischen dem Forscher und dem Künstler. Der letztere entwirft ein Bildchen der Ideenwelt und eben darum, weil er es als Gleichnis entwirft, in jeder Gegenwart ein endgültiges. Der Forscher disponiert die Welt zu der Zerstreuung im Bereiche der Idee, indem er sie von innen im Begriffe aufteilt. Ihn verbindet mit dem Philosophen Interesse am Verlöschen bloßer Empirie, dem Künstler die Aufgabe der Darstellung. Allzu nahe hat eine landläufige Anschauung den Philosophen dem Forscher, und dem oft in der minderen Erscheinung, zugeordnet. Nirgends schien in der Aufgabe des Philosophen für Rücksicht auf die Darstellung ein Ort. Der Begriff des philosophischen Stils ist frei von Paradoxie. Er hat seine Postulate. Es sind: die Kunst des Absetzens im Gegensatz zur Kette der Deduktion; die Ausdauer der Abhandlung im Gegensatz zur Geste des Fragments; die Wiederholung der Motive im Gegensatz zum flachen Universalismus; die Fülle der gedrängten Positivität im Gegensatze zu negierender Polemik.
Daß die Wahrheit als Einheit und Einzigkeit sich darstellt, dazu wird ein lückenloser Deduktionszusammenhang der Wissenschaft mitnichten erfordert. Und doch ist gerade diese Lückenlosigkeit die einzige Form, in welcher die Systemlogik auf den Wahrheitsgedanken sich bezieht. Solch systematische Geschlossenheit hat mit der Wahrheit mehr nicht gemein als jede andere Darstellung, die sich in bloßen Erkenntnissen und Erkenntniszusammenhängen ihrer zu vergewissern sucht. Je peinlicher die Theorie der wissenschaftlichen Erkenntnis den Disziplinen nachgeht, desto unverkennbarer stellt deren methodische Inkohärenz sich dar. Mit jedem einzelwissenschaftlichen Bereiche führen neue und unableitbare Voraussetzungen sich ein, in jedem werden die Probleme der ihm vorgelagerten mit derselben Nachdrücklichkeit als gelöst betrachtet, mit der die Unabschließbarkeit ihrer Auflösung in anderem Zusammenhange behauptet wird. Es ist einer der unphilosophischsten Züge jener Wissenschaftstheorie, die nicht von den einzelnen Disziplinen, sondern von vermeintlichen philosophischen Postulaten in ihren Untersuchungen ausgeht, diese Inkohärenz als akzidentiell zu betrachten. Allein es ist diese Diskontinuität der wissenschaftlichen Methode so weit entfernt, ein minderwertiges, vorläufiges Stadium der Erkenntnis zu bestimmen, daß sie vielmehr deren Theorie positiv fördern könnte, wenn nicht die Anmaßung sich dazwischen legte, in einem enzyklopädischen Umfassen der Erkenntnisse der Wahrheit, die sprunglose Einheit bleibt, habhaft zu werden. Nur dort, wo das System in seinem Grundriß von der Verfassung der Ideenwelt selbst inspiriert ist, hat es Geltung. Die großen Gliederungen, welche nicht allein die Systeme, sondern die philosophische Terminologie bestimmen die allgemeinsten: Logik, Ethik und Ästhetik –, haben denn auch nicht als Namen von Fachdisziplinen, sondern als Denkmale einer diskontinuierlichen Struktur der Ideenwelt ihre Bedeutung. – Die Phänomene gehen aber nicht integral in ihrem rohen empirischen Bestände, dem der Schein sich beimischt, sondern in ihren Elementen allein, gerettet, in das Reich der Ideen ein. Ihrer falschen Einheit entäußern sie sich, um aufgeteilt an der echten der Wahrheit teilzuhaben. In dieser ihrer Aufteilung unterstehen die Phänomene den Begriffen. Die sind es, welche an den Dingen die Lösung in die Elemente vollziehen. Die Unterscheidung in Begriffen ist über jedweden Verdacht zerstörerischer Spitzfindigkeit erhaben nur dort, wo sie auf jene Bergung der Phänomene in den Ideen, das Platonische τὰ φαινόμενα σὠξειν es abgesehen hat. Durch ihre Vermittlerrolle leihen die Begriffe den Phänomenen Anteil am Sein der Ideen. Und eben diese Vermittlerrolle macht sie tauglich zu der anderen, gleich ursprünglichen Aufgabe der Philosophie, zur Darstellung der Ideen. Indem die Rettung der Phänomene vermittels der Ideen sich vollzieht, vollzieht sich die Darstellung der Ideen im Mittel der Empirie. Denn nicht an sich selbst, sondern einzig und allein in einer Zuordnung dinglicher Elemente im Begriff stellen die Ideen sich dar. Und zwar tun sie es als deren Konfiguration.
Der Stab von Begriffen, welcher dem Darstellen einer Idee dient, vergegenwärtigt sie als Konfiguration von jenen. Denn in Ideen sind die Phänomene nicht einverleibt. Sie sind in ihnen nicht enthalten. Vielmehr sind die Ideen deren objektive virtuelle Anordnung, sind deren objektive Interpretation. Wenn sie die Phänomene weder durch Einverleibung in sich enthalten, noch sich in Funktionen, in das Gesetz der Phänomene, in die ›Hypothesis‹ verflüchtigen, so entsteht die Frage, in welcher Art und Weise sie denn die Phänomene erreichen. Und zu erwidern ist darauf: in deren Repräsentation. Als solche gehört die Idee einem grundsätzlich anderen Bereiche an als das von ihr Erfaßte. Es kann also nicht als Kriterium ihres Bestandes aufgefaßt werden, ob sie das Erfaßte wie der Gattungsbegriff die Arten unter sich begreift. Denn das ist die Aufgabe der Idee nicht. Ein Vergleich mag deren Bedeutung darstellen. Die Ideen verhalten sich zu den Dingen wie die Sternbilder zu den Sternen. Das besagt zunächst: sie sind weder deren Begriffe noch deren Gesetze. Sie dienen nicht der Erkenntnis der Phänomene und in keiner Weise können diese Kriterien für den Bestand der Ideen sein. Vielmehr erschöpft sich die Bedeutung der Phänomene für die Ideen in ihren begrifflichen Elementen. Während die Phänomene durch ihr Dasein, ihre Gemeinsamkeit, ihre Differenzen Umfang und Inhalt der sie umfassenden Begriffe bestimmen, ist zu den Ideen insofern ihr Verhältnis das umgekehrte, als die Idee als objektive Interpretation der Phänomene – vielmehr ihrer Elemente – erst deren Zusammengehörigkeit zueinander bestimmt. Die Ideen sind ewige Konstellationen und indem die Elemente als Punkte in derartigen Konstellationen erfaßt werden, sind die Phänomene aufgeteilt und gerettet zugleich. Und zwar liegen jene Elemente, deren Auslösung aus den Phänomenen Aufgabe des Begriffes ist, in den Extremen am genauesten zutage. Als Gestaltung des Zusammenhanges, in dem das Einmalig-Extreme mit seinesgleichen steht, ist die Idee umschrieben. Daher ist es falsch, die allgemeinsten Verweisungen der Sprache als Begriffe zu verstehen, anstatt sie als Ideen zu erkennen. Das Allgemeine als ein Durchschnittliches darlegen zu wollen, ist verkehrt. Das Allgemeine ist die Idee. Das Empirische dagegen wird um so tiefer durchdrungen, je genauer es als ein Extremes eingesehen werden kann. Vom Extremen geht der Begriff aus. Wie die Mutter aus voller Kraft sichtlich erst da zu leben beginnt, wo der Kreis ihrer Kinder aus dem Gefühl ihrer Nähe sich um sie schließt, so treten die Ideen ins Leben erst, wo die Extreme sich um sie versammeln. Die Ideen – im Sprachgebrauche Goethes: Ideale – sind die faustischen Mütter. Sie bleiben dunkel, wo die Phänomene sich zu ihnen nicht bekennen und um sie scharen. Die Einsammlung der Phänomene ist die Sache der Begriffe und die Zerteilung, die sich kraft des unterscheidenden Verstandes in ihnen vollzieht, ist um so bedeutungsvoller, als in einem und demselben Vollzuge sie ein Doppeltes vollendet: die Rettung der Phänomene und die Darstellung der Ideen.
Die Ideen sind in der Welt der Phänomene nicht gegeben. Es entsteht also die Frage, welcher Art ihre oben berührte Gegebenheit ist, und ob die Überantwortung jeder Rechenschaft von der Struktur der Ideenwelt an eine vielberufene intellektuelle Anschauung unumgänglich ist. Wenn irgendwo die Schwäche, welche jede Esoterik der Philosophie mitteilt, beklemmend deutlich wird, so ist es in der ›Schau‹, die den Adepten von allen Lehren neuplatonischen Heidentums als philosophische Verhaltungsweise vorgeschrieben wird. Das Sein der Ideen kann als Gegenstand einer Anschauung überhaupt nicht gedacht werden, auch nicht der intellektuellen. Denn noch in ihrer paradoxesten Umschreibung, der als intellectus archetypus, geht sie aufs eigentümliche Gegebensein der Wahrheit, als welches jeder Art von Intention entzogen bleibt, geschweige daß sie selbst als Intention erschiene, nicht ein. Wahrheit tritt nie in eine Relation und insbesondere in keine intentionale. Der Gegenstand der Erkenntnis als ein in der Begriffsintention bestimmter ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ein aus Ideen gebildetes intentionsloses Sein. Das ihr gemäße Verhalten ist demnach nicht ein Meinen im Erkennen, sondern ein in sie Eingehen und Verschwinden. Die Wahrheit ist der Tod der Intention. Eben das kann ja die Fabel von einem verschleierten Bilde, zu Sais, besagen, mit dessen Enthüllung zusammenbricht, wer die Wahrheit zu erfragen gedachte. Nicht eine rätselhafte Gräßlichkeit des Sachverhalts ist’s, die das bewirkt, sondern die Natur der Wahrheit, vor welcher auch das reinste Feuer des Suchens wie unter Wassern verlischt. Als ein Ideenhaftes ist das Sein der Wahrheit verschieden von der Seinsart der Erscheinungen. Also erfordert die Struktur der Wahrheit ein Sein, das an Intentionslosigkeit dem schlichten der Dinge gleicht, an Bestandhaftigkeit aber ihm überlegen wäre. Nicht als ein Meinen, welches durch die Empirie seine Bestimmung fände, sondern als die das Wesen dieser Empirie erst prägende Gewalt besteht die Wahrheit. Das aller Phänomenalität entrückte Sein, dem allein diese Gewalt eignet, ist das des Namens. Es bestimmt die Gegebenheit der Ideen. Gegeben aber sind sie nicht sowohl in einer Ursprache, denn in einem Urvernehmen, in welchem die Worte ihren benennenden Adel unverloren an die erkennende Bedeutung besitzen. »In einem gewissen Sinne darf man bezweifeln, ob Platons Lehre von den ›Ideen‹ möglich gewesen wäre, wenn nicht der Wortsinn dem nur seine Muttersprache kennenden Philosophen eine Vergöttlichung des Wortbegriffs, eine Vergöttlichung der Worte, nahegelegt hätte: Platons ›Ideen‹ sind im Grunde, wenn man sie einmal von diesem einseitigen Standpunkt beurteilen darf, nichts als vergöttlichte Worte und Wortbegriffe.« Die Idee ist ein Sprachliches, und zwar im Wesen des Wortes jeweils dasjenige Moment, in welchem es Symbol ist. Im empirischen Vernehmen, in welchem die Worte sich zersetzt haben, eignet nun neben ihrer mehr oder weniger verborgenen symbolischen Seite ihnen eine offenkundige profane Bedeutung. Sache des Philosophen ist es, den symbolischen Charakter des Wortes, in welchem die Idee zur Selbstverständigung kommt, die das Gegenteil aller nach außen gerichteten Mitteilung ist, durch Darstellung in seinen Primat wieder einzusetzen. Dies kann, da die Philosophie offenbarend zu reden sich nicht anmaßen darf, durch ein aufs Urvernehmen allererst zurückgehendes Erinnern einzig geschehen. Die platonische Anamnesis steht dieser Erinnerung vielleicht nicht fern. Nur daß es nicht um eine anschauliche Vergegenwärtigung von Bildern sich handelt; vielmehr löst in der philosophischen Kontemplation aus dem Innersten der Wirklichkeit die Idee als das Wort sich los, das von neuem seine benennenden Rechte beansprucht. In solcher Haltung aber steht zuletzt nicht Platon, sondern Adam, der Vater der Menschen als Vater der Philosophie, da. Das adamitische Namengeben ist so weit entfernt Spiel und Willkür zu sein, daß vielmehr gerade in ihm der paradiesische Stand sich als solcher bestätigt, der mit der mitteilenden Bedeutung der Worte noch nicht zu ringen hatte. Wie die Ideen intentionslos im Benennen sich geben, so haben sie in philosophischer Kontemplation sich zu erneuern. In dieser Erneuerung stellt das ursprüngliche Vernehmen der Worte sich wieder her. Und so ist die Philosophie im Verlauf ihrer Geschichte, die so oft ein Gegenstand des Spottes gewesen ist, mit Grund ein Kampf um die Darstellung von einigen wenigen, immer wieder denselben Worten – von Ideen. Die Einführung neuer Terminologien, soweit sie nicht streng im begrifflichen Bereich sich hält, sondern auf die letzten Gegenstände der Betrachtung es absieht, ist daher innerhalb des philosophischen Bereichs bedenklich. Solche Terminologien – ein mißglücktes Benennen, an welchem das Meinen mehr Anteil hat als die Sprache – entraten der Objektivität, welche die Geschichte den Hauptprägungen der philosophischen Betrachtungen gegeben hat. Diese stehen, wie bloße Worte es nie vermögen, in vollendeter Isolierung für sich. Und so bekennen die Ideen das Gesetz, das da besagt: Alle Wesenheiten existieren in vollendeter Selbständigkeit und Unberührtheit, nicht von den Phänomenen allein, sondern zumal voneinander. Wie die Harmonie der Sphären auf den Umläufen der einander nicht berührenden Gestirne, so beruht der Bestand des mundus intelligibilis auf der unaufhebbaren Distanz zwischen den reinen Wesenheiten. Jede Idee ist eine Sonne und verhält sich zu ihresgleichen wie eben Sonnen zueinander sich verhalten. Das tönende Verhältnis solcher Wesenheiten ist die Wahrheit. Deren benannte Vielheit ist zählbar. Denn Diskontinuierlichkeit gilt von den »Wesenheiten …, die ein von den Gegenständen und ihren Beschaffenheiten toto coelo verschiedenes Leben führen; deren Existenz sich dadurch nicht dialektisch erzwingen läßt, daß wir einen beliebigen, an einem Gegenstand uns begegnenden … Komplex herausgreifen und hinzufügen: καϑ’ αὑτὸ, sondern deren Zahl gezählt ist und von denen jede einzelne an dem ihr zukommenden Orte ihrer Welt mühsam zu suchen ist, bis man auf sie stößt, als auf einen rocher de bronce, oder bis sich die Hoffnung auf ihre Existenz als trügerisch erweist«. Nicht selten hat die Unkunde von dieser ihrer diskontinuierlichen Endlichkeit energische Versuche zur Erneuerung der Ideenlehre, zuletzt noch die der älteren Romantiker, gebrochen. In ihrem Spekulieren nahm die Wahrheit anstelle ihres sprachlichen Charakters den eines reflektierenden Bewußtseins an.
Das Trauerspiel im Sinn der kunstphilosophischen Abhandlung ist eine Idee. Von der literarhistorischen unterscheidet eine solche sich am auffallendsten darin, daß sie Einheit da voraussetzt, wo jener Mannigfaltigkeit zu erweisen obliegt. Die Differenzen und Extreme, welche die literarhistorische Analyse ineinander überführt und als Werdendes relativiert, erhalten in begrifflicher Entwicklung den Rang komplementärer Energien und die Geschichte erscheint nur als der farbige Rand einer kristallinischen Simultaneität. Notwendig werden der Kunstphilosophie die Extreme, virtuell der historische Ablauf. Umgekehrt ist das Extrem einer Form oder Gattung die Idee, die als solche in die Literaturgeschichte nicht eingeht. Trauerspiel als Begriff würde der Reihe ästhetischer Klassifikationsbegriffe sich problemlos einordnen. Anders verhält sich zum Bereich der Klassifikationen die Idee. Sie bestimmt keine Klasse und enthält jene Allgemeinheit, auf welcher im System der Klassifikationen die jeweilige Begriffsstufe ruht, die des Durchschnitts nämlich, nicht in sich. Es konnte auf die Dauer nicht verborgen bleiben, wie mißlich es infolgedessen um die Induktion in kunsttheoretischen Untersuchungen steht. Bei neueren Forschern setzt die kritische Ratlosigkeit ein. Gelegentlich seiner Untersuchung »Zum Phänomen des Tragischen« sagt Scheler: »Wie … ist … vorzugehen? Sollen wir uns allerhand Beispiele des Tragischen, d. h. allerhand Vorkommnisse und Geschehnisse, von denen Menschen den Eindruck des Tragischen aussagen, zusammenstellen und dann induktorisch fragen, was sie denn ›gemeinsam‹ haben? Das wäre eine Art induktorischer Methode, die auch experimentell unterstützt werden könnte. Indes dies würde uns noch weniger weiterführen als die Beobachtung unseres Ich, wenn Tragisches auf uns wirkt. Denn mit welchem Recht sollen wir den Aussagen der Leute das Vertrauen entgegenbringen, es sei auch tragisch, was sie so nennen?« Es kann zu nichts führen, Ideen induktiv – ihrem ›Umfang‹ nach – aus der populären Redeweise bestimmen zu wollen, um sodann auf die Wesensergründung des umfänglich Fixierten auszugehen. Denn der Sprachgebrauch ist dem Philosophen zwar unschätzbar, wo er als Hinweisung auf Ideen, verfänglich aber, wo er in seiner Interpretation durch laxes Reden oder Denken als förmlicher Begriffsgrund hingenommen wird. Ja, dieser Sachverhalt erlaubt es auszusprechen, daß nur mit äußerster Zurückhaltung der Philosoph der Gepflogenheit landläufigen Denkens, die Worte, um ihrer desto besser sich zu versichern, zu Artbegriffen zu machen, sich nähern darf. Gerade die Kunstphilosophie ist dieser Suggestion nicht selten erlegen. Denn wenn – unter vielen ein drastisches Beispiel – die »Ästhetik des Tragischen« von Volkelt in ihre Untersuchungen Stücke von Holz oder Halbe im gleichen Sinne wie Dramen von Aischylos oder Euripides einbezieht, ohne auch nur zu fragen, ob das Tragische eine gegenwärtig überhaupt zu erfüllende Form oder aber eine geschichtlich gebundene sei, so liegt, aufs Tragische gesehen, in so verschiedenen Materien nicht Spannung, sondern tote Disparatheit vor. Bei der so entstehenden Häufung von Fakten, unter denen bald die ursprünglichen spröderen vom Wust der ansprechenden modernen verdeckt sind, kann der Untersuchung, die, um das ›Gemeinsame‹ zu ergründen, dieser Stapelei sich unterzog, nichts in Händen bleiben, als einige psychologische Daten, die in der Subjektivität, wenn nicht des Forschers so des gleichzeitigen Normalbürgers, das Verschiedengeartete durch die Gleichheit einer ärmlichen Reaktion zur Deckung bringen. In den Begriffen der Psychologie läßt sich vielleicht eine Vielgestaltigkeit von Eindrücken wiedergeben, von der es belanglos bleibt, daß Kunstwerke sie hervorriefen, nicht aber das Wesen eines Kunstgebietes. Dies geschieht vielmehr in einer durchgebildeten Darlegung seines Formbegriffs, dessen metaphysischer Gehalt nicht sowohl im Inneren befindlich als wirkend zu erscheinen und wie das Blut den Körper zu durchpulsen hat.
Das Haften an der Vielgestaltigkeit auf der einen, die Gleichgültigkeit gegen das strenge Denken auf der anderen Seite sind stets die Bestimmungsgründe einer unkritischen Induktion gewesen. Immer handelt es sich um die Scheu vor konstitutiven Ideen – den universaliis in re – wie sie gelegentlich von Burdach mit besonderer Schärfe formuliert worden ist. »Ich habe versprochen, vom Ursprung des Humanismus zu reden, als sei er ein lebendiges Wesen, das als Ganzes irgendwo und irgendwann auf die Welt kam und als Ganzes dann weiter gewachsen ist … Wir verfahren dabei wie die sogenannten Realisten unter den Scholastikern des Mittelalters, die den allgemeinen Begriffen, den ›Universalien‹, Realität beilegten. In gleicher Weise setzen auch wir – hypostasierend wie die Mythologien der Urzeit – ein Wesen von einheitlicher Substanz und von voller Wirklichkeit und heißen es, als wäre es ein lebendiges Individuum, Humanismus. Wir sollten uns aber hier wie in unzähligen ähnlichen Fällen … darüber klar werden, daß wir einen abstrakten Hilfsbegriff nur erfinden, um unendliche Reihen mannigfaltiger geistiger Erscheinungen und recht verschiedener Persönlichkeiten uns übersichtlich und faßbar zu machen. Wir können das, nach einem Grundsatz menschlicher Wahrnehmung und Erkenntnis, nur dadurch erreichen, daß wir gewisse Eigentümlichkeiten, die in diesen Reihen von Varietäten uns ähnlich oder übereinstimmend erscheinen, aus dem uns angeborenen systematischen Bedürfnis schärfer sehen und stärker betonen als die Unterschiede … Diese Marken Humanismus oder Renaissance sind willkürlich, ja irrig, weil sie diesem vielquelligen, vielgestaltigen, vielgeistigen Leben den falschen Schein einer realen Wesenseinheit geben. Und ebenso eine willkürliche, ja irreführende Maske ist der seit Burckhardt und Nietzsche vielbeliebte ›Renaissancemensch‹.« Eine Anmerkung des Autors zu dieser Stelle lautet: »Das üble Gegenstück des unausrottbaren ›Renaissancemenschen‹ ist ›der gotische Mensch‹, der heute eine verwirrende Rolle spielt und selbst in der Gedankenwelt bedeutender, verehrungswürdiger Geschichtsforscher (E. Troeltsch!) sein gespenstisches Wesen treibt. Dazu tritt dann noch ›der barocke Mensch‹, als welcher uns z. B. Shakespeare vorgestellt wird.« Diese Stellungnahme ist soweit sie gegen die Hypostasierung von Allgemeinbegriffen geht – nicht in allen Fassungen gehören die Universalien zu denen – in ihrem Recht evident. Aber sie versagt gänzlich vor den Fragen einer platonisch auf Darstellung der Wesenheiten gerichteten Wissenschaftstheorie, deren Notwendigkeit sie verkennt. Einzig und allein diese vermag die Sprachform der wissenschaftlichen Darlegungen, wie sie sich außerhalb des Mathematischen bewegen, vor der grenzenlosen und jede noch so subtile Induktionsmethodik zuletzt in ihren Strudel ziehenden Skepsis zu bewahren, der Burdachs Ausführungen nicht begegnen können. Denn sie sind eine private reservatio mentalis, keine methodische Sicherung. Was insbesondere historische Typen und Epochen angeht, so wird man zwar niemals annehmen dürfen, Ideen wie die der Renaissance oder des Barock vermöchten den Stoff begrifflich zu bewältigen, und die Meinung, eine moderne Einsicht in die verschiedenen Geschichtsperioden lasse sich in etwaigen polemischen Auseinandersetzungen beglaubigen, in denen als an den großen Wendepunkten die Epochen gleichsam mit offenem Visier einander begegneten, würde den Gehalt der Quellen verkennen, der von aktualen Interessen nicht von historiographischen Ideen bestimmt zu sein pflegt. Was aber solche Namen als Begriffe nicht vermögen, leisten sie als Ideen, in denen nicht das Gleichartige zur Deckung, wohl aber das Extreme zur Synthese gelangt. Unbeschadet dessen, daß auch begriffliche Analysis nicht unter allen Umständen auf gänzlich auseinanderfallende Erscheinungen stößt und gelegentlich der Umriß einer Synthese in ihr sichtbar wenn auch nicht legitimiert zu werden vermag. So hat gerade vom literarischen Barock, in dem das deutsche Trauerspiel entsprungen ist, Strich mit Recht bemerkt, »daß die Gestaltungsprinzipien durch das ganze Jahrhundert die gleichen geblieben sind«
Burdachs kritische Reflexion ist nicht sowohl im Gedanken an eine positive Revolution der Methode als aus der Besorgnis vor sachlichen Irrtümern im einzelnen vorgetragen. Es darf sich aber letzten Endes die Methodik keinesfalls von bloßen Befürchtungen sachlicher Unzulänglichkeit geleitet, negativ und als ein Warnungskanon präsentieren. Vielmehr muß sie von Anschauungen höherer Ordnung ausgehen als der Gesichtspunkt eines wissenschaftlichen Verismus sie darbietet. Der muß dann notwendig beim einzelnen Problem auf diejenigen Fragen echter Methodik stoßen, die er in seinem wissenschaftlichen Credo ignoriert. Regelmäßig wird deren Lösung über eine Revision der Fragestellung führen, die in der Erwägung formulierbar ist, wie die Frage: Wie es denn eigentlich gewesen sei? sich wissenschaftlich nicht sowohl beantworten als vielmehr stellen lasse. Mit dieser im Vorstehenden vorbereiteten, im folgenden abzuschließenden Erwägung allererst entscheidet sich, ob die Idee eine unerwünschte Abbreviatur ist oder in ihrem sprachlichen Ausdruck den wahren wissenschaftlichen Gehalt vielmehr begründet. Eine Wissenschaft, die sich im Protest gegen die Sprache ihrer Untersuchungen ergeht, ist ein Unding. Worte sind, neben den Zeichen der Mathematik, das einzige Darstellungsmedium der Wissenschaft und sie selber sind keine Zeichen. Denn im Begriff, als welchem freilich das Zeichen entspräche, depotenziert sich eben dasselbe Wort, das als Idee sein Wesenhaftes besitzt. Der Verismus, in dessen Dienst die induktive Methode der Kunsttheorie sich stellt, wird dadurch nicht geadelt, daß am Ende die diskursiven und induktorischen Fragestellungen zu einer »Anschauung« zusammentreten, welche, wie R. M. Meyer mit vielen andern wähnt, als Synkretismus mannigfaltigster Methoden zu runden sich vermöge. Damit steht man wie mit allen naiv-realistischen Umschreibungen der Methodenfrage wieder am Anfang. Denn eben die Anschauung soll ja gedeutet werden. Und das Bild der induzierenden ästhetischen Forschungsweise zeigt die gewohnte trübe Farbe auch hier, indem diese Anschauung nicht die in der Idee gelöste der Sache ist, sondern die subjektiver, in das Werk hineinprojizierter Zustände des Aufnehmenden, auf welche die von R. M. Meyer als Schlußstück seiner Methode gedachte Einfühlung hinausläuft. Diese Methode, als konträrer Gegensatz der im Verlaufe dieser Untersuchung anzuwendenden, »sieht die Kunstform des Dramas und wieder der Tragödie oder Komödie und weiter etwa des Charakter- und des Situationslustspiels als gegebene Größen an, mit denen sie rechnet. Nun sucht sie aus der Vergleichung hervorragender Vertreter jeder Gattung Regeln und Gesetze zu gewinnen, an denen das einzelne Produkt zu messen sei. Und wiederum aus der Vergleichung der Gattungen erstrebt sie allgemeine Kunstgesetze, die für jedes Werk gelten sollen.« Die kunstphilosophische ›Deduktion‹ der Gattung würde hiernach auf induktorischem Verfahren verbunden mit dem abstrahierenden beruhen und eine Abfolge dieser Gattungen und Arten deduktiv nicht sowohl gewonnen als im Schema der Deduktion vorgeführt werden.
Während die Induktion die Ideen zu Begriffen durch den Verzicht auf ihre Gliederung und Anordnung herabwürdigt, vollzieht die Deduktion das gleiche durch deren Projizierung in ein pseudo-logisches Kontinuum. Das philosophische Gedankenreich entspinnt sich nicht in der ununterbrochenen Linienführung begrifflicher Deduktionen, sondern in einer Beschreibung der Ideenwelt. Ihre Durchführung setzt mit jeder Idee von neuem als einer ursprünglichen an. Denn die Ideen bilden eine unreduzierbare Vielheit. Als gezählte – eigentlich aber benannte – Vielheit sind die Ideen der Betrachtung gegeben. Von hier aus ist dem deduzierten Gattungsbegriff der Kunstphilosophie die vehemente Kritik durch Benedetto Croce erwachsen. Mit Recht erblickt er in der Klassifikation als dem Gerüst spekulativer Deduktionen die Grundlage einer oberflächlich schematisierenden Kritik. Und während Burdachs Nominalismus der historischen Epochenbegriffe, sein Widerstand, die Fühlung mit dem Faktum im geringsten zu lockern, auf die Furcht, vom’ Richtigen sich zu entfernen, zurückdeutet, führt ein durchaus analoger Nominalismus der ästhetischen Gattungsbegriffe bei Croce, ein analoges Festhalten am Einzelnen, auf die Besorgnis zurück, mit der Entfernung von ihm des Wesenhaften schlechtweg verlustig zu gehen. Gerade das ist mehr als alles andere angetan, den wahren Sinn ästhetischer Gattungsnamen ins rechte Licht zu setzen. Der »Grundriß der Ästhetik« rügt das Vorurteil »von der Möglichkeit, mehrere oder viele besondere Kunstformen zu unterscheiden, von denen jede in ihrem besonderen Begriff und in ihren Grenzen bestimmbar und mit eigenen Gesetzen versehen ist … Viele Ästhetiker verfassen noch immer Schriften über die Ästhetik des Tragischen oder des Komischen oder der Lyrik oder des Humors und Ästhetiken der Malerei oder der Musik oder der Dichtkunst …; aber was schlimmer ist, … die Kritiker haben bei der Beurteilung der Kunstwerke noch nicht völlig die Gewohnheit abgelegt, sie an der Gattung oder der besonderen Kunst, der sie nach ihrer Meinung angehören, zu messen.« »Jede beliebige Theorie der Teilung der Künste ist unbegründet. Die Gattung oder die Klasse ist in diesem Fall eine einzige, die Kunst selbst oder die Intuition, während die einzelnen Kunstwerke im übrigen zahllos sind: alle original, keines ins andere übersetzbar … Zwischen das Universale und das Besondere schiebt sich in philosophischer Betrachtung kein Zwischenelement ein, keine Reihe von Gattungen oder Arten, von ›generalia‹.« Diese Darlegung hat den Begriffen ästhetischer Gattungen gegenüber volles Gewicht. Aber sie bleibt auf halbem Wege stehen. Denn so ersichtlich eine Aufreihung von Kunstwerken, die es aufs Gemeinsame abstellt, ein müßiges Unternehmen ist, wo es sich nicht um historische oder stilistische Beispielsammlungen, sondern um deren Wesentliches handelt, so undenkbar bleibt, daß die Kunstphilosophie ihrer reichsten Ideen wie der des Tragischen oder des Komischen je sich entäußere. Denn das sind nicht Inbegriffe von Regeln, nein, selber einem jeden Drama an Dichtigkeit und an Realität zumindest ebenbürtige Gebilde, die gar nicht ihm kommensurabel sind. So erheben sie denn keinerlei Anspruch, eine Anzahl gegebener Dichtungen auf Grund irgendwelcher Gemeinsamkeiten ›unter‹ sich zu begreifen. Denn auch wenn es die reine Tragödie, das reine komische Drama, das nach ihnen benannt werden dürfte, nicht geben sollte, mögen diese Ideen Bestand haben. Dazu hat eine Untersuchung ihnen zu verhelfen, die nicht in ihrem Ausgangspunkt an alles dasjenige, was je als tragisch oder komisch mag bezeichnet worden sein, sich bindet, sondern nach Exemplarischem sich umsieht, und sollte sie auch nur einem versprengten Bruchstück diesen Charakter zubilligen können. ›Maßstäbe‹ für den Rezensenten fördert sie so nicht. Kritik, sowie Kriterien einer Terminologie, das Probestück der philosophischen Ideenlehre von der Kunst, bilden sich nicht unter dem äußeren Maßstab des Vergleiches, sondern immanent, in einer Entwicklung der Formensprache des Werks, die deren Gehalt auf Kosten ihrer Wirkung heraustreibt. Dazu kommt, daß gerade die bedeutenden Werke, sofern in ihnen nicht erstmalig und gleichsam als Ideal die Gattung erscheint, außerhalb von Grenzen der Gattung stehen. Ein bedeutendes Werk – entweder gründet es die Gattung oder hebt sie auf und in den vollkommenen vereinigt sich beides.