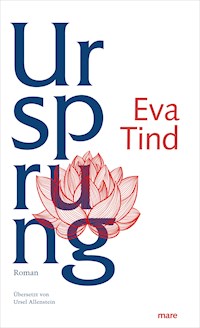
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Sui mit achtzehn von zu Hause auszieht, gerät ihr Vater Kai in eine Krise. Er hat Sui allein großgezogen, weil ihre Mutter Miriam sich ganz ihrer Karriere als Künstlerin widmete. Während Kai seinem Architekturbüro den Rücken kehrt, um in Indien Kraft und neuen Sinn zu finden, verlässt auch Sui Kopenhagen und fährt zu ihrer Mutter, die inzwischen in einem einsamen Waldgebiet lebt. Doch die Begegnung mit Miriam bringt Sui nicht die erhofften Antworten. Auf der Suche nach ihren väterlichen Wurzeln reist sie weiter auf die koreanische Insel Marado, ins Matriarchat der Perlentaucherinnen. Aus drei Perspektiven, in so pointierter wie poetischer Sprache und erfrischend offenherzigen Dialogen hinterfragt Eva Tind gängige Auffassungen von Familie und erzählt von der Suche nach Identität in verschiedenen Lebensphasen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Tind
Ursprung
Roman
Aus dem Dänischenvon Ursel Allenstein
Die Originalausgabe erschien 2019unter dem Titel Ophav bei Gyldendal, Kopenhagen.
Copyright © Eva Tind & Gyldendal 2019
Der Verlag dankt der Danish Arts Foundationfür die Förderung dieser Übersetzung.
© 2021 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Can Stock Photo / Gennadil Korchuganov
Typografie (Hardcover) mareverlag, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-809-0
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-647-8
www.mare.de
Inhalt
Prolog
Kai
Sui
Kai
Kai
Sui
Miriam
Kai
Kai
Suis Notizen
Kai
Miriam
Kai
Miriam
Miriam
Kai
Kai
Kai
Kai
Suis Notizen
Kai
Kai
Kai
Sui
Sui und Miriam
Kai
Miriam
Kai
Miriam
Kai
Miriam
Miriam
Miriam
Miriam
Kai
Miriam und Alice Shea vom Kunstmagazin Looking Glass, NY
Sui
Miriam
Kai
Miriam und Alice Shea vom Kunstmagazin Looking Glass, NY
Sui
Kai
Sui
Suis Notizen
Kai
Kai
Miriam
Kai
Suis Notizen
Sui
Kai
Miriam
Kai
Sui
Kai
Suis Notizen
Miriam und Alice Shea vom Kunstmagazin Looking Glass, NY
Sui
Kai
Miriam
Kai
Sui
Sui
Kai
Miriam
Kai
Suis Notizen
Sui
Miriam
Sui
Kai
Kai
Sui
Miriam
Kai
Kai
Sui
Miriam
Kai
Sui
Miriam
Kai
Sui
Kai
Miriam
Kai
Sui
Miriam
Kai
Miriam
Suis Notizen
Kai
Kai
Sui
Kai
Suis Notizen
Miriam
Kai
Sui
Kai
Kai
Sui
Sui
Über das Buch
Prolog
Milchig weiße Wassertropfen schweben über die Erde wie Nebel. Ich hocke in einem Anzug aus Rehfell am Waldrand. Die Kapuze ist ein Schatten, unter dem sich das Gesicht versteckt, und ganz oben ist ein kleines Gewehr befestigt. Noch ehe ich ihn sehe, höre ich die Krallen des Fasans in der Erde nach Käfern und schleimigen Schnecken scharren. Lautlos hebe ich das Gewehr und ziele. Ein Knall lässt den Wald erzittern, der Fasan fällt um. Die Störung erzeugt einen Wirbel im weißen Nebel, der wie ein Schleier über dem Boden liegt. Ich gehe in die Schussrichtung. Der Fasan liegt reglos auf dem Waldboden und sieht aus, als würde er schlafen. Die kleinen Schrotkugeln haben sich überall hineingebohrt, die Federn über den Einschusslöchern geschlossen. Ich höre mich selbst atmen, höre das Blut, das in meinem Körper pulsiert. Ich knie mich neben den Fasan und blicke in das eine Auge, das aus der Perspektive der Ameisen einer Kristallkugel gleichen muss. Die Kälte aus der Erde dringt bis in die Knie, ich stütze meinen unteren Rücken, richte mich auf und reiße mir die Kapuze vom Kopf. Dann packe ich den Vogel an den Füßen, stehe auf und gehe zurück zur Hütte, als der Tag erwacht.
Das Gras ist hoch, der Raureif bedeckt es wie ein weißer Pelz. Der Pfad, dem ich folge, geht in den Weg zum Haus über, zwei frische Reifenspuren haben grüne Linien durch den weißen Pelz gezogen. Als ich mich dem Haus nähere, sehe ich, dass auf der Lichtung ein schwarzer Fiat parkt. Ich erwarte keine Gäste. Das Auto bewegt sich nicht und dampft wie ein Tier. Ich halte inne und beobachte es aus der Ferne. Es ist, als würde die Natur den Ton herunterdrehen, selbst die Bäume halten die Luft an. Dann unterbreche ich die Stille und gehe zum Auto. Ich erreiche sein Heck, als die Vordertür geöffnet wird. Ihre Füße sehe ich zuerst. Weiße Sneaker, ein weiter Hosenanzug. Ihr Haar ist lang und glatt. Ihr Gesicht gleicht dem von Kai.
»Sui?«
Sie schlägt die Autotür zu und geht mir entgegen.
»Du bist es«, sage ich überrascht.
»Hallo, Miriam«, sagt sie, »lang ist’s her.«
Kopenhagen, 2010
Kai
Es beginnt damit, dass Sui sagt:
»Ich ziehe aus.«
Ein Satz, der in der Luft schwebt wie jeder andere, für mich aber alles verändert.
»Ich werde bei Anton einziehen.«
Sui sieht glücklich aus, nur zwischen ihren Augenbrauen zeichnet sich eine dünne Linie ab.
»Aber hier wohnst du umsonst. Kannst du dir das denn überhaupt leisten?«, frage ich.
»Ich arbeite im Café und lebe doch im Prinzip sowieso schon bei Anton, du wirst keinen Unterschied bemerken«, antwortet sie.
»Ist das nicht viel zu früh?«
»Papa, du bist auch mit achtzehn von zu Hause ausgezogen.«
»Jetzt bleiben die meisten aber bei ihren Eltern wohnen, bis sie mindestens zwanzig sind, und heutzutage verschwimmen die Altersgrenzen viel mehr. Wir machen doch oft dieselben Sachen, lesen dieselben Bücher, gucken dieselben Filme. Wir sind eher wie eine kleine WG, oder?«
»Ich habe das Bedürfnis, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen«, sagt sie.
Meine Wirklichkeit war bisher nur von einer einzigen großen Weltlampe beleuchtet, die auf ihrem gewohnten Platz auf der rechten Seite der Welt hing und alles aus einer festen Richtung beleuchtete, sodass die Möbel und der Kaktus, meine einzige Zimmerpflanze, ihre Schatten immer nach links warfen, doch in dem Moment, als der Satz über Suis Lippen kommt, wird auf der linken Seite eine andere Lampe angeknipst, klick, zwei Lichtquellen, wie zwei Sonnen. Rundum erleuchtet, verlieren die Dinge ihre Tiefe. Alles, was im Schatten verborgen lag, kommt zum Vorschein. Plötzlich spüre ich, wie der Schweiß aus meinen Achseln strömt, auf meiner Oberlippe und aus allen Poren perlen kleine Wassertropfen, der plötzliche Aufruhr des Meeres, und Sui entgleitet meinen Händen wie ein Fisch. Ich lächle ruhig, obwohl mir das Wasser wie ein ganzes Meer im Mund steht. Ich schlucke, aber der Hals verengt sich, noch mehr Wasser strömt hinzu. Der Mensch besteht zu fünfzig bis sechzig Prozent aus Wasser, wenn ich den Mund öffne, wird es heraussprudeln wie ein reißender Wasserfall. Wenn ich den Mund nicht öffne, ertrinke ich.
Jetzt zieht sich das Meer zurück.
»Komm«, sage ich.
Ich umarme sie. Ihr Körper ist fest und gesund, ihre Haut noch zart wie die eines Kindes. Und jetzt möchte sie bei Anton einziehen. Ich sehe ihn vor mir: groß, schlaksig, mit blonden Dreadlocks. Er trägt baumelnde Hängeohrringe, obwohl er in einem Reihenhaus in der Provinz aufgewachsen ist und Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich greife das kapitalistische System von innen an, sagt er. Sui möchte Schriftstellerin werden, sie füllt Notizbücher und wechselt ständig ihre Jobs. In ihren selbst genähten Gewändern und seltsamen weiten Hosenanzügen sieht sie aus wie eine Nymphe, die sich als Landstreicherin verkleidet hat, und man würde ihr die Verkleidung auch abnehmen, hätte sie nicht dieses ovale Gesicht, das lange dunkelbraune Haar und die Augen, die andere Menschen mit einer Mischung aus Überraschung und Mitgefühl betrachten. Diese Augen wenden sich jetzt von mir ab. Sie hinterlassen mich mit meiner Angst, allein zurückzubleiben, nackt in einem leeren weißen Raum.
Stattdessen verliere ich mich lieber in meinem Erinnerungschaos. Man kann etwas nie wieder so erleben, wie man es das erste Mal erlebt: das erste Mal, wenn man von einem Kind verlassen wird und die Sonne hinter den Wolken verschwindet.
Das erste Mal, als Sui einen Zahn verlor, so winzig, dass es kaum zu glauben war.
Das erste Mal, als ich mich verliebte, in Lone aus der Parallelklasse, ihr weicher Mund, und das Haar, so leicht und schön, es duftete nach Tannennadeln, und wenn ich ihr Lachen hörte, kribbelte es überall.
Das erste Mal, als ich Senf probierte, rohen Fisch, Kaninchen, Pferd, Rinderzunge, Passionsfrucht, ich sah die Kerne, die schleimigen Fischaugen glichen, und mir wurde schlecht. Du bist ein Idiot, sagte ich zu mir selbst – und schluckte sie herunter.
Das erste Mal, als ich übers Wasser ging, dünne, glasklare Eisschollen bedeckten den See. Mein Vater stand am Ufer und winkte mir zu, während ich in meinen Stiefeln mit der Holzsohle über das Eis schlitterte, bis in einen Bereich mit großen, blanken Pfützen. Ich stolperte, und das Wasser drang überall ein. Meine Mutter stürzte herbei und heulte wie ein verletztes Tier, aber dann stand ich auf und schlitterte weiter, und sie rief: Du kannst ja übers Wasser gehen! Der Wind zerriss ihre Stimme.
Der erste Flug, die Wolken trieben wie Wattebäusche neben dem Rumpf der Maschine über den Himmel, und ich landete in einer neuen Welt.
Das erste Mal, als ich onanierte, fast versehentlich. Ich rieb an meinem Anhängsel, das sich aufrichtete, und mein Atem beschleunigte sich im selben Takt wie mein Puls.
Das erste Mal, als ich Sui sah, die in ihrer Plastikkrippe lag wie eine Außerirdische, soeben aus der Hülle geschlüpft, in der sie erschaffen worden war.
Als Sui mich das erste Mal anlächelte, ein Kitzeln im Rückgrat vor Freude.
Als sie ihre ersten Schritte machte, mehr Freude.
Als ich sie das erste Mal allein in der Kindertagesstätte zurückließ und sich ihr Schrei wie ein Speer in meine Brust bohrte. Ich taumelte aus der Tür und umklammerte mit beiden Händen das Metall, während ich eine rote Blutspur auf dem Bürgersteig hinter mir herzog.
Als Miriam uns verließ; das ist keine Handlung, die vergeben, verwandelt und verstanden werden soll, sie soll wie eine in Stein gehauene Skulptur in einer Landschaft stehen. Ich möchte alles genau so in Erinnerung behalten, wie es war.
Als Sui unaufhörlich weinte und nach Miriam rief und ich mir das erste Mal wünschte, ich wäre eine Frau, damit ich sie wie eine Mutter in die Arme schließen könnte.
Das erste Mal, als Sui auf einem Fahrrad das Gleichgewicht fand, ein Rad aus Freudenschauern.
Als Sui ihren ersten Schultag hatte und ich Rotz und Wasser heulte vor Stolz.
Als sie ihre Menstruation bekam und ich mir das zweite Mal wünschte, als Frau geboren zu sein.
Und jetzt: Meine Tochter zieht von zu Hause aus, nichts wird mehr sein, wie es war. Wenn ich die Zeit anhalten könnte und Sui daran hindern, mich zu verlassen, würde ich es tun, aber noch in derselben Sekunde bereuen. Ich würde mich selbst in die Hand beißen oder die Hand gegen einen Küchenschrank hämmern und mir zwei Finger verstauchen, und dann würde ich kurz in mich gehen und anschließend gezwungen sein, die Zeit weiterzudrehen und Sui loszulassen. Jetzt werfe ich einen Stein in den Himmel, schließe die Augen und hoffe, dass er nicht herunterfällt und sie trifft. Der Stein fliegt durch die Luft und streift ein handgemaltes Schild mit der Aufschrift: »Hier beginnt die Vorstellung.« Ein neues Leben wartet, womöglich größer als jenes, das sie zurücklässt.
Kopenhagen, 2010
Sui
Komm zurück ins Bett. Musst du wirklich unbedingt gehen?«, fragt Anton.
»Ich bin mit meinem Vater zum Abendessen verabredet«, antworte ich.
»Aber ich brauche dich, dein Vater kann warten. Komm schon, leg dich wieder hin, nur fünf Minuten.«
»Nein, Anton, ich bin immer zu spät.«
»Wir sind jung, wir sind geradezu verpflichtet, zu spät zu kommen.«
»Und auf die Gefühle anderer zu pfeifen?«
»Ja, genau das machen wir. Aber natürlich nicht absichtlich.«
»Nein, natürlich nicht.«
»Jetzt mal im Ernst, was passiert denn schon, wenn du eine halbe Stunde zu spät kommst, wird dein Vater überhaupt jemals sauer?«
»Darum geht es nicht.«
»Er tut doch nie etwas Unerwartetes.«
»Tut er wohl.«
»Nenn mir ein Beispiel.«
»Er kann übers Wasser gehen.«
»Und ich habe magische Hände.«
»Hör auf, das kitzelt!«
»Du hast Mundgeruch.«
»Ich habe mir gerade die Zähne geputzt.«
»Du hast trotzdem Mundgeruch.«
»Komm doch mit, es gibt was zu essen umsonst.«
»Ich muss meine Hausarbeit fertig schreiben. Willst du das da anziehen?«
»Ja.«
»Sieht aus wie ein Sack.«
»Es ist schwer, die Welt zu verändern, wenn man seine Zeit mit Gedanken daran verschwendet, wie sich andere anziehen. Vielleicht schreibst du deshalb nur Hausarbeiten darüber, anstatt wirklich etwas zu unternehmen.«
»Es war nicht so gemeint, Sui, du siehst zum Anbeißen aus in dem Sack.«
»Im Hosenanzug.«
»Na gut. Hosenanzug.«
Als ich zehn Minuten später auf der Straße stehe und zum Fenster der Wohnung hinaufsehe, zieht Anton das Rollo hoch und presst hastig eine Handfläche auf die beschlagene Scheibe, dann ist er weg, und nur der Abdruck seiner Hand bleibt. Als ich mein Fahrrad aufschließe, bemerke ich, dass der Reifen platt ist. Ich überlege, ob ich den Bus nehmen soll, entscheide mich dann aber, zu Fuß zu gehen. Ich stelle mir vor, die Straße wäre ein Fluss und ich ein Fisch, der unter der Wasseroberfläche aufblitzt wie eine Messerklinge. Als ich den Fluss überquere, erfasst mich die Strömung und schiebt mich quer über die Straße. Jensen, eine Freundin meines Vaters, hat mir irgendwann einmal von Copes Regel erzählt: »Als vor 3,6 Milliarden Jahren das Leben auf der Erde begann, waren alle Organismen winzig, und es dauerte 2,5 Milliarden Jahre, bis sich ein Organismus entwickelt hatte, der größer war als eine einzige Zelle. Die Tendenz, im Laufe der Evolution einen größeren Körper zu entwickeln, ist nach dem amerikanischen Paläontologen Edward Drinker Cope benannt. Die Tiere im Meer werden allmählich größer und größer«, sagt Jensen. So was weiß sie einfach so. Und teilt das Wichtigste immer mit mir.
Jetzt gehe ich schneller. Die Straße ist wie ein Fluss voller Fische, kleine Fische mit Augen wie schwarze Kerne und Fische, die groß sind wie Autos. Ich gleite weiter den Fluss entlang, an den hohen Fenstern des Cafés vorbei, in dem ich arbeite. Durch die Scheibe sehe ich hinter dem Tresen Paris stehen, das neue Mädchen, das lustigerweise wirklich aus Paris kommt, sie trägt eine gestreifte Bluse mit einem weiten Ausschnitt, der ihr immer wieder über die linke Schulter rutscht.
Ich gehe zum Haus, die Tür ist offen. Die Küche leer.
»Papa?«
»Ich bin im Bad. Fängst du schon mal mit der Bolognese an?«
Meistens wechseln wir uns beim Kochen ab, wenn wir beide zu Hause sind. Das heißt, wir haben uns abgewechselt. Ich zupfe ein paar Blätter vom Basilikum, nehme Dosen, Fleisch und Gemüse aus dem Kühlschrank, hacke die Zwiebeln und brate sie in der Pfanne an, dann schneide ich die Tomaten mit dem japanischen Messer und gebe sie zu den Zwiebeln, das Öl spritzt. Mein Vater kommt ins Wohnzimmer, er steht mitten in unserem Haus und sieht aus, als wäre er ein Teil von allem.
»Jetzt muss sie nur noch ein bisschen köcheln«, sage ich.
»Es duftet schon«, sagt er und hängt sein nasses Handtuch über die Heizung.
Meinem Vater war es immer wichtig, dass wir so normal wie möglich wirken. Er hasst es, sich von anderen abzuheben. Deshalb haben wir seine Fähigkeit, manch kleine Krankheit mit den Händen zu heilen, immer geheim gehalten, obwohl sie uns einige Klinikaufenthalte erspart hat. »Ich kann ein inneres Ungleichgewicht beheben und Spannungen, aber keine Krankheiten, die sich im Körper niedergelassen haben«, erklärt er. Mein Vater ist Architekt, deshalb lassen sich die Krankheiten im Körper nieder, als wäre der Körper ein Haus. Unseres hat er selbst entworfen und gebaut, aber obwohl wir hier einen Großteil meiner Kindheit verbracht haben, hat es etwas Nüchternes an sich, das es unbewohnt erscheinen lässt. Über dem Tisch hängt eine PH-Lampe, die anderen Möbel sind auch Designerstücke. Es gibt keine Familienbilder, keine unnötigen Farben und Muster, es sei denn, sie fließen bewusst in die Gestaltung mit ein. Es ist das genaue Gegenteil von dem Haus, in dem Antons Mutter wohnt, wo die Blüten der vertrockneten Blumen auf die Fensterbank rieseln und die Zimmer mit Nippes, Skulpturen und Souvenirs von ihren vielen Reisen dekoriert sind. Ihr Haus ist wie ein Trödelladen, aber jeder kleine Gegenstand ist mit Gefühlen und Geschichten verbunden.
»Woran denkst du gerade?«, fragt mein Vater.
»An nichts«, antworte ich.
Madonna hat sich auf der Kokosfasermatte im Flur zusammengerollt und knurrt im Schlaf, ihr geschecktes Fell hängt schlaff herab. Jetzt öffnet sie ein Auge und sieht mich an.
Kopenhagen, 2010
Kai
In meinen Jahren als alleinerziehender Vater habe ich immer an meinem Selbstverständnis als Reisender festgehalten. Und obwohl ich nicht mehr mit dem Rucksack unterwegs bin, sehe ich mich selbst weiter als Nomade. Nach dem Gymnasium bin ich allein im Nahen Osten, in Südamerika und Afrika umhergereist. Eigentlich wollte ich nach meinem Architekturstudium wieder losziehen, aber dann wurde ich Vater. Seit Sui geboren ist, führe ich ein geregeltes Leben. Gemeinsam mit meinem Freund Finn habe ich ein Architekturbüro gegründet, was sich als gute Entscheidung erwies. Mittlerweile führen wir eine kleinere Firma, zu deren Entwürfen und Projekten alles von kleinen Anbauten bis hin zu größeren Wohnbauprojekten gehört. Um mein Fernweh zu lindern, klammere ich mich an etwas, was Jensen einmal gesagt hat: dass die Vorstellung von einem Ort oft viel interessanter ist als der Ort selbst. In den letzten achtzehn Jahren habe ich ein Zuhause geschaffen und meine Tochter großgezogen. Jetzt bin ich ein dreiundvierzigjähriger Mann mit grauen Schläfen, der allein mit seinem Hund lebt. Ich habe erst die Hälfte meines Lebens hinter mir, was also fange ich mit dem Rest an? Bin ich immer noch eine nomadische Natur, oder hänge ich in einem erstarrten Bild davon fest, wer ich bin? Ich spüre ein Kribbeln im Bauch, wenn ich daran denke, dass ich jetzt frei bin, die Welt zu erkunden, die mich umgibt. Würde ich es überhaupt wagen, wieder aufzubrechen? Ich ziehe meine Jacke an und wieder aus, nachdem ich mich im Palmengarten des Skulpturenmuseums an einen Tisch gesetzt habe. Eine tropische Riesenpflanze ist erblüht. Die Leute drängen sich um die Blüte und fotografieren und filmen sie. Die großen Blütenblätter umkränzen das samtartige Innere, und die gepuderten Stempel vibrieren wie kleine Fühler. Ihre Schönheit steht in starkem Kontrast zu ihrem Geruch, der an den Gestank von verwestem Fleisch erinnert. Die Menschen halten sich Mund und Nase zu, als könnte die Fäulnis in sie hineinkriechen und sich in ihren Atemwegen festsetzen.
Ich sitze in der hintersten Ecke des Cafés und vertreibe mir die Zeit damit, die naserümpfenden Blumenmenschen zu beobachten, als Jensen die Bühne betritt. In einem flatternden gelben Kleid, mit einem großen Strohhut auf dem Kopf und einem kleinen rot und weiß gepunkteten Halstuch schwebt sie durch den Palmengarten.
»Es macht mich immer so glücklich, dich zu sehen«, sagt sie und küsst mich auf die Wange.
Ihre Lippen sind feucht, es fühlt sich an, als würde der rote Lippenstift an meiner Wange kleben. Ich wische mit dem Handrücken darüber.
»Du hast gerade einen unbedeutenden roten Fleck bedeutend größer gemacht«, kommentiert sie. »Was gibt’s Neues aus Asien?«
»Bei jedem anderen würde ich jetzt aufstehen und gehen«, antworte ich.
»Ich werde nie müde, dich zu diskriminieren«, erwidert Jensen und lacht.
»Dabei bin ich noch nicht mal ein richtiger Asiate.«
»Nein, aber das Schlitzäugige hat sich doch unverkennbar durchgesetzt.«
Halt endlich die Klappe, würde ich am liebsten sagen, aber ich möchte sie nicht verletzen, denn so großschnäuzig sie ist, so empfindlich ist sie zugleich auch, wenn jemand ihre guten Absichten bestreitet.
»Ich überlege gerade, ob ich mit meinem alten Rucksack in die Welt hinaus reisen soll«, sage ich.
»Wirst du dann auch nach Korea fahren?«, fragt sie.
»Nein«, antworte ich.
»Es ist komisch, dass du gar nicht neugierig bist, das Land zu sehen, aus dem du kommst.«
»Das Land, aus dem mein biologischer Vater kommt. Ich habe mehr als genug von dem Koreanischen abbekommen. Ich habe wirklich keine Lust auf mehr. Mein Aussehen hat immer verhindert, dass andere mich als Dänen ansehen.«
»Wer möchte schon gern Däne sein, jetzt, wo der Freigeist abgeschafft wurde«, sagt Jensen. »Warum betrachtest du deine Lebensumstände nicht als Geschenk? Dein Vater hat dich verlassen, aber dafür hast du einen ganzen Brunnen aus Gefühlen bekommen, der nie austrocknet. Ich wünschte, ich könnte einen so tiefen Schmerz empfinden, dass ihn niemand tilgen kann, nicht einmal der, der ihn verursacht hat.«
»Ich fühle mich, als würde ich das ganze Jahr als Asiate verkleidet durch die Gegend laufen, dabei wünsche ich mir doch nur, eins mit meiner Umgebung zu werden.«
»Im Grunde beneide ich dich und Sui trotzdem.«
»Empathisch warst du noch nie.«
»Nein, eben«, sagt Jensen lächelnd.
Ich ärgere mich über ihre taktlosen Kommentare, aber ich kann meinen Zorn nie lange genug bewahren, um ihn zu äußern. Sie streckt mir ihre wohlgeformten Beine entgegen. Ihre Fingernägel, die türkis lackiert sind, trommeln auf den Tisch. Wir sind seit zehn Jahren befreundet. Obwohl sie erst dreißig ist und sich benimmt wie ein trotziger Teenie, hat sie etwas Gealtertes an sich. Ihr Gesicht ist auffallend schief, aber ihre großen Brüste und langen Beine kompensieren das. Ich könnte mich in Jensen verlieben. Aber immer, wenn ich versucht bin, mich nach ihr auszustrecken, halten mich ihre Provokationen und ihr schwerer, parfümierter Duft davon ab.
»Vielleicht bist du gar nicht zur einen Hälfte dies und zur anderen das. Vielleicht bist du eine Brücke«, sagt Jensen.
»Eine Brücke?«
»Etwas, das einen Erdteil mit einem anderen verbindet.«
»Vielleicht. Wie läuft es mit deinem Roman?«
»Ich ärgere mich darüber, dass die Wunden, die einem im Erwachsenenalter zugefügt werden, nicht tief genug sind, um in der Kindheit Wurzeln zu schlagen. Ich muss mich mit traumatischen Dingen konfrontieren, damit ich etwas zu schreiben habe. Es ist anstrengend, sich die Wunden anderer anzuziehen, daran herumzuknibbeln, damit sie nässen, bis die Geschichte fertig geschrieben ist.« Jensen spricht laut und artikuliert, ihre Brüste wogen zwischen ihr und mir im Raum.
»Du bist eine der wenigen, die vom Schreiben leben kann, die meisten anderen Autoren müssen nebenbei jobben, damit sie sich die Milch zum Kaffee leisten können.«
»Und den Wein.«
»Milch und Wein.«
Kopenhagen, 1991
Kai
Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Wie bitte?«
»Du starrst mich an.«
»Dein silbernes Kleid … hat einen magnetischen Effekt. Trägst du immer Silber?«
»Nur, wenn ich von meiner eigenen Vernissage komme. Ich bin gegen Kunstsammler allergisch, meine Galeristin zum Glück aber nicht, also ist sie geblieben, und ich bin gegangen.«
»Bist du Miriam Bang?«
»Ja.«
»Ich habe letztes Wochenende im Guardian ein Interview mit dir gelesen. Ich heiße Kai.«
»Du siehst nicht wie ein Künstler aus.«
»Nein, ich habe gerade mein Architekturstudium abgeschlossen.«
»Glückwunsch und prost! Darauf, dass du jetzt hier stehst und entzückend aussiehst.«
»Ich bin fünfundzwanzig. Ich würde mich nicht als entzückend bezeichnen.«
»Lass uns zu dir gehen.«
»Sollten wir nicht erst ein Bier trinken?«
»Ich trinke kein Bier. Gibt es etwas, was ich über dich wissen sollte?«
»Ich habe ein drittes Auge, in meiner Handfläche. Das zeige ich aber nur selten jemandem.«
»Das sieht ja wirklich aus wie ein Auge. Putzig, ein asiatischer Mann mit Fatimas Hand. Hat das einen bestimmten Nutzen?«
»Ich kann die Gedanken der Menschen sehen, sie zeigen sich mir in Bildern.«
»Und woran denke ich gerade?«
»An mich. Ich liege nackt in einem Bett.«
»Du kannst Gedanken lesen!«
»Sage ich doch.«
»Dein Blick ist unglaublich intensiv, er geht mir direkt ins Blut.«
»Ja?«
»Ja.«
Die Nacht ist kalt, der Vollmond tropfend. Das Bett ist eine Wanne, die vom Mond gefüllt wird. Die dunkellila Spitze spannt über Miriams Brüsten, der Abgrund zwischen ihnen weckt ein schmerzliches Verlangen, ihr dunkles Haar fließt auf mein Gesicht herab, und überall bilden sich kleine Schweißperlen. Ihre grünen Augen, von kräftigen schwarzen Strichen umrahmt, bohren sich direkt in meine, sie ist unwirklich und ungehemmt, ich habe noch nie jemanden getroffen wie sie. Berauscht dringe ich in sie ein, lasse ihren Körper reifen, bis ich die Energie in ihr mit einem einzigen, sanften Stoß zum Ausbruch bringe. Die Luft im Zimmer ist so feucht, dass die Scheiben beschlagen.
Ich öffne das Fenster, lege mich wieder zu ihr und vergrabe meine Finger in ihrem Haar. Mit der Wange an ihrem nackten Rücken schlafe ich ein.
Als ich aufwache, ist sie weg. Sie hat einen ausgetrockneten Salzsee auf dem weißen Laken hinterlassen, auf seiner Oberfläche glitzern kleine Silberfetzen, die sich von ihrem Kleid gelöst haben. Ich fühle mich verlassen, zerrissen und zugleich vollkommen.
Was wäre, wenn es den Menschen, der mich aus meiner Einsamkeit befreien kann, tatsächlich gibt?
Kopenhagen, 2010
Sui
Wie hat dein Vater es aufgenommen?«
»Seltsamerweise war er überrascht.«
»Jetzt bist du mein Panda.«
»Ich wohne hier, aber ich gehöre dir nicht.«
»Du bist ein ganz besonderes Tier, der einzige selbstständige Panda auf der Welt.«
»Jetzt hör endlich auf!«
»Wusstest du, dass es nur noch 1864 Pandas gibt? Sie gehören den chinesischen Behörden, die sie den Zoos ›stiften‹, aber das ist immer mit geschäftlichen Absprachen und politischen Botschaften verbunden und mit einer Klausel, dass die Chinesen jederzeit verlangen können, sie wieder zurückzubekommen.«
»Nee, das wusste ich nicht.«
»Der einzige Ort, an dem der Panda frei lebt, ist in den Regenwäldern Chinas. Ursprünglich war er ein Raubtier, hat sich jedoch zum Vegetarier entwickelt, er muss ununterbrochen etwas fressen, um genügend Energie zu haben. Genau wie du.«
»Du hörst dich wirklich gern selbst reden.«
»Ja, und ich sage: Du gehörst mir.«
»Dann gehörst du mir auch.«
»Ja.«
»Für immer?«
»Ja.«
»Und Paris?«
»Paris?«
»Aus dem Café.«
»Paris ist etwas ganz anderes.«
»Seid ihr nur Freunde?«
»Bettgefährten.«
»Anton, was machst du da eigentlich?«
»Wir führen doch eine offene Beziehung, oder nicht?«
»Doch, aber jetzt, wo wir zusammenwohnen – könnten wir das Offene da nicht sein lassen? Es wird ein bisschen kompliziert, wenn Paris in unser Bett einzieht.«
»Ganz ruhig, ich verspreche dir, dass ich sie nicht ins Schlafzimmer lasse.«
»Anton, ich habe darüber nachgedacht, ich habe meine Meinung geändert, ich glaube nicht länger an die offene Beziehung.«
»Müssen wir uns wirklich unbedingt in dieses kleinbürgerliche Denken einsperren?«
»Vielleicht bin ich tatsächlich so sterbenslangweilig.«
»Ich verstehe.«
Kopenhagen, 1991
Miriam
Sie sind in anderen Umständen«, sagt der Arzt.
»Ich kann doch gar nicht schwanger werden«, erwidere ich.
»Das dachte ich auch, aber nichtsdestotrotz sind Sie schwanger.«
»Ich habe keinen Mann.«
»Also ist der Vater unbekannt?«
»Ich weiß natürlich, wer es ist, aber ich kenne ihn nicht gut, und ich wünsche mir auf gar keinen Fall, Mutter zu werden.«
»Sie nähern sich der 12-Wochen-Grenze, wenn Sie die überschreiten, darf man nur noch in begründeten Ausnahmefällen einen Abbruch vornehmen.«
»Ich bin mir ganz sicher, ich möchte es abtreiben.«
»Ich gebe Ihnen trotzdem Bedenkzeit, ehe wir weitersehen. Denken Sie ein paar Tage darüber nach, und dann können Sie wiederkommen.«
»Das klingt vernünftig, aber es wird nichts ändern.«
»Als ich Sie das letzte Mal untersucht habe, hatten sie kaum noch Eizellen. Es muss eine Ihrer allerletzten Eizellen gewesen sein, die da befruchtet wurde.«
Ich schließe die Tür zu meinem Atelier auf, etwas Unerwünschtes wächst in mir, ein lebendiges Wesen mit einer selbstständigen Kraft. Es weckt Unbehagen. Meine Vernunft rät mir, es wegzumachen. Doch jetzt, wo es sich in mir eingenistet hat, spüre ich eine seltsame Verpflichtung, es in die Welt zu setzen. Ich wäge alle Möglichkeiten und Fluchtwege ab, bis ich eine klare Lösung vor Augen habe. Ich rufe in der Galerie an.
»Ja?«
»Vor ein paar Monaten war ein jüngerer Mann da, ein Architekt, der seine Visitenkarte hinterlassen hat, hast du die noch?«
»Ja, ich werfe nie etwas weg.«
»Könntest du mir die Adresse schicken?«
»Ja, sicher. Kann ich dir sonst noch behilflich sein?«
»Nein, das war alles.«
Kopenhagen, 1991
Kai
Darf ich reinkommen?«, fragt Miriam.
»Ja, natürlich. Ich war schon mehrmals in der Galerie. Sie wollten mir deine Nummer nicht geben, also habe ich meine hinterlassen, aber du hast dich ja nie gemeldet.«
»Ich hatte viel zu tun.«
»Möchtest du einen Kaffee?«
»Nein, danke.«
»Wein?«
»Auch nicht, danke. Ich bin schwanger.«
»Herzlichen Glückwunsch! Du wirst Mutter?«
»Ja. Und du bist der Vater.«
»Ich? Bist du sicher?«
»Seither war ich mit niemandem sonst im Bett, ich hatte wie gesagt viel zu tun.«
»Das heißt, wir werden Eltern?«
»Nein. Ich bin einundfünfzig, deshalb möchte ich das Kind nicht behalten, obwohl ich großen Respekt vor dem habe, was andere Schicksal nennen. Als ich ganz jung war, hatte ich eine Abtreibung, der Arzt hat zu viel ausgeschabt, und mir wurde gesagt, ich könnte mit hundertprozentiger Sicherheit nicht wieder schwanger werden. Seither habe ich nicht verhütet, und das war nie ein Problem. Bis jetzt.«
»Das muss eine schreckliche Nachricht sein, wenn man noch so jung ist.«
»Es ist ja lange her.«
»Es tut mir leid, dass ich in dieser Nacht nicht besser aufgepasst habe, sonst wären wir jetzt nicht in dieser Situation.«
»Wärst du denn gerne Vater?«
»Ja, aber ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt.«
»Ich möchte das Kind wie gesagt nicht behalten. Die Karriere stand für mich immer an erster Stelle, daran wird auch die Schwangerschaft nichts ändern, und ich eigne mich auch nicht als Mutter.«
»Es gibt doch ganz unterschiedliche Mütter?«
»An diesem Punkt meiner Karriere würde mich ein Kind alles kosten, das Risiko kann ich nicht eingehen. Andererseits will ich mich dem Schicksal auch nur ungern völlig entgegenstellen, aber ich hätte einen Vorschlag: Wenn ich auf die Mutterschaft verzichte, würdest du das Kind dann adoptieren?«
»Das … Ich weiß es nicht genau. Ich muss darüber nachdenken.«
»Ja, natürlich.«
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich sie wiedersehen würde, aber jetzt sitzt sie hier auf meinem Sofa, das Haar ballt sich wie eine Wolke um ihr Gesicht, ihre stark geschminkten Augen verleihen ihr einen intensiven Blick, sie ist wahnsinnig attraktiv, und obwohl wir uns in einer so heiklen Situation befinden, kann ich nicht aufhören, sie in Gedanken auszuziehen. Ein Teil von mir wünscht sich nichts anderes, als noch einmal dieses Gefühl von Vollkommenheit zu erleben, in dem sie mich zurückließ. Und dann diese überrumpelnde Nachricht, dass ich sie geschwängert habe. Wünsche ich mir wirklich ein Kind?
Kopenhagen, 1991
Kai
Ich kann meine Mutter vor mir sehen, ganz gleich, ob ich die Augen offen oder geschlossen habe. Ich habe sie intensiv beobachtet, ihre Bewegungen und ihre Worte nachgeahmt. Ich habe mich im Zorn von ihr abgewandt, ihre Werte verhöhnt, um sie dann langsam wieder anzunehmen. Vor einem Jahr ist sie in ihr jütländisches Heimatdorf zurückgezogen, und jetzt entwickelt sich unsere Beziehung in langen Telefonaten. Ihre Stimme klingt mittlerweile wie unter Wasser, undeutlich und sanft. Sie ist schwer krank, die Ärzte geben ihr nur noch drei Monate. Als sie das zu mir sagte, fröstelte ich innerlich und war verzweifelt. Ich bat sie darum, zu mir zu ziehen, aber sie sagte, jetzt sei sie endlich nach Hause gekommen.
»Das Schlimmste daran, allein zu wohnen, ist die Langeweile, aber dann rufst du mich an und unterhältst mich mit den Geschichten aus deinem Leben. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz, und ich liebe dich, aber ich möchte dort sterben dürfen, wo mein Leben auch anfing.«
»Mich schmerzt der Gedanke, dass du allein und krank bist«, sage ich.
»Wenn die Zeit gekommen ist, kannst du mich besuchen«, antwortet sie.
In mancherlei Hinsicht ist es auch eine Erleichterung, dass ich einfach weiterleben kann, dass sie nicht versucht, mich an sich zu binden wie ein Kind an einen Baum. Gleichzeitig macht es mich seltsam traurig, dass ich in ihrem Leben entbehrlich bin, und mir wird bewusst, dass ich ihren Rat immer noch brauche, dass ich mich an ihre Stimme anlehnen muss. Ich bin noch längst nicht bereit, sie loszulassen.
»Kann man es überhaupt verantworten, allein ein Kind zu bekommen?«, frage ich.
»Es ist hart, ein alleinerziehender Vater zu sein, und du bist erst fünfundzwanzig. Es wird dein Leben unweigerlich radikal verändern«, sagt sie. »Andererseits bereut man ja nicht die Kinder, die man bekommen hat, sondern nur die, die man nicht bekommen hat.«
Ob sie es bereut, keine anderen Kinder als mich bekommen zu haben, jetzt, da sie weiß, dass sie bald sterben wird?
»Ich liege ja die meiste Zeit des Tages nur hier herum, aber so habe ich eine Menge Zeit, mir meine künftige Enkelin vorzustellen, ihre winzigen Finger, die meine umschließen. Ich würde sie so gerne noch kennenlernen.«
»Oder ihn«, sage ich.
»Es wird ein Mädchen«, sagt sie.
Jetzt ist ihre Stimme ganz dünn und zart, und sie verschwindet, aber kurz darauf ist sie wieder da.
»Wenn du recht hast, werde ich sie nach dir benennen.«
»Susanne ist vielleicht ein bisschen altmodisch«, antwortet sie.
»Ich mag den Namen«, erwidere ich.
»Was ist mit Sus, das hat etwas vom Sausen des Windes. Ein Name verankert einen, aber man darf auch nie vergessen, dass es nur ein Name ist, man kann ihn immer ändern. Dein Vater hat sich Kai genannt, als ich ihn kennenlernte, und diesen Namen hat er an dich weitergegeben. Es gibt ihn in verschiedenen Kulturen. Auf Japanisch bedeutet er Erde, Geist, Drache und Liebe. Auf Thailändisch ›der, der Hühnereier verkauft‹, auf Kreolisch ist Kai ein Haus, und auf Hawaiianisch ist es ein Wort für Meer.«
»Ich könnte sie Sui nennen.«
»Sui?«
»Nach dir. Und einem Lied von den Sneakers, über Sui, die von zu Hause wegläuft. ›Niemand weiß, wo sie hinwill, die Stadt wischt ihre Spuren aus. Sie schießt wie ein Pfeil in die Welt hinaus‹«, singe ich in den Hörer.
»Du hast dich schon entschieden«, sagt sie.
»Ja«, sagt mein Mund.
Als mir die Antwort entfährt, weiß ich, dass sie recht hat. Ich hatte mich schon in der Sekunde entschieden, in der Miriam mir erzählte, dass sie schwanger war. Aber erst jetzt sickert es in mein Bewusstsein. Ich fliege förmlich zur Tür hinaus, der Sui-Song geht mir nicht mehr aus dem Kopf, sein Text ist banal, und obwohl ich das Lied schon lange nicht mehr gehört habe, kenne ich es auswendig. Während ich zur Galerie fahre, berauscht mich die Freiheit des Liedes. Als ich davor parke, tritt Miriam gerade heraus. Ich kurble das Fenster herunter und pfeife, und sie entdeckt mich und kommt zum Auto.
Kopenhagen, 2010
Suis Notizen
Gesang
Wenn etwas in einem singt. Ein Teil von einem größeren epischen Gedicht. Musik mit der Stimme hervorbringen oder etwas mit einer heftigen Wucht treffen, aus aller Kraft, sodass der Schmerz im Schädel singt oder in den Knochen. Oder Töne von sich geben wie Vögel, Insekten und manche Säugetiere; flöten, trillern, gurren, schnarren, schnattern, klappern, krähen, kreischen; oder einen langen, pfeifenden Laut ausstoßen. In einer finnischen Studie wurden 1200 Menschen befragt, wie oft sie einen Ohrwurm hätten, und 90 Prozent antworteten: mindestens einmal pro Woche.
Chorgesang
Ein Ensemble aus Sängern, die ein- oder mehrstimmig singen. Das Wort Koralle erinnert an Choralis, was Chorgesang bedeutet. Ein Ensemble aus Korallen bildet ein Korallenriff, eine pflanzenähnliche Formation aus Skeletten; tote Seebäume, Totenhände und Augenkorallen, hart wie Stein.
Stein
Ein Stein ist ein kleineres Stück harten geologischen Materials. Wenn der Stein kleiner als zwanzig Millimeter ist, nennt er sich Kiesel, nach oben hin ist die Grenze fließender, ein Stein kann so groß wie ein Berg sein. Ein großer Stein kann einen Ort oder eine historische Begebenheit markieren. Der harte Kern einer Frucht. Ein Kristallklumpen in einem Organ. Ein Hoden ist ein Stein in einem Sack. Man kann ein Herz aus Stein haben, und es kann einem ein Stein vom Herzen fallen. Man kann den Stein der Weisen finden, einen Stein erweichen und Steine zu Brot machen, den ersten Stein werfen und eine Lawine auslösen, einen Stein auf den anderen setzen, wie ein Stein schlafen oder Steine ins Rollen bringen. Wenn man jeden Stein umgedreht hat, sodass alle Steingesichter zum Himmel schauen, wird die Welt so entblößt, wie sie wirklich ist.
Kopenhagen, 1991
Kai
Ich fliege förmlich aus dem Auto und eile Miriam entgegen. Sie ist von mehreren Schichten bunten Lichts umgeben, als wäre sie in einen Regenbogen gekleidet, und ich trete in die Farben hinein und lege die Arme um sie. Sie trägt ein Kleid in dunklem Orange, ihr Blick ist von schwarzen Strichen umrahmt, und die Lippen, die sie mit der Zunge befeuchtet, glänzen; ich denke: Sie trägt unser Kind in sich. Miriam entzieht sich meiner Umarmung und weicht einen Schritt zurück.
»Kai, was machst du hier?«
»Ich habe eine gute Nachricht: Ich möchte gern Vater werden.«
»Ja?« Miriam lächelt. »Und Mutter.«
»Wir können doch zusammen Eltern sein, obwohl wir getrennt leben.«
»Ich habe genug damit zu tun, mit mir selbst klarzukommen.«
»Glaubst du, du kannst ein Baby verlassen, das du neun Monate in dir getragen hast?«
»Es wird bestimmt Spuren in mir hinterlassen, vielleicht sogar ein Trauma verursachen, aber wir Menschen besitzen ein einzigartiges Talent, uns anzupassen, und mir fällt es verhältnismäßig leicht, solche Sachen zu verdrängen.«
»Ich kann den Gedanken nicht einmal denken, ohne dass es mich in der Brust schmerzt.«
»Deshalb eignest du dich auch für die Elternrolle. Ich bin ein eher abgestumpfter Mensch. Aber dafür eine überragende Künstlerin.«
»Du wärst vielleicht eine unkonventionelle Mutter, aber heutzutage kann man durchaus beides sein, eine überragende Künstlerin und ein liebevoller Elternteil, ich selbst bin schließlich auch ein ausgezeichneter Architekt.«
»Es ist ein entscheidender Unterschied, ob man im eigenen kleinen Land Erfolg hat oder einen weltweiten Durchbruch erleben will. Letzteres erfordert bedingungslose Hingabe, und dabei ist ein Kind nur im Weg.«
»Im Weg?«





























