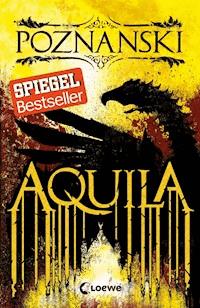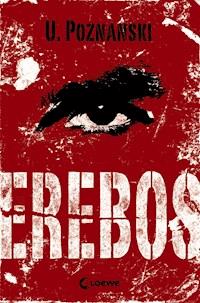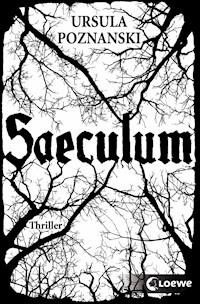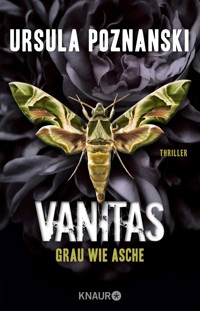
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Vanitas-Reihe
- Sprache: Deutsch
Seit wann muss man auf dem Friedhof um sein Leben fürchten? Der Thriller von Ursula Poznanski um die Wiener Blumenhändlerin jetzt im Taschenbuch: die Fortsetzung zu VANITAS - Schwarz wie Erde! Carolin ist zurück in Wien, zurück in der Blumenhandlung am Zentralfriedhof. Sie weiß, dass ihre Verfolger sie nicht mehr für tot halten, doch wie es aussieht, haben sie ihre Spur in München verloren. Kaum beginnt sie sich wieder ein wenig sicherer zu fühlen, wird der Friedhof von Grabschändern heimgesucht. Immer wieder werden nachts Gräber geöffnet, die Überreste der Toten herausgeholt und die Grabsteine mit satanistischen Symbolen beschmiert. Nicht lange, und auf einem der Gräber liegt eine frische Leiche – ist jemand den Grabschändern in die Quere gekommen? Die öffentliche Aufmerksamkeit und das Polizeiaufkommen rund um den Friedhof sind Carolin alles andere als recht – doch fast noch mehr irritiert sie ein junger Mann, der seit kurzem täglich den Blumenladen besucht. Nach außen hin gilt sein Interesse ihrer Kollegin, doch in Carolin wächst der Verdacht, dass er in Wahrheit hinter ihr her ist. Sie entschließt sich zu einem folgenreichen Schritt ... Ursula Poznanski, Autorin der Erebos-Megaseller, beglückt ihre Leser mit einem Bestseller rund um die Sprache der Blumen. Die Presse zu VANITAS - Grau wie Asche: »Echt raffiniert: eine Story, die von unerwarteten Entwicklungen lebt und mit ihrem morbiden Handlungsort fasziniert.« Für Sie »Was Poznanski mit dem ersten Satz verspricht, das hält sie – die Spannung reißt bis zur letzten Seite nicht ab.« Kronenzeitung »... und am Ende des Buches baut sie einen Cliffhanger ein, sodass man sehnsüchtig Band drei herbeisehnt." Wiener Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ursula Poznanski
VANITAS
Grau wie Asche Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Carolin Bauer hat es vorerst geschafft. Sie ist zurück in der Blumenhandlung am Wiener Zentralfriedhof. Ihre Verfolger wissen: Sie ist am Leben. Doch wie es aussieht, haben sie ihre Spur in München verloren.
Kaum beginnt Carolin sich wieder ein wenig sicherer zu fühlen, wird der Friedhof von Grabschändern heimgesucht. Immer wieder werden nachts Gräber geöffnet, die Überreste der Toten herausgeholt und die Grabsteine mit satanistischen Symbolen beschmiert. Nicht lange, und auf einem der Gräber liegt eine frische Leiche – ist jemand den Grabschändern in die Quere gekommen?
Die öffentliche Aufmerksamkeit und das Polizeiaufkommen rund um den Friedhof sind Carolin alles andere als recht – doch fast noch mehr irritiert sie ein junger Mann, der seit Kurzem täglich den Blumenladen besucht. Nach außen hin gilt sein Interesse ihrer Kollegin, doch in Carolin wächst der Verdacht, dass er in Wahrheit hinter ihr her ist. Sie entschließt sich zu einem folgenreichen Schritt …
Inhaltsübersicht
Prolog. Park.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Brücke
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Autobahnparkplatz
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Zweiter Stock
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Prolog. Park.
Der Mann lag bäuchlings im Gras und atmete in unregelmäßigen Zügen die kühle Nachtluft ein. Durch den Mund, denn die Nase hatte die größte der drei Gestalten ihm schon mit dem ersten Schlag gebrochen. Er hatte das Knacken gehört und gespürt, wie Blut ihm über die Lippen lief; der nächste Fausthieb hatte ihn zu Boden gestreckt, seine Brille war davongeflogen, die Welt hatte ihre Konturen verloren.
Der Überfall war aus dem Nichts gekommen, kaum fünfzig Meter von seiner Haustür entfernt. Tagsüber war dieser Park von spielenden Kindern und Spaziergängern bevölkert, aber nachts war hier menschenleeres Niemandsland.
Bisher war kein Wort gefallen. Mit leisem Stöhnen hob er den Kopf, sah ein Paar schwarze Stiefel mit dicker Sohle, abgewetzt. »Bitte«, murmelte er, »meine Geldbörse steckt in der rechten Jackentasche. Mein Handy auch. Nehmen Sie es einfach.«
Der Tritt gegen die Rippen kam blitzschnell; der Mann hörte sich selbst aufkeuchen, er krümmte sich.
»Deinen Scheiß kannst du behalten«, erklärte eine tiefe Stimme über ihm.
Sie wollten ihn nicht ausrauben, das war übel. Obwohl nun jeder Atemzug schmerzte, richtete er sich ein Stück auf. »Was möchten Sie dann?«
Zwei der Angreifer wechselten einen schnellen Blick. Ohne seine Brille sah er die Welt nur als verschwommene Anordnung von Farbflecken, aber trotz dieser Tatsache und trotz der dürftigen Parkbeleuchtung war er sicher, zwei Dinge erkannt zu haben: Die drei Gestalten, die über ihm aufragten, hatten die Gesichter verhüllt; vielleicht trugen sie auch Masken. Und der Mittlere der drei, der mit der tiefen Stimme, der ihn getreten hatte, hielt etwas in den Händen, das wie eine lange Eisenstange aussah.
»Du hast ein schönes Leben, nicht wahr?«, stellte der jetzt fest. »Das Haus da drüben ist deines?«
»Ja.«
»Erstaunlich für jemanden wie dich. Aber ich glaube, wir wissen, wie du das gemacht hast.« Er ging in die Hocke, brachte das verhüllte Gesicht nah an das seines Opfers.
Skimasken, dachte der Mann. Und spiegelnde Sonnenbrillen. »Du bist einen Pakt mit dem Teufel eingegangen, und es hat sich gelohnt für dich. Dumm nur, dass die, die sich mit dem Teufel einlassen, am Ende immer in der Hölle landen.«
»Aber ich habe nicht …«
In einer einzigen raschen Bewegung hatte der andere sich aufgerichtet und ließ die Eisenstange durch die Luft zischen. Das Geräusch, mit dem sie die Schulter des Mannes zerschmetterte, war ekelerregend, der Schmerz übertraf alles, was er bisher gekannt hatte. Er heulte auf und fühlte im nächsten Moment, wie jemand sein Haar packte und ihm den Kopf in den Nacken riss.
»Du erzählst uns jetzt Details«, sagte die tiefe Stimme, »dann tut es nicht mehr lange weh.«
»Ich weiß nicht, was …«
Der nächste Schlag traf seine Hüfte, der übernächste den Rücken. Wieder schrie er auf, und der Mann mit der Skimaske drückte ihm das Gesicht ins Gras. Einer der beiden anderen, kleiner und schmaler, trat hinzu. »Ganz ruhig, Arschloch. Du weißt, was wir von dir wollen. Vielleicht weißt du sogar, wer wir sind? Erinnerst du dich nicht mehr an die alte Hilde?«
Wieder wurde sein Kopf am Haar hochgezogen. Der kleinere Mann hatte Brille und Maske abgenommen.
Nein, da war nichts Bekanntes. Nichts Vertrautes. Auch wenn er natürlich wusste, worauf sein Angreifer hinauswollte. Oh Gott, er hatte so sehr gehofft, dass das niemals passieren würde. »Ich kenne Sie nicht«, keuchte er. »Ich habe Sie noch nie gesehen.«
Die Hand ließ los, sein Kopf plumpste ins Gras. »Das ist traurig, nicht?«, sagte der Erste. »War aber zu erwarten. Und es spielt überhaupt keine Rolle. Wir unterhalten uns jetzt ein wenig über die Hölle.«
1.
Ich merke schon, dass etwas nicht stimmt, als ich um Punkt sieben Uhr morgens den Zentralfriedhof betrete. Heute durch Tor 11. Ich habe mir angewöhnt, nie zwei Tage hintereinander denselben Weg zu nehmen. Nicht mehr, seit die falschen Leute wissen, dass ich noch am Leben bin.
Normalerweise ist um diese Zeit alles ruhig, man hört höchstens die Bagger, die erste Gräber ausheben, aber heute hastet ein Friedhofsmitarbeiter im Arbeitsoverall an mir vorbei, auf den Ausgang zu. Seine Miene ist starr, er würdigt mich keines Blickes.
Alarmiert sehe ich mich um, doch der alte jüdische Friedhof, neben dem ich mich befinde, ist verlassen. Hier schmieren immer wieder mal Idioten Hakenkreuze auf die Grabsteine, doch darum scheint es heute nicht zu gehen. In einiger Entfernung kann ich Polizeisirenen hören.
Ich beschleunige meine Schritte, allmählich kann ich den Ort des Geschehens erahnen. Gruppe 16D, dort hat sich eine etwa zehnköpfige Menschentraube gebildet, alles Leute, die auf dem Friedhof arbeiten und schon vor dem Öffnen der Tore Zugang haben. Ich erkenne Albert und Milan – zwei der Totengräber – und eine Baumpflegerin, die anderen sind vermutlich Saisonarbeiter. Drei oder vier haben ihre Handys gezückt und fotografieren. Einer der anderen Totengräber schüttelt den Kopf und wendet sich ab.
Das Atmen fällt mir schwerer. Es sieht ganz so aus, als wäre etwas wirklich Ungewöhnliches passiert, und das lässt mich automatisch denken, dass es mit mir zu tun haben muss.
Ich bin jetzt fast da. Die Ursache für den Menschenauflauf befindet sich offenbar in Reihe sieben und scheint eines der Gräber dort zu betreffen. Ich sehe den Grabstein nur von hinten, aber ganz offensichtlich liegt etwas obenauf.
Ohne jede Neugierde, nur voller dunkler Vorahnungen steuere ich auf das Grab zu. »Was ist denn los?«, frage ich heiser, doch anstelle einer Antwort rücken die anderen ein Stück zur Seite, damit ich besser sehen kann.
Das Szenario ist schaurig, es hat etwas Unwirkliches. Mit Sicherheit bin ich die Einzige hier, die bei dem Anblick nicht Entsetzen, sondern Erleichterung empfindet. Was hier passiert ist, hat mit mir nichts zu tun.
Jemand hat das Grab geöffnet. Nicht nur das Grab, auch den Sarg; er wurde zertrümmert, morsche Holzteile wurden nach oben geworfen, und der Tote …
Es ist sein Kopf, der auf dem Grabstein liegt. Vollständig skelettiert, ein paar Haare kleben noch auf der Schädeldecke. Ich kann nicht gleich erkennen, was da zwischen den gelblichen Zähnen steckt, doch auf den zweiten Blick wird mir klar, dass es sich um einen abgeschnittenen Hühnerkopf handelt. Der Körper des Tieres liegt in der Grube, auf den Resten der Leiche, zwischen Stofffetzen und den verbliebenen Trümmern des Sargs.
Ich gehe ein Stück zur Seite, stelle mich neben einen Haufen ausgehobener Erde, aus dem ein Knochen herausleuchtet. Auf dem Grabstein finden sich drei Namen: Karl, Theresa und Roland Klessmann; die Inschriften sind schwer zu lesen. Nicht weil sie schon so verblasst wären, sondern weil jemand den hellgrauen Marmor des Grabsteins mit roter und schwarzer Farbe beschmiert hat. Ein Pentagramm, darunter ein Omega, zweimal die Zahl 666 und ein Symbol, dessen Bedeutung ich nicht kenne. Liegende Achten und ein Kreuz. Das, was zerquetscht daneben klebt, sind wohl die Organe des toten Huhns.
Die Polizeisirenen heulen nun in unmittelbarer Nähe, im nächsten Moment verstummen sie. Zeit für mich, zu verschwinden. Ich will nicht befragt werden, ich will in keinem Protokoll auftauchen, sondern mich in der Blumenhandlung verschanzen.
Mit gesenktem Kopf mache ich mich auf den Weg. So schauderhaft das Bild auch ist, das sich bietet, es hätte viel schlimmer kommen können. Der exhumierte Tote hat nichts mit mir oder meiner Vergangenheit zu tun; sollte die Grabschändung eine Drohung sein, richtet sie sich gegen jemand anderen. Aber wahrscheinlich haben nur ein paar besonders dämliche Jugendliche ein pseudo-satanistisches Ritual abgehalten. Ich frage mich, an welcher Stelle sie über die Friedhofsmauer geklettert sind, ohne Leiter geht das nämlich nirgends.
Das Bild des Schädels mit dem Huhn zwischen den Zähnen lässt mich nicht los, während ich den Friedhof durchquere. Logisch überlegt, muss der Tote Roland Klessmann gewesen sein. 1937–2004, von den drei Personen im Grab war er der Jüngste und somit der, der zuoberst lag. Die anderen beiden sind bereits über vierzig Jahre tot; von ihnen kann nichts mehr übrig sein.
Ich schließe die Blumenhandlung auf und hinter mir sofort wieder ab – wir öffnen erst um acht, und bis Eileen, Matti und vielleicht auch Paula aufkreuzen, möchte ich friedlich Kaffee trinken.
Die Espressomaschine im Hinterzimmer erwacht auf Knopfdruck zum Leben, fauchend und zischend. Durch die trüben Fensterscheiben sehe ich einen Wagen vor dem Haupteingang parken und drei Männer aussteigen. Ich würde wetten, dass es Polizisten sind. Keiner trägt Uniform, aber die Art, wie sie sich umsehen, die Zielstrebigkeit ihrer Bewegungen ist mir vertraut.
Als Nächstes werden Journalisten eintreffen.
Der Gedanke vertreibt sofort jeden Ansatz von Entspanntheit. Ich ziehe mich mit meinem Kaffee und dem Bestellbuch in den düstersten Winkel der Werkstatt zurück und blättere die heutigen Aufträge durch: Grabgestecke, Kränze, ein großes Herz aus roten Rosen. Das soll Eileen übernehmen, sie trifft sich seit zwei Wochen mit einem ganzkörpertätowierten Maschinenschlosser und ist so verliebt, dass es kaum auszuhalten ist.
Der Kaffee ist heiß und bitter. Ich frage mich, wie lange die Grabschänder gebraucht haben, bis sie auf den vermoderten Sarg plus Inhalt gestoßen sind. Sie müssen mit Spaten gearbeitet haben, also wohl mehrere Stunden. Es ist Juni, der Boden ist weich, trotzdem erfordert es Kraft und Ausdauer, ein solches Loch auszuheben, das heißt …
Die Ladentür wird aufgesperrt; Matti und Eileen treten gemeinsam ein. Sie wirken fröhlich. »Caro, du bist schon wieder so früh da? Hast du die Maschine angelassen?«
Ich deute nickend auf den Vollautomaten. »Und Wasser nachgefüllt.«
Eileen nimmt sich ihre Tasse aus dem Regal. »Weißt du, was draußen los ist? Da parken zwei Sendewagen, wird wieder irgendwas gedreht heute?«
Ihre Frage kommt nicht von ungefähr, der Zentralfriedhof ist ein beliebtes Filmset. »Nein. Jemand hat letzte Nacht ein Grab geöffnet und den Grabstein beschmiert. Ich bin zufällig vorbeigegangen, Gruppe 16D. Sieht nach satanistischem Ritual aus – Pentagramme, ein totes Huhn und verstreute Leichenteile.«
Eileens Augen sind groß geworden. »Ist ja abartig.« Sie zaust sich durchs pechschwarze Haar und nimmt den Rucksack von den Schultern. »Denkst du echt, hier sind Teufelsanbeter unterwegs?«
»Sieht ganz so aus.« Ich versuche, ein wenig mehr Erschrockenheit in meine Stimme zu legen. Weniger abgebrüht zu wirken. Tatsächlich finde ich die Inszenierung am Grab der Familie Klessmann bloß geschmacklos. Das Opfer der Aktion war bereits tot, man konnte es weder quälen noch ein zweites Mal töten. Und ein Pentagramm ist nichts weiter als ein paar Striche, die einen Stern bilden. Aber mir ist klar, dass meine gelassene Sicht der Dinge nicht normal ist.
Matti reagiert bloß mit finsterem Kopfschütteln. »Idioten«, murmelt er. »Vandalen. So einen würde ich gerne einmal erwischen …« Er drückt die Rosenschere mehrmals zusammen. Das Geräusch lässt mich schaudern, mehr als der Anblick des Totenschädels auf dem Grabstein. Ich habe nicht vergessen, dass man mit solchen Scheren Finger abtrennen kann.
Besser, ich widme mich dem ersten Kranz des heutigen Tages. Weiße Lilien und rosa Nelken über Fichtenzweigen und Palmenblättern. Am Anfang steht immer das Köpfen der Blumen und das Präparieren der Stängelreste mit Draht, damit man die Blüten später in den Kranzrohling stecken kann.
Dieser Teil der Arbeit erfüllt mich jedes Mal mit einer Mischung aus Langeweile und leisem Bedauern, ich beherrsche die Handgriffe im Schlaf, meine Gedanken schweifen ab. Geköpfte Blumen, geköpfte Hühner. Ein kunstvoll auf den Grabstein drapierter Totenschädel.
Zufall, dass es dieses Grab erwischt hat? Ich kenne mich mit Satanisten und ihren Gebräuchen nicht aus, aber ich gehe davon aus, dass Zahlen und Symbole eine große Rolle spielen. Vielleicht liegt es an der Nummer der Grabstelle oder einem der Todesdaten.
Vielleicht aber auch daran, dass die Klessmanns in einem Teil des Friedhofs beerdigt sind, von dem aus Arbeitsgeräusche nicht bis nach draußen dringen.
Theoretisch kann es tausend Gründe dafür geben, dass die Hühner schlachtenden Satansjünger ausgerechnet dieses Grab gewählt haben, aber das ist wirklich nicht mein Problem. Ich greife nach der nächsten Lilie. Ich sollte einfach nur froh sein, dass es nicht mein Kopf war, den man auf einem der Grabsteine gefunden hat.
Mit der stumpfsinnigen Vorbereitungsarbeit bin ich fertig, nun geht es ans Stecken. Ich greife nach dem Kranzrohling – Stroh mit grünem Vlies überzogen – und arbeite gegen den Uhrzeigersinn. Es ist schön, mit den Farben zu spielen, das Muster wachsen zu sehen …
»Kann jemand vorne die Kasse übernehmen?«, unterbricht Matti meine Konzentration. »Ich würde … also, ich muss kurz nach draußen. Caro? Eileen?«
Wir wechseln einen stummen Blick. »Okay.« Eileen wischt sich seufzend die Hände an der Schürze ab und betrachtet mit Bedauern ihr eben begonnenes Rosenherz. »Aber beeil dich, die Blumen müssen bald zurück ins Kühlhaus.«
Ohne ein weiteres Wort läuft Matti aus dem Laden. Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen; wie ich ihn kenne, will er zumindest einen kurzen Blick auf das geschändete Grab erhaschen, um später mitreden zu können. Vielleicht hätte ich ihm zuliebe doch ein Handyfoto schießen sollen, denn jetzt wird ihm wohl die Polizei die Sicht versperren.
Als mein Kranz fertig ist, winke ich Eileen in die Werkstatt zurück. »Ich kümmere mich um die Kunden und du dich um dein Herz, okay?«
Sie strahlt mich an. »Sehr zweideutig, Caro!« Sie macht sich sofort an die Arbeit, singt dabei etwas Undefinierbares, in dem immer wieder das Wort »Crown« vorkommt.
Während ich einer älteren Dame gelbe Rosen zu einem Strauß binde, einem bärtigen Mann zwei Biedermeiersträußchen verkaufe und telefonisch eine Bestellung für ein Trauergesteck aufnehme, behalte ich den Parkplatz und die Straße vor unserem Geschäft im Auge. Tatsächlich stehen zwei Sendewagen da, ebenso das Auto, in dem vorhin die drei Polizisten angekommen sind.
Ich wünschte, sie würden bald abziehen. Wahrscheinlich ist es Unsinn, aber sobald der Zentralfriedhof öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, habe ich das Gefühl, sichtbarer zu werden. Für die falschen Leute.
Ich dränge den Gedanken sofort beiseite, weiß aber, dass er spätestens am Abend wie ein Bumerang zu mir zurückkehren wird. Immer, wenn ich alleine zu Hause sitze, rücken die Gespenster näher an mich heran. Die lebenden und die toten.
Seit über fünf Wochen bin ich nun wieder in Wien, und bisher ist alles verdächtig ruhig geblieben. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, alles andere wäre unlogisch.
Aus Gründen, die ich nicht verstehe, hat Robert den Kontakt zu mir abgebrochen. Der Strauß Tagetes, den er mir geschickt hat, war das letzte Lebenszeichen. Ich habe sie mit einem Stück Schnur in die Küche gehängt und trocknen lassen; dort hängen sie immer noch, als tägliche Mahnung. Totenblumen. Ich habe Robert zehn E-Mails geschickt, plus drei Sträuße, die seinem aufs Haar glichen, um eine Erklärung für seine Botschaft zu bekommen. Ohne Erfolg. Vielleicht ist er ja selbst tot.
Die Zeit seither habe ich jedenfalls genutzt. In dem Bewusstsein, dass die Karpins jeden Tag hier auftauchen könnten, habe ich Vorbereitungen getroffen. Die Barrett, die ich in München zurücklassen musste, habe ich ersetzt. Ein relativ teurer Deal übers Darknet hat mir eine Cadex Kraken eingebracht, ein kanadisches Snipergewehr in Matschbraun. Als Draufgabe habe ich mir eine Pistole geleistet, eine Walther P99, mit der ich üben sollte, ich weiß bloß nicht, wo ich das ungestört tun könnte. Derzeit betrachte ich sie eher wie einen Talisman, wie ein Amulett, das durch seine bloße Existenz alle Übeltäter fernhalten soll.
Außerdem besitze ich seit zwei Wochen ein Auto. Einen Fluchtwagen für den Notfall. Er ist zwar alt, und der schwarze Lack blättert ab, aber alles funktioniert. Zudem ist es einer dieser wundervoll unauffälligen Japaner, denen keiner einen zweiten Blick schenkt.
Dieser Shopping-Anfall der anderen Art hat mich über die letzten Wochen gebracht und mir die Illusion vermittelt, ich wäre meinem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert. Als später die Panik wieder in tsunamihohen Wellen über mich hinwegspülen wollte, war das Auto mein bester Freund. Durch die Ausfahrten über den Stadtrand hinaus habe ich etwas entdeckt, das von unschätzbarem Wert für mich ist, und ich muss es nicht mal kaufen.
Ich bin dabei, zwei Frühlingssträuße für einen Herrn mit Hut zusammenzustellen, als Matti zurückkehrt. Ihm ist anzusehen, dass der Ausflug nicht sehr erfolgreich gewesen sein kann. »Sie haben einen Sichtschutz aufgebaut, fast ein Zelt«, murrt er, kaum dass der Kunde wieder draußen ist. »Milan hat gesagt, das war ein Voodoo-Ritual.«
»Glaube ich nicht.« Ich lege zwei Scheine in die Kasse. »Eher so eine Art Teufelsbeschwörung. Lass es dir von Albert zeigen, der hat wie wild fotografiert.«
Matti ist sichtlich hin- und hergerissen zwischen Neugier und seinem merkwürdigen Ehrgeiz, selbst derjenige sein zu wollen, der Neuigkeiten unters Volk bringt. »Ist ja auch egal«, stellt er fest und macht sich wieder an die Arbeit.
Gegen eins verschwinden die Autos der TV-Sender, gegen drei der Polizeiwagen. Ich warte bis halb sechs, dann mache ich mich auf den Weg.
Diesmal ist es reine Neugier, die mich den Weg zu Tor 11 einschlagen lässt. Natürlich nicht direkt, ich gehe einen großen Bogen, bis ich die Stelle mit dem geöffneten Grab aus weiter Entfernung sehen kann.
Gruppe 16D liegt verlassen da, alle Handyfotos sind geschossen, alle Ermittlungsschritte erledigt. Dann kann ich eigentlich noch einen schnellen Blick auf den Grabstein werfen. Das unbekannte Symbol fotografieren. Ich würde zu gerne wissen, was es bedeutet.
Man hat die Grube zugeschüttet und den Totenschädel entweder zu Spurensicherungszwecken mitgenommen oder wieder beerdigt. Ein Fetzen rot-weißes Absperrband liegt neben der Grabeinfassung. Die Schmierereien sind noch da, die wird jemand mit Spezialreinigungsmittel entfernen müssen. Ein Pentagramm, die dreifache Sechs. Und dieses Zeichen, das ich noch nie gesehen habe. Es erinnert an ein Unendlichkeitszeichen, in dem ein Kreuz steckt – oder ein Schwert?
Ich öffne die Kameraapp meines Handys. Stelle scharf, drücke ab. Im gleichen Moment tritt jemand neben mich, so plötzlich, als hätte er sich aus dem Nichts materialisiert.
Ich springe reflexartig zur Seite, kann nur mit Mühe einen Schrei unterdrücken, das Telefon rutscht mir beinahe aus der Hand.
»Oh, tut mir leid«, sagt der Mann und bemüht sich, nicht zu lachen. »Tja, das ist meine übliche Wirkung auf Frauen.«
Meine Hände zittern, und obwohl ich eine mit der anderen festhalte, bemerkt er es. Sein Gesicht wird ernst. »Das wollte ich nicht. Entschuldigung. War ich so leise, dass Sie mich nicht kommen gehört haben? Es war nicht meine Absicht, mich anzuschleichen, ich wollte Sie wirklich nicht erschrecken.«
Ich nicke stumm, fassungslos, dass mir das passieren konnte. Ich bin normalerweise so vorsichtig, immer darauf gefasst, dass jemand mir auflauern könnte. Doch eben hat mir ein flüchtiger Rundumblick genügt, dann habe ich meine ganze Aufmerksamkeit auf den Grabstein konzentriert. Es wird mir eine Lehre sein.
Nachdem der erste Schreck verklungen ist, wird mir klar, dass ich den Mann, der immer noch schuldbewusst wirkt, heute schon einmal gesehen habe. Er gehört zu der Dreiergruppe, die vor dem Blumenladen aus dem Auto gestiegen ist. Polizisten, wenn meine Instinkte mich nicht völlig verlassen haben. Er ist der Kleinste der drei, trägt eine abgewetzte braune Lederjacke, Jeans und hat seine Sonnenbrille auf den kahlen Kopf hochgeschoben. »Wissen Sie, was hier passiert ist?«, fragt er mich.
Ich zucke mit den Schultern. »Nicht so genau.«
Sein Blick wandert von meinen Augen zu meinen Schuhen und wieder zurück, dann zückt er einen Ausweis. Polizei, bingo, habe ich es doch gewusst.
»Mein Name ist Oliver Tassani. Ermittlungsdienst.«
»Wie bitte?«
Er seufzt. »In Fernsehkrimis sagt man Mordkommission dazu.«
»Mordko…« Ich schlucke meinen Kommentar hinunter. Der Tote aus dem Grab wurde zwar gewissermaßen enthauptet, aber da war er schon so tot, wie man nur sein kann. Warum interessiert sich die Mordkommission für die Sache? Ich setze mein naivstes Gesicht auf. »Ist jemand umgebracht worden?«
Tassani antwortet nicht, betrachtet nur nachdenklich den Grabstein. »Sie sind doch nicht zufällig hier, oder?«, sagt er nach ein paar Sekunden. »Sie haben gehört, was passiert ist.«
Sogar gesehen, noch vor ihm. Aber das muss er nicht wissen. »Stimmt«, bestätige ich.
»Sie arbeiten hier?«
»In der Nähe. Und falls Sie es verwerflich finden, dass ich das Grab fotografiert habe, gebe ich Ihnen recht. Aber ich stelle das Bild nicht auf Instagram, ich wollte nur nach diesem Zeichen googeln.« Ich deute auf die liegende Acht mit dem Kreuz.
Tassani wendet mir langsam den Kopf zu. Sein Blick ist forschend; seine Augen sind auf derselben Höhe wie meine. Für einen Mann ist er wirklich nicht groß. »Nach diesem Zeichen, hm?« Er greift in seine Jackentasche und zieht eine Visitenkarte heraus. »Wenn Sie bei Ihren Recherchen erfolgreicher sind als ich, dann rufen Sie mich doch bitte an.«
Zu Hause lege ich tatsächlich mit Nachforschungen los. Allerdings google ich nach dem Polizisten und werde reichhaltiger fündig als erwartet. Drei Interviews zu abgeschlossenen Fällen, eines zum Personalmangel bei der Wiener Polizei. Und schließlich ein Artikel, der gerade mal zwölf Tage alt ist. Tassani wird als Ermittler in einem Mordfall genannt, von dem Matti aus der Zeitung vorgelesen hat, außerdem gab es mehrere Tage lang Meldungen in den Fernsehnachrichten: Ein siebenundsechzigjähriger Mann wurde tot in einem Park aufgefunden, nur wenige Meter von seinem Zuhause entfernt. Ein gewisser Gunther S. Erschlagen, wie die Medien am nächsten Tag berichteten. Bisher keine Spur zum Täter.
Mit diesem Fall müsste Tassani also derzeit beschäftigt sein – was kratzen ihn dann ein paar verstreute Knochen auf dem Zentralfriedhof?
Beim Weitergoogeln lande ich mindestens dreißig Treffer zu dem Mord im Park; Tassani wird allerdings nur in dem einen Artikel namentlich erwähnt. Ich schenke mir ein Glas Rotwein ein, setze mich auf die Couch und betrachte die Visitenkarte, die er mir mitgegeben hat.
Wenn ich das Symbol entschlüssle, soll ich mich melden, hat er gemeint. Wäre interessant zu wissen, warum das für ihn wichtig ist. Mir fällt nur ein plausibler Grund ein: dass bei der Leiche von Gunther S. das gleiche Zeichen gefunden wurde.
In den Nachrichten wird die Grabschändung nur kurz erwähnt, die Fernsehteams haben Bilder von möglichst pittoresken Grabreihen geschossen, keines von dem geschändeten Grab selbst und schon gar nicht von dem Schädel mit dem Hühnerkopf zwischen den Zähnen. »Die Schmierereien auf dem Grabstein lassen nicht auf politische Motive der Täter schließen«, heißt es. Was so viel bedeutet wie: keine Hakenkreuze.
Auf dem Handy öffne ich das Foto und ziehe es mit zwei Fingern größer. Kreuz oder Schwert? Es ist nahe der Mitte in der linken Schleife der liegenden Acht platziert. Ist die Asymmetrie Absicht, oder hatte der Maler es eilig?
Mit Handy und Wein setze ich mich wieder an den Computer. Gebe Unendlichkeitszeichen erst in Kombination mit dem Wort Kreuz, dann mit Schwert ein. Der erste Versuch bringt mir hauptsächlich Bilder von Schmuckanhängern ein, bei denen der Querbalken des Kreuzes die liegende Acht ist. Der zweite läuft – abgesehen von ein paar Tattooentwürfen – ins Leere. Ich ändere die Suchanfrage noch drei Mal, doch erst als ich den Teufel als Suchbegriff mit ins Spiel bringe, finde ich etwas, das dem Geschmiere auf dem Grabstein zumindest ähnelt.
Das Symbol heißt Leviathan-Kreuz, wird auch Satanskreuz genannt und ist das alchemistische Zeichen für Schwefel. Was perfekt zu Pentagramm und Hühnerkopf passen würde. Allerdings hat dieses Kreuz zwei Querbalken, und der Längsholm sitzt exakt in der Mitte der Unendlichkeitsacht.
Ich vertiefe mich noch einmal in das Foto des Grabsteins. Der fünfzackige Stern, das Omega und die Sechsen sind sehr sorgfältig gemalt, das vierte Symbol eigentlich auch. Wurde der Grabschänder beim Zeichnen überrascht und musste sein Werk unvollendet zurücklassen? Oder haben sich zwei Täter künstlerisch betätigt; der eine begabt, der andere nicht? Ich frage mich, ob Tassani schon mehr herausgefunden hat.
Ein Schluck Wein ist noch im Glas. Ich blicke nachdenklich auf das Browserfenster und kämpfe das plötzliche Bedürfnis nieder, nach den Namen aus meiner Vergangenheit zu googeln – meinem eigenen zum Beispiel. Allerdings stünde mir dann eine schlaflose Nacht bevor; ich weiß schon, warum ich das Internet sonst lieber meide.
Meine Finger verharren kurz über der Tastatur, dann gebe ich Robert Lesch ins Textfenster ein. Vielleicht finde ich in den Weiten des Netzes den Grund, warum er sich nach den Ereignissen in München nicht bei mir gemeldet hat – sieht man von dem angsteinflößenden Blumengruß ab, der mich bei meiner Rückkehr erwartet hat.
Die Suche fördert keine aktuellen Meldungen zutage. Nur Altbekanntes, darunter eine Kurzmeldung, etwas mehr als ein Jahr alt, die meine Stimmung sofort auf Grabestiefe senkt. Er wird im Zusammenhang mit Leichenfunden erwähnt, zu denen er keinen Kommentar abgeben will.
Die dürren Worte sind geradezu eine Verhöhnung dessen, was damals geschehen ist. Mit einem schnellen Mausklick schließe ich den Browser; ich wusste, es war ein Fehler, in der Vergangenheit herumzukramen. Soll Robert doch zum – ha, ha – Teufel gehen. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, so heißt es doch.
Allerdings würde ich ihm gerne die Meinung sagen, er soll wissen, wie ich es finde, dass er mich den Karpins wie einen Köder vor die Nase gehalten hat. Und ich wüsste gern, ob Pascha noch hinter Gittern sitzt.
Ihn anzurufen kommt nicht infrage. Nach den Ereignissen in München habe ich mir wieder ein gebrauchtes Handy zugelegt und mit gefälschtem Ausweis eine Guthabenkarte besorgt. Die Nummer kennt Robert nicht, aber er weiß, dass er mich auch auf andere Art erreichen kann.
Es wird eine lange Nacht. Ich liege im Bett, und alle paar Minuten fällt mir ein neuer Grund dafür ein, dass Robert sich nicht meldet. Mein Favorit: Er hat eine Spur nach Wien gelegt, die Karpins werden bald hier auftauchen, und er will keinesfalls, dass eine Kontaktaufnahme das Unternehmen gefährdet. Er weiß, dass ich beim kleinsten Verdacht voller Panik abhauen würde.
Ich presse das Gesicht ins Kissen und rufe mir den Moment ins Gedächtnis, zu dem ich die Zeit gern zurückdrehen würde. Den Sommerabend, an dem ich verhaftet wurde und Robert zum ersten Mal gegenübersaß.
»Haben Sie die gemacht?« Er hielt mir zwei Geburtsurkunden unter die Nase.
»Natürlich nicht«, sagte ich. »Wie kommen Sie darauf?«
Und dann stellte sich heraus, dass ich in eine Falle gegangen war. Dass man mich schon länger im Blick hatte und einer meiner letzten Auftraggeber für die Polizei tätig gewesen war.
»Sie werden ins Gefängnis gehen, Herzchen«, sagte Robert damals. »Obwohl es schade ist um so viel Talent. Es gäbe da eine Alternative …«
Ich hätte mich für den Prozess und die Strafe entscheiden sollen, denke ich jetzt nicht zum ersten Mal, während ich im Bett liege und meine Herzschläge zähle. Beides läge nun wahrscheinlich schon hinter mir. Ich hätte an diesem Abend den Kopf schütteln und mich verhaften lassen sollen. Stattdessen bin ich einen Deal eingegangen, der mir in gewisser Weise lebenslang eingebracht hat. Oder vielleicht sogar eine Art von Todesstrafe.
Um ein Uhr fünfunddreißig quäle ich mich wieder aus dem Bett und öffne auf dem Computer die Seite meines üblichen Blumenversandhandels. Iris für »Ich warte auf Nachricht«. Akelei für »Du Feigling«. Und, um dem Ganzen ein bisschen Pfeffer zu verleihen, Petunien. Die stehen für »Überraschung« und werden Robert eine harte Nuss zu knacken geben. Wer hat eine Überraschung für wen? Dann noch mit Zittergras garnieren – das wenig originell für Unruhe steht –, und der Strauß ist fertig. Er geht ans BKA in Wiesbaden, und ich lege mich wieder ins Bett.
Am nächsten Tag betritt kurz nach zehn Uhr Tassani den Blumenladen. Ich gieße gerade die Topfpflanzen und habe keine Chance, in Deckung zu gehen, denn er entdeckt mich schon beim Hereinkommen.
»Guten Morgen!« Matti lächelt und breitet die Arme aus. »Womit kann ich Ihnen helfen?«
»Sehr freundlich, aber ich bin nicht der Blumen wegen hier«, erwidert Tassani. »Ich wollte mich kurz mit Ihrer Mitarbeiterin unterhalten. Frau Bauer?«
Ich stelle die Kanne beiseite. Habe ich mich ihm gestern vorgestellt? Ich glaube nicht. Ganz sicher weiß ich, dass ich ihm nicht erzählt habe, wo ich arbeite. »Ja?«
»Wäre es okay, wenn wir ein paar Minuten rausgehen?«
Mir ist klar, dass Matti platzt vor Neugierde, aber er nickt mir aufmunternd zu. »Mach nur.«
Also folge ich Tassani vor den Laden. Möglicherweise hat er ja herausgefunden, was das dritte Symbol bedeutet, will es mir erzählen und hat deshalb nachgeforscht, mit wem er sich gestern unterhalten hat. Klingt sehr wahrscheinlich.
»Sie waren gestern schon ganz frühmorgens bei dem Grab.« Er zieht den Reißverschluss seiner Lederjacke etwas höher. »Noch bevor wir eingetroffen sind.«
»Ja.« Ich muss nur ein bisschen das Kreuz durchdrücken, dann bin ich größer als er. »Ist das verboten?«
»Natürlich nicht. Ich habe Sie dort allerdings nicht gesehen, im Unterschied zu ungefähr zwanzig anderen, die gar nicht genug von dem Anblick bekommen konnten.«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich bin nicht so versessen auf zerbröselnde Leichen. Und ich verstehe noch immer nicht, was Sie von mir wollen.«
»Ach, nichts Besonderes. Mich hat das nur erstaunt. Dass Sie gehen, kurz bevor die Polizei eintrifft, aber am Abend zurückkommen und Fotos vom Tatort machen. Fast so, als wollten Sie uns nicht begegnen. Fast so, als hätten Sie etwas damit zu tun.« Er strahlt mich an. »Haben Sie?«
Ich grinse trotzig. »Ihnen ist klar, dass die Antwort auf jeden Fall Nein sein wird, oder? Jetzt müssen Sie nur noch herausfinden, ob das auch der Wahrheit entspricht.« Bin ich bescheuert? Was mache ich da? Lustiges Geplänkel mit der Polizei? Ich lasse das Lächeln in sich zusammenfallen. »Sie fragen mich das nicht ernsthaft, oder?«
Es wirkt, als würde er sich die Antwort darauf gründlich überlegen. »Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber etwas an Ihnen ist eigenartig. Erst habe ich Sie für eine Journalistin gehalten – oder für jemanden aus einem der nahe gelegenen Büros. Ich war ehrlich erstaunt, als einer der Totengräber mir gesagt hat, dass Sie in der Blumenhandlung arbeiten.«
Ich schweige, also fährt er fort: »Nachdem sich unsere Wege gestern getrennt haben, ist er von seinem Bagger geklettert und hat Ihnen hinterhergesehen. Da habe ich ihn gefragt, ob er Sie kennt.«
Das war vermutlich Mirko. Lieber Kerl auf der verzweifelten Suche nach einer Frau in seinem Leben. Ich seufze. »Sie ahnen gar nicht, wie gut ich hierher passe. Und jetzt sollte ich weiterarbeiten.« Durch die Scheibe sehe ich Matti die Töpfe gießen und immer wieder zu uns herblinzeln.
»Dann halte ich Sie nicht länger auf.« Tassani wirft einen Blick auf seine Uhr. »Haben Sie noch etwas zu dem Zeichen herausgefunden?«
»Es ähnelt einem Leviathan-Kreuz, aber das ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen.« Ich verschränke die Arme vor der Brust und mustere ihn von oben bis unten. »Haben Sie eigentlich italienische Wurzeln?«
»Mein Großvater stammte aus Caserta. Er war Brigadiere bei den Carabinieri. So nahe an Neapel war das eine halsbrecherische Berufsentscheidung.«
Gleich werden wir in unserem Gespräch die Mafia streifen, die ist allerdings das Letzte, worüber ich mich unterhalten möchte. »Dann haben Sie es ja besser erwischt.«
Er blickt zum Himmel, an dem sich allmählich Wolken vor die Sonne schieben. »Wien ist ruhiger. Aber auch kühler. Und das Zeichen ist kein Leviathan-Kreuz.« Er reiht die Fakten sachlich aneinander, beinahe erwarte ich eine vierte Feststellung im gleichen Ton: Und Sie sind nicht Carolin Bauer. Aber er streckt nur die Hand aus. Ich ergreife sie. »Auf Wiedersehen«, sage ich. »Viel Glück bei Ihren Ermittlungen.«
Sein Lächeln ist schief. »Grazie. Ciao.«
»Was hat er erzählt? Was will er von dir?« Matti hat den Arm voller Tulpen, als ich den Laden wieder betrete.
»Nichts Besonderes. Es ging nur um eines der Symbole, die auf den Grabstein gepinselt worden sind.« Ich hätte Tassani auch ein paar Fragen stellen sollen. Nach dem Mord im Park und ob das Zeichen eine Verbindung darstellt. Nur hätte er daraufhin wohl erwidert, dass mich das nichts angeht. Was absolut stimmt; ihm wäre dann aber klar gewesen, dass ich mich über ihn schlaugemacht habe, und er hätte sich zu Recht gefragt, warum.
Im Grunde ist meine Neugierde auch bloß ein ungesunder Reflex. Je weniger ich mit alldem zu tun habe, desto besser.
2.
Nach Feierabend fahre ich mit der Straßenbahn nach Hause, aber die Vorstellung, den Abend alleine vor dem Fernseher zu verbringen, drückt mir schon die Luft ab, bevor ich die Wohnung betrete. Also checke ich nur schnell meine Mails – keine Nachricht von Robert, aber eine Bestätigung des Blumenversandshops, dass der Strauß beim Empfänger abgeliefert worden ist. Immerhin. Ich schalte den Rechner aus, nehme die Autoschlüssel vom Haken und bin schon wieder draußen.
Der kleine Mazda ersetzt mir derzeit den Therapeuten. Er vermittelt mir das Gefühl, etwas unter Kontrolle zu haben, und das beruhigt mich mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Wenn ich damit herumfahre, fühle ich mich anonym, bin einfach nur einer von Tausenden Verkehrsteilnehmern. Trotzdem habe ich häufig den Blick im Rückspiegel, vor allem die ersten fünf Minuten lang. Ich will sicherstellen, dass niemand mir folgt.
Spätestens, nachdem ich aus der Stadt hinausgefahren bin und die Landstraße erreiche, habe ich Gewissheit. Hier würde jedes Verfolgerauto sofort auffallen, denn außer mir sind nicht viele Menschen unterwegs.
Mein Ziel liegt etwa zwanzig Kilometer östlich der Wiener Stadtgrenze, ich habe es während einer meiner ersten Ausfahrten entdeckt, als ich möglichst nah an den Wald gelangen und dort spazieren gehen wollte.
Eine Nebenstraße, von der eine schmälere Straße abzweigt, danach ein holpriger Feldweg. An einer Stelle muss man nach rechts in die Wiese ausweichen, um nicht mit dem linken Vorderreifen in ein knietiefes Schlagloch zu geraten. Doch am Ende des Wegs, halb schon im Schatten des Waldes, halb auf einer Wiese mit meterhohem Gras, liegt meine Entdeckung.
Ein geducktes, ebenerdiges Haus, ehemals wohl ein kleiner Bauernhof. Jetzt ein Abbruchobjekt, das offenbar keiner haben will. Das »Zu verkaufen«-Schild hinter einer zersprungenen Fensterscheibe ist verblasst. An der Außenwand lehnt noch verrostetes Werkzeug, in einem Schuppen liegen alte Traktorreifen. Das Dach hängt an zwei Stellen durch. Beim ersten Mal musste ich auf dem Weg zum Eingang Büsche überklettern und Ranken aus dem Weg zerren, bis ich vor einer alten Holztür stand, von der grüner Lack abblätterte.
Dort stehe ich auch jetzt. Der Wagen parkt hinter einer Gruppe junger Fichten, die Straße ist außer Sichtweite. Ich öffne die Tür und bin sofort in der Wohnküche: ein gemauerter Holzofen mit rußig schwarzer Kochplatte, grün-grau bezogene Stühle rund um einen Resopaltisch. Die habe ich dort hingestellt, zuvor lagen sie kreuz und quer im Raum, ebenso wie ein paar brüchige Ziegelsteine und ein altes Ofenrohr.
Jedes Mal, wenn ich herkomme, mache ich das Haus ein wenig wohnlicher. Natürlich ist mir klar, dass das Gemäuer jederzeit über mir einstürzen kann, aber ich vertraue darauf, dass es das nicht tun wird. Ich habe es entdeckt, ich erwecke es wieder zum Leben. Wir sind Verbündete.
Neben der Wohnküche gibt es ein Schlafzimmer mit einem schäbigen Holzbett und löchrigen Matratzen, in denen vermutlich einiges lebt.
Erstaunlicherweise verfügt das Haus über zwei Toiletten. Eine steht direkt im schwarz-weiß gekachelten Badezimmer, die andere im Keller, der zur Hälfte gemauert, zur anderen Hälfte ein Erdkeller ist. Vielleicht war er früher eine Kombination aus Weinkeller und Werkstatt, jedenfalls gibt es einen rostigen Kühlschrank, der wider Erwarten funktioniert. Und eben ein Klo, ebenfalls intakt, kaum zu glauben. An einer der Wände lehnt ein alter, verwitterter Mühlstein. Er muss mindestens eine Tonne wiegen, ich frage mich, wie er hier heruntergeschafft wurde. Vielleicht stand früher ja eine Mühle hier.
Wenn es so weit kommen sollte, wenn es wirklich passiert und die Karpins meine Spur aufnehmen, werde ich hierher flüchten. Es ist Niemandsland, kein Mensch kann mich hier finden. Ich muss nur darauf achten, dass niemand den kleinen schwarzen Mazda bemerkt, wenn er auf den Feldweg einbiegt.
Wie die letzten Male habe ich auch heute Vorräte für den Ernstfall mitgebracht. Ein paar Dosen Ravioli, die man notfalls kalt essen kann. Sechs Liter Wasser – obwohl es im Haus immer noch läuft, erstaunlicherweise; es gibt auch funktionierende Steckdosen. Eine Flasche Rotwein, die ich zu den beiden anderen stelle. Zwei Dosen mit Linsen, zwei mit Bohnen, zwei mit Sauerkraut. Beim nächsten Mal werde ich Knäckebrot mitbringen, das sollte eigentlich nicht schimmeln, auch wenn es in diesem Keller alles andere als trocken ist.
Ich betaste die feuchte Wand und lehne die Stirn dagegen. Fünf Atemzüge lang das Gefühl von Sicherheit. Sechs. Sieben.
Putzmittel wären auch eine gute Idee. Die beiden Toiletten sind nicht auf eklige Weise schmutzig, aber jahrzehntealter Staub und Feuchtigkeit haben dunkle Krusten hinterlassen. Ich mache mir innerlich Notizen, füge eine vakuumverpackte Decke und ein Kissen hinzu. Außerdem eine Isomatte, denn eine Matratze hierherzutransportieren, wird schwierig.
Dann setze ich mich auf den Boden und genieße das Verschwundensein. Lehne mich mit geschlossenen Augen gegen den alten Kühlschrank und lasse die Stille in den Ohren rauschen. Lasse die Zeit stillstehen.
Was sie in Wahrheit leider nicht tut, ich muss hier wieder weg, bevor es so dunkel ist, dass ich die Autoscheinwerfer einschalten muss. Wenn der Zufall es will, bemerkt jemand die Lichter, die aus dem Nichts auf die Straße zufahren, und kommt auf die Idee, sich die Ecke ein wenig genauer anzusehen.
Voller Bedauern steige ich die Kellertreppe hinauf, rücke noch mal die Stühle rund um den Tisch zurecht, dann bin ich draußen. Schließe die grüne Tür hinter mir und gehe zum Auto.
Auf dem Weg zurück nach Wien ergänze ich meine mentale Liste. Klopapier. Und eine Taschenlampe.
Als ich nach Hause komme, klebt ein Post-it an meiner Wohnungstür. Habe Quiche gemacht. Wenn du eine Portion willst, kannst du jederzeit kommen. Norbert.
Mein freundlicher Nachbar aus der unteren Wohnung. Er ist der Einzige im Haus, zu dem ich Kontakt habe, und den sollte ich gelegentlich pflegen. Ein paar Minuten später stehe ich in seinem sparsam eingerichteten Wohnzimmer. Es sieht nicht aus, als gehöre es jemandem, der bald siebzig wird – keine Kinkerlitzchen, die an vergangene Zeiten erinnern, sondern moderne Drucke an den Wänden. Und zwei hohe Bücherregale.
Norbert tischt Quiche und Weißwein auf, fragt mich nach meinem Tag, erzählt mir, was er zuletzt gelesen hat. Manchmal habe ich das Gefühl, er will in mir die Tochter sehen, die er nie hatte. Testet an, wie es sein könnte, Kinder zu haben, auch wenn sie jetzt schon erwachsen wären.
Er ist angenehme Gesellschaft, denn er fragt fast nichts; ihm genügt es, reden zu können. Ich muss nur nicken und ab und an zustimmende Geräusche von mir geben.
Doch dann, während ich gerade hingebungsvoll mit der Quiche beschäftigt bin, wechselt er das Thema. »Ich habe gehört, auf dem Zentralfriedhof sind Gräber geschändet worden, hast du davon was mitbekommen?«
Ich kaue, schlucke und seufze. »Nicht viel. War auch nur eine einzige Grabschändung, bestimmt ein paar besoffene Jugendliche, denen langweilig war.«
Norberts Blick bleibt erwartungsvoll, also fahre ich fort: »Sie haben einen Sarg ausgebuddelt und ein paar Knochen herausgeholt. Außerdem den Grabstein beschmiert. Idioten eben, die Polizei ist dran.« Unwillkürlich fällt mir Tassani ein und sein entspannter Humor. Leider auch seine scharfe Beobachtungsgabe. Etwas an Ihnen ist eigenartig.
Ich dränge die Erinnerung an das Gespräch beiseite und stecke mir den nächsten Bissen in den Mund. Totenschädel und Pentagramme sind nicht mein Problem, ebenso wenig wie Kriminalbeamte mit italienischen Großvätern und dunkelbraunen Augen. Mein Fokus sollte weiter östlich liegen. Bei stiernackigen Russen mit wasserblauen Augen und Händen wie Baggerschaufeln.
Am nächsten Tag binde ich gerade vier Sträußchen aus Rosen und Schleierkraut, die bei einer Beerdigung ins Grab geworfen werden sollen, als die Ladentür sich öffnet. Der junge Mann, der eintritt, trägt die Jacke eines Lieferdienstes. Er sieht sich um und lacht auf. »Da hat jemand echt Sinn für Humor.« Sein Blick bleibt an mir hängen. »Carolin Bauer?«
»Ja.«
»Ich habe etwas für Sie.«
Aus den Augenwinkeln habe ich es bereits gesehen, und ich muss ihm recht geben. Ist höchst merkwürdig, einen Blumenstrauß in einen Blumenladen zu liefern.
»Ich fürchte, Ihr Love-Interest hat nicht wirklich mitgedacht«, sagt der Bote, während ich den Empfang quittiere. »Trotzdem alles Gute. Falls Sie Geburtstag haben.«
»Habe ich nicht.« Ich drücke ihm einen Euro Trinkgeld in die Hand und wickle das Papier vom Strauß. Hyazinthen und Märzenbecher, ergänzt mit Dotterblumen – optisch eine eigenartige Kombination, die inhaltlich aber Sinn ergibt. Hyazinthen symbolisieren Abweisung, Märzenbecher Ungeduld, und Dotterblumen weisen auf eine baldige Kontaktaufnahme hin. Ich übersetze das für mich so, dass Robert kein Verständnis für mein Drängen hat und sich bald melden wird.
»Was is’n das?« Matti kommt aus der Werkstatt nach vorne und wirft einen skeptischen Blick auf den Strauß. »Das ist nicht von uns, oder?«
»Nein. Keine Sorge.« Am liebsten würde ich die Blumen wegwerfen, aber das haben sie nicht verdient. Also gebe ich sie der nächsten Kundin als Draufgabe mit und freue mich, dass sie sich freut.
Tassani lässt sich den ganzen Tag über nicht blicken, was ich halb erleichtert, halb enttäuscht zur Kenntnis nehme. Wobei die Enttäuschung mich selbst erstaunt – ich sollte froh sein, dass sein Fokus nicht so stark auf mir liegt, wie ich befürchtet habe, und die Dinge wieder ihren normalen Lauf nehmen. Der Presse ist die Grabschändung nur noch da und dort eine Kurzmeldung wert, und die Schaulustigen halten sich ebenfalls in Grenzen.
Auch der darauffolgende Tag bleibt ereignislos, was ihn für mich zu einem guten Tag macht. Je weiter die Münchner Ereignisse in die Vergangenheit rücken, ohne dass Andreis Killer auftauchen, desto größer wird meine Hoffnung, dass ich mit einem blauen Auge davongekommen bin.
Wie dünn mein Vertrauen darauf ist, zeigt sich bereits am nächsten Abend: Das kräftige Klopfen an meiner Tür lässt mich so heftig zusammenzucken, dass mir beinahe mein Glas aus der Hand rutscht.
Ich atme tief ein und aus. Starre auf die Salamischeiben, mit denen meine Pizza belegt ist. Norbert klopft nicht, er klingelt. Außer ihm kenne ich die Nachbarn nur vom Aneinander-Vorbeischauen.
Das Klopfen wiederholt sich. Lauter diesmal. Und dann beginnt jemand zu singen. »Sweet Caroline – taaataaataaa – good times never seemed so good!« Es klingt schräg und falsch, und ich kenne die Stimme. So schnell hätte ich nicht mit ihm gerechnet, aber umso besser.
Ich gehe zur Tür, öffne sie. »Hallo, Robert.«
Er schnuppert, bevor er eintritt. »Da habe ich ja den perfekten Zeitpunkt erwischt. Ich verhungere.«
Sobald wir am Küchentisch sitzen, schiebe ich ihm den Teller mit der halben Pizza hin, und er verschlingt sie innerhalb von zwei Minuten. Ich beobachte ihn dabei und staune, dass ich jedes Mal wieder vergesse, was für eine Beleidigung Robert fürs Auge ist. Es liegt nicht an seinen Genen – er könnte durchschnittlich bis okay wirken, wenn er wollte. Wenn er sein kaum noch vorhandenes Haar abrasieren würde, statt es in dünnen Strähnen bis über die Ohren hängen zu lassen. Wenn er die Fingernägel nicht zu lang werden ließe, zumal die der rechten Hand gelb vom Nikotin sind. Wenn er kein gestörtes Verhältnis zu Deodorants hätte.
»Du hattest es eilig, hier bin ich«, sagt er, kaum dass er mit Essen fertig ist. Sieht mich erwartungsvoll an, während er mit den Fingernägeln Salamireste zwischen den Zähnen hervorstochert. »Also?«
»Du bist extra deshalb hergekommen? Eine schriftliche Nachricht hätte mir genügt.«
Robert zieht eine Augenbraue hoch. »Nicht nur deshalb. Ich habe ein paar Gespräche mit Wiener Kollegen. Es gibt da einen grenzübergreifenden Fall. Was war denn meiner Diva so wichtig? Und was wolltest du mir mit den Petunien sagen? Von wegen Überraschung und so?«
Diva. Ich habe große Lust, ihm den Teller um die Ohren zu schlagen. »Du bist mir noch eine Menge Erklärungen schuldig. Das mit München war ein ziemliches Meisterstück von dir. Ich löse für dich die Baustellensache und mache dir gleichzeitig den Köder für die Karpins. Richtig?«
Roberts Augen werden groß und rund. »Köder? Aber das stimmt doch gar nicht! Wäre es nach mir gegangen, hättest du Tag und Nacht bei zugezogenen Vorhängen in der Agnesstraße sitzen können, aber du wolltest ja auf Charity-Galas gehen – und dich dort fotografieren lassen.«
Der Punkt geht an ihn, aber unsere Abmachung hat er trotzdem gebrochen. »Du hattest mir versprochen, du würdest mir Bescheid geben, sobald sich irgendwer von Andreis Truppe in meine Nähe bewegt, und das hast du nicht getan. Du warst selbst in München, weil du wusstest, du würdest vielleicht Pascha dort schnappen können. Oder den Big Boss selbst. Und du hast mich nicht gewarnt.«
Endlich, jetzt wirkt er etwas schuldbewusst. »Stimmt. Aber wie du schon sagst, ich bin extra persönlich hingefahren. Ich hätte niemals zugelassen, dass dir etwas passiert.«
Meinen Lachanfall nimmt er erst stoisch hin, dann senkt er lächelnd den Blick. Wir wissen beide, dass er Unsinn redet. Er hätte mich nicht schützen können. Ich habe Pascha töten gesehen, so schnell, dass ich erst begriffen habe, was passiert war, als das Opfer schon reglos in seinem Blut lag. Wobei das nicht Paschas bevorzugte Vorgehensweise ist. Viel lieber nimmt er sich Zeit, vor allem, wenn er Zuseher hat. Nicht umsonst fällt mir wieder die Rosenschere ein.
»Ihr habt ihn noch? Pavel?«
Robert nickt. »Ja. Ist aber nicht so einfach. Es gibt kaum Beweise gegen ihn; die Clans killen sich zwar gerne gegenseitig, aber sie schwärzen einander nicht an. Wenn wir die Leichen überhaupt zu Gesicht bekommen, hat man vorher dafür gesorgt, dass wir keine verwertbaren Spuren an ihnen finden. Weißt du ja.«
Und ob. Dafür gesorgt, mit Feuer oder Lauge. Sobald ich die Augen schließe, habe ich die großen Fässer wieder vor mir. Ich hätte auf die Pizza verzichten sollen.
Ich lehne mich über den Tisch und stelle Robert die Frage aller Fragen. »Sie wissen es, nicht wahr? Sie wissen, dass ich noch lebe.«
Er hält meinem Blick stand. »Sie … na ja, sie vermuten es. Ganz sicher sind sie nicht, nachdem dich keiner von ihnen wirklich zu Gesicht bekommen hat. Aber sie kennen die Fotos, davon müssen wir ausgehen.«
Die Fotos. Die von der Gala und die von verschiedenen Überwachungskameras. Auf denen ich mich allerdings fünfzehn Kilo schwerer, blond und zur Brillenträgerin gemacht habe.
Doch für jemanden wie Vera reicht das womöglich nicht. Sie hat einen unglaublich scharfen Blick für Gesichter, und auch, wenn wir uns früher gut verstanden haben – ihre Angst vor Andrei ist zu groß, als dass sie mir zuliebe lügen würde.
Apropos. »Wie sieht es mit Andrei aus? Habt ihr von ihm irgendwelche Lebenszeichen?«
»Er ist nicht aus der EU ausgereist«, sagt Robert vage. »Jedenfalls nicht unter seinem Namen. Auch nicht mit Dokumenten, die von dir gefälscht worden sind.«
Das muss nichts heißen. Er hat bestimmt noch andere, mittlerweile wahrscheinlich ganz neue. »Er steht nach wie vor auf der Fahndungsliste?«
»Natürlich. Allerdings nur wegen Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Verdachts auf Menschenhandel.«
Wieder lache ich auf. Mitgliedschaft ist eine hübsche Untertreibung, und die Liste ist weit entfernt von vollständig. Es fehlt vor allem Mord mit denkbar grausamen Mitteln. Den ich ihn allerdings nie habe eigenhändig ausführen sehen.
»Wie wahrscheinlich ist es, dass sie meine Spur nach Wien nachverfolgen können?«
»Es gibt keinerlei Anzeichen dafür.« In Roberts Blick liegt mehr Ernsthaftigkeit, als ich von ihm gewohnt bin. »Es tut mir leid, dass ich dich in München nicht gewarnt habe. Aber ich verspreche dir, dass du dich beim nächsten Mal auf uns verlassen kannst. Wenn es ein nächstes Mal überhaupt geben sollte. Im Moment sieht es so aus, als würden sie dich in verschiedenen deutschen Städten suchen. Unmittelbar nach Pavels Verhaftung sind Leute aus dem Clan nach Stuttgart, Hamburg und Leipzig gefahren. Eine Woche später in Richtung Nürnberg und Hannover. Niemand, nicht einer, nach Österreich oder gar Wien.«
Zumindest niemand von denen, die ihr im Auge habt, denke ich und nicke. »Du rätst mir also, vorerst hierzubleiben?«
»Ja. Bleib hier. Bleib, Carolin. Ich werde dich nach Möglichkeit auf dem Laufenden halten.« Er deutet auf den trockenen Strauß, der am Fenster hängt. »Über Blümchen und notfalls über Mail, nachdem du mir deine neue Handynummer nicht gibst.«
»Ist zu riskant, sorry.« Mein Blick ist an den dürren Tagetes hängen geblieben. Totenblumen. »Warum hast du mir die eigentlich geschickt? Mich hat fast der Schlag getroffen.«
Er hebt die Schultern. »Ich dachte, es wäre klar. Ich wollte mich bedanken und dir sagen, dass du jetzt wieder in Ruhe tot sein darfst. Aber offenbar lässt sich über Blumengrüße kein Humor transportieren.«
Humor. Ich könnte Robert seine spärlichen Haare ausrupfen. »Besser, du gehst jetzt.«
Als er weg ist, bedaure ich meine spontane Reaktion. Fassungslos über Roberts mangelndes Einfühlungsvermögen zu sein ist besser als alleine in Gesellschaft meiner düsteren Gedanken. Würde er mir diesmal wirklich Bescheid geben, wenn ich in Gefahr bin?
Im Grunde habe ich nur zwei Möglichkeiten: ihm zu vertrauen oder schnellstmöglich die Stadt zu wechseln. Ohne Garantie, dass ich dort sicher sein werde.
Wien hat mir bisher nichts angetan, es hat sich als Unterschlupf bewährt. Und nun habe ich sogar noch meinen persönlichen Notfallbunker, von dem niemand weiß.
Alles spricht dafür, zu bleiben.
Nach fünf Stunden unruhigen Schlafs krieche ich aus dem Bett und stürze zwei Tassen schwarzen Kaffee hinunter. Es ist so früh, ich werde den ersten Bus erwischen und noch vor der Öffnung der Tore am Friedhof sein. Gute Sache, ich könnte ein bis zwei Kränze fertig haben, bis Matti auftaucht. Oder …
Ich könnte auch außen ein wenig herumspazieren und nachsehen, ob es nicht doch Stellen an der Mauer gibt, die man überklettern kann.
Der letzte Schluck Kaffee ist kalt und bitter. Draußen geht die Sonne auf.
Diesmal steige ich nicht wie sonst bei Tor 2 aus, sondern bei Tor 3. Ich schlendere die Friedhofsmauer entlang. Wenn ich keine Stelle finde, die sich zum Überklettern eignet, werde ich bis zu Tor 9 spazieren, das dann schon geöffnet sein sollte.
Ich bin etwa eine halbe Stunde unterwegs, als mir am Fuß der Mauer, direkt neben einem Baum etwas ins Auge springt. Jemand hat einen Klapphocker hingestellt, ein altes Ding aus Holz, das es einer normal großen Person leicht erlauben sollte, über die Friedhofsmauer zu kommen.
Sind hier die Vandalen eingestiegen? Wenn Tassanis Leute diesen Hocker im Zuge ihrer Ermittlungen übersehen haben, waren sie nicht sehr gründlich.
Ich schieße ein Foto mit meinem Handy, um es Tassani unter die Nase zu halten, falls er noch einmal im Laden vorbeikommt. Dann steige ich auf den Hocker. Die Mauer reicht mir jetzt nur noch bis zum Bauch, und ich habe einen ausgezeichneten Ausblick auf die Gruppen 164 und 165. Einmal hochstemmen, ein Bein nach dem anderen hinüberschwingen, ein Sprung ins Gras, und schon stehe ich auf dem Friedhof und schlage den Weg zu Tor 2 ein. Ich muss mir überlegen, wie ich Tassani meine Entdeckung am besten verkaufe – die Wahrheit, dass ich aktiv nach einer geeigneten Einstiegsstelle gesucht habe, möchte ich ihm nicht erzählen.
Diesmal ist weit und breit wirklich niemand zu sehen. Die Sonne steht noch so tief, dass die Grabsteine lange Schatten werfen, das Gras ist feucht, und ein feiner Dunst liegt darüber. Es riecht nach frischer Erde und frühem Sommer. Außer meinen Schritten höre ich nur den Vogelgesang aus den Baumkronen.
Es ist eine gute Entscheidung, in Wien zu bleiben, denke ich wieder. Ich fühle mich hier mit jedem Tag mehr zu Hause, meine Umgebung ist mir so vertraut geworden, dass ich sofort bemerken würde, wenn etwas seltsam …
Ich bin stehen geblieben und weiß im ersten Moment nicht genau, warum. Etwas in meinem Blickfeld hat exakt zu meinen Gedankengängen gepasst – eine Veränderung, eine Unregelmäßigkeit. Ein Detail, das nicht stimmt.
Ich blicke mich um. Gehe drei Schritte zurück, drehe mich um die eigene Achse. Und dann weiß ich, was mich beim ersten Vorbeigehen irritiert hat: Bei Gruppe 133, Reihe vier, liegt ein Schuh. Ein schwarzlederner Herrenschuh mit spitz zulaufender Kappe.
Aus der Nähe betrachtet sieht er zu sauber aus, um schon länger hier zu liegen. Mein erster Gedanke, dass ihn vielleicht ein Beerdigungsbesucher verloren hat, ist natürlich Unsinn; er hätte ihn wieder angezogen. Und wenn er einem der Typen gehört, die das Grab verunstaltet haben? Und er ihn verloren hat, als er überstürzt flüchten musste? Bloß sind der oder die Täter von niemandem beobachtet worden, soweit ich weiß. Warum also wegrennen?
Noch bevor ich mich bücke, um den Schuh aufzuheben, fällt mein Blick auf etwas anderes. Etwas, das auf einem der hinteren Gräber in Reihe vier liegt.
Ich kann meine Beine kaum spüren, während ich einen Schritt nach dem anderen darauf zugehe, und obwohl mir im tiefsten Inneren bereits klar ist, was ich gleich sehen werde, versucht mein Gehirn immer noch, mich mit harmlosen Erklärungen zu beruhigen. Alte Kleidung. Arbeitsgewand eines Friedhofsmitarbeiters. Ein schlafender Obdachloser.
Doch es ist der Besitzer des Schuhs. Dass er den anderen noch trägt, ist das Erste, was ich registriere. Dann das bleiche Gesicht, auf dem halb getrocknetes Blut klebt, aber nicht nur das. Außerdem Erde. Vielleicht auch Hirnmasse, denn die linke Schädelseite ist eingedrückt.
Der Mann liegt auf dem Grab, als hätte man ihn verkehrt herum gekreuzigt. Der Kopf hängt über die Grabeinfassung, die Füße stoßen an den Grabstein, die Arme sind nach rechts und links ausgebreitet. Die ausgehobene Erde, die in kleinen Haufen danebenliegt, lässt mich eine Sekunde lang denken, dass die Grabschänder diesmal eine frischere Leiche exhumiert haben, aber das ist natürlich Unsinn. Erstens wird jeder Tote gewaschen, bevor man ihn beerdigt. Niemand wird blutverschmiert in den Sarg gelegt. Zweitens ist das Loch, das durch den Körper zum Teil bedeckt wird, kaum tiefer als zwanzig Zentimeter. Die Spaten der Grabenden können den Sargdeckel nicht einmal gestreift haben.
Mein Blick wandert höher. Ein heller Stein mit goldener Schrift. Und roten Schmierereien. Die dreifache Sechs. Das Pentagramm. Das Omega. Ein paar Zacken, als hätte jemand versucht, eine Bergkette zu skizzieren. Und das Leviathan-Kreuz, das keines ist. Aber es ist diesmal nicht Blut, sondern wahrscheinlich Permanentmarker, mit dem die Symbole angebracht wurden.
Mit tauben Fingern ziehe ich mein Smartphone aus der Jackentasche. Der morgendliche Kaffee kriecht sauer meine Speiseröhre hoch.
Ich habe wirklich gehofft, in diesem Leben keine blutüberströmten Toten mehr sehen zu müssen, keine Mordopfer, eigentlich überhaupt keine Leichen. In Wien ist mir das bisher gelungen. Bisher.
Ich schieße drei Fotos, dann gehe ich, ohne etwas anzurühren. Die Sonne strahlt schräg durch die Blattkronen, es wird ein schöner Tag werden. Ein Tag, an dem jemand eine Leiche finden und die Polizei informieren wird. Doch das werde nicht ich sein. Nicht Carolin Bauer. Die läuft stattdessen durch den neuen jüdischen Friedhof und versteckt sich im Schatten der Zeremonienhalle. Hier ist noch kein Mensch, in fünfzehn Minuten wird es sieben Uhr sein.
Ich warte, bis es so weit ist, dann gehe ich los, will den Eindruck erwecken, dass ich gerade erst ankomme. Dass ich gelassen durch den Park der Ruhe und Kraft spaziere, auf Tor 2 zu. Ohne jedes Anzeichen von Verstörtheit. Erst nachdem ich die Blumenhandlung aufgesperrt und mich nach hinten in die Werkstatt verkrochen habe, öffne ich noch einmal die Fotos auf meinem Handy.
Zuallererst ziehe ich den Kopf des Toten größer, betrachte sein Gesicht. Ich schätze den Mann auf etwa Mitte vierzig und bin so gut wie sicher, dass ich ihn vorher noch nie gesehen habe. Die Jacke, die er trägt, ist von Ralph Lauren und war somit nicht billig. Die Marke der Uhr an seinem linken Handgelenk kann ich auch bei maximaler Vergrößerung nicht erkennen.
Wieso ist jemand wie er nachts auf dem Friedhof? Nicht einmal ich kann meine Fantasie so sehr strapazieren, dass mir dieser Mann als Grabschänder plausibel erscheint. Vielleicht aber jemand, der die Möchtegern-Satansjünger überrascht hat? Der ihnen gefolgt ist, um sie von ihrem Tun abzuhalten?
Dazu müsste er ebenfalls über eine Mauer geklettert sein. Vielleicht an derselben Stelle wie ich, vielleicht ist der Hocker seiner.
Ich wünschte, ich hätte ihn nicht gesehen oder hätte zumindest die Kletterei bleiben gelassen. Dann ginge es mir jetzt besser. Dann wäre mir der Anblick des erschlagenen Mannes erspart geblieben.
Ich wische die Fotos hin und her und suche das heraus, auf dem man den Grabstein am besten sieht. Ja, es sind die gleichen Zeichen auf dem Stein wie beim letzten Mal, und wieder steckt das Kreuz nicht in der Mitte der liegenden Acht, sondern ein Stück weiter links. Auch diesmal gibt es nur einen Querbalken. Damit ist die Option Zufall gestorben.
Neu ist das Zackenmuster. Vier Spitzen nach oben, vier nach unten. Sieht nicht sehr satanistisch aus.
Beinahe lasse ich das Handy fallen, als ein Schlüssel ins Schloss der Ladentür fährt. Matti, heute zusammen mit Paula, seiner Frau, die sich nur selten in der Blumenhandlung blicken lässt. Weil sie nach einer Brustkrebserkrankung kürzertreten sollte, bin ich eingestellt worden.
Hastig schließe ich die Fotoapp und stecke das Handy weg. Paula kommt nach hinten und drückt mich. »So früh schon da! Aber ich kann dich verstehen, ich schlafe auch schlecht.« Sie hat selbst gebackenen Kuchen mitgebracht, der vegan ist und zitronig schmeckt. Ich esse mein Stück aus reiner Höflichkeit und gebe mir den Anschein, als würde ich dem Gespräch zwischen ihr und Matti folgen, in Wahrheit ist meine ganze Aufmerksamkeit auf den Parkplatz gerichtet. Noch keine Polizeiautos. Aber vielleicht parken die auch bei Tor 9, das ist näher an der Fundstelle.
Natürlich weiß ich nicht, ob es überhaupt schon einen Fund gegeben hat. Je später es wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Besucher auf die Leiche stößt. Vermutlich eine der alten Damen, die regelmäßig die Gräber ihrer toten Ehemänner gießen. Das würde tatsächlich mein Gewissen belasten, ich will nicht, dass jemanden vor Schreck der Schlag trifft. Ich will aber auch keine Schlüsselfigur in den bevorstehenden Polizeiermittlungen sein.
Um neun Uhr ist es immer noch ruhig. Eileen sitzt auf dem Arbeitstisch und lässt die Beine baumeln, während sie mir von ihrem gestrigen Date erzählt. Pizzeria, Kino, Romantik. Ich arbeite an einem Kranz in Gelbtönen und nicke nach jedem zweiten Satz.
Um halb zehn fahren drei Polizeiautos gleichzeitig über den Parkplatz, bleiben dort aber nicht stehen, sondern durchqueren den Haupteingang. Einer der Wagen ist ein Kleinbus, und ich schätze, dass sich darin ein Transportsarg aus Aluminium befindet.
Außer mir bekommt niemand im Laden es mit. Matti und Paula haben Kunden, Eileen schwärmt immer noch von Lukas, dem hinreißenden Maschinenschlosser. Erst eine halbe Stunde später stürzt Albert herein. Er ist mit Matti befreundet und weiß, wie wild der auf Neuigkeiten ist. »Sie haben einen Toten gefunden! Gruppe 133, sieht nach Mord aus!«
»Echt jetzt?« Matti stellt einen Eimer mit Rosen ab. »Wer hat ihn gefunden? Einer von euch?« Totengräber wie Albert müssen mit ihren Kleinbaggern auch in die entlegeneren Ecken des Friedhofs.
»Nein.« In seiner Stimme schwingt echtes Bedauern mit. »Einer von der städtischen Gärtnerei. Er sollte zwei Reihen weiter ein Grab neu bepflanzen. Aber ich habe noch einen Blick auf die Leiche werfen können, bevor sie abgesperrt haben!« Er zückt sein Handy. »Willst du …«
»Du spinnst, oder?«, fällt Paula ihm ins Wort. »Sag nicht, du hast ein Foto gemacht.«
Alberts schuldbewusster Blick spricht Bände. Er streicht sich durch den langen Bart, mit knapp sechzig ist Albert der älteste Hipster Wiens. »Äh. Nein. Nur vom Grabstein, der ist wieder beschmiert worden.«
Matti zieht seinen Kumpel am Arm zum Ausgang. »Ich gehe nur schnell raus, eine rauchen.« Bevor Paula protestieren kann, haben sie die Tür schon hinter sich zugezogen. Durch das große Frontfenster sehen wir, wie sie zwanzig Meter weiter stehen bleiben und sich ihre Zigaretten anzünden. Dann beugen sie sich über Alberts Handy.
»Idioten«, schimpft Paula. »Als hätten wir nicht genug Tote um uns herum.«
»Aber keine so frischen«, erklärt Eileen lächelnd; sie ist derzeit wirklich durch nichts von ihrer Wolke zu holen. »Du weißt doch, wie gern Matti Krimiserien schaut, und jetzt hat er den Mord direkt vor der Tür.«
Paula murmelt etwas vor sich hin, das nicht freundlich klingt, doch dann betritt eine Kundin den Laden, und sie setzt ihr professionelles Lächeln auf. »Wie kann ich helfen?«