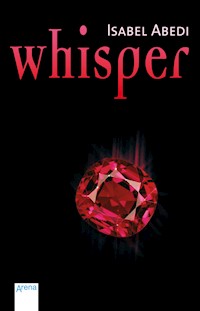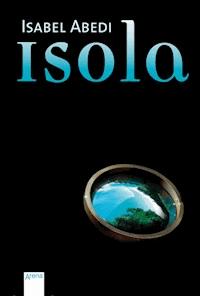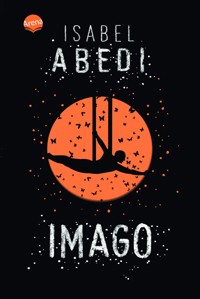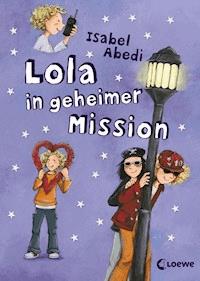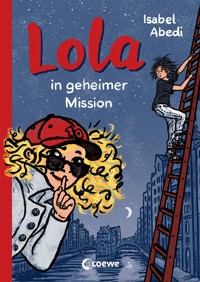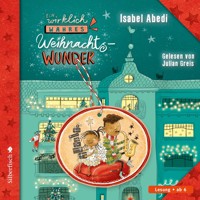Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Von einem Tag auf den anderen verschwinden berühmte Bauwerke auf der ganzen Welt. Die Freiheitsstatue, der Eiffelturm, das Berliner KaDeWe – viele Gebäude sind auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Mit jedem neuen Tag löst sich eine weitere Sehenswürdigkeit in Luft auf. Otis und Olivia finden sich auf einmal geschrumpft in einem düsteren Raum wieder. Dort treibt ein unheimlicher Riese sein Unwesen. Wie sind sie nur dort hingelangt und wie sollen sie diesem verrückten Ort wieder entfliehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Ein rätselhaftes Vorspiel
Schwindelnde Höhen und drohende Veränderungen
Kreuzberger Nächte sind lang
Mach nicht so ein Gesicht!
Das Mädchen mit der Taube
Otis am Haken
Olivia auf der Flucht
Wo ist Otis?
Die Welt ist wirklich klein
Der Ausblick aus dem Wintergarten
Flächen, Säulen und Abgründe
Help heißt Hilfe
Ein düsterer Empfang
Eine weiße Taube in dunkler Nacht
Ausbruch und Aufbruch
Carlos bekommt einen Wutanfall
Ich bin keine Mücke!
Hoch hinauf
Ein kleines und ein großes Licht
Ein Regal in Forthwick Castle
Wie das freudige Gebrüll eines Tyrannosaurus Rex
Die westliche Welt nennt mich Minima
Ein Stück Land bei Barcelona
Maßstab 1:75
Sonne, Mond und Schreie
Ich bin der König der Welt
Sieg und Verlust
Nachrichten aus aller Welt
Verpflegung und Verschönerungen
Nicolas sieht Gespenster
Ein Ritt ins alte Persien
Tapfere Cherilyn
Alles wegen einer kleinen Spinne
Eine große Tüte Schwachsinn
Ein großes Kasino verschwindet, und ein kleiner Sessel taucht wieder auf
Zwei Schwestern aus Zauber und Luft
Neue Sorgen und zwei neue Gäste
Menschen aller Länder, vereinigt euch!
Der Irrgarten
Die Sagrada Família
Salome langweilt sich
Gefährlicher Besuch
Alles verloren?
Ein Schlüssel für Cherilyn
Wie eine betrunkene Hummel
Das Schloss im Schloss
Arme kleine Cherilyn
Tausendundeine Lampe
Ein Käufer für Forthwick Castle
Die westliche Welt nennt mich Maxima
Hinaus, hinein und hinab
Alles auf einen Streich
Das Duell
Mikroben
Wiedervereinigung
Viele Fragen
Zurück!
Und was jetzt?
Ein Interview und zwei Entscheidungen
Ein glückliches Nachspiel
Danke!
Reginalds Welt
Für Sofia,
meinen Schutzengel
»Kannst du kein Stern am Himmel sein,
so sei eine Lampe im Haus.«
EINRÄTSELHAFTESVORSPIEL
Eigentlich war es eine Nacht wie im Märchen.
Klirrend kalt.
Still und sternklar.
Und die einzige Wolke am Himmel gab, wie von einer unsichtbaren Hand gezogen, den vollen Mond frei. Sein silbriger Schein fiel auf das nachtschwarze Schloss. Alles schlief, sogar Lord Darnley, der schwarze Schlosskater mit den schottisch gemusterten Söckchen an den Pfoten.
Wach war nur ein Einziger. Reginald.
Hätte auch er geschlafen, hätte er das zögernde Klopfen an der Tür nicht als Erster vernommen, so hätte diese Geschichte einen anderen Anfang, ein anderes Ende genommen oder wäre womöglich nie erzählt worden.
Aber Reginald schlief nicht. Er huschte auf seine lautlose Art durch die ehrwürdige Eingangshalle, eine Tasse dampfenden Tee in der linken Hand, eine Öllampe in der rechten. Die Lampe war aus dem 18.Jahrhundert, Reginalds Vater hatte sie nach dem Zweiten Weltkrieg einem venezianischen Kunsthändler abgekauft. Trotz ihres erstaunlichen Alters funktionierte die Lampe noch einwandfrei. Ihr flackerndes Licht warf geisterhafte Schatten über die Ahnengalerie an den Wänden; es streifte den schimmernden Rücken eines Tigers aus chinesischem Porzellan, tänzelte über die persischen Teppiche auf den hölzernen Dielen und schwebte schließlich vor der Eingangstür aus schwerer dunkler Eiche. Dort klopfte es wieder, zögernd, leise. Misstrauisch hielt Reginald inne. Wer kam so spät in der Nacht? Wer hatte jetzt, um diese Stunde, hierhergefunden? Selbst bei Tag war das Schlosshotel nicht leicht zu erreichen und Gäste waren für heute keine gemeldet.
Schon gar nicht zu dieser Unzeit.
Als Reginald die Tür einen Spaltbreit öffnete, sah er zunächst nur einen Schatten. Eine schmale Gestalt. Weißer Atem hing ihr vor dem Mund, um ihren Kopf war ein Tuch gewickelt, wie ein Turban sah es aus.
Ehe Reginald die Tür ganz öffnen konnte, hörte er auch schon das laute Klackern energischer Schritte hinter seinem Rücken.
Petula hatte das Klopfen also auch vernommen.
»Lass mich das machen«, sagte sie unwirsch. Sie zog den Gürtel um ihren karierten Schlafrock enger, schob ihren Mann zur Seite und riss mit einem Ruck die Tür auf.
Ein plötzlicher Windzug fegte ins Haus, so eisig kalt, dass sich Reginalds Beinhaare aufstellten.
»Sie wünschen?«
Ein Mann. Die fremde Gestalt war ein Mann. Weit, unendlich weit war er gereist, war auf Eseln, Elefanten und Kamelen geritten, hatte in Kutschen und Lastwagen gesessen, sich in Schiffsbäuchen und Eisenbahnwaggons versteckt – und war immer wieder gelaufen, gelaufen und nochmals gelaufen.
Seine weiße Kleidung war zerschlissen, sein hageres Gesicht mit dem aschfahlen Bart erschöpft und ausgelaugt, und die Schatten unter seinen Augen waren dunkel wie die Nacht. Aber in seinen Augen war ein Funkeln, das von innen her zu kommen schien. Als brenne ihm wirklich ein Wunsch auf der Seele, so hell, so verzweifelt, dass sein Gesicht ihn nicht zu verbergen vermochte.
Er war überall gewesen, dieser Mann, überall, an jedem noch so versteckten Winkel dieser Welt. Und nun war er hier.
Aber was er wünschte, sollte er nicht erhalten.
Und was er bei sich hatte, sollte ihm genommen werden.
In jener märchenhaften Nacht, mit der eine ebenso märchenhafte Geschichte ihren unheilvollen Anfang nahm.
Als der Morgen graute, war der Fremde verschwunden.
Und das Lächeln auf Reginalds Lippen strahlte heller als der Schein der aufgehenden Sonne.
SCHWINDELNDEHÖHENUNDDROHENDEVERÄNDERUNGEN
New York von oben zu sehen, zählt zu den Träumen eines jeden Besuchers dieser Stadt und in dem Schönheitssalon, wo Cherilyn Tilton arbeitete, konnte man sich diesen Traum erfüllen. Der Schönheitssalon trug den Namen New You und lag im 48. Stockwerk eines kreisrunden Wolkenkratzers.
Hier oben lag einem die Stadt buchstäblich zu Füßen. Der mächtige Trump Tower, die stählerne Brooklyn-Brücke und das kantige Empire State Building, dessen Spitze im Film der Riesenaffe King Kong erklommen hatte, waren nur einige der Sehenswürdigkeiten, die man von der breiten Glasfront der einzelnen Kabinen aus bewundern konnte. Und an klaren Tagen, wenn im Westen der Stadt die orangefarbene Sonne unterging und den New Yorker Himmel in ein wildes Farbenmeer verwandelte, meinte man fast ein wenig, Gott zu sein. Darin waren sich alle Besucher des Schönheitssalons einig – alle außer Cherilyns einzigem Sohn Otis.
Seit sie nach New York gezogen waren, hatte Otis seine Mutter schon viele Male in der luftigen Höhe des Schönheitssalons besucht. Aber bis an die gläserne Front heranzutreten, war ihm bislang nie gelungen. Und das hatte einen einfachen Grund: Otis Tilton litt an Höhenangst.
Manch einer vermutete, dass es die Umstände seiner Geburt vor zwölfeinhalb Jahren gewesen waren, die diese Höhenangst verursacht hatten. Otis war nämlich in einem Flugzeug zur Welt gekommen. Der Kopilot persönlich hatte Cherilyn bei der Entbindung geholfen, die Stewardess hatte die Nabelschnur mit einem Dessertmesser aus der ersten Klasse abgetrennt und das Baby in eine himmelblaue Continental-Wolldecke gewickelt. Zum Dank hatte Cherilyn ihren Sohn Otis mit zweitem Namen Continental getauft und war damals sogar im Fernsehen mit ihm aufgetreten. Die Geburt von Otis Continental hatte in ganz Amerika für Schlagzeilen gesorgt und jedes Mal, wenn seine Mutter davon erzählte, meinten die Leute, sich noch an ihren Fernsehauftritt erinnern zu können.
Inzwischen war aus dem prallen, sieben Pfund schweren Flugzeugsäugling mit den dicken Babyspeckringen an Armen und Beinen ein auffallend zarter Junge mit lackschwarzem Haar und grünen Katzenaugen geworden. Das Auffallendste an ihm waren jedoch die langen, geschwungenen Wimpern, die Otis diesen mädchenhaften Ausdruck gaben. Cherilyn meinte, für solche Wimpern würde eine Frau ihr halbes Vermögen hergeben, aber Otis konnte seine Wimpern nicht ausstehen. Einmal hatte er sogar versucht, sie abzuschneiden, aber Cherilyn hatte ihm entsetzt die Schere aus der Hand gerissen.
Da hatte sich Otis mit seinen Wimpern abgefunden. Mit seiner Höhenangst dagegen fand er sich nicht ab – und hätte Otis sie mit irgendeiner Zauberschere dieser Welt entfernen können, er hätte es sofort getan.
Aber Ängste konnte man nicht wegschneiden.
»Seinen Ängsten muss man begegnen«, pflegte Cherilyn zu sagen. Und Otis gab sein Bestes.
Jeden Freitagnachmittag, wenn er seine Mutter im 48. Stockwerk des kreisrunden Wolkenkratzers von der Arbeit abholte, versuchte er, sich einen Zentimeter weiter an die Glasfront heranzukämpfen.
Warum Otis so dringend aus dem Fenster sehen wollte?
Auch das hatte einen einfachen Grund: Die gigantischen Bauwerke dieser Stadt faszinierten ihn. Von allen Orten, an denen Otis mit seiner rastlosen Mutter gewohnt hatte – und er hatte an so vielen gewohnt, dass er sie kaum noch zählen konnte –, war ihm New York der liebste.
Es war sein entschiedenster Vorsatz, es irgendwann so weit zu schaffen, dass er von hier oben aus bis auf die Brooklyn-Brücke hinabschauen konnte.
Otis wusste alles über die Brooklyn-Brücke. Wann sie erbaut worden war und von wem. Und sogar, dass der Architekt nach der Fertigstellung des weltberühmten Bauwerks den Zirkus Barnum mit all seinen Elefanten über die berühmte Hängebrücke geschickt hatte, um ihre Tragfestigkeit zu überprüfen.
In manchen Nächten, wenn Otis nicht schlafen konnte, stellte er sich vor, wie er selbst auf einem Zirkuselefanten über die Brooklyn-Brücke ritt, ohne dass ihm dabei vor Höhenangst schwindelig wurde. Aber das war natürlich ein Traum.
Was die Wirklichkeit anging, würde Otis genug damit zu tun haben, es schwindelfrei bis zum Fenster von Cherilyns Schönheitssalon zu schaffen, und das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Zentimeterarbeit.
Heute, an einem klirrend kalten Freitagnachmittag im Dezember, war es wieder einmal so weit. Mit dem festen Willen, seinen Rekord von letzter Woche um einen Zentimeter zu übertreffen, betrat Otis den Aufzug im Erdgeschoss und drückte mit einem tiefen Atemzug auf die Nummer 48. Mit einem Klacken schloss sich die Tür, und der Aufzug rauschte nach oben. Otis kniff die Augen zu, versuchte, das Schwindelgefühl zu unterdrücken, und ging, oben angekommen, mit großen Schritten auf das Behandlungszimmer seiner Mutter zu.
Cherilyn Tilton
Kosmetik & Gesichtsbehandlungen
Massage & Maniküre
stand auf dem silbernen Schild neben der Tür. Bevor Otis die Klinke hinunterdrückte, warf er einen raschen Blick auf die Uhr. Kurz nach vier. Cherilyns letzte Behandlung für heute müsste bereits begonnen haben – und der zitronige, leicht krautige Duft, der ihm aus dem Türspalt entgegenkam, gab Otis recht.
»Verbena officinalis«, murmelte er schnuppernd. Cherilyns Vorliebe für pflanzliche Duftstoffe hatte Otis quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Zu Hause roch es ständig nach irgendwelchen geheimnisvollen Aromamischungen, die seine Mutter in den blauen Behälter ihrer kleinen Öllampe füllte, damit sie im warmen Lampenöl ihre Wirkung entfalteten. Und was sie angeblich bewirken sollten, wurde Cherilyn nicht müde zu erzählen.
Verbena officinalis förderte Reichtum und Wohlstand, wirkte wohltuend bei Migräne und kündigte außerdem Veränderungen an. Für Otis stand Verbena officinalis jedoch vor allem dafür, dass er Cherilyns Kabine während der Freitagnachmittagbehandlung betreten durfte. Sie benutzte diesen Duft nämlich ausschließlich für Scarlett Silverstone, eine steinalte Millionärin mit weiß blondiertem Haar, die unter Tränensäcken und starken Kopfschmerzen litt.
Da saß sie auch schon, die alte Dame; ihren Kopf in Cherilyns Händen, die Augen fest geschlossen, die Lippen in Bewegung.
Lautlos schob sich Otis in die Kabine. Eigentlich war es mehr ein Saal als eine Kabine, kreisrund, mit hellen Möbeln und einer riesigen, vom Fenster bis zum Boden reichenden Glasfront. Der Duft von Verbena officinalis erfüllte den ganzen Raum – und die alte Dame plapperte mal wieder, was das Zeug hielt. Otis musste grinsen, als er ihre Worte aufschnappte. Ganz offensichtlich war Scarlett Silverstone mal wieder bei ihrem Lieblingsthema angelangt. »Natürlich musste ich nach der Abreise aus Schottland meinem kleinen Goldstück noch einen Besuch abstatten«, zwitscherte sie, während sie sich von Cherilyn die Schläfen massieren ließ. »Ach, meine Guteste, Sie wissen ja gar nicht, wie sehr ich unter der Trennung leide.«
Cherilyn warf Otis einen Luftkuss zu und erwiderte sein Grinsen mit einem Augenzwinkern. Doch, sie wusste es – und Otis wusste es auch, schließlich hörten sie es jeden Freitagnachmittag aufs Neue.
Scarlett Silverstones Goldstück war ihre Enkelin Salome, die im letzten Sommer mit ihren Eltern nach Europa umgesiedelt war. Scarlett Silverstone liebte Salome abgöttisch und behauptete immer, Otis wäre ein ganz wunderbarer Spielkamerad für ihr kleines Goldstück gewesen.
Und während Otis im Schneckentempo die gläserne Fensterfront in Angriff nahm, plauderte Scarlett Silverstone weiter. »Aber zumindest hatte ich Salome nach meinem Schottlandaufenthalt ein paar Tage in meiner Nähe und wie immer wollte das kleine Goldstück mit mir in den Zoo, um ihre Lieblingstiere zu sehen. Na …?« Scarlett Silverstone legte eine kunstvolle Pause ein. »Was meinen Sie, welche Tiere das sind?«
»Vielleicht die Löwen?«, riet Cherilyn höflich und Otis gab sich alle Mühe, nicht loszuprusten. Es war ganz offensichtlich, dass seine Mutter auch dieses Rätsel nicht zum ersten Mal lösen sollte, aber Cherilyn spielte ihre Ahnungslosigkeit perfekt.
»Falsch!«, gluckste die alte Dame begeistert. Sie hatte ihr linkes Auge geöffnet und klimperte Otis zur Begrüßung freudig zu. »Es sind die Elefanten – und zwar vornehmlich: die weißen Elefanten. Aber damit konnte der Zoo leider nicht dienen. Es war mal wieder eine arge Enttäuschung für Salome. Stell dir vor, lieber Otis, mein kleines Goldstück wünscht sich so sehnlich, auf dem Rücken eines weißen Elefanten zu reiten. Ist das nicht ein ganz und gar entzückender Wunsch? Aber wo findet man heutzutage noch weiße Elefanten?«
Die alte Dame stieß einen mitleidsvollen Seufzer aus und Otis, der jetzt fast in der Zimmermitte angekommen war, stutzte. Salome wollte auf dem Rücken eines weißen Elefanten reiten? Wie seltsam, dass ausgerechnet er einen ähnlichen Traum wie Scarlett Silverstones Enkelin hatte!
Eine Antwort auf die Frage ihrer Großmutter wusste er natürlich nicht, aber die alte Dame schien auch keine zu erwarten und Otis setzte einen zögernden Schritt nach vorn. Gut drei Meter war das große Fenster jetzt noch von ihm entfernt und die Aussicht machte ihn schwindelig – vor Glück und Angst zugleich.
»Aber dafür, lieber Otis«, fuhr Scarlett Silverstone fort, »habe ich dir heute endlich ein Foto von meiner kleinen Salome mitgebracht. Dort drüben, siehst du?«
Widerwillig ließ Otis sein Ziel aus den Augen und folgte Scarlett Silverstones Zeigefinger in Richtung ihrer fliederfarbenen Wildledertasche, die am Kleiderhaken neben der Eingangstür hing. »Es müsste ganz vorne in der Tasche stecken. Such es dir ruhig heraus und schau dir mein kleines Goldstück mal an. Sicher hast du dich schon oft gefragt, wie sie aussieht.«
Nein, um ehrlich zu sein, diese Frage hatte sich Otis noch nicht gestellt und Salome Silverstone interessierte ihn auch heute nicht im Geringsten. Aber natürlich wollte er Cherilyns beste Kundin nicht verärgern.
Gehorsam ging Otis zurück zur Tür und zog ein silbergerahmtes Foto aus der Handtasche. Es zeigte ein etwa sechsjähriges Mädchen mit langen blonden Zöpfen. Man hätte es durchaus als hübsch bezeichnen können, wäre auf seiner Stirn nicht diese tiefe Zornesfalte gewesen. Das Mädchen grinste, aber es war ein böses, ja, fast gemeines Grinsen, das eigentlich mehr wie ein Zähneblecken aussah. Auf den Zähnen des Mädchens prangte eine silberne Zahnspange und in der Hand hielt es eine Ballerinapuppe mit verdrehten Beinen und bekritzeltem Gesicht.
Angewidert schob Otis das Foto zurück in die Handtasche.
»Ist sie nicht niedlich?«, fragte Scarlett Silverstone Beifall heischend. Zum Glück hatte sie ihre Augen wieder fest geschlossen, sodass Otis seine Miene nicht verstellen musste. Aber sagen konnte er beim besten Willen nichts. Er biss sich auf die Lippen und warf seiner Mutter einen flehenden Blick zu. Cherilyn tauchte ihre Fingerspitzen in eine ölige Flüssigkeit und begann, die Ohrläppchen der alten Dame zu massieren.
»Sie sagten vorhin, Sie haben die kleine Salome nach Ihrem Schottlandurlaub besucht, MrsSilverstone?«, wechselte sie gekonnt das Thema. »Wo genau waren Sie denn da, wenn ich fragen darf?«
Scarlett Silverstone seufzte genießerisch, und Otis atmete erleichert auf. Cherilyn hatte ihre Ohrläppchenmassage mehrfach an ihm ausprobiert – sehr zu Otis’ Leidwesen –, aber Scarlett Silverstone genoss es sichtlich. Und Cherilyns Ablenkungsmanöver funktionierte bestens.
»Oh, ich war an einem reizenden, wundervollen Ort«, erwiderte die alte Dame begeistert. »In Forthwick Castle, einem alten Schlosshotel in den schottischen Hochlanden, fernab von allem, man möchte fast sagen, am Ende der Welt. Das Gebäude würde dir gefallen, Otis Continental. Deine Mom hat mir erzählt, wie sehr du dich für Architektur interessierst, und Forthwick Castle ist wirklich ein Schatzkästchen, ein ganz erstaunliches Bauwerk. Wir Amerikaner können uns das hier ja gar nicht vorstellen. Die Schlosshalle, in der wir gespeist haben, ist eine der ältesten ganz Europas und es gibt lediglich dreizehn Gästezimmer im ganzen Anwesen. Dabei war der Aufenthalt ein Schnäppchen.« Scarlett Silverstone gluckste vergnügt. Trotz ihrer Millionen, hatte Cherilyn Otis erzählt, achtete die alte Dame peinlich genau darauf, nicht zu viel Geld auszugeben.
»Stellen Sie sich vor, dem schwarzen Schlosskater haben sie sogar schottische Söckchen über die Pfoten gestreift, ist das nicht entzückend? Wie hieß er doch gleich, Lord Irgendwas, ein wunderlicher Name.«
»Ein schwarzer Hauskater, wie niedlich!« Ein Lächeln erschien auf Cherilyns Lippen. Otis’ Mutter liebte Katzen.
»Ja, wirklich ganz entzückend«, schwärmte Scarlett Silverstone weiter. Otis stellte seine Ohren auf Durchzug und setzte seinen Versuch, der gläsernen Front ein Stück näher zu rücken, fort. Drei Schritte, vier, fünf, sechs und – sieben. Jetzt war er an dem kleinen runden Ölfleck angelangt, den Cherilyn beim Füllen ihrer Lampe auf dem hellen Teppich hinterlassen hatte. Otis hatte sich diesen Fleck als Markierung seines letzten Rekords gemerkt. Vorsichtig und mit rasendem Pulsschlag schob er jetzt seinen linken Fuß weiter vor. Einen halben – und einen ganzen Zentimeter. Geschafft!
Er zog den rechten Fuß nach und jubelte innerlich auf. Er war seinem Ziel näher gekommen, ein winziges Stück nur, aber immerhin: Es ging voran!
Mit angehaltenem Atem hob Otis den Kopf und starrte nach draußen, um sich von seiner neuen Bestleistung zu überzeugen. Den obersten Zipfel des Rockefeller Centers hatte er bereits bei seinem vorletzten Besuch gesehen – und heute erhaschte er zum ersten Mal die äußerste Ecke des Chrysler-Hochhauses. Wie flüssiges Gold fiel der Schein der untergehenden Sonne auf die Fassade.
Otis lächelte – und seufzte. Die Brooklyn-Brücke war noch nicht zu sehen. Noch lange nicht!
Von hinten drang wieder Scarlett Silverstones Stimme an sein Ohr. Die alte Dame hatte sich in Rage geredet und war noch immer bei diesem schottischen Schlosshotel.
»… und erst die Einrichtung!«, rief sie aus. »Zauberhaft, meine Guteste, ganz und gar zauberhaft! Natürlich gibt es Ritterrüstungen, eine Ahnengalerie und alte Wappen. Nicht zu vergessen die wunderlichen Kuriositäten aus aller Herren Länder. Der ehemalige Schlossherr soll weit gereist sein, erzählte man mir.«
Otis drehte sich um und sah, wie Scarlett Silverstone auf Cherilyns blaue Lampe zeigte. »Ihnen hätten bestimmt die vielen kostbaren Öllampen gefallen, die überall in den Fluren und Zimmern hängen. Man fühlt sich wie in Tausendundeiner Naaahhh…« Die alte Dame unterbrach ihren Redefluss, um sich für einen Moment ganz dem Genuss der Massage hinzugeben.
Cherilyns blaue Augen hatten sehr plötzlich zu funkeln begonnen und Otis merkte, wie sich ein hohles Gefühl in seiner Magengegend breitmachte. Er kannte dieses Gefühl – und es hatte nichts mit seiner Höhenangst zu tun.
»Das klingt ja wirklich sehr aufregend«, hörte er seine Mutter flüstern. »Ein altes Schlosshotel, Otis, was sagst du dazu? Welche Sprache spricht man eigentlich in Schottland? Französisch?«
Otis vergrub den Kopf in den Händen. Er konnte sich an Cherilyns grenzenlose Unwissenheit in Geografie und Geschichte einfach nicht gewöhnen. Vor ein paar Tagen, als Otis mit einem Bildband über das Rom der Antike aus der Bibliothek gekommen war, hatte sich seine Mutter erkundigt, ob Rom die Hauptstadt von Bayern sei. Dass Rom in Italien lag und Bayern ein deutsches Bundesland war, hatte sie in größtes Erstaunen versetzt.
Und dass man in Schottland nicht Französisch, sondern Englisch sprach, weil es zu Großbritannien gehört, nahm Cherilyn jetzt entzückt zur Kenntnis. »Es gibt in diesem Schlosshotel nicht zufällig einen Schönheitssalon?«, fragte sie wie beiläufig.
Scarlett Silverstone seufzte erneut, diesmal allerdings voller Unbehagen. »Einen Salon schon«, bemerkte sie klagend und öffnete ihr rechtes Auge. »Aber die Kosmetikerin hatte drei Tage zuvor gekündigt und sie hatten noch keinen Ersatz gefunden. Deshalb bin ich ja auch so entsetzlich verspannt!«
Scarlett Silverstone klappte ihr rechtes Auge wieder zu und gab sich nun ganz der Wirkung der Massage hin. Irgendwann verriet ihr leises Schnarchen, dass sie eingeschlafen war. Sie lächelte selig wie ein kleines Kind.
Aber der Ausdruck, den Otis jetzt auf Cherilyns Gesicht erblickte, war unmissverständlich. Cherilyn drängte es nach Veränderung – das stand ihr auf der Stirn geschrieben. Und das hieß, dass der nächste Umzug in nicht allzu weiter Ferne lag.
Mit bleischwerem Herzen wandte sich Otis ein letztes, verzweifeltes Mal der Fensterfront zu. Aber allein bei dem Versuch, seinen Fuß einen weiteren Zentimeter voranzuschieben, brach ihm der Schweiß aus.
Und wie es aussah, würde er seinen Vorsatz, die Brooklyn-Brücke von oben zu sehen, jetzt auch nicht mehr verwirklichen können.
Als Scarlett Silverstone sich nach der Behandlung noch einmal dicht vor das große Glasfenster stellte, um den Anblick zu bewundern, sagte sie freudestrahlend: »Ich fühle mich wie neugeboren.«
Otis fühlte sich alles andere als das. Ihm war sterbenselend.
KREUZBERGERNÄCHTESINDLANG
Als Olivia Englert aus ihrem alten Kinderzimmerschrank kletterte und sich die steifen Glieder rieb, war es im Zimmer so dunkel, dass sie kaum die Hand vor den Augen erkennen konnte. Vorsichtig knipste sie die Lampe an, setzte sich ihre Taube Columbina auf die Schulter, kletterte über einen Stapel Helikopterbücher, der sich auf ihrem Fußboden türmte, lief ans Fenster und riss es auf. Nervös sah sie auf die Uhr – und atmete erleichtert aus. Die Digitalanzeige ihrer Armbanduhr zeigte 22:21Uhr und 50Sekunden.
In zehn Sekunden war es 22:22Uhr und auf die Sekunde genau würde auch heute wieder das Gebrüll des Obdachlosen an den grauen Betonwänden des Berliner Hinterhofes in Kreuzberg widerhallen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins – und da war er auch schon, der gellend laute Ruf, pünktlich wie immer: »ICH BIN EIN BERLINER!«
Obwohl es schon so spät war, spielten draußen im Hof noch Kinder, eine alte Frau, mit schweren Alditüten beladen, humpelte über den Gehweg und vor einer der Haustüren stritten sich zwei Männer. Auf den Ruf des Obdachlosen reagierte längst niemand mehr.
Als Olivia die Worte zum ersten Mal gehört hatte, war sie vier Jahre alt gewesen und hatte keine Ahnung gehabt, was sich dahinter verbarg. Mittlerweile wusste sie natürlich, dass es sich um ein weltberühmtes Zitat handelte und dass das Zitat aus der Rede des weltberühmten amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy stammte. Sogar dass die Worte gleich zweimal in Kennedys Rede vorgekommen waren, wusste Olivia, denn sie hatte die Textstellen in einem Geschichtsbuch nachgeschlagen und auswendig gelernt.
Die erste Stelle lautete: »Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz: ›Ich bin ein Bürger Roms.‹ Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz: ›Ich bin ein Berliner.‹«
Die zweite Stelle lautete: »Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger von Berlin, und deshalb bin ich als freier Mensch stolz darauf, sagen zu können: ›Ich bin ein Berliner!‹«
John F. Kennedy hatte diese Rede vor vielen Jahren vor dem Berliner Rathaus Schöneberg gehalten und ein paar Monate später war er in seiner Limousine in Amerika erschossen worden.
Auch das wusste Olivia. Wer den Präsidenten erschossen hatte und warum, hatte sie dagegen vergessen, aber das war ja auch schließlich nicht der Grund, warum sie die beiden Textstellen auswendig konnte. Es waren die Stellen mit der Freiheit, die Olivia so mochte.
Ein freier Mensch. In der Welt der Freiheit. Wie machtvoll und wunderbar diese Worte doch klangen. Jedes Mal, wenn Olivia den Ausruf des Obdachlosen hörte, flüsterte sie die Stellen mit der Freiheit hinterher und spürte, wie ihr Herz dabei schneller schlug. Auch heute – gerade heute – war es wieder so. Denn Olivia hatte fest vor, ein freier Mensch zu bleiben. Trotz der Umstände, die allesamt dagegen zu sprechen schienen.
Draußen war die Temperatur auf zehn Grad unter null gesunken. Ein eisiger Windzug fegte ins Zimmer. Columbina stieß ein unwilliges Gurren aus und Olivia schloss eilig das Fenster. Sie rieb sich die Beine, reckte ihre Arme in die Luft, drehte ihren Kopf nach links, dann nach rechts. Ihre Glieder knackten und ihr tat jeder Muskel weh, aber das war ja auch kein Wunder. Eine Stunde, siebzehn Minuten und 35Sekunden bewegungslos in einem dunklen Kleiderschrank auszuharren ist eine beachtliche Leistung für eine Elfjährige. Oder vielmehr: für eine Zwölfjährige, die Olivia seit heute war.
Olivia war ein kräftig gebautes Mädchen mit kastanienbraunen Augen, einem ausgeprägten Kinn und dicken, dunkelblonden Haaren, die kurz waren – aber nicht zu kurz, um alle möglichen oder unmöglichen Frisuren damit auszuprobieren. Zum Geburtstag hatte sie von ihrer Mutter eine Tüte Glitzerhaargummis bekommen, mit denen sich Olivia zwei Dutzend Zöpfe gemacht hatte. Wie Igelstacheln standen sie von ihrem Kopf ab und zeigten in alle Himmelsrichtungen.
Am Nachmittag hatte Olivias Mutter mit ihr auf den Geburtstag angestoßen. Olivia hatte Cola getrunken und ihre Mutter eine Dose Bier. Danach hatte ihre Mutter noch zwei weitere Dosen Bier getrunken und dann war sie einkaufen gegangen. Ein Glas Bockwürstchen und eine Flasche Ketchup für Olivia, zwei Flaschen Glühwein und eine Flasche Wodka für sich selbst.
Während Olivia kalte Würstchen mit Ketchup gegessen hatte, hatte sich ihre Mutter die erste Flasche Glühwein genehmigt und dabei mit lallender Stimme einen alten Berliner Schlager gesungen:
»Kreuzberger Nächte sind lang,
Kreuzberger Nächte sind lang,
Erst fang’ se janz langsam an,
Aber dann, aber dann …«
Ja, dann hatte Olivias Mutter die zweite Flasche Glühwein getrunken und nach der halben Flasche Wodka war sie umgekippt.
Olivia war es gewohnt, dass ihre Mutter umkippte. Sie konnte zwar nicht die Uhr danach stellen wie nach dem Ausruf des Obdachlosen, aber früher oder später kippte ihre Mutter mit zuverlässiger Regelmäßigkeit um. Und die letzten beiden Male war sie danach nicht mehr aufgestanden. Zum zweiten Mal in diesem Monat hatte Olivia einen Krankenwagen gerufen, die Wohnungstür geöffnet und sich mit ihrer Taube Columbina im Kleiderschrank versteckt, bis ihre Mutter abgeholt worden war.
»Aber uns bekommen sie nicht«, flüsterte Olivia Columbina zu. Sie dachte an Kennedys Sätze mit der Freiheit und streichelte ihrer Taube über die schneeweißen Federn. Wie wunderbar weich sie waren, wie Samt und Seide. Columbina stieß ein paar leise, behagliche Gurrlaute aus. Olivia legte ihre Nase an Columbinas Nacken, dort wo das Federkleid am weichsten war und aus unerfindlichen Gründen immer ein wenig nach Zimt roch.
»Uns holen sie nicht ab, die Idioten vom Jugendamt«, flüsterte sie. »Uns nicht, das verspreche ich dir, Columbina. So wahr ich Olivia Englert heiße: Wir zwei lassen uns nicht in ein Heim sperren!«
Aber diesmal würde es schwierig werden, das wusste Olivia.
Beim letzten Mal hätte der Mann vom Jugendamt ihr Versteck um ein Haar gefunden und nachdem Olivias Mutter zurückgekehrt war, hatte er jeden Tag geklingelt und stundenlang vor dem Hof gewartet. Und vor zwei Tagen war er sogar in die Schule gekommen.
»Pech. Dann gehe ich halt nicht mehr hin«, sagte Olivia zu ihrer Taube. »Übers Fliegen kann ich dort sowieso nichts lernen. Ach, Columbina, du hast es gut. Du hast zwei Flügel, brauchst sie nur auszubreiten und – zwusch, bist du die Königin der Lüfte und fliegst fort, fort, fort!«
»Gurrrru«, machte Columbina, flatterte auf den Küchentisch und pickte ein paar Wurstreste von Olivias Geburtstagsessen auf.
Olivia breitete die Arme aus und lief um Columbina herum, schneller und schneller, bis ihr schwindelig wurde. »Fertig machen zum Start, wir heben ab!«, rief sie und sprang in die Luft. Eine halbe Sekunde später kam sie wieder auf dem Boden auf – und dann schrillte die Klingel. Ein durchdringendes, hässliches Geräusch.
»Aufmachen!«, rief eine dunkle Männerstimme. »Wir wissen, dass du da bist, mach auf! Hier ist die Polizei!«
»Verdammt!«, zischte Olivia. »Los, Columbina, wir müssen hier weg!«
Die Taube flatterte auf Olivias Schulter. Das Klingeln wurde länger, durchdringender, hässlicher.
»Olivia Englert!«, polterte die Männerstimme. »Wenn du nicht aufmachst, müssen wir die Tür aufbrechen!«
Olivia raste in ihr Zimmer. Schnappte sich ihren Rucksack. Griff nach einem Wollpulli, stopfte ihn rein, ebenso ihren alten Discman, den sie auf dem Flohmarkt gekauft hatte, und das Foto ihres Vaters, der vor acht Jahren gestorben war. Ihr Vater war Pilot gewesen, Helikopterpilot. Seinen Computer, den er Olivia hinterlassen hatte, würde sie nicht mitnehmen können, ebenso wenig wie den kleinen schwarzen Flugsimulator und all die Bücher, die sich in Olivias Kinderzimmer türmten, auf dem grünen Plastikhocker neben dem Bett, auf Regalflächen und auf dem Schreibtisch aus Sperrholz. Olivia raste zurück in den Flur, riss ihren Mantel von der Kleiderstange, die Mütze, den Schal.
Draußen warf sich jemand gegen die Tür. Holz splitterte.
Olivia hechtete zum Fenster. Draußen hatte es zu hageln begonnen.
Ihre Wohnung lag im ersten Stock. Vor dem Fenster war ein vereistes Blumenbeet. Wie tief mochte es sein? Drei Meter, vier, fünf? Die Haustür flog auf.
Columbina flatterte von Olivias Schulter. Ein weißer Schatten in der dunklen Nacht. Aber Olivia konnte nicht fliegen.
Sie musste springen.
MACHNICHTSOEINGESICHT!
Bislang war für Otis der Freitag immer der schönste Tag der Woche gewesen. Seit jeher hatte er sich aussuchen dürfen, was Cherilyn und er an diesem Tag nach Feierabend unternahmen. Und die mit Abstand schönsten Freitagnachmittage hatte Otis in New York erlebt. Gemeinsam hatten sie die Architekturausstellung im Museum of Modern Art besucht, weltberühmte Stars in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett angesehen oder an einer der Straßenbuden haltgemacht, um einen Hotdog mit Senf und sauren Gurken zu essen.
Doch als Otis an diesem speziellen Freitag hinter Cherilyn in den Aufzug stieg, war ihm völlig gleichgültig, wohin sie gingen. Seit MrsSilverstone von der verlassenen Kosmetikstelle in diesem schottischen Schloss gesprochen hatte, hatten Cherilyns blaue Augen nicht mehr aufgehört zu glitzern. Sie hatte die Worte der alten Dame noch mit keiner Silbe kommentiert, aber was daraus werden würde, war für Otis so sicher wie das Amen in der Kirche.
Freitag – sein Glückstag? Wie hatte er nur so blöd sein können!
»Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wohin wir heute gehen wollen, muss ich das eben übernehmen«, sagte Cherilyn fröhlich. »Am Rockefeller Center leuchtet seit gestern der Weihnachtsbaum, es wird wunderschön sein.«
Und das war es auch.
Als Otis mit seiner Mutter ins Freie trat, fielen wie auf Bestellung die ersten Schneeflocken. Am Himmel funkelte bereits der Abendstern und bei der Eisbahn des Rockefeller Centers wurde eine 25Meter hohe Fichte von 30000 Lichtern angestrahlt. Ja, es war so schön wie im Märchen, aber als Otis die Schlittschuhläufer ihre anmutigen Pirouetten auf der schillernden Eisfläche drehen sah, traten ihm heiße Tränen in die Augen. Voriges Jahr bin ich zum ersten Mal hier gewesen, dachte er. Und dieses Jahr wird es mein letztes Mal sein.
»Na, komm schon, Katerchen, mach nicht so ein Gesicht.« Cherilyn wuschelte ihrem Sohn durch die Haare und zog ihn mit sich zum Schlittschuhverleih. Die mürrische Miene des Mannes hinter dem Tresen verwandelte sich in ein strahlendes Lächeln, als Cherilyn und Otis an der Reihe waren. Wie seine Mutter auf andere wirkte, war Otis gewöhnt. Cherilyn war eine beeindruckend gut aussehende Frau. Das glänzend schwarze Haar reichte ihr bis zu den wohlgeformten Hüften, und was ihr Gesicht betraf, mussten sogar ihre Kolleginnen im Schönheitssalon feststellen, dass Cherilyn anmutete, als sei sie selbst ihre beste Kundin.
Heute trug Cherilyn einen leuchtend roten Wollmantel, einen dunkelgrünen Samtschal und ein weißes Käppi aus Pelzimitat. An ihren Ohren baumelten große silberne Christbaumkugelohrringe, in denen sich die Lichter New Yorks spiegelten.
Sobald sie auf der Eisbahn war, fasste Cherilyn Otis an den Händen und wirbelte ihn über das Eis. Dabei strahlte sie über das ganze Gesicht. Cherilyns Fröhlichkeit konnte ansteckender als jede Grippe sein. Irgendwann musste auch Otis lächeln, und je länger sie ihre gemeinsamen Kreise zogen, desto stärker zog der zauberhafte Ort Otis in seinen Bann.
Als er mit roten Wangen neben seiner Mom in einem Restaurant saß und einen Truthahnburger mit Pommes frites verschlang, hatte er seine dunklen Sorgen um die Zukunft fast vergessen.
Aber kaum waren sie zu Hause, legte Cherilyn los.
Und dann ging alles so schnell, dass es Otis fast schwindelig wurde. Cherilyn hockte sich, noch in Schal und Mantel, an den Computer und stieß, nachdem sie im weltweiten Netz das Schlosshotel Forthwick Castle ausfindig gemacht hatte, Schreie der Begeisterung aus.
Otis verdrückte sich in sein Zimmer und drehte die Musik von seinem Lieblingssänger Eminem so laut, dass er Cherilyns Gekreische nicht mehr hören musste. Dann schlug er seinen Bildband über Kirchen und Klöster der Weltgeschichte auf und vertiefte sich in die tröstlich vertrauten Grundrisse. Als er gerade mit der Fingerspitze an den Türmen des Kölner Doms entlangfuhr, legte sich Cherilyns Hand auf seine Schulter und das Unvermeidliche brach über Otis zusammen.
»Mein Sohn, wir ziehen nach Schottland«, verkündete Cherilyn und drückte ihm ein Blatt Papier in die Hand. »Unser nächstes Weihnachtsfest feiern wir auf Forthwick Castle.«
Verstört starrte Otis den Artikel an, der die Fotografie eines Burgschlosses zeigte. Es thronte auf einer steilen Klippe und sah aus, als wäre es mindestens 1000 Meilen von jeglicher Zivilisation entfernt. Otis schnappte nach Luft, aber Cherilyn zwinkerte ihm zu und verließ fröhlich pfeifend das Zimmer.
Otis brauchte ein paar Minuten, um sich zu sammeln. Dann las er den Artikel:
Ein Schlosshotel am Ende der Welt
Einsame Seen, schroffe Berge und geheimnisvolle Schlossburgen prägen die dramatische Landschaft der vom Wind umbrausten schottischen Highlands. Eine dieser Schlossburgen ist Forthwick Castle.
Dass aus dem 1443 errichteten Bauwerk ein echter Geheimtipp geworden ist, verdankt es dem reichen Kaufmann Wilbert Winter. Er besuchte ForthwickCastle auf seinen Reisen durch die Welt und fand ein heruntergewirtschaftetes Schlosshotel mit einer verwitweten Schlossherrin vor. In sie verliebte sich Wilbert Winter – und richtete das verfallene Gemäuer wieder her. Neben der beeindruckenden Architektur faszinieren jetzt vor allem die Antiquitäten aus aller Welt, die der leidenschaftliche Sammler Wilbert Winter nach ForthwickCastle brachte. Als beispiellos gilt die Sammlung kostbarer Öllampen. Auskünften des Schlosspersonals zufolge sollen es genau tausendundeine Lampe sein und von manchen wird gemunkelt, sie kämen geradewegs aus dem Land der Märchenprinzessin Scheherezade.
Mittlerweile wird ForthwickCastle von Wilbert Winters Nachkommen geführt. Mit einer hervorragenden Schlossküche, dreizehn Gästezimmern sowie einem Schönheitssalon in den Kellerräumen weiß die Belegschaft von ForthwickCastle seine Gäste zu verzaubern. Entdecken Sie also einen Ferienort der besonderen Art – in einem verwunschenen Schlosshotel am Ende der Welt.
Otis ließ den Artikel sinken. Cherilyns Worte von vorhin klangen in seinen Ohren nach, setzten sich zusammen, bruchstückhaft, wie die Scherben einer hinuntergefallenen und schlecht geklebten Porzellanfigur. Umzug – Schottland – nächstes Weihnachtsfest – Forthwick Castle.
Mit einem wilden Satz sprang Otis auf und stolperte in die winzige Küche, wo seine Mutter gerade heiße Schokolade kochte.
»Unser nä-nächstes Weihnachtsfest?« Otis konnte vor Entsetzen kaum sprechen. »Soll das etwa heißen, wir ziehen noch in diesem Jahr um?«
»Das soll es, Katerchen.« Cherilyn füllte die Schokolade in zwei Tassen, streute eine Prise Zimt darüber und stellte eine vor Otis auf den Tisch. »Ich habe alles geklärt. Es ist vielleicht ein wenig überstürzt, aber wenn ich nicht sofort reagiert hätte, wäre der Job weg gewesen und das wollen wir doch nicht.«
Otis überhörte das wir und starrte fassungslos auf seine Tasse, auf der in großen roten Buchstaben I ♥ NEW YORK stand.
»Es ist einfach unglaublich gelaufen«, sprudelte es aus Cherilyn heraus. »Mein erstes Bewerbungsgespräch übers Telefon! Und es hat gleich geklappt. Petula – das ist übrigens meine neue Chefin – hat sich nach unserem ersten Gespräch offenbar noch mal bei Scarlett Silverstone rückversichert. Aber dann kam auch schon ihr Rückruf mit der Zusage. In zehn Tagen trete ich meine neue Arbeit an. Na, was sagst du dazu?«
Otis sagte nichts. Er fühlte sich wie in einem Traum, und zwar in einem, aus dem er am liebsten so schnell wie möglich wieder erwacht wäre.
»Aber«, flüsterte er schließlich, »aber was ist mit unseren Möbeln, mit meiner Schule, mit …« Die Stimme versagte ihm.
»Alles geklärt«, erwiderte Cherilyn. »Die Möbel können wir einlagern, so haben wir es doch auch beim Umzug von Las Vegas nach Texas getan, weißt du nicht mehr?« Cherilyn pustete in ihren Kakao. »Viel ist es ja ohnehin nicht. Falls wir beschließen, in Schottland zu bleiben, sehen wir weiter. Fürs Erste brauche ich nur einen Koffer. Ich reise nächste Woche ab und du kommst vor Weihnachten nach. Bis dahin habe ich eine neue Schule für dich gefunden. Um eine Wohnung brauchen wir uns schließlich keine Sorgen zu machen. Wir wohnen im Schloss!« Cherilyn strahlte Otis an, als hätte sie gerade ihr erstes Weihnachtsgeschenk geöffnet.
Otis schloss die Augen.
»In einem der Türme gleich unter dem Dach«, hörte er seine Mutter schwärmen, »gibt es zwei wunderschöne Zimmer für uns. Und wie du die Woche in New York überbrückst, bis du nach Schottland nachkommst, habe ich auch schon geklärt: Du wohnst bei Duncan Stomp. Seine Mutter war vor einiger Zeit bei mir in Behandlung. Ich habe ihr eine haarige Warze am Kinn entfernt und als ich sie eben anrief und fragte, ob du für eine Weile bei ihnen wohnen dürftest, hat sie keine Sekunde gezögert. Na, habe ich mich nicht selbst übertroffen? In zwei Stunden das Leben ändern, das soll mir erst mal einer nachmachen.«
Otis hatte die Augen wieder aufgerissen.
Cherilyn machte ein Gesicht, als hätte sie sich soeben einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde verdient, aber Otis hatte ihr gar nicht mehr zugehört. Er sprang so heftig auf, dass der Kakao über den Rand seiner Tasse schwappte. »Bei DUNCAN STOMP?«
Das war nun wirklich der Gipfel! Otis hatte sich daran gewöhnt, dass er durch seine ständigen Schulwechsel keine dauerhaften Freundschaften schließen konnte. Aber Feinde hatte er bislang auf jeder Schule gefunden – und Duncan Stomp war der übelste von allen. Die Liste seiner Gemeinheiten kannte kein Ende. Otis’ Pausenbrot mit flüssigem Kleister zu bestreichen, Fotos von nackten Frauen in sein Biologiebuch zu kleben oder seinen Hinterkopf während einer Mathearbeit mit rosa Graffitispray zu besprühen, waren nur einige der Streiche, die Duncan ihm gespielt hatte. Plötzlich bereute Otis bitterlich, dass er Cherilyn nie davon erzählt hatte. Er hatte immer Angst gehabt, dass sie eingreifen und es dadurch nur noch schlimmer machen würde. Und jetzt war es zu spät. Wenn Otis jetzt damit ankäme, würde Cherilyn denken, er wolle sich herausreden.
Otis sank zurück auf den Küchenstuhl. Er fühlte sich plötzlich wie ein Luftballon, aus dem jemand die Luft herausgelassen hatte.
»Ach, Katerchen, komm schon, mach es uns nicht so schwer.« Cherilyn streckte ihre Hand nach Otis’ Schulter aus. »Du wirst schon sehen, es wird bestimmt ganz wunderbar. Denk doch nur an all die herrlichen Bauwerke, die du dort entdecken kannst. Schottland soll voll von Schlössern und Burgen aus der Steinzeit sein. Und ist nicht sogar der Eiffelturm in Schottland?«
Otis schüttelte kraftlos den Kopf. »Der Eiffelturm steht in Paris, Mom. Und die Burgen und Schlösser Schottlands sind aus dem Mittelalter. In der Steinzeit gab es noch keine Schlösser.«
»Na ja, ist doch auch egal.« Cherilyn drückte Otis’ Arm und setzte ihr fröhlichstes Lächeln auf. »Jedenfalls bin ich sicher, dass es dir in unserem mittelalterlichen Märchenschloss gefallen wird. Und wenn nicht, ziehen wir einfach …«
»… wieder um«, beendete Otis den Satz. Dann erhob er sich von seinem Stuhl, trottete mit gesenktem Kopf in sein Zimmer und vergrub sich unter der Bettdecke. Aber schlafen konnte er nicht.
Ein letzter schwarzer Gedanke setzte sich in seinem Kopf fest. Ihre Umzüge innerhalb Amerikas hatte Cherilyn mit Rücksicht auf seine Höhenangst immer mit dem Auto gemacht. Aber nach Schottland konnte man nicht mit dem Auto fahren. Und eine Methode, sich über den Ozean zu beamen, war auch noch nicht erfunden worden.
Otis würde fliegen müssen.
Und zwar mutterseelenallein.
DASMÄDCHENMITDERTAUBE
Der schönste Ort Berlins war für Olivia der Flughafen. In der Abflughalle die startenden Flugzeuge oder die landenden Helikopter zu beobachten, gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen und die einzigen Menschen, die ihr etwas bedeuteten, hatte Olivia an diesem Ort kennengelernt.
Bis vor zwei Jahren hatte René noch hier gearbeitet, der frühere Kollege ihres Vaters. Zu Olivias zehntem Geburtstag hatte ihr René einen Gutschein über zehn Helikopterflüge geschenkt. Zehn wunderbare Freitagnachmittage durfte Olivia in Renés Robinson R 22Beta II mitfliegen, dem kleinsten und am meisten verkauften Helikopter der Welt. Über den Dächern Berlins erhielt sie Flugunterricht und erfuhr alles, was sie noch nicht über Helikopter wusste – was im Grunde verschwindend wenig war, wenn man bedachte, dass Olivia mit der Fachliteratur ihres Vaters das Lesen gelernt hatte. Sechseinhalb Jahre war sie alt gewesen, als sie mit ihrem kleinen Zeigefinger an Fachbegriffen wie Heckrotordurchmesser, Kollektiver Blattverstellhebel oder Koaxiales Rotorsystem entlanggewandert war. Mit neun Jahren hatte sie dann begonnen, die ersten englischen Bücher über die Kunst des Fliegens zu studieren.
René war von Olivias Kenntnissen schwer beeindruckt. Deshalb erlaubte er ihr während der Flugstunden sogar ein paarmal, den Helikopter allein zu steuern. »Du bist ein Naturtalent, weißt du das?«, sagte er damals zu ihr. »Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen.«
Vor einem Jahr war René nach Frankreich gezogen. Seitdem sah Olivia die Helikopter nur noch von Weitem. Aber der Flughafen war ihr zweites Zuhause geblieben.
Und so war es kein Wunder, dass Olivias Zufluchtsort auch – oder vielmehr gerade – heute der Flughafen war. Die Polizisten abzuhängen, war leichter gewesen, als sie befürchtet hatte, doch nun drückte die Angst auf ihre Schultern. Heute kam sie schließlich nicht hierher, um Flugzeuge oder Helikopter starten zu sehen, sondern um einen Platz für die Nacht zu finden.
»Okay, Columbina«, sagte Olivia mit fester Stimme. »Dann wollen wir mal.«
Zielstrebig marschierte sie durch die große Drehtür in die Abflughalle und steuerte den Schalter der Luftlinie Condor an. Hier arbeitete Carlos Almadovar, Olivias allerbester Freund. Carlos war vor vier Jahren nach Deutschland übergesiedelt. Olivia hatte ihn im Flughafenrestaurant kennengelernt und besuchte ihn seither, sooft sie konnte. Carlos war Mitte zwanzig, hatte schwarzes, schulterlanges Haar, warme braune Augen und immer ein Lächeln auf den Lippen. Ganz besonders für Olivia, der er den Spitznamen Mädchen mit Taube gegeben hatte. So hieß auch ein Bild des berühmten spanischen Malers Pablo Picasso. Und weil Carlos ebenfalls aus Spanien kam, nannte er Olivia meistens Niña con paloma, denn das war der Titel des Bildes auf Spanisch.
Freitags hatte Carlos Spätschicht. Als Olivia mit Columbina an seinen Schalter kam, fertigte er gerade die Passagiere für den letzten Flug nach New York City ab. Stirnrunzelnd sah er von der Flughafenuhr zu Olivia. Mittlerweile war es 23Uhr15 und was Carlos’ Blick bedeuten sollte, war nicht schwer zu erraten. Ist das nicht ein bisschen spät für ein kleines Mädchen mit Taube? Aber im nächsten Moment lächelte er beruhigend und bedeutete Olivia mit einem Handzeichen, dass sie sich ein wenig gedulden sollte. Normalerweise fiel Olivia das nicht schwer, aber heute klopfte ihr das Herz bis zum Hals. Würde Carlos ihre verzweifelte Bitte erfüllen?
»Drück die Krallen, Columbina«, flüsterte sie ihrer Taube zu, die ihr weißes Köpfchen aus Olivias rotem Mantel streckte. »Wir brauchen jetzt einen Schutzengel, der uns Glück bringt.«
Columbina gurrte leise, und als Olivia den Kopf hob, bemerkte sie, dass sie beobachtet wurde. Von einem fremden Mann in Jeans und Lederjacke, der ganz am Ende der Schlange stand. Er hatte dunkles, zurückgekämmtes Haar und große graublaue Augen, die plötzlich nervös zuckten. Eine Sekunde lang war Olivia starr vor Schreck. War sie doch verfolgt worden? Hatten die Männer vom Jugendamt ihr aufgelauert? Oder ein getarnter Polizist? Unbehaglich musterte sie den Fremden.
»Da hast du dir aber einen hübschen Begleiter ausgesucht«, sagte der Mann und lächelte Olivia freundlich an. Wieder zuckten seine Augen, und Olivia machte einen misstrauischen Schritt zurück.
»Ist es eine Brieftaube?«, fragte der Mann. Seine Stimme war tief und warm und sein Interesse schien ehrlich.
»Ihre Mutter«, erwiderte Olivia schüchtern. »Ihre Mutter war eine Brieftaube. Mit Columbina klappt es noch nicht so richtig.«
»Columbina?« Der Mann schob seinen Koffer ein Stück vor und schmunzelte. »Dann ist sie ja eine kleine Weltentdeckerin – wie Christoph Kolumbus. Ein schöner Name, Columbina. Hast du sie geschenkt bekommen?«
Er musterte Columbinas Köpfchen so liebevoll, dass Olivia ihr Misstrauen vergaß. Dieser Mann war ganz offensichtlich ein Passagier. Außerdem hatte er etwas an sich, das Olivia mochte. Es war etwas an seinem Gesicht, seinen Augen, die trotz ihres seltsamen Zuckens irgendwie traurig aussahen.
»Ich habe Columbina ausgebrütet«, erklärte Olivia, und jetzt war ihre Stimme voller Stolz. Ganz genau erinnerte sie sich noch an den warmen Frühlingstag vor den Osterferien, als sie bei einem Schulausflug zum Berliner Taubenzüchterverein das vereinsamte Ei im Nest gesehen hatte. Sie hatte gedacht, die Mutter hätte es verlassen. Erst später erfuhr sie, dass Tauben immer zwei Eier legen und ihre Brutzeit erst dann beginnen, wenn das Gelege vollständig ist. Jedenfalls hatte Olivia das Ei mitgenommen, es vorsichtig in ihren Schal gewickelt und nach dem Ausflug gleich nach Hause getragen.
Aber das würde sie dem Fremden natürlich nicht erzählen. »Ich habe das Ei gefunden«, sagte sie stattdessen. »Und dann habe ich ein Nest in meinem Zimmer gebaut und es so lange bebrütet, bis Columbina geschlüpft ist.«
Auf dem Gesicht des Mannes breitete sich ein so strahlendes Lächeln aus, dass es Olivia ganz warm ums Herz wurde.
Sie warf einen Blick auf die Anzeigetafel, auf der der Flug nach Amerika angekündigt war.
»Wohnen Sie in New York?«, fragte sie neugierig.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich mache Urlaub, zum ersten Mal seit fünf Jahren. New York zur Adventszeit. Das wollte ich immer schon mal erleben.«
Ich auch, dachte Olivia. Die Warteschlange war weiter vorgerückt, der Mann würde gleich an der Reihe sein.
»Und du?«, fragte er. »Fliegst du auch nach New York?«
Olivia schüttelte den Kopf. Sie schluckte. Für einen kurzen, verrückten Moment verspürte sie den Wunsch, den fremden Mann zu bitten, sie mit sich zu nehmen. Aber das würde sie selbstverständlich nicht tun.
»Na«, sagte der Mann, »es war jedenfalls schön, euch kennenzulernen, dich und deine kleine Weltentdeckerin. Ich heiße übrigens Nicolas.«
Mit diesen Worten drehte er sich um und hievte seinen Koffer auf das Rollband. Carlos nahm sein Ticket in Empfang und eine Viertelstunde später saß Olivia mit ihrem besten Freund im Flughafenrestaurant und starrte auf ein kleines braunes Päckchen mit einer roten Schleife.
»Alles Gute zum Geburtstag«, sagte Carlos. »Ist doch heute, oder? Siehst jedenfalls toll aus, mit deinen Igeldornen.«
Carlos zog an einem von Olivias Zöpfen, und Olivia musste kichern. »Igelstacheln meinst du wohl«, korrigierte sie ihn. Dann wickelte sie das Papier auf. Darunter kam eine gerahmte Postkarte zum Vorschein. Sie zeigte ein kleines Mädchen in einem weißen Kleid. Das Mädchen hatte kurz geschorenes Haar, vor seinen Füßen lag ein Ball, und seine Hände, die es vor der Brust hielt, schmiegten sich um eine weiße Taube. Olivia lächelte. Das Bild von Pablo Picasso.
»Für meine Niña con paloma zum Geburtstag«, sagte Carlos liebevoll.
»Danke«, erwiderte Olivia. »Ich … ich danke dir und ich möchte dich um etwas bitten. Es ist nämlich so, dass … ich meine, dass meine …«
Carlos legte seine Hand auf Olivias Arm. »Deine Mutter?«, fragte er sanft. »Hat sie wieder zu viel getrunken?«
Olivia nickte. Und dann fing sie so bitterlich an zu weinen, dass Carlos sie auf seinen Schoß zog. »Du weißt, dass ich dich bei mir aufnehmen würde, wenn ich das könnte«, sagte er. »Aber ich kann es nicht, Niña, ich lebe allein, in einer winzigen Wohnung, habe unregelmäßige Arbeitszeiten, das würde mir das Jugendamt niemals erlauben.«
»Bitte«, flüsterte Olivia. »Bitte, nur für ein paar Nächte, nur bis meine Mutter wiederkommt. Bitte. Ich hab doch heute Geburtstag, Carlos!« Dann begann sie wieder zu schluchzen. Columbina gurrte und am Nebentisch drehte sich eine ältere Dame mitfühlend zu ihnen um.
Carlos seufzte. Lang und tief. »Ich muss verrückt sein«, murmelte er. Und laut sagte er: »Dann komm, Niña con paloma. Wir gehen zu mir nach Hause und dort mache ich dir erst mal eine heiße Badewanne. Deine Hände sind ja eiskalt.«
Als Olivia an Carlos’ Hand durch die Flughafenhalle ging, passierten sie das große Leuchtposter mit der amerikanischen Freiheitsstatue und Olivia musste wieder an die Stelle aus Kennedys Rede denken. Ein freier Mensch. Heute, in der Welt der Freiheit.
OTISAMHAKEN
Größer und immer größer wurde die Freiheitsstatue, als Otis und seine Klassenkameraden mit der Fähre die kleine Insel am Hafen New Yorks ansteuerten.
Es war ein sonniger Montagmittag und Otis’ Geschichtslehrer Mister Pommeroy strahlte, als hätte er das Wetter eigens für diesen Anlass bestellt. Der Ausflug zum Wahrzeichen der Stadt war schon lange geplant gewesen, und Mister Pommeroy hatte seine Schüler gründlich vorbereitet. Dass die steinerne Riesenlady in der ganzen Welt ein Symbol für Freiheit war, wussten die meisten Kinder in Otis’ Klasse. Aber dass die Statue vor allem den unzähligen Einwanderern Amerikas ein neues Leben in einer neuen Stadt versprochen hatte, war vielen gar nicht klar gewesen.
Otis seufzte. Auch für ihn würde bald ein neues Leben in einer neuen Stadt beginnen – aber eine Freiheitsstatue würde seine Ankunft nicht begrüßen.
Cherilyns Flugzeug war gestern Abend vom New Yorker John-F.-Kennedy-Flughafen gestartet und Otis hatte die letzte Nacht bereits bei Duncan Stomp verbracht. Gegen seine Erkältung, die ihn seit einer Woche plagte, hatte Duncans Mutter ihm eine heiße Milch mit Honig gekocht, und dass Duncan Stomp ihn weitgehend in Ruhe ließ, verdankte Otis Duncans Vater, einem strengen Polizisten. Bis auf die blöde Bemerkung, dass Jungen in Schottland Röcke tragen müssten, hatte sich Duncan ungewöhnlich friedlich verhalten.
Jetzt saß Duncan am anderen Ende der Fähre und bohrte in der Nase.
Über Nacht hatte es wieder geschneit. New York trug sein festlichstes Winterkleid und der Blick auf die machtvolle Freiheitsgöttin raubte Otis beinahe den Atem. Stolz hielt sie die Fackel mit ihrer goldbeschichteten Flamme in die Höhe, fast als wolle sie damit den Himmel berühren. Das Haupt der Statue schmückte eine siebenstrahlige Krone, in der sich 25Fenster befanden. Otis wusste, dass die Strahlen der Krone die sieben Meere und Kontinente symbolisierten, während die Fenster für die 25Edelsteine der Welt standen. Er wusste auch, dass das verkleidete Stahlgerüst der Statue von Gustave Eiffel, dem französischen Konstrukteur des Eiffelturms, erdacht worden war. Und auf der einstündigen Führung würde er nun einen Einblick in das Innenleben der Freiheitsgöttin erhalten und all die spannenden Einzelheiten über ihre Baugeschichte erfahren.
Otis hustete. Wenn die Honigmilch von Duncans Mutter wenigstens gewirkt hätte! Aber viel mehr als ein Flüstern gab seine Stimme immer noch nicht her und müde war er außerdem. Auf dem quietschenden Klappbett in Duncans Zimmer hatte er einfach keinen Schlaf finden können.
»Auf dem Podest der Freiheitsstatue seht ihr ein Gedicht eingraviert«, sagte Mister Pommeroy, als sie vor der Statue standen. »Es heißt Der neue Koloss. Duncan, wenn du die Freundlichkeit besäßest, es uns allen vorzulesen?«
Duncan, der gerade einen Nasenpopel an der Jacke einer Mitschülerin abwischte, blickte erschrocken auf und begann widerwillig zu lesen:
»Bring mir deine Müden, deine Armen,
Deine zusammengekauerten Massen,
Die sich nach Freiheit sehnen …
Schick diese Heimatlosen, Sturmgebeugten zu mir.
Ich erhebe meine Fackel neben dem goldenen Tor …«
Ein paar Kinder kicherten, vielleicht über die sonderbaren Worte, vielleicht aber auch, weil Duncan eine Ewigkeit brauchte, um sich durch den Text zu stottern. Auch Otis konnte ein heiseres Kichern nicht unterdrücken – was er gleich darauf bitter bereute.
»Ich mach dich fertig, du Mistkäfer!«, zischte Duncan in sein Ohr. »Wenn du glaubst, ich teile für die nächsten Tage mein Zimmer mit dir, dann hast du dich geschnitten.«
Mittlerweile hatte Mister Pommeroy die Klasse in die große Eingangshalle im steinernen Sockel der Statue getrieben. Hier befand sich das Museum über die Geschichte der Einwanderung nach Amerika. Später würden sie auch auf die Aussichtsterrasse hinauffahren, um von dort einen Blick auf die Wolkenkratzer von Manhattan zu werfen. Otis schaute auf die Uhr. Die Führung würde erst in 25 Minuten beginnen, und Mister Pommeroy hatte alle Hände voll damit zu tun, die Klasse irgendwie zusammenzuhalten. Wie so oft trug Otis’ Geschichtslehrer seinen grüngelb karierten Anzug und schwarze, auf Hochglanz polierte Schuhe. Mit seinen roten Locken und der dicken Nase sah er aus wie ein Clown, der seinen Beruf verfehlt hatte.
Die Stimmen der durcheinanderlaufenden Kinder schwirrten durch das Museum, hallten von den Wänden wider und vermischten sich zu einem undefinierbaren Eintopf an Tönen und Worten. Es wurde gekichert, gemurmelt, gekreischt, gemault, geknistert, geschubst und gedrängelt – kurz: Es wurde all das getan, was einen echten Klassenausflug ausmacht. Dass Mister Pommeroy verzweifelt versuchte, seine heiß geliebten Fragebögen zu verteilen, störte die wenigsten. Otis überflog den Zettel. Im Wesentlichen fragte ihr Lehrer die Maße der Riesendame ab:
1.Wie hoch ist der Sockel?
2.Wie hoch ist die Freiheitsgöttin?
3.Wie hoch ist die ganze Statue, vom Sockelboden bis zur Spitze der Fackel?
4.Wie viel wiegt die Statue?
5.Wie viele Meter misst ihr Taillenumfang?
6.Wie breit ist ihr Mund?
7.Wie lang ist ihr rechter Arm, der die Fackel hält?
8.Wie lang ist der Zeigefinger?
»Alle Mann Abmarsch aufs Klo, bevor wir ins Museum gehen!«, schrie Mister Pommeroy, nachdem er endlich alle Blätter verteilt hatte. »Nicht dass ihr mir ständig während des Rundgangs durch die Ausstellung davonlauft! Und beeilt euch, die Führung beginnt in ein paar Minuten!«
Wieder kicherten ein paar Kinder. Mister Pommeroy war bekannt für seine schwache Blase. Mindestens zweimal in der Stunde verließ er deswegen den Unterricht. Offensichtlich schloss er von sich auf andere und war auch gleich als Erster im Männerklo verschwunden. Otis und Duncan gehörten zu den Letzten in der Schlange. Als sie an die Reihe kamen, wollte sich Otis gleich in die erste Kabine verdrücken, aber da hatte sich Duncan bereits zu ihm gedrängt, die Tür geschlossen und den Riegel umgedreht. Aus irgendeinem Lautsprecher ertönte leise Musik, und Otis brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass es sein eigenes Miniradio war. Es hing an einer Schnur um seinen Hals und Duncans bulliger Oberkörper musste den Startknopf in Gang gesetzt haben, als er sich gegen Otis stemmte. Aus den anderen Kabinen drangen die Stimmen der Mitschüler an Otis’ Ohr. Otis öffnete den Mund, um zu schreien. Aber alles, was herauskam, war ein klägliches Krächzen.
Mit einem gemeinen Grinsen zeigte Duncan auf den kleinen Garderobenhaken in der Kabine, an dem man seine Jacke oder seinen Mantel aufhängen konnte, bevor man sein Geschäft verrichtete.
»Jetzt wollen wir mal sehen, ob der Haken deinem Mückengewicht gewachsen ist«, zischte Duncan und stemmte Otis an der Wand hoch. Zum Schutz vor der Kälte hatte Otis am Morgen seine neue, mit Fell gefütterte Lederjacke angezogen. Ein Geschenk von Cherilyn. Die Jacke hatte einen Gürtel und außen am Jackenkragen war eine breite, fest angenähte Schlaufe. »Todschick«, hatte Cherilyn gesagt. »Du siehst wirklich richtig cool aus in der Jacke, Katerchen. Die schottischen Mädels werden sich nach dir umdrehen. Und einen Kleiderbügel zum Aufhängen brauchst du auch nicht. Wer weiß, ob es in Schottland überhaupt Kleiderbügel gibt.«
Daran hatte Otis keine Sekunde lang gezweifelt, aber der Gebrauchswert der Schlaufe war wohl auch Duncan Stomp nicht entgangen. »Praktisch, so ein Teil«, flüsterte er hämisch. »Damit kann ich dich wie eine mickrige Handtasche an den Haken hängen. So, da haben wir’s.« Duncan war Jugendmeister im Gewichtheben und eine halbe Portion wie Otis an einen Kleiderhaken zu befördern, war für ihn die leichteste Übung. Es ging so schnell, dass Otis nicht einmal daran denken konnte, sich zu wehren. Und dann kam auch schon sein Jackengürtel zum Einsatz. In Sekundenschnelle hatte Duncan ihn aus den Schlaufen gezogen und Otis’ Hände damit zu einem kleinen, festen Paket verschnürt. Während Otis vor Schreck und Wut die Tränen in den Augen standen, strich sich Duncan höchst zufrieden das weißblonde Haar hinter die Ohren. »Mach’s dir gemütlich und zieh nicht so ein undankbares Gesicht«, sagte er. »Du kannst hier in aller Ruhe abhängen, während wir die blöde Ausstellung anschauen müssen. Ist das nicht nett vom guten Onkel Duncan?«
Eine Antwort schien der gute Onkel allerdings nicht zu erwarten, denn in der nächsten Sekunde hatte Duncan Otis’ Fragebogen zu einer Kugel zusammengedrückt und ihm in den Mund gestopft.
Die anderen Jungen hatten die Toilette längst verlassen und als Duncan pfeifend aus der kleinen Kabine verschwand, war Otis allein.
Hilflos hing er mit seiner neuen Jacke an der Wand. Gefangen in der Freiheitsstatue.
Mister Pommeroy wird bemerken, dass ich fehle, versuchte er, sich zu beruhigen, nachdem er den aufgeweichten Fragebogen auf den Toilettenboden gespuckt hatte. Er wird nach mir suchen und wenn es ihm nicht auffällt, dann bestimmt jemandem aus meiner Klasse. Oliver vielleicht oder Ben oder Lizzy Thompson. Oder Mister Pommeroy wird wegen seiner schwachen Blase noch einmal herkommen und dann kann ich rufen und bin frei.
Aber Mister Pommeroy kam nicht. Niemand kam. Und warum Otis’ Fehlen niemand zu bemerken schien, wusste er insgeheim am besten. Es gab Kinder wie Duncan, die überall auffielen – selbst dann, wenn sie durch Abwesenheit glänzten. Und es gab Kinder wie ihn, Otis, die sogar im kleinsten Raum übersehen wurden.
Verzweifelt versuchte Otis, seine Hände aus dem Gürtel zu befreien, aber die schlaflose Nacht hatte ihm alle Kräfte geraubt und Duncan hatte ganze Arbeit geleistet. Wenigstens war der Jackenkragen weich gefüttert, sodass er Otis nicht würgte. Aber bequem war seine Position bei Weitem nicht. Mittlerweile griff die Erschöpfung wie mit Fingern nach ihm. Otis klappten die Augen zu. An seine Ohren drangen Geräusche aus seinem Miniradio. Der Empfang war miserabel, es rauschte und knackte und so hörte Otis nur in Bruchstücken, was der Sprecher in den 16-Uhr-Nachrichten zu berichten hatte. Zwei Bauwerke verschwunden … weltberühmt … die ägyptische Sphinx, der Pariser Eiffelturm … Wirbelsturm … Nebel … Erdboden verschluckt … Terroristen … Außerirdische …
Verdammt, warum musste denn niemand aufs Klo?
Über dieser verzweifelten Frage schlief Otis ein.
OLIVIAAUFDERFLUCHT
Seit einer Viertelstunde hockte Olivia nun schon auf Carlos’ Toilette. Nicht weil sie musste, sondern weil es hier so viel zu sehen gab. Carlos nannte das stille Örtchen sein Heimatmuseum. Warum, das war leicht zu erraten. Die ganzen Wände waren voll von gerahmten Postkarten und präsentierten Spaniens schönste Sehenswürdigkeiten: das Schloss La Granja in Kastilien, das Kloster Poblet in Tarragona, die Altamira-Höhle in Kantabrien mit ihren Malereien aus der Steinzeit und die Kathedrale Sagrada Família in Barcelona. Voller Stolz hatte Carlos Olivia die Geschichten zu den einzelnen Bauwerken erzählt, vor allem die von der Kathedrale Sagrada Família, die Olivia wie eine riesige Fantasieburg vorkam. Entworfen hatte sie ein berühmter spanischer Architekt. Seinen Namen hatte Olivia wieder vergessen, obwohl er lustig geklungen hatte, wie nach einem anderen Wort für Spaß. Behalten hatte sie, dass an diesem prachtvollen Tempel seit über 100Jahren gebaut wurde. Das bezeugten auch die hohen Baukräne, die mit den Kirchtürmen um ihren Platz an der Sonne kämpften. Als der Architekt gestorben war, hatte nur ein einziger der geplanten Türme gestanden, meinte Carlos. Jetzt zählte Olivia acht Türme auf dem großen Foto und unter einem, von einem steinernen Balkon aus, winkte ihr Carlos in Miniaturgröße zu.
»Das Foto hat mein Onkel gemacht. Immer wenn ich in Barcelona bin, besuche ich die Kathedrale«, schwärmte er. »In zwei Wochen ist es wieder so weit. Ich zähle schon die Tage, kann es kaum noch abwarten, mein Zuhause zu besuchen. Irgendwann werde ich auf meinem Stück Land ein Hotel bauen.«
Carlos’ Stück Land hing auch an der Wand, auf einem goldgerahmten Foto. Es war eine wilde, mit Pflanzen und Olivenbäumen bewachsene Hochebene, nicht weit vom Meer entfernt.
Carlos hatte es von seiner Großmutter geerbt, aber für den Bau eines Hotels fehlte ihm natürlich das Geld. Deshalb war er nach Berlin gekommen, um mit einer gut bezahlten Arbeit für seinen Lebenstraum zu sparen und in seine Heimat zurückzukehren.
Olivias Heimat, das war seit genau zehn Tagen Carlos’ winzige Wohnung in Berlin. Sie lag im Norden der Stadt und Olivia hatte sich noch nie so wohlgefühlt wie hier. Jeden Tag, wenn sie daheim anrief, um zu prüfen, ob ihre Mutter aus dem Krankenhaus zurück war, stritt in ihr das schlechte Gewissen mit der Hoffnung, dass sich niemand melden würde.
»Bis deine Mutter wieder zu Hause ist, und keinen Tag länger«, das hatte Carlos angeordnet und an ihre Klassenlehrerin hatte Olivia eine Nachricht schicken müssen, dass sie in guten Händen war.
Das war sie ja schließlich auch. Carlos, der eigentlich ein gelernter Meisterkoch war, verwöhnte Olivia in seinen freien Stunden so sehr, wie es ihre Mutter seit Jahren nicht mehr getan hatte. Er kochte ihr spanische Paella, ein Omelette aus Eiern, Kartoffeln und Zwiebeln, das man in Spanien Tortilla de patata nennt; und die spanischen Karamellpuddings, die Carlos zum Nachtisch zauberte, waren so köstlich, dass Olivia beim Essen die Augen schloss.
Jetzt klingelte das Telefon und Olivia hüpfte vom Klo.
»Heute Abend gibt es Ropa Vieja«, kündigte Carlos ihr an. »Das ist ein Eintopf. Auf Deutsch heißt er Alte Klamotten und er ist genau das Richtige bei diesem Kuhwetter.«
Olivia kicherte. »Sauwetter«, korrigierte sie ihren spanischen Freund. »In Deutschland sagt man Sauwetter.«
»Kuhwetter, Sauwetter, auf jeden Fall bin ich gleich da und koche den wärmsten Eintopf, den die Welt je gesehen hat. Deckst du den Tisch, Niña con paloma? Und was hältst du von gebackenen Honigbananen zum Nachtisch?«
Olivia lächelte. »Viel, sehr viel! Bis gleich!«