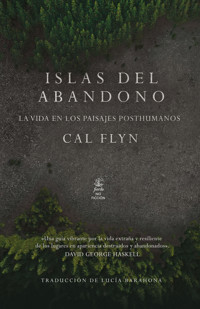Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die mehrfach ausgezeichnete schottische Essayistin Cal Flyn erkundet in diesem außergewöhnlichen Buch Orte, an denen keine Menschen mehr leben – oder nur noch wenige ihr Dasein fristen. Es sind Sperrgebiete oder Geisterstädte, Festungsinseln und Niemandsländer, unwegsames Terrain, auf das sich Flyn wagt, als sie verwaiste und verwüstete Orte besuchte, um zu verstehen, was passiert, wenn man der Natur erlaubt, sich ihren Platz zurückzuerobern. Auf einer unbewohnten schottischen Insel begegnet sie einer Herde verwilderter Rinder, in Tschernobyl einer Handvoll Menschen, die nach der Nuklearkatastrophe in ihre kontaminierten Häuser zurückkehrten, und in Detroit, der einst viertgrößten Stadt der USA, trifft sie auf ganze Straßenzüge, die so verfallen sind, dass Tiere und Pflanzen sie übernommen haben. Egal wie trostlos, unheimlich, verwüstet und verseucht die Orte sind, die Flyn erkundet, überall erkennt sie allen Widrigkeiten zum Trotz Anzeichen von ökologischer Resilienz und Regeneration, kurzum: von Leben. Sie entdeckt Pflanzen, die auf kontaminierten Böden gedeihen, Fische, die gegen bestimmte Gifte unempfindlich geworden sind oder einen künstlichen See, der zur belebten Wüste versandet. Ihr Buch ist ein genau recherchiertes und mit literarischem wie psychologischem Einfühlungsvermögen geschriebenes Plädoyer für eine radikale Überprüfung dessen, was wir unter ›Natur‹ verstehen. Nicht zuletzt bietet es vielfältige, auch verstörende Antworten auf die dringliche Frage, wie der Schaden, den wir an der Natur verursacht haben, noch behoben werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CAL FLYN
Verlassene Orte
Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt
Aus dem Englischen von Milena Adam
NATURKUNDEN
Für Rich,der mich so unheimlich glücklich macht
NATURKUNDEN N° 100
herausgegeben von Judith Schalanskybei Matthes & Seitz Berlin
INHALT
Anrufung: Forth Islands – Schottlands
Erster Teil
IN ABSENTIA
1 Das öde Land: Five Sisters – West Lothian – Schottland
2 Niemandsland: Pufferzone – Zypern
3 Alte Felder: Harju – Estland
4 Nuklearer Winter: Tschernobyl – Ukraine
Zweiter Teil
DIE BLEIBENDEN
5 Stadtruinen: Detroit – Michigan – USA
6 Tage der Anarchie: Paterson – New Jersey – USA
Dritter Teil
DER LANGE SCHATTEN
7 Unnatürliche Selektion: Arthur Kill – Staten Island – USA
8 Der verbotene Wald: Zone Rouge – Verdun – Frankreich
9 Invasion der Aliens: Amani – Tansania
10 Ausflug zum Rose Cottage: Swona – Schottland
Vierter Teil
ENDSPIEL
11 Offenbarung: Plymouth – Montserrat
12 Sintflut und Wüste: Saltonsee – Kalifornien – USA
Anmerkungen und Quellennachweise
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Register
ANRUFUNG
Forth Islands — Schottland
In den Tunneln ist es kühl, nicht kalt wie draußen. Und dunkel, stockdunkel. Die Luft steht beinahe, aber nicht ganz – ein Hauch streift die Blätter, die in niedrigen Verwehungen am Rand liegen, wo Wände und Boden aufeinandertreffen. Vielleicht habe ich deshalb das nervenaufreibende Gefühl, nicht völlig allein zu sein.
Um zum Allerheiligsten vorzudringen, muss ich im äußeren Gang über die Kadaver von Möwen und Kaninchen steigen, die sich verirrt oder zum Sterben hierher verkrochen haben. Meine Schritte sind vorsichtig und ich versuche, möglichst nicht hinzusehen. Irgendwann, nachdem mir das vom Stein zurückgeworfene Aufblitzen der Taschenlampe einen Schrecken eingejagt hat, schalte ich sie aus und warte, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Durch die angelehnte Metalltür dringt gerade genug Licht, dass ich die breiten Steinstufen erkennen und tiefer ins Innere der Festung vordringen kann.
Die einst weiß verputzten Wände sind jetzt schmutzig marmoriert sowie hier und da von dunklem Schimmelgrün überzogen. Bald allerdings ist es zu düster, um etwas zu erkennen. Obwohl ich mich selbst zur Ruhe mahne, spüre ich, wie mein Puls sich beschleunigt. An jeder Ecke, wo das Unbekannte finster und bedrohlich lauert, muss ich mich zum Weitergehen zwingen – ich atme ein, strecke die Finger nach der Wand aus, betaste sie. Ich rieche nassen Stein, Erde, Moder – Gruftgeruch. Als nichts mehr hilft, schalte ich die Taschenlampe wieder an.
Also doch: Ich bin nicht allein. Zumindest nicht ganz. Neben den grob behauenen Wänden erfasst der Lichtkegel zunächst einen dunklen Körper, dann noch einen. Ich finde drei, dicht gedrängt am Boden, die Flügel gefaltet wie Hände zum Gebet. Ich muss mich auf alle Viere in den Staub fallen lassen, um sie in allen Einzelheiten zu betrachten: die komplexe Musterung der Flügelunterseiten – eine Schnitzarbeit in Ebenholz und Tiefbraun, durchzogen von schwachem Kupferglanz. Ruhende Schmetterlinge. Bald werden sie wach.
Das hier ist Inchkeith, eine Insel im Meeresarm Firth of Forth, gut sechs Kilometer vor Edinburgh. Seinerzeit war Inchkeith alles Mögliche: abgelegener Standort für eine »Prophetenschule«, später Quarantäneinsel für Syphiliskranke (die man dorthin verbannte, »bis Gott ihnen Gesundheit schenkte«), dann Pestkrankenhaus und sogar Gefängnisinsel, auf der das Wasser die Mauern ersetzte.
So abgelegen war sie, und doch immer in Sichtweite der schottischen Hauptstadt – ein felsiges Trugbild am Horizont –, dass sie angeblich die Fantasie des schottischen Königs James IV beflügelte, der Inchkeith, so heißt es, für sein berüchtigtes Sprachentzugsexperiment auserkor. Als Universalgelehrter mit rastlosem Geist setzte er sich intensiv mit den Wissenschaften der Renaissance auseinander, praktizierte sowohl Aderlass als auch Zähneziehen und versenkte riesige Summen in die Erforschung von Alchemie, dem menschlichen Flugvermögen und laut einem Chronisten aus dem 16. Jahrhundert auch in das Unternehmen, zwei Neugeborene und eine taube Amme nach Inchkeith zu bringen, in der Hoffnung, dass die Kinder abseits der schädlichen gesellschaftlichen Einflüsse die »göttliche Sprache« aus der Zeit vor dem Sündenfall zu sprechen lernen würden.
Aufgrund der extremen Isolation und unumkehrbaren sozialen Fehlprägung, denen die Kinder ausgesetzt waren, ging der Versuch als »das verbotene Experiment« in die Geschichte ein. Die Ergebnisse waren uneindeutig. »Manche sagen, sie sprachen gut Hebräisch«, berichtet der Chronist verschmitzt, »ich weiß ja nicht.« Andere erzählten von einem »viehischen Gestammel«. Die Auslegung hing wahrscheinlich davon ab, nach welchem Gott man Ausschau hielt.
Mit der Zeit wurde aus Inchkeith eine Inselfestung, die zu Kriegszeiten sporadisch von den Engländern gehalten wurde, und schließlich – nach großem Blutvergießen – von den Franzosen. Im Zweiten Weltkrieg waren über tausend Soldaten auf der nicht einmal einen Kilometer langen Insel stationiert, und Geschützstellungen wachten angespannt über die Forth-Mündung. Nach dem Waffenstillstandsabkommen wurde Inchkeith, das zu klein, zu schwer beschädigt und zu unzugänglich war, um in Friedenszeiten Beachtung zu erfahren, erneut verlassen.
Inchmickery, eine Insel im Meeresarm Firth of Forth (Schottland), ist ein wichtiger Brutplatz für Robben.
Doch während die Insel in Vergessenheit geriet, stieg ihre ökologische Bedeutung. Bis in die Vierzigerjahre hinein war nur eine einzige dort nistende Seevogelart bekannt: die Eiderente. In den darauffolgenden Jahrzehnten jedoch ist die Insel zur Brutstätte von einem Dutzend weiterer Arten geworden, und noch mehr nutzen die Insel als Rastplatz. Im Frühsommer wimmelt die Felsküste nur so von Leben und ist vom Vogelkot kalkweiß, auf jedem Vorsprung drängen sich struppige Nester aus verrotteten Algen und gesprenkelte, direkt auf dem Fels abgelegte Eier, jede Spezies richtet sich im Relief des Lebens ein: Krähenscharben ruhen auf den gischtumtosten Felsen unten im Wasser, die glänzenden, schwarzweißen Lummen auf den unteren Stufen der Klippen, ein Stockwerk höher die gnomenhaften Tordalken mit ihren gebogenen Schnäbeln, im Penthouse residieren die in elegantes Grau gekleideten Dreizehenmöwen – und permanent beschweren sie alle sich lauthals kreischend über ihre Nachbarn.
Wo einst das Weideland des Leuchtturmwärters war, nehmen dralle Papageientaucher mit ihren knallbunt gestreiften Schnäbeln leere Kaninchenbauten in Beschlag. Winterzaunkönige und Rauchschwalben haben die ehemaligen Militärbauwerke eingenommen, die zusammensacken und aufplatzen wie fauliges Obst. Holunderdickicht wuchert aus den dachlosen Gebäuden, dicht gedrängt, wie um den bitterkalten Windstößen von der Nordsee zu trotzen.
Verfallene Offiziersunterkünfte auf der nahegelegenen Festungsinsel Inchkeith.
Wenn das Wetter kühler wird, hieven sich Kegelrobben auf die algenüberwucherten Bootsrampen, um sich in der schwachen Sonne zu wärmen – Tausende von ihnen finden hier, mitten in der Fahrrinne, ausreichend Zuflucht, um Junge zu bekommen. Ihr rehäugiger Nachwuchs verbringt den Winter damit, im büscheligen Gras zu lümmeln, die Pfade entlang zu robben und die Ruinen zu erkunden. Ungefähr zur selben Zeit ziehen die Schmetterlinge und Motten, die wie Rauch über der Insel wabern, sich in die dunklen Tunnel zurück, die die Hänge durchziehen, um dort zu überwintern – blau schillernde Tagpfauenaugen, glänzende, wie gepanzert aussehende Zimteulen, oder Kleine Füchse, deren schartige Silhouetten an Muscheln erinnern. Einer zuckt mit dem Bein. Ich lasse sie in Frieden.
Ich spüre einen Luftzug, einen Hauch, der mir den Weg nach oben weist. Weit über mir erkenne ich einen Schimmer von Tageslicht. Ein schwaches, alkalisches Aroma nach Guano hängt in der Luft. Ich finde eine Tür, die halb zugerostet ist, sich aber noch öffnen lässt, und dann bin ich draußen, stehe wie eine Galionsfigur allein am äußersten Bug der Insel, und vom kreisrunden Krater der Geschützstellung, Überrest eines letzten verzweifelten Abwehrversuchs in einem längst vergangenen Krieg, blicke ich aufs Meer hinaus.
Der Wind fährt schnell durch leeren Raum: Mächtige Luftströme saugen mir den Atem aus den Lungen. Und in einer einzigen großen Woge, als wirbelnde Masse steigen die Vögel auf. Schreiend, kreischend, rasend auf der Suche nach mir, hier, auf dieser Insel, diesem verlassenen Ort.
* * *
In diesem Buch bereisen wir einige der unheimlichsten und menschenleersten Orte auf Erden. Ein Niemandsland zwischen NATO-Drahtzäunen, wo Passagiermaschinen nach vier Jahrzehnten der Verwahrlosung auf dem Rollfeld vor sich hin rosten. Eine arsenvergiftete Lichtung, auf der kein Baum mehr wachsen kann. Die um einen schwelenden Kernreaktor errichtete Sperrzone. Einen sterbenden Salzsee, an dessen verödeter Küste sich ein Strand aus den Skeletten von Fischen gebildet hat, die einst darin schwammen.
Diesen ungleichen Orten ist gemein, dass der Mensch sie verlassen hat, sei es aufgrund von Krieg oder Katastrophen, Krankheit oder wirtschaftlichem Niedergang. Die Natur hatte freien Lauf – und beschert uns unschätzbare Erkenntnisse über Lebensumwelten im stetigen Wandel.
Dies ist ein Buch über die Natur, jedoch keines, das vom Reiz des Ursprünglichen schwärmt. Das ist gewissermaßen der Not geschuldet. Weltweit können immer weniger Orte die Bezeichnung »unberührt« für sich beanspruchen. Jüngste Untersuchungen konnten Mikroplastik sowie gefährliche menschengemachte Chemikalien sogar im Eis der Antarktis oder auf dem Boden der Tiefsee nachweisen. Luftaufnahmen des Amazonasbeckens zeigen tief im Wald verborgene Erdwälle, die letzte Überreste ganzer Zivilisationen sind. Der menschengemachte Klimawandel droht, jedes Ökosystem, jede Landschaft auf diesem Planeten umzuformen, und langlebige künstliche Materialien haben der Geologie unauslöschlich unseren Stempel aufgedrückt.
Es ist nicht zu bestreiten, dass manche Orte davon relativ gesehen sehr viel weniger betroffen sind als andere. Was mich interessiert, ist jedoch nicht der Nachglanz unberührter Natur, während sie hinter dem Horizont verschwindet, sondern der schmale Silberstreif am Himmel, der vielleicht von einem neuen Morgen kündet, einer neuen Wildnis, während weltweit immer mehr Land sich selbst überlassen wird.
In Teilen ist dieses Buch auch ein Nachsinnen über sich verändernde Demografien, da die Geburtenraten in der entwickelten Welt sinken und es die Landbevölkerung immer mehr in die Städte zieht. In beinahe der Hälfte aller Länder liegen die Geburtenraten mittlerweile unter dem Reproduktionsniveau; in Japan – wo die Bevölkerung Voraussagen zufolge bis 2049 von 127 Millionen auf 100 Millionen oder weniger fallen wird – ist bereits jede achte Immobilie verlassen, bis zum Jahr 2033 soll ein Drittel des Wohnbestands leerstehen (in Japan spricht man von akiya, Geisterhäusern.)
Das hängt teilweise auch mit der sich verändernden Landwirtschaft zusammen. Intensive Landwirtschaft ist – trotz zahlreicher ökologischer Nachteile – effizienter und erzielt auf weniger Fläche höhere Erträge. Riesige Mengen »randständiger« Anbauflächen, insbesondere in Europa, Asien und Nordamerika, dürfen zu einem wilderen Dasein zurückfinden. Heute gibt es etwa 2,9 Milliarden Hektar »Sekundärvegetation« (das heißt verlassene Anbauflächen und Nutzwälder), das ist mehr als doppelt so viel, als es aktuell genutzte Kulturflächen gibt. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Zahl auf 5,2 Milliarden Hektar ansteigen.
Wir befinden uns mitten in einem selbstgesteuerten Experiment zur Rückverwilderung. Das Verlassen von Orten ist Rückverwilderung im reinsten Wortsinn, da der Mensch sich zurückzieht und die Natur sich holt, was einst ihr gehörte. Solche Vorgänge haben im großen Maßstab völlig unbeobachtet stattgefunden, finden immer noch statt. Ich halte das für eine überaus aufregende Perspektive. »Die riesigen und weiterwachsenden Ausmaße sich erholender Ökosysteme weltweit«, so heißt es in einer kürzlich erschienenen Studie, »bieten nie dagewesene Chancen für ökologische Renaturierungsbemühungen, um ein sechstes Massenaussterben abzuschwächen.«
Während der Arbeit an diesem Buch wurden wir von einer globalen Pandemie überrollt. Während dieser Zeit machten im Internet weltweit Berichte über Wildtiere die Runde, die sich in die ausgestorbenen Siedlungen vorwagten, während die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen festsaßen. Im walisischen Llanduno stürmten marodierende Banden von Wildziegen die Straßen, im japanischen Nara grasten Sikahirsche auf Verkehrsinseln, in Santiago schlichen Pumas durch die Gassen, und durch die leere Innenstadt von Adelaide hüpften Kängurus.
Obwohl die Motive durchaus eindrucksvoll waren, zeigten viele der prominentesten Fotos Tierpopulationen, die ohnehin an den Rändern menschlicher Siedlungsgebiete leben (die Sikahirsche beispielsweise werden regelmäßig von Touristen gefüttert – und waren wahrscheinlich auf der Suche nach einem Leckerbissen). Sie bewiesen weniger, dass die Natur sich erholte, sondern vielmehr, dass sie sich aus ihrem Versteck herauswagte. Allerdings riefen sie uns ins Gedächtnis, wie sehr sich unsere eigene Einflusssphäre selbst heute mit der nichtmenschlichen Welt überlagert und überkreuzt – und wie rasch Orte demnach von der Tierwelt kolonisiert werden, sobald der Mensch sie tatsächlich verlässt.
In den folgenden Kapiteln erzähle ich die Geschichten von zwölf Orten rund um die Welt, und jede beleuchtet einen anderen Aspekt der Rückeroberung vom Menschen verlassener Orte durch die Natur. Diese Orte, die sich hinsichtlich Klima, Kultur und Geschichte stark unterscheiden, strahlen auf ihre ganz eigene Art Melancholie und Hoffnung aus: Sie zeigen uns, dass die Natur überall, ganz gleich wie groß die Zerstörung ist, einen Weg findet, aber auch, dass der menschliche Einfluss auf Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte wie ein Schatten auf diesen nicht mehr genutzten Flächen liegen wird.
Manche dieser Orte sind tatsächliche Inseln, manche sind es im übertragenen Sinne – Wildnisenklaven in einem Meer aus Stein und Asphalt oder monokulturellen Anbauflächen. Die enormen Abraumhügel im schottischen West Lothian, denen wir im ersten Kapitel begegnen, wurden von der Ökologin Barbra Harvie als »Inselrefugialräume« des Lebens beschrieben, und von genau dieser Betrachtungsweise ist das ganze Buch geprägt.
Der erste Teil behandelt vier Orte, die versinnbildlichen, inwiefern die Abwesenheit von Menschen es Flora und Fauna erlaubt, sich zu erholen – in manchen Fällen deutlich schneller, als man erwarten könnte. Wir betrachten die grundlegenden Prozesse der ökologischen Sukzession, erwägen das gewaltige Potenzial verlassener Landstriche zur Kohlenstoffbindung und untersuchen, inwieweit humanitäre Krisen wie Krieg und atomare Katastrophen Sperrzonen hervorgebracht haben, die gewissermaßen als strikte Naturreservate dienen – erschreckenderweise wiegen die positiven Auswirkungen der Abwesenheit von Menschen schwerer als der durch Kontamination oder Verminung angerichtete Schaden.
Definitionsgemäß hat verlassenes Land einmal irgendjemandem gehört. Meine Erwartung war, dass Menschen ausschließlich als Negativfaktor Eingang in die Geschichten dieser Orte finden würden, doch im Zuge meiner Reisen und Nachforschungen wurde mir zunehmend klar, dass an den allermeisten Orten doch noch Menschen leben – manche harren seit langer Zeit an einem Ort aus und weigern sich, ihn zu verlassen, andere sind erst später gekommen, haben das Land besetzt, weil sie den Beschränkungen der Gesellschaft entkommen wollten oder schlicht Wohnraum brauchten. Mir ging auf, dass dies ein Schlüsselelement der Geschichte ist: die sozialen und ökonomischen Kräfte, die dazu führen, dass Orte verlassen werden, und die psychologischen Kräfte, die auf jene wirken, die noch da sind – die standhaft blieben, als alle anderen gingen – oder neu dazukamen.
Sie zu ignorieren wäre, wie Henry James es einmal über seine eigenen Ruinenerkundungen schrieb, ein »herzloser Zeitvertreib«. Menschen, die in zu Großteilen verlassenen Gegenden wohnen – insbesondere in Detroit –, empfinden die Ästhetisierung ihrer Lage, also die Darstellung ihrer fotogenen Motive ohne sozialen Kontext, als eine Form des Voyeurismus oder sogar als »Verfallsporno«. Diese menschliche Komponente behandle ich vorrangig im zweiten Teil.
Der Neurowissenschaftler David Eagleman hat einmal davon gesprochen, dass wir drei Tode erleben würden: den ersten, sobald der Körper seine Funktion einstellt, den zweiten beim Begräbnis und den dritten in »dem Moment, irgendwann in der Zukunft, wenn der eigene Name zum letzten Mal ausgesprochen wird«. Der dritte Teil ist die Auseinandersetzung mit einer ganz ähnlichen Vorstellung: Der lange Schatten, den wir als Spezies auf die Erde werfen, als eine Art Nachleben. In diesem Abschnitt bereise ich Orte, an denen unser Vermächtnis lange nach unserem Verschwinden fortbesteht, Orte, die verdeutlichen, dass die Lage komplizierter ist, als es in der Floskel »wir gehen und die Natur kehrt zurück« zum Ausdruck kommt. Wir haben uns in die DNA dieses Planeten eingeschrieben, die Erde selbst mit der Menschheitsgeschichte durchzogen. Jeder Lebensraum enthält Rückstände seiner Vergangenheit. Jedes Waldgebiet ist ein Memoir aus Blättern und Mikroben, die sein »ökologisches Gedächtnis« bilden. Wir können lernen, es zu lesen und in der Welt, die uns umgibt, die Geschichte ihrer Entwicklung erkennen. In England beispielsweise entdeckt man so vielleicht die Geister uralter Wälder, die nicht mehr existieren, indem man nach schattenliebenden Spezies wie Hasenglöckchen, Salbei-Gamander, Geißblatt oder dem Weichen Honiggras Ausschau hält – einer Flora, die eigentlich auf schattengesprenkelten Lichtungen gedeiht und nun in Gärten und auf Grünstreifen gestrandet ist: Indikatorspezies, die auf die Vergangenheit verweisen. Ähnlich wie unsere eigenen Erinnerungen uns beeinflussen, haben sie Auswirkungen auf das Ökosystem der Gegenwart.
All das führt uns zum vierten Teil, der von der Erkundung zweier verlassener Orte handelt, die mir – und vielleicht auch Ihnen – erscheinen, als würden sie über ihre Gegenwart hinausweisen und uns einen Blick auf eine Zukunft erhaschen lassen, in der die Erderwärmung und andere menschliche Vermächtnisse eine ganz andere Welt hervorgebracht haben werden.
Zwei Jahre habe ich mit Reisen an Orte verbracht, an denen das Schlimmste schon passiert ist. Landschaften, die durch Kriege, Kernschmelze, Naturkatastrophen, Desertifikation, Vergiftung, Strahlung und wirtschaftlichen Zusammenbruch zerstört worden sind. Eigentlich hätte das hier ein düsteres Buch werden müssen, eine Litanei der schrecklichsten Orte auf Erden. Tatsächlich ist es eher eine Geschichte über Erlösung geworden, darüber, wie die am schlimmsten verschmutzten Orte des Planeten – zerbombt, erstickt unter Ölteppichen, kontaminiert von radioaktivem Niederschlag oder all ihrer natürlich Ressourcen beraubt – sich durch ökologische Prozesse wiederherstellen können, wie die kühnsten Ruderalpflanzen Wurzeln schlagen und Beton und Schutt genauso besiedeln wie Sanddünen, wie die Paletten ökologischer Sukzession sich verändern, wenn Moos zu Goldgras wird, zu bunt leuchtenden Mohnblumen und Lupinen, zu Sträuchern und schließlich zu Baumbedeckung. Eine Geschichte darüber, dass es an einem bis zur Unkenntlichkeit veränderten Ort, wo jede Hoffnung verloren scheint, vielleicht doch noch Potenzial für eine andere Form von Leben gibt.
Erster Teil
IN ABSENTIA
1 DAS ÖDE LAND
Five Sisters — West Lothian — Schottland
Five Sisters
Fünfundzwanzig Kilometer südwestlich von Edinburgh ragt eine knöcherne Faust aus einer zartgrünen Landschaft: fünf Gipfel aus roségoldenem Schutt, durch Gras und Moos miteinander verbunden, stehen da wie ein Gebirge auf dem Mars, gigantische Erdwälle. Tatsächlich sind es Schlackenhalden.
Die Gipfel erheben sich entlang eines scharfen Grats vom selben Ausgangspunkt, in geometrischer Schlichtheit aufgefächert. Über diese Grate verliefen früher Schienen, auf denen Wagen voll mit tonnenweise dampfenden Felssplittern fuhren: Abfälle aus den frühen Tagen der modernen Ölindustrie.
Dank einer innovativen Destillationsmethode, bei der aus diesen Gesteinssplittern Flüssigbrennstoff gepresst wurde, war Schottland ab 1860 etwa sechzig Jahre lang weltweit führend in der Produktion von Schieferöl. Diese sonderbaren Hügel sind ein Denkmal jener Jahre, in denen hier 120 Anlagen dröhnten und röhrten und dem Boden in dieser bis dahin verschlafenen Ackerbauprovinz jährlich 600 000 Barrel Öl abrangen. Dieser Vorgang war allerdings kostspielig und mühsam. Zur Gewinnung des Öls musste der Schiefer zerbrochen und hoch erhitzt werden. Dies produzierte riesige Mengen Abfall: Auf zehn Barrel Öl kamen sechs Tonnen feste Rückstände. Insgesamt waren das 200 Millionen Tonnen Schlacke, und irgendwo musste man damit abbleiben. So entstanden diese gigantischen Haufen. Siebenundzwanzig waren es insgesamt, neunzehn stehen bis heute.
Doch die Bezeichnung Schlackehaufen wird ihrer Größe, ihrer Statur, ihrer konstanten Präsenz in der Landschaft, unnatürlich in Gestalt und Ausmaß, nicht gerecht. Lokal werden sie als bings bezeichnet, vom Altnordischen bingr – Halde, Kippe, Eimer.
Diese spezielle Formation, die fünfzackige Pyramide, ist als Five Sisters bekannt. Sanfte Schrägen führen jeweils zum höchsten Punkt dieser Schwestern und brechen dann abrupt ab. Sie erheben sich aus dem Flachland einer ansonsten ziemlich unauffälligen Landschaft – matschige Felder, Strommasten, Heuballen, Kühe – und wurden so zum Kennzeichen der Region: manche eher pyramidenförmig oder eckig, andere organisch und formlos, manche noch immer mit ungeschlachten Hängen und flacher Hochebene, rot wie der Uluru.
Die zunächst noch kleinen Haufen türmten sich immer höher auf und veränderten ihre Gestalt wie Dünen. Mit der Zeit wurden sie zu richtigen kleinen Hügeln. Und schließlich zu Bergen aus kleinen Steinsplittern – jeder so groß wie ein Fingernagel oder eine Münze, brüchig wie Terrakottascherben. Die Berge wuchsen und breiteten sich aus, als ein Karren nach dem anderen ausgekippt wurde. Sie gingen auf wie Brotlaibe und verschlangen alles, mit dem sie in Berührung kamen: reetgedeckte Cottages, Gehöfte, Bäume. Unter dem nördlichsten Arm der Five Sisters liegt ein ganzer viktorianischer Landsitz begraben – ein steinerner Prachtbrau mit großen Erkerfenstern und Kuppelturm.
Die hiesige Ölproduktion wurde in großem Maßstab betrieben, bis die gewaltigen Flüssigölvorkommen im Nahen Osten den Markt beherrschten. Die letzte schottische Schiefermine wurde 1962 geschlossen und brachte das Ende einer lokalen Kultur und Lebensweise mit sich. Der nun weggebrochene Bergbau hatte den Menschen in den umliegenden Dörfern den Lebensunterhalt gesichert, und nur die riesigen, ziegelroten Bings erinnern heute noch daran. Lange Zeit galten sie als Schandfleck: fruchtloses Ödland, das sich über den Horizont erhebt und höchstens dazu taugt, den Menschen der Region den Bankrott einer Industrie und die Plünderung der Umwelt vorzuhalten. Niemand will über seine Schutthalden definiert werden. Doch was tut man damit? Das war unklar.
Einige wurden eingeebnet. Andere wurden später noch einmal abgebaut, da den roten Steinsplittern, fachsprachlich blaes genannt, ein zweites Leben als Baumaterial zukam. Eine Zeit lang sah man sie plötzlich überall: Sie wurden zu rosafarbenen Quadern verarbeitet oder zu Splittbelag auf Autobahnen und Sportplätzen, wie auch an meiner Highschool. Blaes steckten in aufgeschürften Knien, sammelten sich im Profil der Sportschuhe, hinterließen typischen Staub auf den Pullis, die als Tormarkierung auf dem Boden lagen – und bildeten somit den ziegelroten Hintergrund des Erwachsenwerdens in unserer Gegend. Im Großen und Ganzen aber waren die Bings verlassen und wurden nicht weiter beachtet. Mit der Zeit gewöhnten sich die Dorfgemeinschaften in ihrem Schatten an ihre stille Anwesenheit. Irgendwann hatte man sie geradezu liebgewonnen.
Die Bings zu finden ist einfach. Sie sind aus Kilometern Entfernung sichtbar. Man fährt ihnen einfach entgegen, bis es nicht mehr weitergeht und klettert über den Zaun. Kein Trara. Nur Schlackehaufen, groß wie Kathedralen, Hangars oder Bürogebäude, die in künstlichen Formationen aus dem Feld ragen.
* * *
Meine Tante und mein Onkel leben in West Lothian, nicht weit von den Five Sisters, ganz in der Nähe ihres noch größeren Verwandten in Grandykes. Als wir letztes Mal zu Besuch waren, fuhren mein Lebensgefährte und ich einen Umweg, um auf den schlafenden Riesen zu steigen. Das Licht war trüb und silbrig, der Himmel grau und mit Wattewolken verhangen. Wir parkten auf einem halb verfallenen Industriegelände zwischen angerosteten Wellblechbaracken und verblassten Schildern und betraten eine Landschaft von beinahe unglaublicher Seltsamkeit, als wären wir Pioniere auf einem unbekannten Planeten. Da standen von Wind und Regen geformte Solitäre und Brocken aus einem Konglomerat komprimierter blaes, eine ganz eigene Gesteinsart, marsrot und dort, wo die äußere Schicht abgeplatzt war und den Blick auf frisches Gestein freigab, gräulich-lila, glatt, beinahe ölig glänzend wie zersprungener Feuerstein, mit olivgrünem Schimmer – noch nicht durch Oxidation verfärbt.
Die als
blaes
bezeichneten Steinsplitter sind ein Abfallprodukt der Ölindustrie des 19. Jahrhunderts.
Tiefe, flaschengrüne Teiche hatten sich unten an den Hängen gesammelt, am Fuß jeder Senke und jeder Mulde, die sich im faltigen Relief der Halde geformt hatte, ihre Umrisse zeichneten sich im Giftgrün des Laichkrauts und der haarfeinen Gräser ab, mit denen das seichte Wasser durchsetzt war. Seerosen lugten über die Wasseroberfläche, auf der winzige Insekten vorbeiglitten. Spindeldürre, seidig-glänzende Birken sprossen mit unwahrscheinlichem Elan aus ihrem Schotterbett und trugen Knospen winziger neuer Blätter. Wir drängelten uns zwischen den Birken hindurch und folgten einem schmalen Pfad, der uns zum Fuß des eigentlichen Bings führte. Seine ausladenden roten Flanken ragten vor uns auf, das von Rissen durchzogene Relief wurde von der Vegetation dramatisch hervorgehoben und war von Spuren gezeichnet.
Wir begannen den Aufstieg, kamen jedoch nur schwer voran. Die Steine hatten sich zu festen Konglomeraten verhärtet, die teilweise Felswände, teilweise Geröllhalden bildeten. An anderen Stellen war die äußerste Schicht grasbewachsen, aber knittrig wie Wäsche, wo die Haut abgerutscht war, und wenn wir die Füße daraufsetzten, brachen wir ein wie in Firnschnee. Splitt sammelte sich in unseren Schuhen. Wir mussten anhalten und sie ausleeren, und ich empfand etwas wie einen Anflug von Nostalgie.
Wir arbeiteten uns bis hinauf zum Gipfel. Von der windgepeitschten Hochebene hatten wir einen Rundumblick über leergefegte Felder bis nach Niddry Castle, einem Wehrturm aus dem 16. Jahrhundert, dem ein weiterer Bing im Nacken saß, eine steile Klippe aus Schieferschlacke, rotgesichtig mit grünen und grauen Schlieren. Und dahinter erhoben sich stolz noch weitere seiner Art.
Dort oben wuchs eine eigenartige Mischung von Pflanzen, es war schwierig zu bestimmen, mit welcher Art von Klima man es hier zu tun hatte. Rostrote Weidenröschentriebe wuchsen hier wie an einer beliebigen Landstraße. Doch davon abgesehen machte die Vegetation einen kargen, subarktischen Eindruck: ein dichter Bestand pelziger Blätter und sternförmiger Blumen, kurzes, helles Gras. Doch es gab auch Wiesenklee, dessen nektargefüllte Köpfchen sich gerade öffneten, und Fingerknabenkraut. Die ersten Hummeln des Jahres schlingerten vorüber, die Motoren brummten auf Hochtouren. Das Land schwelgte in der Sonnenwärme, stand kurz vor der Blüte. Es war Ende April. Unmöglich, da nicht an T. S. Eliot zu denken:
April ist der übelste Monat von allen, treibt
Flieder aus der toten Erde, mischt
Erinnerung mit Lust, schreckt
Spröde Wurzeln auf mit Frühlingsregen.
Im Jahr 2004 hatte die Ökologin Barbra Harvie die Flora und Fauna der Bings untersucht und zur allgemeinen Überraschung herausgefunden, dass sie sich unbemerkt zu einem Hotspot der Tier- und Pflanzenwelt entwickelt hatten. Sie prägte dafür den Begriff »Inselrefugialräume«: kleine verwilderte Inseln in einer von Landwirtschaft und Städtebau geprägten Umgebung. Hasen und Dachse, Moorschneehühner, Feldlerchen, Braune Waldvögel und Mittlere Weinfalter sowie Zehnpunkt-Marienkäfer hatten sich angesiedelt. Unter den Pflanzen fand sich eine große Bandbreite an Orchideenarten – etwa die überaus seltene Epipactis youngiana, eine zarte, vielköpfige Blume in Blassgrün und Rosa, die in Großbritannien nur an zehn Standorten vorkommt (allesamt ehemalige Industriegelände, zwei davon Bings); das zottige Männliche Knabenkraut in Violett, die Grünliche Waldhyazinthe mit ihren geflügelten Blütenblättern – und ein genetisch einzigartiger lichter Birkenwald, der sich auf natürliche Weise am Fuß des winzigen Bings bei Mid Breich angesiedelt hatte.
Auf einer Schlackenhalde im schottischen West Lothian gedeiht leuchtend grüner Bewuchs inmitten von Schiefersplitt.
Insgesamt fand Harvie über dreihundertfünfzig Pflanzenarten auf den Bings – mehr als am Ben Nevis –, darunter acht hierzulande seltene Arten von Moosen und Flechten wie das grazile Blattlose Koboldmoos, dessen feine Stämmchen kleine Schilde gen Himmel recken wie ein Miniaturheer. Über eine Zeitspanne von fünfzig Jahren war dieses ehemals kahle Ödland zuckend und zitternd zum Leben erwacht.
Die Menschen in Eliots ödem Land – zumindest einige – entpuppen sich als seine Zeitgenossen: moderne Pendler, die im Morgengrauen über die London Bridge strömen, einsame Stenotypistinnen, die ihre Abende in Mietzimmern vertrödeln. In gewissem Sinne wohnen wir alle noch immer im öden Land – damals, als ich am Bug dieses großen Mahnmals der Umweltzerstörung stand, spürte ich das ganz deutlich.
Was sind das für Wurzeln, die krallen, was für Äste wachsen
Aus diesem steinernen Schutt?
Eliots ödes Land geht auf den »finsteren Wald« der keltischen Mythologie zurück, ein »unbeschreiblich fruchtloses« Land, das ein Held durchqueren muss, um die Anderswelt zu finden, oder den Heiligen Gral. Auch die Bings bieten uns einen Vorgeschmack darauf, was uns womöglich auf der anderen Seite erwartet: Erholung und Rückeroberung. Ein Ökosystem, das stur neues Leben bildet und sich selbst mit aller Kraft aus dem Ruin holt. Das von vorne beginnt und etwas von Schönheit erschafft.
* * *
Die auf 500° C erhitzten Schiefersplitter wurden noch glühend heiß auf der Kippe abgeladen, sodass zunächst eine weitläufige, sterile Wüste entstand, auf der weder Samen noch Sporen überleben konnten. Der Bewuchs, den wir nun sehen, hat also bei Null begonnen, ohne Erde noch sonst irgendetwas, ein als »Primärsukzession« bekannter Vorgang.
Zuerst kamen die Pionierpflanzen: Filigrane Laubflechten mit gekräuselten Rändern, die sich zu korallenriffartigen Verbänden zusammenfinden, sowie Stereocaulon, eine weiße Strauchflechte, die Krusten bildet. Grünes Moos legte sich wie eine Picknickdecke auf den Schutt, weich und einladend. Dann folgten die Ruderalpflanzen – vom Lateinischen rudera: zum Schutt gehörend –, Wildblumen und tiefwurzelnde Gräser, die die losen Geröllfelder besiedeln und sie zusammenhalten, wie Strandhafer Sanddünen zusammenhält: Wundklee, Leinkraut, Hasenglöckchen, Wegerich, Kleiner Klappertopf, Mastkraut, Ehrenpreis und Süßdolde. In den feuchten Rissen hielten Weißdorn, Hagebutte und Birke Einzug, schlugen Wurzeln.
Sie alle erschienen wie von Zauberhand: Entweder trugen der Wind oder Vögel sie herbei, oder sie stammten aus Wildtierkot (in der Ökologie kennt man dafür den poetischen Begriff »Samenregen«). Sie sind die wenigen Überlebenden eines viel größeren Experiments, der harte Kern, der sich auf den Halden halten konnte. Je mehr von ihnen schon da sind, desto leichter wird es auch für andere, da sich organische Materie in Form von Laubkompost, Totholz und Algen ansammelt und der nächsten Generation als Nährboden dient. Zu Beginn waren die Bings also höchstwahrscheinlich speziesarm, an ihren Flanken wird es Fluktuationen von Arten gegeben haben, die einander abwechselten und neue Formen des Werdens ausprobierten. Gebirgsflora, gewöhnliche Gräser, ausgebüchste Zierpflanzen. Mit der Zeit beginnen manche Spezies, sich zu häufen, werden sesshaft. Und mittlerweile fungieren die Bings quasi als Archiv der Biodiversität in der Umgebung.
Und obwohl die Bings ein erstaunliches Beispiel für Primärsukzession in Aktion sind, ist das kein Sonderfall. In der Natur kommen diese Prozesse allerdings nur selten vor – auf neugebildeten Dünen etwa, oder frisch von Unterwasservulkanen ausgespuckten Inseln. Doch Menschen haben die schlechte Angewohnheit, das Land allen Lebens zu berauben und alles auf Null zu setzen.
Nach dem als blitz bezeichnete Luftangriff der Wehrmacht auf London beobachtete E.J. Salisbury, der Direktor der Kew Gardens, einen ähnlichen Prozess in den verkohlten Einschlagskratern, von denen die Hauptstadt übersät war. In einer Broschüre von 1943 mit dem Titel The Flora of Bombed Areas beschrieb Salisbury, »wie schnell sich der grüne Mantel der Vegetation auf die schwarzen Kriegsnarben gelegt hat«. Die Pflanzen sprossen spontan aus dem Boden, stellte er fest, wuchsen auf blankem Schutt und in Häuserruinen. Die »staubartigen Sporen« von Mosen, Farnen und Pilzen flogen durch die zersprungenen Fenster herein, die seidenhaarigen Samen des Weidenröschens schwebten von Krater zu Krater (jede Jungpflanze kann, wie er bemerkt, 80 000 Samen pro Saison produzieren). Mit ihnen kam auch das leuchtend gelbe Jakobs-Greiskraut, das zarte, stabartige Flohkraut, die Gänsedistel und der Löwenzahn, und auch die winzige Vogelmiere.
Diese Samen und Sporen – und mit ihnen die Möglichkeit von Wildblumen, von Leben – schweben jederzeit in der Luft um uns und warten auf ihre Gelegenheit. So wie in einer offen herumstehenden Petrischale bald ganz eigene Kulturen wachsen, verhält es sich auch mit sterilen Bombenkratern, Lavafeldern oder Bings, nur in größerem Maßstab. Alles, was die Samen und Sporen brauchen, ist ein Landeplatz.
Und während sich in London die Wunden der Luftangriffe schlossen und die Ölschieferindustrie im schottischen Tiefland langsam zum Erliegen kam, wurde infolge weiterer Bombenexplosionen auf der anderen Seite der Welt ein ähnlicher Prozess angekurbelt. Diesmal unter Wasser.
* * *
Auf dem Bikini-Atoll, einem Ring von Koralleninseln um eine türkisblaue Lagune, führten die USA in den Vierziger- und Fünfzigerjahren Kernwaffentests durch – insbesondere die Operation Castle Bravo im Jahr 1954, im Zuge derer eine thermonukleare Waffe getestet wurde, deren Sprengkraft die der Hiroshima-Bombe um ein Siebentausendfaches überstieg. Die Explosion fiel so unerwartet heftig aus, dass selbst ihre Entwickler schockiert waren und schließlich ein weltweites Verbot von atmosphärischen Tests anregten.
Die Detonation hinterließ einen Krater, der über anderthalb Kilometer lang und achtzig Meter tief war, vernichtete zwei Inseln vollständig und ließ einen riesigen Atompilz aus Dampf, Heißluft und pulverisierten Korallen aufsteigen, einen leuchtenden Feuerball, der wie eine zweite Sonne den Himmel tiefrot färbte. Er erhob sich 40 Kilometer in die Atmosphäre, bevor der radioaktive Niederschlag wie ein Schneesturm über die Marshall-Inseln kam und alles, mit dem er in Berührung kam, verbrannte. Das Wasser der Lagune begann jäh zu kochen, die Temperaturen stiegen bis auf 55 000 °C, dreißig Meter hohe Wellen preschten nach außen und wirbelten Millionen Tonnen Sand auf, sodass alle Korallen, die die Explosion überstanden hatten, darunter begraben wurden und erstickten. Zurück blieb ein völlig zerstörtes Unterwasserödland, das stark kontaminiert und bar jeden Lebens war.
Als jedoch 2008 ein internationales Forschungsteam die Lagune inspizierte, stellte es zu seiner eigenen Überraschung fest, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten ein florierendes aquatisches Ökosystem im Krater entwickelt hatte. Es schien, wie eine Korallenforscherin bemerkte, »vollkommen unberührt«. Während die Inseln über Wasser auf unheimliche Weise verlassen wirkten – unbewohnt bis auf ein paar Leute, die eine winzige Touristeninitiative betrieben* – und das Grundwasser und die dort wachsenden Kokosnüsse verstrahlt waren, erschien die Lagune darunter als Kaleidoskop blühenden Lebens. Völlig erholt hatte es sich nicht – noch immer fehlten achtundzwanzig Korallenarten –, trotzdem war es zu einem der beeindruckendsten Riffe weltweit geworden, wo Korallen sich als riesige Felskissen erhoben, groß wie Autos, oder bis zu acht Meter hohe, verästelte Skulpturen mit schmalen Fingern.
Ein Forschungsteam der Universität Stanford tauchte 2017 erneut in den Krater hinab und entdeckte, dass er mittlerweile noch mehr vor Leben wimmelte. Hunderte Schulen von Thunfischen und Riffhaien sowie Schwärme von Schnappern schossen durch das klare Wasser. Es war, wie der Projektleiter Professor Stephen Palumbo berichtete, »visuell und emotional überwältigend«. Er erklärte, das Riff sei auf sonderbare Weise durch die traumatische Geschichte des Atolls geschützt worden – als direkte Folge des Ausbleibens menschlicher Einflüsse seien die Fischpopulationen größer, die Haie zahlreicher, die Korallen beeindruckender.
Aus glühender Asche ist eine Überfülle an Leben entstanden. Nicht Wind oder Vögel haben es herbeigetragen, sondern Meeresströmungen. Korallenlarven – die Staubkörnchen des Meeres – sind mutmaßlich vom hundertzwanzig Kilometer entfernten Rongelap-Atoll angeschwemmt worden und gründeten eine neue Kolonie auf einem Untergrund, der damals noch einer verkraterten Mondlandschaft glich, bedeckt mit den pulverisierten Überresten ihrer Vorgängerinnen.
Wieder diese Latenz des Lebens. Die ganze Zeit über umgibt es uns, unsichtbar, wie der Äther. Es ist in der Luft, die wir atmen, im Wasser, das wir trinken.
Lassen Sie sich das einmal das auf der Zunge zergehen: Jeder Atemzug, jeder Schluck steckt voller Potenzial. In einer Handvoll Nichts liegt die Saat für alles.
* * *
Die selbstaussäenden Ökosysteme, die sich auf den Bings und an ähnlichen aufgegebenen Standorten entwickelt haben, können uns viel über die Möglichkeiten und Prozesse der Regeneration erzählen, über die Resilienz der Natur und ihre Fähigkeit, sich von einem vermeintlich tödlichen Schlag zu erholen.
Diese Geschichten handeln von Erneuerung, nicht von Wiederherstellung. Die Natur an solchen Orten wird nie wieder so werden, wie sie einmal war. Dennoch schenken sie uns Einsichten in die Prozesse von Reparation und Anpassung und – wichtiger noch – Hoffnung. Sie rufen uns ins Gedächtnis, dass selbst dann, wenn die Lage zum Verzweifeln scheint, nicht alles verloren ist.
Von ihnen können wir viel lernen. Tatsächlich hat sich unsere Wahrnehmung und Wertung postindustrieller oder anderer »anthropogener« Standorte in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Einige der aufregendsten Entwicklungen auf dem Feld von Ökologie und Naturschutz wurden durch die Erforschung von Landschaften angestoßen, die stark vom Menschen beschädigt waren und an deren Beispiel man beobachten konnte, wie Ökosysteme sich ausbreiten und wieder zusammenschrumpfen, sich an veränderliche Umstände anpassen, heftige Schläge einstecken und danach wieder erstarken.
Ein neuer Fokus wissenschaftlichen Interesses sind Standorte, die auf den ersten Blick trist, verwahrlost und dem Verfall preisgegeben scheinen: Ihre Bedeutung anzuerkennen erfordert eine gewisse Sensibilisierung des Blicks bei der Betrachtung unserer Umgebung. Es ist viel schwieriger, den Wert von Blei anzuerkennen, wenn es im Glanz von Silber und Gold erblasst. Doch solche terrains vagues mit ihren starrsinnigen Pflanzengemeinschaften sind womöglich auf authentischere Weise lebendig, auf beständigere Weise echt als viele der beliebtesten Naturlandschaften der Welt – und verfügen über eine ureigene Anziehungskraft und einen speziellen Wert.
Einige der ganz frühen Arbeiten über die Bedeutung solcher zusammengestückelter, improvisierter Ökosysteme, die an verlassenen Orten gedeihen, stammen aus dem Berlin der Nachkriegszeit, wo ähnlich wie in London große Teile urbaner Bebauung durch Luftangriffe in Schutt und Asche gelegt worden waren. Doch anders als in London verzögerte sich der Wiederaufbau durch die Errichtung der Berliner Mauer und die Teilung der Stadt. So wurden etwa Bahnhöfe in Westberlin außer Betrieb genommen, nachdem Ostdeutschland seine Züge die von den Alliierten besetzten Zonen umfahren ließ.
Der stillgelegte Rangierbahnhof Tempelhof wurde von der Natur zurückerobert. Die Gleise blieben, doch breitstämmige Birken kämpften sich zwischen den Bahnschwellen empor, blockierten die Gleise und verhinderten die Rückkehr der Züge. Ein komplexes Mosaik aus Wiesen, Sträuchern und Robiniengehölz gedieh unter einem verrostenden Wasserturm, und im Jahr 1980 zählte man im achtzehn Hektar großen Areal, das mittlerweile Naturpark Südgelände heißt, 334 Arten von Farnen und Blühpflanzen, außerdem werden dort regelmäßig Füchse, Falken und drei bis dato unbekannte Käferarten gesichtet sowie eine seltene Spinnenart, die man zuvor ausschließlich in unterirdischen Höhlen im Süden Frankreichs angetroffen hatte.
Ingo Kowarik, ein ortsansässiger Ökologe, hat das Gelände ausführlich erforscht und auf Grundlage seiner Beobachtungen dort und an ähnlichen verlassenen Standorten in der Stadt einen neuen Bezugsrahmen ausgearbeitet, um ihre Bedeutung verstehen zu lernen. Insgesamt gebe es vier verschiedene Vegetationsarten, schreibt er. Zunächst die Überreste dessen, was wir als »unberührte« Natur bezeichnen würden – alte Wälder und andere ursprüngliche Gebiete. Sie sind von großem Wert, weil sie eine immense Vielfalt und eine dichte Struktur aufweisen. Dann die Kulturlandschaften, die von der Land- und Forstwirtschaft geformt wurden. Drittens die Bäume und Pflanzen, die aus ästhetischen Gründen gepflanzt wurden und Teil der Stadtplanung sind. Und schließlich das, was Kowarik prägnant als »Natur der vierten Art« bezeichnet: die spontan und ohne Einflussnahme auf Brachen sprießenden Ökosysteme. Ihm geht es darum, dass diese neu entstandenen wilden Ökosysteme eine neue Form der Wildnis darstellen, die es zu schützen gilt.
In England hat sich etwas Vergleichbares in Canvey Wick abgespielt, wo ein dreiundneunzig Hektar großer Landstrich als Deponie für das ausgebaggerte Sediment der Themsefahrrinne verwendet wurde. Später sollte dort eine Ölraffinerie entstehen: Riesige kreisrunde Betonfelder wurden als Untergrund für die gigantischen Metalltanks angelegt, doch das Bauvorhaben kam aufgrund abstürzender Ölpreise zum Erliegen und wurde schließlich eingestellt. Das Areal galt als Schandfleck, bis man im Jahr 2003 unzählige Arten seltener Wirbelloser entdeckte, darunter 300 Mottenarten und Insekten, die so außergewöhnlich waren, dass sie keine englischen Namen hatten. Gutachten bescheinigten dem Gelände später die größte Biodiversität pro Quadratmeter im gesamten Vereinigten Königreich. Der »kleine Regenwald auf einer Industriebrache«, wie ein Naturschutzbeauftragter schwärmte, wurde 2005 zu einem Standort besonderen wissenschaftlichen Interesses erklärt.
Vor ein paar Monaten besuchte ich ein ähnliches Brachenwunder, etwas näher an meiner Heimat: die Halbinsel Ardeer an Schottlands Südwestküste, früher ein weitläufiger Landstrich aus Sanddünen und Salzwiesen, der im 19. Jahrhundert zu einem Industriezentrum wurde, als Alfred Nobel dort eine Dynamitfabrik samt Testgelände bauen ließ. Zu den Glanzzeiten arbeiteten 13 000 Angestellte in den Labors und in der Produktion, und in den Tanks lagerten Tausende Gallonen Nitroglyzerin. Aufgrund der Unfallgefahr wurden die Gebäude mit großem Abstand hinter Sandböschungen errichtet. (Und Unfälle gab es durchaus: 1884 wurden zehn junge Frauen, die Dynamitpatronen befüllten, bei einer gewaltigen Explosion getötet. Die Lokalzeitung berichtete: »von der Baracke ist keine Spur mehr zu sehen«. Teile des Körpers von einer der Frauen fand man beinahe 150 Meter vom Ort der Explosion entfernt.)
Diese Baracken sind nun verfallen und den Elementen preisgegeben, die Explosionsschutzwände mit Heide überwuchert. Verblichene Schilder warnen: GEFAHR – EXPLOSIONSFÄHIGE ATMOSPHÄRE.
Iain Hamlin, ein ortsansässiger Naturschützer, der sich gegen die Neubebauung des Geländes einsetzt, führt mich durch eine Lücke im Zaun auf den etwas unheimlichen Bahnsteig inmitten von Bäumen, der auf den letzten Zug zu warten scheint. Der ehemalige Parkplatz ist nun ein Patchwork aus weichem braunem Moos und schaumigen grauen und minzgrünen Flechten, die wirken wie die Oberfläche eines impressionistischen Teichs, stellenweise aufgewühlt und stellenweise still. Grasbüschel brechen durch die Oberfläche, und auch schwer mit Kätzchen beladene Salweiden. Sanddorn hat sich an den Rändern breitgemacht, und seine dunkelorangenen Beeren zerren an den Zweigen, die schon ganz kränklich und blass aussehen – Vogelfutter. Als ich meinen Absatz in den federnden Boden grabe und ihn aufscharre, kommt darunter der bröcklige Asphalt zum Vorschein, wie Knochen. Iain geht auf die Knie und zeigt mir den winzigen Eingang zum Tunnel eines Stierkäfers, der Kaninchenkot in seine unterirdischen Speisekammern rollt, außerdem die typischen Bauten der Solitärbienen. In den Kühlteichen, in denen Rohre vor sich hin rosten, tummeln sich Krickenten und Moorhühner. Im dahinterliegenden Wald steht eine einsame Straßenlaterne: eine Art verwüstetes Narnia. Über uns pfeifen die Häher.
Obwohl die Nutzung der Gelände unauslöschliche Spuren hinterlassen hat, sind sowohl Ardeer als auch Canvey Wick herausragende Standorte für die Entfaltung von Biodiversität. Alter Beton und Asphalt verzögern die Sukzession, verhindern die Ausbreitung von Wald – der, auch wenn es unlogisch erscheint, der Biodiversität eher abträglich ist – und halten den Standort sonnig. Ähnliches bewirken die Teenager aus den umliegenden Orten, die wir dabei beobachten, wie sie zündeln und auf dem Dach des stillgelegten Kraftwerks herumklettern. Die Kombination verschiedener nah beieinanderliegender winziger Subhabitate bietet vielen Insekten einen optimalen Lebensraum, da sie in unterschiedlichen Entwicklungsstadien wechselnde Ansprüche haben. Verlassene Gebäude, sonderbar schön in ihrem allmählichen Verfall, dienen zudem als Unterschlupf für Winterruhe haltende Schmetterlinge und Motten, deren Puppen und Kokons zu Hunderten an den feuchten, dunklen Wänden entdeckt wurden.
Angesichts der Intensität der heutigen Landwirtschaft, den sich zum Horizont erstreckenden Reihen von Monokulturen, erfährt die Tatsache, dass verfallene, vollkommen sich selbst überlassene Grundstücke zu Rückzugsorten für die Tierwelt geworden sind, zunehmend Anerkennung, und tatsächlich weisen laut der Naturschutzorganisation Buglife »einige Brachflächen Wirbellose von solcher Diversität und Seltenheit auf, wie man sie sonst nur aus Urwäldern kennt«. Was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass die meisten Brachen erst seit wenigen Jahrzehnten existieren, während ein Wald oft Jahrhunderte braucht, um seine volle Reife und ökologische Komplexität zu erlangen.
Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass wir mittlerweile die Ökologie unserer Umgebung mit ganz neuen Augen sehen. Man erinnere sich, dass der Begriff »Ödland« im 17. Jahrhundert oftmals keine verlassenen Gegenden bezeichnete, sondern Sümpfe, Moore und Marschen. Solche Landstriche wurden im Grunde als Platzverschwendung betrachtet – verwildert, ungeeignet für den Anbau, ein Hindernis für Reisende – und waren Ziel von »Aufwertungsmaßnahmen«, die sie in ertragreiches Ackerland umwandeln sollten. Heutzutage gelten diese »öden Landstriche« des 17. Jahrhunderts als unschätzbar wertvolle Feuchtgebiete, in denen es vor seltenen Arten nur so wimmelt und die außerdem eine wichtige Rolle als natürlicher Hochwasserschutz und Kohlenstoffspeicher spielen. Für ihren Erhalt und die Zuschüttung alter Entwässerungsgräben werden Millionen ausgegeben.
In dicht besiedelten und stark bewirtschafteten Regionen wie dem Vereinigten Königreich und Europa sind die einzigen Flächen, auf denen es echten unregulierten Wildwuchs gibt, womöglich solche, die früher genutzt und dann verlassen wurden. Man vergleiche die chaotischen Brachen von Canvey Wick, wo Käfer sich den Winter über in ungeschnittenen Halmen einrollen, seltene Spinnenarten in feuchten Reisighaufen lauern und Kreuzottern auf sonnenwarmem Asphalt ruhen, mit einem gestutzten und herausgeputzten Garten, der sorgfältig gepflegt wird und doch nur oberflächlich lebt.
Vermeintliche Schandflecke wie solche Brachflächen lehren uns eine neue, differenziertere Wertschätzung der Natur, die uns umgibt: nicht gemessen daran, wie malerisch sie ist oder mit wie viel Mühe sie gehegt wird, sondern mit dem Augenmerk auf ihre ökologische Potenz. Gewöhnt man sich diesen Blick an, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Scheinbar »hässliche« oder »wertlose« Flächen können sich als von großer ökologischer Bedeutung erweisen – und womöglich sind sie gerade aufgrund dieser Hässlichkeit und Wertlosigkeit dauerhaft verlassen, was sie vor Neubebauung oder übereifriger Bewirtschaftung und somit der Zerstörung bewahrt.
* * *
Laut Aldo Leopold beginnt unsere Fähigkeit, den Wert der Natur zu erkennen, »wie in der Kunst mit dem Schönen«. Danach durchläuft sie »aufeinanderfolgende Stadien der Schönheit bis zur Erkenntnis eines Werts, der von der Sprache noch nicht erfasst ist«. Damit wollte er wohl sagen: Wissen vertieft Wertschätzung. Leopold sah dünne Nebelschleier über einem Sumpf im Morgenlicht glitzern, beobachtete Kraniche, die ihre Futterstellen »in schallenden absteigenden Spiralen« anflogen – und sah darin auch die Geschichte der Kraniche und all ihrer Vorfahren, die im Lauf der Evolution ihre Kreise über diesem Feuchtgebiet drehten, wie ähnliche Kreaturen es schon in Urzeiten getan hatten, und die Erkenntnis, dass die idyllische Szene in diesem Augenblick notwendiger Bestandteil oder Synekdoche eines größeren, erstaunlichen Ganzen war, hielt er sich vor Augen wie ein Fernglas.
Auch das ist eine Form von Schönheit – sie ist eher konzeptioneller Natur und entspricht vielleicht der Art und Weise, auf die eine Mathematikerin eine besonders elegante Gleichung schätzt, oder es einem Künstler angesichts eines leeren Raums, der nur von einem flackernden Licht erhellt oder halbvoll mit Rohöl ist, den Atem verschlägt.
Und wie auch andere Formen des Ästhetizismus kann man lernen, sie zu sehen. Eine verlassene Mine, eine Abraumhalde, einen Steinbruch, einen Parkplatz oder ein Ölterminal aufzusuchen und darin das neu entstandene Wunder der Natur zu erkennen, ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Doch in dieser ökologisch angespannten Zeit lohnt es sich, diesen Blick zu kultivieren.
So wie die Feuchtgebiete im Namen des Fortschritts trockengelegt wurden, kam es auch in West Lothian zu Fehleinschätzungen. In einer Folgeuntersuchung zu ihrer Bewuchserhebung erforschte Barbra Harvie die Auswirkungen der Methoden, die bei der »Verwaltung« einiger der verbleibenden Bings zum Einsatz kamen; ab den Siebzigerjahren war man bemüht, das Aussehen einiger Halden durch invasive »Renaturierung« zu verbessern: Gipfel und Grate wurden abgerundet, Muttererde aufgebracht und eine kommerzielle Weidelgrasmischung an den Flanken ausgesät. Dies geschah, wie Harvie anmerkt, aus rein ästhetischen Gründen, die Halden sollten »natürlicher« wirken.
Doch die Bemühungen scheiterten. Die Nährstoffe aus dem frischen Mutterboden waren nach wenigen Jahren ausgelaugt und die gepflanzten Arten starben. Ohne dauerhaften Einsatz von Düngemitteln wurden die bewirtschafteten Bings kahl und unfruchtbar und befanden sich schließlich in deutlich schlechterem Zustand als jene, die man sich selbst überlassen hatte. Arm an Spezies und Nährstoffen dienen diese »verwalteten« Gebiete als abschreckendes Beispiel für die Folgen von Verschönerungsmaßnahmen.
Ähnliches ließe sich auch von New Yorks High Line behaupten – einer ehemaligen Hochbahntrasse, die nach ihrer Stilllegung bald dicht von spontanem Bewuchs überwuchert war. Mittlerweile wurde sie in einen beliebten Park umgewandelt, nur zehn Meter breit, dafür aber fast zweieinhalb Kilometer lang. Als ich selbst dort war, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass man die alte, eigenständig entstandene Vegetation ausgegraben und durch einen pflegeintensiven Garten ersetzt hatte, der vom ursprünglichen, selbstaussäenden Wildwuchs »inspiriert« ist. Später fand ich folgende Darstellung auf der offiziellen Website: »Die natürliche Bepflanzung soll einem emotionalen Naturerleben nahekommen. Die Gärten mögen natürlich erscheinen, sind es aber keineswegs. Pflanzen, die sich in freier Natur niemals begegnen würden, wurden hier auf speziell abgestimmter Erde nebeneinander gepflanzt. Gärtner*innen gießen, stutzen, bearbeiten, formen die Pflanzen und jäten Unkraut. Menschliche Einflussnahme ist allgegenwärtig und der Zustand des Geländes ist in vielerlei Hinsicht ein künstlicher.«
Man kann Standorte wie die High Line unterschiedlich bewerten, doch aus ökologischer Sicht ist diese kuratorische Herangehensweise, die für unser Weltbild so typisch ist, eher schädlich. (1967 führte der Wissenschaftshistoriker Lynn White Jr. die Umweltkrise auf die jüdisch-christliche »Arroganz« der Natur gegenüber zurück. In der Genesis überträgt Gott dem Menschen die Herrschaft über die gesamte Natur – über Vögel, Fische, Vieh und »alles, was auf Erden kriecht«. White zufolge gibt es »weltweit keine Religion, die so anthropozentrisch ist wie das Christentum, insbesondere in seiner westlichen Ausprägung«.)
Obwohl wir unsere selbst zugewiesene Rolle als Verwalter des Planeten voller Begeisterung annehmen, hier zurechtstutzen und da anpflanzen, aufräumen und »Plagen« bekämpfen, sind unsere Bestrebungen nicht immer von Erfolg gekrönt. Gärten, Parks und Ackerflächen sind oft ökologisch einfältig und ihr Bestehen hängt von unserem Wohlwollen ab, während Hecken, Seitenstreifen und städtisches terrain vague oft artenreiches, tief verwurzeltes Leben aufweisen. Wir reißen Pflanzen aus, die gut an den Boden und die Standortbedingungen angepasst sind, und beharren an ihrer statt auf teuren, ungeeigneten Zierpflanzen. Es wäre wohl besser, diesem Impuls zu widerstehen und einen Schritt zurückzutreten.
Marcel Duchamp soll über die Kunst gesagt haben, dass ein Sich-Ergötzen am Ästhetischen eine Gefahr darstellt, die man vermeiden sollte. Darin steckt auch eine universelle Wahrheit: Es ist nicht so, dass diese Lebensräume nicht schön sind, sondern dass unser Blick noch nicht geübt darin ist, das wertzuschätzen, was sie sind und wofür sie stehen. Stattdessen wird unser Blick vom faulen Anschein der Fülle abgelenkt und verführt.
Niddrie Woman
, aus der Luft gesehen
Ich erkenne darin ein ähnliches Muster wie bei der Unterscheidung zwischen rehäugigen Gesichtern in Modekatalogen und dem kantigen, manchmal sogar ungelenken Äußeren der Haute-Couture-Models, das sich mit dem kaum übersetzbaren französischen Begriff jolie laide fassen lässt (wörtlich »hässlich schön«, eine Bezeichnung für Frauen, deren Unvollkommenheiten sie aus der Masse konventioneller Schönheiten hervorheben und sie auf einer anderen Ebene visuell interessant machen). Die Bings und ähnliche Orte könnte man ebenfalls als jolie laide bezeichnen: Landschaften, deren industrielle Narben ihre heutige Form und ökologische Bedeutung nur noch betonen.
Im Jahr 1975 wurde der avantgardistische Konzeptkünstler John Latham von der Scottish Development Agency mit einer kreativen Neuinterpretation der riesigen Schlackenhalden beauftragt, die damals als Makel in der Landschaft galten, um eine neue Bestimmung für sie zu finden. Statt eine Umgestaltung oder Entfernung vorzuschlagen, lobte Latham ihre »makellose und klassische Natur«, und beharrte darauf, sie als »prozesshafte Skulpturen« neu zu konzeptualisieren und zu erhalten.
Zur Untermauerung seines Vorschlags legte Latham Satellitenbilder der Bingformation vor, zu der auch Greendykes gehört, und erklärte sie zu Bestandteilen einer riesigen Niddrie Woman, also Frau von Niddrie, dem angrenzenden Stadtteil – und damit zu einer riesigen Land-Art-Skulptur, die von Zehntausenden Händen über Jahrzehnte geschaffen worden war, ähnlich wie der Riese von Cerne Abbas oder das weiße Pferd von Uffington, eine »moderne Variante der Keltischen Sage«. Bei unserer Wanderung über den Bing von Greendyke hatten wir demnach ihren großen nackten Bauch überquert, und das, was Latham zufolge ihr Kopf ist, erhebt sich als Bing von Albyn Works im Süden, hinter der Talmulde ihres Schlüsselbeins, in der sich ein grünes Standgewässer gesammelt hat, auf dem sich Wasservögel tummeln. Der Bing von Hopetoun, der sich gen Norden erstreckt, stellt ihren vom Körper getrennten Arm dar, während die roten Klippen in Niddry ihr übergroßes Herz repräsentieren.
Der konzeptuelle Imagewandel war ein schlauer Schachzug. Von der Regierung wurde nichts verlangt außer der Erhaltung des Gebiets. So gesehen war die Niddrie Woman eine kostengünstige Lösung des Bingproblems. Recht bald wurde der Bing von Greendykes also zum Nationaldenkmal erklärt – einer der Gründe, warum er so lange vor den Planierraupen verschont geblieben ist, dass die Natur zurückkehren konnte.*
Als wir, während der Wind an uns zerrte, stolpernd den Gipfelgrat erreichten, versuchte ich, sie mit weniger kritischen Augen zu sehen. Noch einmal betrachtete ich die plastische Form ihres Rumpfs, die sich kreuzenden, auffällig dunklen Motocrossspuren, die immer wieder parabelförmig die Wölbung zwischen Kopf und Hals nachzeichneten, die klarsten Linien ihrer Gestalt, und den Anschein einer Kohlezeichnung erweckten. Ich betrachtete die fleckigen Farben der Steinsplitter selbst, die von korallenrot über melonengelb reichen, gesprenkelt mit dem rußigen Blau des ursprünglichen, ungebrannten Ölschiefers. Ich sah zu den kleinen Blumen, die den Pfad säumten, den mattrosa Flechten. Lauschte dem Murmeln der Insekten und dem flötenden Trillern einer auffliegenden Lerche. Niddrie Woman ist in vielerlei Hinsicht eine prozesshafte Skulptur. Sie ist die »unbewusste Skulptur« der Ölschieferindustrie, wie Latham sie sah und als die sie offiziell anerkannt wurde, doch sie ist auch Denkmal für den Prozess der Sukzession, der Erholung, der Rückeroberung.
In seiner »Machbarkeitsstudie« verglich Latham die Niddrie Woman mit der Venus von Willendorf, einer altsteinzeitlichen Figurine mit hängenden Brüsten und ausladendem Bauch, die von manchen für ein Fruchtbarkeitssymbol gehalten wird. Doch ganz sicher gibt es kein passenderes Symbol für die Fruchtbarkeit – für den Sieg neuen Lebens über Sterilität – als die Bings selbst.
Welche Art von Frühlingsritus könnte man an einem solchen Ort abhalten? Wenige Tage später, an einem der letzten Aprilabende, besuchte ich das Fire Festival Beltane auf dem Calton Hill in Edinburgh, eine ritualisierte Performance, die den Tod und die Wiedergeburt des »Grünen Mannes« thematisiert, einer keltischen Sagengestalt, die die zyklische Wiederkehr neuer Vegetation im Frühling symbolisiert, und sein Umwerben der Muttergöttin. Scharlachrot angemalte, bis auf ein Leintuch splitternackte Gestalten sprangen um ihn herum, trommelten, wanden sich, spuckten Feuer und gaben klagende Laute von sich. Ein wildes Bacchanal, in dem die Teilnehmenden sich vielleicht verlieren und alte Hemmnisse abwerfen können. Wahrscheinlich so etwas in der Art. Man könnte auch des Grauballe-Manns gedenken, einer in Jütland gefundenen Moorleiche mit aufgeschnittenem Hals und einem Bauch randvoll mit Frühlingssaat: Klee, Weidelgras, Hahnenfuß. Latham, da bin ich mir sicher, würde beides gutheißen.
Als wir uns an den Abstieg machten und auf Händen und Füßen den Schiefersplitt hinabschlitterten, trafen wir einen Motocrossfahrer, der gegen alle Gesetze der Schwerkraft die Geröllfelder rauf und runter raste. Er trug einen Helm mit verspiegeltem Visier, den er nie absetzte, und obwohl er zwischendurch haltmachte, damit wir aus seiner Bahn verschwinden konnten, sagte er kein Wort und gab uns auch sonst nicht zu verstehen, dass er unsere Anwesenheit zur Kenntnis nahm.
Es war eine unheimliche Begegnung. Ich musste mehrfach vom festgetretenen Pfad abweichen und meine Füße in den losen Splitt sinken lassen, was sich anfühlte, wie durch Tiefschnee zu waten. Als wir den grünen Tümpel erreichten, brach mit einem Mal eine Rothirschkuh aus dem Dickicht und preschte den Hang hinauf, auf den Motocrossfahrer zu. Sie war ausgewachsen, fit und rostrot, mit kräftigen Hinterbeinen, die im Galopp in die losen Steine traten. Eine Zeit lang schien sie jedes Mal, sobald sie etwas an Höhe gewonnen hatte, sofort wieder abzurutschen, und minutenlang sahen wir alle drei gebannt zu, wie sie mit aller Kraft gegen das Geröll ankämpfte, sodass goldener Schiefersplitt den Hang hinabklapperte, bis sie schließlich den stummen Fahrer passierte, den ersten Vorgipfel umrundete und in der dahinterliegenden Wildnis verschwand.
* Die 167 ursprünglichen Bewohner des Bikini-Atolls, die »zeitweise« ihre Heimat für die Tests der USA verlassen sollten, durften 1970 zurückkehren, nur um 1978 erneut evakuiert zu werden. Das Leben auf Kili, einem anderen zu den Marshallinseln gehörenden Atoll, auf dem viele von ihnen heute leben, ist schwierig; es gibt keinen natürlichen Hafen, und das Leben auf der Insel ist von immer extremer werdenden Gezeiten und Überflutungen bedroht. Der Außenminister der Marshallinseln erklärte, die Insel sei aufgrund des Klimawandels »unbewohnbar« geworden.
* Als Latham 2007 starb, wurde seine Asche in West Lothian verstreut, im Herzen der Niddrie Woman.
2 NIEMANDSLAND
Pufferzone — Zypern
Yiannakis Rousos kann von hier aus sein Haus sehen. Ich senke den Kopf, damit mein Blick seinem Fingerzeig folgen kann, über die Felder bis zu einem viereckigen zweigeschossigen Block, der allein unten am Meer steht. Das ist sein Elternhaus. Das Gebäude und das Land zwischen meinem Standort und der Küste, fast fünf Hektar, sind noch immer in seinem Besitz – zumindest auf dem Papier.
Früher waren hier überall Zitrusplantagen: Orangen, Grapefruits und Zitronen hingen schwer von den Zweigen, türmten sich in Körben. Seine Familie sei reich gewesen, erzählt er. Sie hätten alles gehabt. Und dann, von einem Tag auf den anderen, nichts mehr.
In den frühen Stunden des 20. Juli 1974 fiel die Türkei als Folge eines Militärputsches auf Zypern auf der Insel ein. Der Putsch stellte den Höhepunkt jahrzehntelanger Spannungen und gelegentlicher Gewaltausbrüche zwischen der zyperngriechischen und der zyperntürkischen Bevölkerung dar, und sollte mit Unterstützung der griechischen Junta die Enosis, also die Vereinigung Zyperns mit Griechenland, erzwingen.
Obwohl das plötzliche Auftauchen türkischer Truppen als »Friedensoperation« deklariert wurde, starben über dreitausend Menschen in den darauffolgenden schweren Kämpfen, und weitere Tausend, die bis heute als vermisst gelten, sind mutmaßlich ebenfalls tot. Mehr als ein Drittel der Insel wurde besetzt und ist es noch heute.
Während die türkischen Streitkräfte einen Landstrich nach dem anderen einnahmen, flohen 150 000 Zyperngriechen aus ihren Häusern, darunter auch die Familie Rousos. Sie rannten wortwörtlich um ihr Leben. Damals begriffen sie noch nicht, dass sie ihr ganzes Leben hinter sich ließen.
Zwei Tage nach ihrem Aufbruch, ihr Hof war immer noch voller türkischer Soldaten, kehrte Yiannakis’ Vater im Schutz der Dunkelheit allein zurück, schlich sich durch die ihm so vertrauten Orangenhaine, und verschwand zwischen den Bäumen, sobald Patrouillen in Sicht kamen. Heimlich huschte er ins Haus, suchte mit zitternden Fingern die wichtigsten Dokumente zusammen. Draußen im Hof waren außer einem Hund und einem einzigen Schwein alle Tiere tot.
Vier Wochen später wurde eine Waffenruhe ausgerufen und die türkischen Truppen stoppten ihren Vormarsch. Zur physischen Trennung der beiden Kriegsparteien richtete man eine streng überwachte entmilitarisierte Zone ein, die sich quer über die Insel erstreckt und die türkischen Truppen im Norden der Insel von den zyperngriechischen im Süden trennt. Dieser Korridor ist 180 Kilometer lang und zwischen dreieinhalb Metern und sieben Kilometern breit. Er schnitt Straßen ab, umschloss ganze Dörfer und teilte die Hauptstadt Nikosia in der Mitte. Er durchtrennte auch das Land der Familie Rousos, ihr Haus befand sich nun auf der anderen Seite.
In den folgenden Monaten sah die Familie aus der Entfernung zu, wie die Zitrusbäume, die sie so sorgsam gepflegt und bewässert hatten, vertrockneten und starben. Heute ist das Haus verfallen, das Land wird von türkischen Bauern zum Weizenanbau genutzt. Manchmal raube ihm diese Vorstellung den Schlaf, erzählt Yiannakis. Seite an Seite stehen wir direkt vor dem Niemandsland, der Pufferzone zwischen der Republik Zypern und der Türkischen Republik Nordzypern, die als Staat nur von der Türkei anerkannt wird, und von Yiannakis Rousos ganz eindeutig nicht. Drei Lagen eingerosteten Stacheldrahts versperren uns den Durchgang. Yiannakis nennt die Konstruktion, die sich von hier, der Ostküste, bis ganz in den Westen der Insel erstreckt, »den Zaun der Schande«.
Unweit von hier ragt ein zweigeschossiger Wachturm auf, von dem sowohl die griechische als auch die zypriotische Flagge wehen. Vielleicht hundert Meter weiter sein Gegenstück mit der türkischen Flagge und ihrem nordzypriotischen Negativ, dem roten Halbmond auf weißem Grund. Die Gebäude sehen aus wie zum Angriff bereit, im Innern sind die Schatten von Wachleuten zu sehen, die durch Ferngläser spähen. Die Soldaten werden bei Schichtwechsel ausgetauscht, doch die Abläufe sind immer dieselben, wie jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr seit 1974.
Seit 1974 warten die Menschen darauf, dass sie zu ihren Häusern und Grundstücken zurückkehren dürfen.
Mittlerweile sind die Mitglieder der Familie Rousos älter geworden, manche auch alt. Der Wandel ihrer Umstände – gestern wohlhabend, heute mittellos – hat sie alle schwer getroffen, besonders aber Yiannakis’ Mutter. Sie habe sich an das Leben als Flüchtling nicht gewöhnen können, »ohne Essen, ohne Geld, ohne Schuhe«. Sie habe unter der emotionalen Belastung sehr gelitten. Zeitweise sei sie im Krankenhaus gewesen. Auch deshalb, sagt Yiannakis, habe er nie selbst eine Familie gegründet. Er habe warten wollen, bis sie ihr Land zurückhätten. Auch heute könnte er mit einem solchen Grundstück in bester Lage, direkt an der Küste, wieder ein reicher Mann werden. Doch bis dahin, fügt er hinzu, »kann ich nicht mal in meinem eigenen Haus schlafen«.
Die Frühlingluft ist warm, eine Brise vom Meer streicht über die Felder. Wolken hängen bedrohlich am Himmel, der Himmel ist mit einem Mal hell und dunkel zugleich. Yiannakis pflückt im Garten des letzten zyperngriechischen Hauses vor dem Grenzzaun eine Orangenblüte; sie verströmt einen schweren, berauschenden Duft. Die Blüten hätten sich erst heute geöffnet, sagt er. Auf so etwas achtet man, wenn man auf einer Zitrusplantage aufgewachsen ist. Die Zitronenbäume sind schon schwer mit grünen Früchten beladen. Ich kann sie von hier aus riechen: frisch und sauber, wie ein Antiseptikum.
Wir wenden uns ab und gehen die Straße entlang, die an die Pufferzone grenzt. Streunende Katzen laufen uns voraus, das Fell verfilzt und nass. An dem Zaun, der uns am nächsten ist, prangen dreieckige rote Schilder, die in drei Sprachen vor Minen warnen. Damals habe er geglaubt, sie würden am selben Nachmittag zurückkehren, sagt Yiannakis. Bald musste er seiner Erwartungen revidieren: Vielleicht würde es doch ein paar Wochen dauern. Oder Monate. Seitdem sind fünfundvierzig Jahre vergangen. »Vielleicht«, sagt er mit einem beinah amüsierten Gesichtsausdruck, »erzähle ich diese Geschichte in zwanzig Jahren immer noch.«
Was als Notlösung in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen begann – eine verzweifelte Maßnahme zur Wiederherstellung des Friedens, ein Abstraktum, das mit grünem Stift auf eine Karte gezeichnet wurde, hat sich nun unauslöschlich in die Struktur des Landes gegraben. Rebecca Solnit schrieb einmal über »das Blau der Ferne«, die Farbe der sich in Schichten zum Horizont erstreckenden Hügel. Dann ist dies wohl das Grün der Zeit. Das Grün, das aus dem Nichts erwächst, aus allem, wenn man es lang genug in Ruhe lässt. Zuerst erscheint es in der Form von Schimmelpilzen. Ein grünlich-grauer Überzug, manchmal mit senfgelbem Stich, das Grün des Verfalls. Doch dann wächst es immer weiter und zeigt sich in der leuchtenden Palette neuen Lebens, in Blattgrün, Lindgrün, dem Grün junger Triebe.
Mit der Zeit machte sich dort, wohin kein Mensch gehen kann, ohne eine Verhaftung oder einen gewaltsamen Tod zu riskieren, anderes Leben breit. Kapuzinerkresse schoss in Kringeln durch den rissigen Asphalt. Kakteen rankten von Balkonen. Palmen wuchsen mitten aus der Straße. Bäume und Sträucher erschienen hier und da, dürr und in großem Abstand, und verdichteten sich dann, vereinten ihre Kräfte. Sie alle sind eine tickende Stoppuhr, sie messen die in einem blutigen Patt verstreichende Zeit.