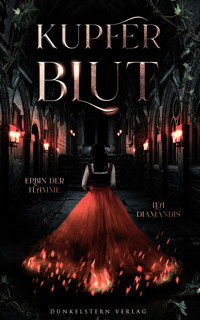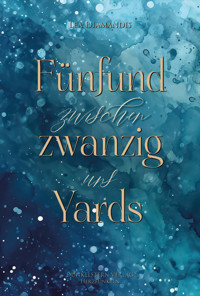Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dunkelstern Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon als Kind habe ich mich in Melodien geflüchtet, wenn ich drohte, mich selbst zu verlieren. Ihr Zauber ist nicht verblasst, als ich erwachsen geworden bin. Als Lucies Zwillingsbruder bei einem Autounfall ums Leben kommt, an dem sie sich die Schuld gibt, zerbricht ihr gemeinsamer Traum von einer Musicalkarriere. Sie schwört sich, nie wieder zu singen. Die Stille in ihr übertönt die Beziehungen zu den Menschen, die ihr nahestehen. Als sie die Musical-Studentin Chiara kennenlernt, bekommen ihre Mauern immer mehr Risse. Vielleicht braucht sie nur eine Person, die ihr erste Noten vorgibt, um ihren Takt wiederzufinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright 2024 by
Dunkelstern Verlag GbR
Lindenhof 1
76698 Ubstadt-Weiher
http://www.dunkelstern-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Lektorat Mitternachtsfunke
Korrektorat: Michelle G.
Cover und Satz: Bleeding Colours Coverdesign
ISBN: 978-3-98947-034-7
Alle Rechte vorbehalten.
Für alle, die schon einmal jemanden verloren haben, und für alle, die einen Teil von sich selbst in der Musik wiedergefunden haben.
Inhalt
Content Notes
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Nachwort
Content Notes
Content Notes
Dieses Buch nutzt Inhalte, die bei einigen Leserinnen und Lesern Unwohlsein hervorrufen oder eventuelle persönliche Trigger darstellen könnten. Eine genaue Auflistung der inbegriffenen Themen bzw. Szenen ist am Ende dieses Buches zu finden, da sie explizite Spoiler zur Geschichte enthält.
Kapitel 1
Taylor Swift – The Lucky One (Taylor’s Version)
Juli
»Vertraue auf dein Können«, formen die Lippen meines Spiegelbildes. Unter der Schicht Lippenstift gleichen sie einer geschlossenen Rosenblüte. »Das ist nicht deine erste Hauptrolle, und es wird nicht deine letzte sein.« An den Rändern splittert die Farbe, nimmt die Illusion der Blüte mit sich. »Du wirst sie umhauen«, wispere ich, während ich das Rosenrot nachbessere.
»Sprichst du mit dir selbst?«
Der Klang der von Amüsement gefärbten Stimme lässt mich zusammenzucken. Der Lippenstift entgleitet mir und fällt auf den Schminktisch. Mein Herzschlag beruhigt sich. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn eine Zickzacklinie mein Make-up verunstaltet hätte. Einen Moment für mich zu haben, in dem ich es nachbessere, beruhigt mich vor Aufführungen.
Oliver ist im Spiegel hinter mir aufgetaucht. Er trägt einen viktorianischen nachtschwarzen Anzug mit ausgestelltem Kragen und über dem Hemd in der Farbe von Rabenfedern eine rostrote Samtweste mit Stickereien, die wie Herbstlaub aussehen. Die als unzähmbar geltenden honigblonden Locken sind streng zurückgekämmt, Haargel hält sie in Form. Charlie würde behaupten, Oliver sähe aus, als wolle er alle, die ihm begegnen, zu einem vornehmen Dinner einladen. Wären da nicht die Lederhandschuhe in der Farbe des Anzuges, welche einen silbernen Gehstock umklammern. Gemeinsam mit der ikonischen weißen Maske, unter welcher die rechte Hälfte seines Gesichts erstarrt ist, verwandeln sie den viktorianischen Gentleman in das Phantom der Oper.
Nur, dass die bernsteinfarbenen Augen dieses Phantoms funkeln, was sich bis zum Mund ausbreitet.
»Du hättest beinahe mein Make-up zerstört.« Mein Spiegelbild verzieht das Gesicht. »Alexis hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie mich neu schminken müsste, und ich auch, wenn ich zu spät zu unserer letzten Aufführung komme.«
Er legt den Kopf schief. »Wie wäre es, wenn du dein Make-up nicht vor jeder Aufführung selbst erneuerst, um das zu verhindern?«
Ich schnaube. »Ich bin deine ältere Schwester, ich sollte dir Ratschläge geben. Nicht umgekehrt.«
»Stimmt.« Um seine Mundwinkel zuckt es. »Die fünfzehn Minuten haben dir sicher viel Lebenserfahrung verliehen.«
Das eiserne Band um meine Brust bleibt. Ich senke die Schultern, widerstehe dem Impuls, mir auf die Lippe zu beißen. Das macht die Make-up-Situation nicht besser. »Mein Make-up zu erneuern, beruhigt mich. Ich wollte mir ein wenig Mut zusprechen.«
Oliver legt eine behandschuhte Hand auf meine nackte Schulter, neben den Spaghettiträger meines Kleides. Kühles Leder auf meiner bloßen Haut lässt mich frösteln.
Das erste Kostüm von Christine Daaé, der Protagonistin aus Das Phantom der Oper, ist für meinen Geschmack zu freizügig. Unbehaglich zupfe ich den Rock aus samtenen smaragdgrünen und rubinroten Fäden zurecht. Oben ist das Kleid tief ausgeschnitten, betont jede Andeutung einer Rundung und der längsgestreifte Samt klebt an meiner Haut. Schmucksteine im Gewand von Gold, Rubinen und Smaragden sind auf den Saum gestickt und spiegeln sich in der Krone, die meine honigblonden Locken zurückhält.
Die Hauptrolle in Das Phantom der Oper zu verkörpern ist mein Traum gewesen, seit ich das Musical zum ersten Mal besucht habe. Die Holzscheite der Liebe für ein Leben auf der Bühne hat mir meine Großmutter in die Wiege gelegt. Ihre Erzählungen, der elfenbeinfarbene Flügel in ihrem Wohnzimmer, an dessen Wänden unzählige Plakate von Musicals prangen, in denen sie die Hauptrolle gespielt oder Regie geführt hat, und mein erster Musicalbesuch haben das Feuer entzündet. Erst in mir, bevor es auf Oliver übergesprungen ist. Das Phantom der Oper ist eine Hommage an Musicals. Beim Gedanken daran, im Flutlicht zu baden und in schemenhafte jubelnde Gesichter zu blicken, während ich das namensgebende Stück singe, erfüllt mich ein Kribbeln bis in die Fingerspitzen.
Olivers Spiegelbild runzelt die Stirn, was mit der Maske so unweigerlich komisch aussieht, dass das Pokerface meines Spiegelbildes unter einem Lachen zu Scherben zerspringt. »Du brauchst keinen Mut, Lucie. Dein Auftritt als Christine Daaé wird das grande finale deiner Karriere in unserer Musicalgruppe.«
Ein Anflug von Wärme steigt in mir auf. Die Sehnsucht nach dem Flutlicht füllt jeden Winkel meines Seins aus. Ich bin der Stern, die Bühne mein Orbit, wir gehören zueinander und es wird mich auf ewig zu ihr hinziehen. »Ich habe gerade zu mir selbst gesagt, dass ich alle umhauen werde. Wie Christine, als sie ihre erste Hauptrolle spielt.« Ich zwinkere ihm zu. »Das Phantom, das mich ermutigt, ist anders als ihres zum Glück weniger unheimlich.«
Oliver entschlüpft das vertraute Lachen, welches mich mein Leben lang begleitet. Der Ton von Aufwind, in den ich mich mit ausgebreiteten Flügeln fallenlassen kann – er wird mich halten. »Für immer.« Er legt mir einen Arm um die Schultern. »Unsere Musicalgruppe wird ihre zwei aufsteigenden Sternschnuppen verlieren. In Hamburg an der Musical Akademie leuchten wir gemeinsam weiter.«
Ich ziehe eine schmalgezupfte Augenbraue in die Höhe. »Bist du dir sicher, dass du nicht Drehbuch studieren solltest?«
Er schmunzelt. »Auf der Bühne zu stehen, schließt das Schreiben von Drehbüchern nicht aus. Wenn unsere Zeit im Rampenlicht vorbei ist, arbeiten wir hinter den Kulissen, wie grand-mère Marie.«
Seine Worte verwandeln mein Herz in einen Schmetterling im Marmeladenglas, der panisch mit den Flügeln schlägt. Bei dem Gedanken, nie mehr Scheinwerferlicht auf meiner Haut zu spüren und von den Wellen tosenden Applauses davongetragen zu werden, fühle ich mich eingesperrt und verloren. Als würden die Glaswände näherkommen, bis ihre scharfkantigen Splitter meine Flügel brechen, und als sei das Glas zeitgleich unendlich wie das Universum, in dem ich als zielloser Meteor umhertreibe. Mein Platz in der Welt ist auf der Bühne. Ihn zu verlieren würde bedeuten, mich selbst zu verlieren.
Manchmal habe ich Albträume. Schiefe Töne. Aufbrandendes Lachen. Stürze von der Bühne. Das Brechen von Knochen. Grellen Straßenreklamen gleich flackern die Bilder in meinem Kopf auf. Ein Echo aus Lachen und bedauernden Worten, dass ich nicht mehr auf der Bühne stehen könne, verdichtet sich zu einem Dröhnen hinter meinen Schläfen.
Ich vergrabe meine rosenrot lackierten Fingernägel in den Handflächen, ein Stechen verankert mich im Jetzt. An einem Punkt in der Zeit, an dem die Körner in der Sanduhr erst zu fallen begonnen haben. Die Frau im Spiegel, die meinen Blick auffängt, hat ihr Abitur mit 1,2 bestanden und das Vorsprechen an der Musical Akademie mit Bravour gemeistert.
Nach meiner Zeit auf der Bühne werden mir Türen offenstehen. Grand-mère Marie hat, gemeinsam mit ihrem besten Freund Nicolas, unsere Musicalgruppe ins Leben gerufen. Marie Chevalier, die ehemalige Musicaldarstellerin, die Paris gegen Hamburg und die Großstadt gegen ein Leben auf der Insel getauscht hat. Nicht umsonst folge ich ihren Fußspuren – ihr Weg endete nicht, als der letzte Vorhang gefallen ist.
Dennoch verblassen die Albträume nicht. Sie lauern in den Ecken, welche die Lampe über dem Schminktisch nicht erhellt, jederzeit bereit, meine Welt in Dunkelheit zu tauchen.
Ich zwinge meine Atmung zur Ruhe und fokussiere mich auf das Licht, nicht auf die tintenschwarzen blinden Flecken dazwischen. An eine Zeit, in der mein letzter Vorhang fällt möchte ich frühestens in fünfundzwanzig Jahren denken.
»Ist alles in Ordnung?« Oliver drückt mich fester an sich.
Mir wird mein Zittern bewusst. Ich straffe die Schultern, spanne alle Muskeln an. »Ich bin traurig, dass es unsere letzte Aufführung auf Fehmarn ist, umgeben von bekannten Gesichtern. Nächstes Jahr um diese Zeit schauen wir Emily bei ihrem grande finale vom Zuschauerraum aus zu.« Mein Blick gleitet an Christines spärlichem Rock herunter, ich rümpfe die Nase. »Außerdem ist Juli und ich friere.«
Eine Falte bildet sich auf der freigelegten Gesichtshälfte zwischen seinen Augenbrauen. Wir sind ein Doppelstern – wir leuchten und verglühen zusammen, er kennt mich zu gut, möchte sicher nachfragen, welcher Schatten mein Licht schluckt.
Ich springe so schnell auf, dass mir schwarz vor Augen wird. Olivers Hand auf meiner Schulter hindert mich daran, mit dem Samtteppich Bekanntschaft zu machen. »Lass uns gehen.«
Seufzend betrachtet er mich von Kopf bis Fuß, resigniertes Begreifen tritt in seinen Blick. Er hält mir den Arm hin. »Kommen Sie, Mylady.«
Ich hake mich bei ihm unter, wir verlassen den Ankleideraum.
Im Backstagebereich erwartet uns ein Ozean aus Geräuschen. Aufgeregtes Murmeln schwappt über mich hinweg. Ausgestellte viktorianische Kleider in blassem Champagner, Anzüge aus Samt mit passenden Hüten und Spiegelbilder meines Kostüms vermischen sich zu einem Meer aus fließenden Stoffen. Aufregung vibriert in der Luft, ich atme sie ein, drücke den Rücken durch, hebe das Kinn, trage meine Krone mit Würde – hier bin ich zuhause.
Eiswasser flutet meine Adern. Ein letzter fallender Vorhang, danach werde ich die zweite Familie, welche unsere Musicalgruppe mir geschenkt hat, gegen eine andere eintauschen. Die hölzerne Bühne auf Fehmarn mit überschaubarem Zuschauerraum gegen eine dreimal so große.
Schokoladenbraune Augen suchen meinen Blick, ehe sie an Oliver haften bleiben. Emily bahnt sich mit ausgestreckten Ellbogen einen Weg durch die Menge. Eine prunkvolle, rubin- und smaragdbesetzte Krone thront auf ihren nachtschwarzen, zu sanften Wellen aufgedrehten Haaren. Die Version eines echten Kleides meines Kostüms schmiegt sich an ihren Oberkörper und endet in einem Glockenrock. Ornamente in Gold, Smaragdgrün und Rubinrot zieren den Brokatstoff.
Ein Strahlen breitet sich auf Olivers Zügen aus. Er beugt sich zu Emily hinab, um ihr einen Kuss auf den Haaransatz zu drücken. Ihr Make-up möchte er im Gegensatz zu meinem wohl nicht ruinieren. »Du siehst wunderschön aus.«
Sie macht einen Knicks. »Du siehst auch nicht schlecht aus.« Ihre Aufmerksamkeit huscht zu mir, ein schelmisches Lächeln biegt ihre Lippen. »Dein Kostüm ist etwas knapp.«
»Nach meinem ersten Auftritt tausche ich es gegen eines, das deinem ähnelt«, erinnere ich sie, die Stimme gefärbt von grimmiger Belustigung. »Carlotta wird nie dazu kommen, die Hauptrolle zu spielen, das ist Christines Part.« Ich streiche den Stoff meines Oberteils glatt. »Sie weiß es noch nicht.« In der Hinsicht sind unsere Rollen aus Das Phantom der Oper ein Spiegel. Am Ende spiele ich die Hauptrolle. Anders gewöhnt bin ich es nicht. Ich muss Emily nicht in den Schatten drängen, der Platz im Rampenlicht gehört mir.
Olivers feste Freundin ist ein Jahr jünger als wir und zwei Jahre nach uns Teil der Musicalgruppe geworden. Sie ist herausragend, ich bin sensationell. Sobald mein letzter Akt vorbei ist, wird sie aus meinem Schatten ins Scheinwerferlicht treten – nicht länger meine Zweitbesetzung und die zweitwichtigste weibliche Rolle.
Sie drückt den Rücken durch. »Zum Glück ist dies der letzte Abend, an dem ich dir das Rampenlicht überlasse.«
Ich hebe eine Hand zum Schwur. »Ich verspreche, dass du danach nie wieder in meinem Schatten stehen musst.«
Sie schlägt ein, Goldreflexe glimmen in ihren Augen auf.
»Außer es verschlägt dich noch einmal auf dieselbe Bühne wie mich«, füge ich mit gesenkter Stimme an. »Dann garantiere ich für nichts.«
Ihr fällt das Lächeln aus dem Gesicht, sie zieht die Hand zurück, als hätte sie sich an mir verbrannt. »Es war klar, dass du mir nicht einfach so das Feld überlässt.« Das Zucken ihrer Mundwinkel straft die gespielte Ernsthaftigkeit Lügen.
»Nicht im Traum.«
Die Aussicht, Emilys und meine freundschaftliche Rivalität nicht zu verlieren, spendet der bevorstehenden Düsternis einen Strahl Sonnenlicht. Ich schließe sein Leuchten in meinem Herzen ein. Für die Aufführung und den Moment, in dem mein neues Leben in einer fremden Stadt beginnt.
Links neben mir taucht ein vertrautes Gesicht auf, Maurice‘ nussbraune Augen sind von den Kontaktlinsen leicht gerötet, dahinter funkelt dieselbe Aufregung, welche mein Herz zu rasenden Schlägen antreibt. Ein schwarzer samtener Anzug hebt sich von seiner dunkelbraunen Haut ab, sein Haar ist so millimeterkurz geschoren, dass kein Haargel der Welt es in eine andere Form hätte bringen können.
»Bereit für den letzten großen Auftritt?«
Oliver nickt seinem besten Freund zu. »Mehr als das.«
»Ich auch.« Das Vibrato meiner Stimme erzählt eine andere Geschichte. Ich streiche mein faltenfreies Oberteil glatt, als könne ich die Wogen meiner Gedanken auf dieselbe Art glätten.
Ein ernster Zug spielt um Emilys Mund. »Zum Glück bleibst du mir nächstes Jahr erhalten, Maurice.«
Er reibt sich den Nacken. »Vorausgesetzt, ich habe während des FSJs im Kindergarten genug Zeit für die Proben.«
Sie schnappt nach Luft. »Mach mir keine Angst.«
Eine mit goldenen Ringen besetzte Hand gleitet auf meine Schulter. Marie Chevalier betrachtet mich prüfend, als sei ich nicht ihre Enkelin, sondern ein Kleid, bei dem sie unsicher ist, ob sie es kaufen möchte. Mit angehaltenem Atem versinke ich in winterblauen Fluten, bis ein Anflug von Stolz in ihren Blick tritt. »Tu es prête, ma chérie.«
Mein Herz flattert gegen den Käfig meiner Rippen. »Je ne te décevrai pas«, bringe ich atemlos hervor.
Sie macht eine wegwerfende Handbewegung. »Pas de fausse pudeur.« Ohne mich loszulassen, wendet sie sich Oliver zu, dessen Gesichtsfarbe der Maske in Sachen Blässe in nichts nachsteht. »Tu es prêt aussi.« Ihr wachsamer Blick huscht zwischen uns hin und her. »Je vous souhaite du succès.«
Mit diesen Worten rauscht sie in ihrem schwarzen Abendkleid davon.
Emily schnaubt. »Wieso muss sie mit euch immer Französisch sprechen?«
Oliver grinst. »Das stört dich, weil du kein Wort verstehst.«
Ich stupse ihn in die Seite. »Vermutlich möchte sie dich an deine Wurzeln erinnern, weil sie es Mama nicht verzeiht, dass keiner deiner Vornamen französisch ist.«
Er zuckt die Schultern. »Oder es ist ein Automatismus, weil wir zu Hause mit Mama und ihr Französisch sprechen. Damit meine ich uns beide, nicht Charlie.«
»Charlie spricht kein Französisch, aber sie versteht es«, werfe ich mit weicher Stimme ein.
»Alle herhören!«, schallt die Stimme von Nicolas über das Gemurmel hinweg und setzt allen Unterhaltungen ein Ende. Wir machen dem Produktionsleiter und meiner Großmutter Platz, in einem Halbkreis stellen wir uns um sie herum auf. In seinem schwarzen Anzug ist Nicolas kaum von einigen Darstellern zu unterscheiden. Er ist auf Fehmarn geboren worden und nach seiner Zeit als Musicaldarsteller auf die Insel zurückgekehrt, um unsere Musicalgruppe zu gründen. Dekaden überdauern, was mir ein Gewicht vom Herzen nimmt – die Musicalgruppe bleibt meine Familie, obschon uns bald die Ostsee voneinander trennen wird. »Das ist nicht nur die letzte Aufführung unseres dynamischen Duos, Lucie und Oliver Chevalier«, wenn Nicolas‘ Emotionen die Oberhand gewinnen, nutzt er immer Alliterationen. Mit glasigem Blick bedenkt er Oliver und mich, ein Kloß in meinem Hals erschwert das Atmen, »es ist eine der aufwendigsten Produktionen, die es auf dieser Bühne jemals gegeben hat, nachdem die Stadt uns freundlicherweise Sponsorengelder zur Verfügung gestellt hat. Seit einem dreiviertel Jahr arbeiten wir auf den heutigen Abend hin.« Wie in Zeitlupe gleitet sein Blick durch die Menge, als wolle er präzise überprüfen, ob jeder Schmuckstein an den Kostümen und jede Haarlocke am richtigen Platz sind. »Ich weiß, dass die heutige Aufführung großartig werden wird.«
Grand-mère Maries Augen funkeln, wie von Scheinwerfern angestrahlt. »Enttäuscht mich nicht.«
Aufgeregtes nach Luft schnappen, erklingt.
Ein mattes Lächeln kräuselt ihre Lippen. »Das werdet ihr nicht, dafür habe ich in den Proben gesorgt.«
»Hals und Beinbruch«, sagen Marie und Nicolas wie aus einem Munde.
»Hals und Beinbruch«, echoen wir ihre Worte.
Einem Fluss, der von einem Stein aufgehalten wird, gleich trennt sich die Menge. Das Orchester und alle Darstellerinnen und Darsteller, die Teil des Prologs sind, betreten die Bühne.
Seichte Klavierklänge sickern durch den geschlossenen roten Samtvorhang und vermischen sich mit Streichern in tiefem Moll. Die Musik knistert wie Strom in meinen Adern, je spannungsgeladener und mysteriöser sie wird, desto schneller schlägt mein Herz.
Während einer Aufführung fließt die Zeit anders. Meine Metamorphose stoppt den Fall der Körner im Stundenglas, und ich streife das Kleid einer anderen Frau über, sobald das Scheinwerferlicht meine Haut berührt. Entlässt es mich aus seinem Griff, zerreißt es im Angesicht der Wirklichkeit, zerbrechlich wie der Staub auf Schmetterlingsflügeln und doch kraftvoll wie ihre Flügelschläge – so fühlen sich die Momente auf der Bühne an.
»Ihr schafft das«, flüstert Oliver am Rande meines Bewusstseins.
Feingliedrige Finger gleiten zwischen meine, Emily. »Bist du bereit, mir ein letztes Mal die Show zu stehlen?«
Ich lehne meine Schulter gegen ihre, ziehe Kraft aus ihrer Nähe. »So was von.«
Sie lässt mich los, ich schwebe über den Boden, nicht länger unsicher in dem freizügigen Kostüm, und nehme meine Position auf der Bühne ein.
Als die ersten Töne erklingen und mein letzter Vorhang nach oben gleitet, bin ich angekommen.
***
Applaus brandet durch die Menge und erfüllt mich mit warmem goldenem Glück. Olivers und Maurice‘ Hände, die mit meinen verflochten sind, sind schweißnass. Scheinwerferlicht verwandelt das Publikum in ein Meer aus dunklen Schemen. Der Applaus gilt nicht meiner Rolle, sondern Lucie, die auf der Bühne gar nicht existiert. Dennoch atmet sie, nachdem sie alle Soprantöne getroffen und die Aufführung mit Bravour gemeistert hat, die Freude der Menge ein wie ihr Lebenselixier.
Ich wende mich Oliver zu, er scheint das zu spüren, unsere Blicke verschmelzen miteinander. Unter der Maske breitet sich ein Strahlen auf seinem Gesicht aus, er sieht genauso euphorisch aus, wie ich mich fühle.
»Das war ein würdiges grande finale für dich«, formen seine Lippen.
»Für uns.«
Nacheinander werden alle, die bei der Aufführung mitgewirkt haben, nach vorne gebeten. Angefangen bei dem Team, welches für das Bühnenbild zuständig gewesen ist, über die Kostüme, die Technik, das Orchester und schließlich die Darstellerinnen und Darsteller.
Mich bitten sie als vorletzte, nach Maurice und vor Oliver, an ihre Seite. In dem cremeweißen bodenlangen Rüschenkleid gleite ich über den Boden, mache einen Knicks, und der Applaus dröhnt mir im Takt meines Herzschlags in den Ohren. Wie die Musik meiner Träume, die allesamt wahr geworden sind.
Grand-mère Marie nimmt meine Hand, als wolle sie der Welt zeigen, dass ich ihre Enkelin bin, die als würdige Nachfolgerin in ihre Fußstapfen tritt; jetzt, da ihre Füße nicht mehr zu klein sind, um diese auszufüllen. Ihr Gesicht ist von weißem Licht umgeben, ihre Augen gleichen einer sternenklaren Winternacht. Wohlige Wärme, wie ein Kaminfeuer beim Nachhausekommen, rieselt durch meine Adern. Nie habe ich die Frau, die mir alles beigebracht hat, stolzer gesehen.
Als ich in zahlreiche von demselben Stolz erfüllten Gesichter blicke, sehe ich keine Menschen, von denen ich mich bald verabschieden muss. Sondern eine Familie, die Spuren in mir hinterlassen hat, die für immer bleiben.
Nachdem der Applaus abgeklungen ist, führen uns Nicolas und grand-mère Marie hinter die Bühne.
Letztere zieht mich, kaum sind wir stehengeblieben, in eine Umarmung, und ich atme den herben Duft ihres Parfums ein. »Je suis fière de toi«, flüstert sie mir ins Ohr.
Unsere Blicke finden einander, ihrer ist unendlich, wie ein sternenklarer Winterhimmel voller Silberlichter, mein wortloser Dank ist angekommen.
Ein Crescendo aus Schritten nähert sich uns, wir lösen die Umarmung. Angehörige aller Mitwirkenden strömen in den Backstagebereich.
Charlie erreicht mich als Erste, denselben von Silberperlen bestickten winterblauen Samt wie grand-mère Marie in den Augen. Schokoladenbraune Locken umfließen ihre geröteten Wangen, und ich komme nicht umhin zu schmunzeln. Sie hat unsere Eltern überredet, dass sie ein T-Shirt mit Cover des Albums Imaginaerum von Nightwish mit einem rot-schwarz karierten Rock tragen darf – bei einer Musicalaufführung, während der die meisten Abendgarderobe tragen. »Ihr wart großartig!«
Ich breite die Arme aus, sie schlingt die ihren um mich. Wehmut wallt in mir auf, jedes Jahr muss ich mich weniger hinunterbeugen, irgendwann ist sie so groß wie ich. Die Umarmung zerknittert das schneeweiße Rüschenkleid, dessen Stoff sich von jenem ihres T-Shirts abhebt. Licht und Schatten, ein rhythmischer Viervierteltakt und ein unregelmäßiger Fünfvierteltakt – Melodie und Gegenmelodie, die dank ihrer Verschiedenheit ein wohlklingendes Lied ergeben.
Ich streiche ihr durch die Locken. »Nicht so großartig wie du auf dem Hockeyfeld.«
Ich lasse Charlie los, ein Strahlen zeichnet ihre Züge und offenbart die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen. Sie wendet sich von mir ab, mit vorgeschobener Unterlippe sieht sie Oliver an. »Darf ich die Maske aufsetzen?«
Ihre beste Freundin Sophie taucht hinter ihr auf, die türkisblauen Augen funkeln, und sie stellt sich auf die Zehenspitzen. »Ich auch? Bitte!«
Oliver schaut die beiden perplex an, was mir ein Lachen entlockt. So haben sie mich letztes Jahr belagert, getrieben von der Überlegung, ob sie mit Mary Poppins‘ Regenschirm fliegen können.
Charlie hat das musikalische Gen nicht geerbt. Außer es geht darum, die Musik ihrer liebsten Bands so laut aufzudrehen, dass sich die ganze Nachbarschaft daran erfreut. Dafür ist sie die treffsicherste Angreiferin im Feldhockey, die ich kenne. Für Requisiten und Kostüme ist sie immer zu haben. Wie Sophie, die ihr auf dem Hockeyfeld als Frontstopperin den Rücken freihält.
»Carla Marie Chevalier, un accessoire n’est pas un jouet!«, mahnt grand-mère Marie.
Charlie zieht die Nase kraus. »Nenn mich nicht Carla.«
Sie stemmt die Hände in die Hüften. »Ich verstehe nicht, was du gegen den Namen deiner Urgroßmutter hast. Es sollte dir eine Ehre sein, dass Monique dich nach ihr benannt hat.«
»Lucie!«
Mamas Stimme lässt mich herumwirbeln. Tränenperlen glitzern in ihren Wimpern, und sie zieht mich in eine Umarmung, die alle Luft aus meiner Lunge quetscht. »Du hast atemberaubend gesungen, und ich dachte, Christine Daaé sei zum Leben erwacht.« Sie zieht sich ein Stück zurück und umfasst mein Gesicht. »Ich bin stolz auf dich.«
Ihre Worte verschlagen mir den Atem und besprühen meine Augen mit Nebel. Das Phantom der Oper ist das liebste Musical meiner Eltern. »D-danke«, stammle ich.
Papa legt mir eine Hand auf die Schulter, hinter der runden Brille schimmern auch in seinen Augen Tränen. »Ich stimme deiner Mutter zu. Deine Großeltern auch, sie warten draußen, hier ist ihnen zu viel Trubel.«
Mama löst sich von mir, damit ich ihn ebenso fest in die Arme schließen kann.
Goldenes Glück flutet meine Adern. Für den Stolz meiner Familie würde ich jeden Applaus eintauschen.
Papa wendet sich Oliver zu, der Charlie und Sophie erklärt, wieso es keine gute Idee ist, die Maske aufzusetzen. Mama versucht, ihre Mutter mit einem Gespräch abzulenken – ohne Erfolg, sie beäugt die Mädchen mit skeptischer Miene.
Mary Poppins‘ Regenschirm haben sie letztes Jahr nicht zerstört, und sie kommen nächste Woche in die sechste Klasse. Mit der Maske würden sie vorsichtig umgehen.
Eine Hand auf meinem Oberarm hindert mich daran, es auszusprechen, ich drehe mich um und schaue in Simons sturmgraue Augen hinter seiner Brille. »Ich werde es vermissen, jedes Jahr zu euren Aufführungen zu kommen.«
Ich hebe eine Augenbraue. »Das heißt, es war ein würdiges Finale?«
Er zieht mich in seine Arme. »Auf jeden Fall. Ich bin stolz auf dich.«
Meine Augen brennen, ich blinzle gegen die Tränen an. Fokussiere mich nicht darauf, dass dieser Vorhang zum letzten Mal für mich gefallen ist, sondern auf die Bühnen, welche auf mich warten. »Nächstes Jahr gehen wir zu der Aufführung, bei der Emily ihren größten Auftritt hat, und du besuchst Olivers und meine erste Aufführung, die vor einem größeren Publikum stattfindet.«
Er löst die Umarmung, schüttelt schmunzelnd den Kopf. »Wer wäre meine beste Freundin, wenn sie nicht ständig von hohen Zielen umgetrieben wird?«
»Nicht mehr sie selbst«, erwidere ich, und atme das aufgeregte Summen der vertrauten Stimmen und das abklingende Adrenalin in der Luft ein letztes Mal ein. Dieser Augenblick ist in meine Seele eingeschrieben, und wird mich begleiten, wenn Oliver und ich in unsere Wohnung in Hamburg ziehen.
Umringt von den Menschen, die mir am wichtigsten sind, fühle ich mich nicht länger, als bedeute mein letzter fallende Vorhang auf dieser Bühne das Ende der Welt. Mein grande finale ist erst der Anfang.
Kapitel 2
Taylor Swift – Bigger Than The Whole Sky
Nachdem der Trubel Backstage vorbei gewesen ist, haben wir uns umgezogen und mit Champagner und Orangensaft auf die phänomenale Aufführung angestoßen. Anschließend sind Oliver, Emily, Simon, Maurice, dessen fester Freund Lukas und ich zur ruhigen Steilküste in Wulfen gefahren. Wir lassen den Abend ausklingen, mit gerösteten Marshmallows, Stockbrot und Getränken – Mischbier für Emily, Oliver und Lukas, Cola für Simon, Maurice und mich. Wir müssen fahren, und ich bin gerne Herrin meines Verstandes, Alkohol trinke ich nicht.
Im Gegensatz zu dem Rüschenkleid spüre ich den Stoff meines elfenbeinfarbenen Sommerkleides kaum, über dem ich eine hellblaue Jeansjacke trage. Meine Zehen sind in dem noch leicht erwärmten Sand vergraben, die weißen Riemchensandeln stehen neben mir. Seichter Wind braust die Ostsee auf und spielt mit meinen Locken. Marshmallow- und Lippenstift-Reste kleben an meinem Mund.
Nach Sommerabenden wie diesen sehne ich mich im Winter, wenn sich Eiskristalle und Sand aneinanderreihen wie Perlen an einer zerrissenen Schnur. Die Sonne schmilzt in der Ostsee und färbt die Schaumkronen der aufsprudelnden Wellen in zartem Sommerorange, Magenta und Goldgelb. Dieselben Muster zerreißen den Himmel, die ersten Sterne besticken den nachtblauen Samt mit Nadelspitzen in strahlendem Silber.
Zwischen uns knistert ein Lagerfeuer, die Funken tanzen durch die Luft. Unsere Gesichter konturiert das Flammenleuchten in diffusem Schein und gibt ihnen etwas Unwirkliches, als würden wir gemeinsam denselben Traum von einem nie endenden Sommer träumen.
Gedankenverloren drehe ich mein Stockbrot im Feuer, der Teig färbt sich goldbraun. »Das fühlt sich unwirklich an«, murmele ich.
Oliver sitzt neben mir, einen Arm hat er um Emily geschlungen, auf deren goldbrauner Haut das Feuer filigrane Muster zeichnet. »Bis unser Studium im Oktober anfängt, haben wir alle Zeit der Welt.« Sein Blick schweift zum Horizont. Mit ihren Zacken ribbeln die Sterne die letzten zarten Fäden des Sonnenuntergangs auf. Silbernes Licht ergießt sich über uns. »Wir können tun und lassen, was wir wollen.«
Seufzend schmiegt sich Emily an ihn. »Ich habe eine Woche Sommerferien, bevor ich mich in das Abenteuer des dreizehnten Schuljahres stürzen muss.«
Maurice lächelt ihr aufmunternd zu. »Dafür warst du in den Ferien mit Lucies und Olivers Familie in Los Angeles, und die Aufführung war großartig. Die Erinnerungen nimmt dir niemand.« Seine Stirn kräuselt sich. »Trotzdem weiß ich, wie du dich fühlst. Vor einem Jahr hat sich mein FSJ endlos weit entfernt angefühlt, nächste Woche beginnt es.«
Simon fährt sich durch das dunkelblonde Haar. »Genau wie meine Ausbildung.« Diese wird er in einer Agentur für Webdesign in Oldenburg absolvieren.
Ich ziehe mein Stockbrot aus der Glut und drücke auf den goldbraunen weichen Teig. »Ich kann es kaum erwarten, wenn Olivers und mein Studium beginnt.«
Emily verdreht die Augen. »Du bist zu ungeduldig. Selbst dein Stockbrot isst du roh, wir sind nicht schuld, wenn du morgen Bauchschmerzen hast.«
»Roh schmeckt es am besten.« Ich nehme einen Bissen – außen knusprig, innen weich.
Ihr Lachen schwebt auf den lauen Böen davon.
»Das Abenteuer dreizehnte Klasse wirst du meistern«, verspricht Oliver Emily und drückt ihr einen Kuss auf die dunklen, mit der Nacht verschmolzenen Strähnen.
»Hoffentlich …« Ihre Stimme bebt, wie die Wellen unter dem Säuseln des Nachtwindes. »Ich möchte mir nicht vorstellen, dass wir uns bald nur an den Wochenenden sehen.«
»Nächstes Jahr ziehst du zu Lucie und mir nach Hamburg, und es bleiben drei Monate bis zu unserem Studienbeginn. Wenn die Schule anfängt, haben wir die Nachmittage für uns.«
Wortlos überbrückt Emily die Distanz zwischen ihnen, um ihn zu küssen.
Strömungen widersprüchlicher Emotionen prallen in meinem Inneren aufeinander. Sollte ich froh sein, keine feste Freundin zu haben und somit nicht die Aussicht auf eine Fernbeziehung? Wehmütig? Erleichtert, dass ich in einem Jahr eine Wohnung für mich habe, wenn Emily und Oliver zusammenziehen? Der Gedanken daran, mehr als einen Flur durchqueren zu müssen, um ihn zu sehen, schnürt mir die Luft ab. Genauso ist es mir anfangs mit der Beziehung von Emily und Oliver ergangen. Vor drei Jahren ist aus den Knospen ihrer Freundschaft mehr erblüht. Anfangs ist die Tatsache, dass Oliver eine feste Freundin hat, ätzendem Gift gleich in meinen Verstand gesickert. Er ist mein Doppelstern, ich habe mich gefühlt, als hätte sich unser gemeinsamer Schwerpunkt verschoben. Als sei er davongetrieben in eine andere Galaxie, und ich müsse allein durch die unendlichen Weiten des Alls treiben. Bis mir klargeworden ist, dass Emily nichts zwischen Oliver und mir verändert. Seitdem macht mein Herz jedes Mal, wenn ich sie zusammen sehe, einen Hüpfer. Im Urlaub in Los Angeles sind sie jede Sekunde beieinander gewesen, und ich habe nichts vermisst, sondern mein gemeinsames Abenteuer mit Charlie aus den zwei Wochen erschaffen und einen gemeinsamen Takt gefunden. Wir haben uns wie die Königinnen der Sandburgen gefühlt, welche wir erbaut haben. Feinkörnige Mosaike, die auf ewig als Erinnerung in meinem Herzen überdauern werden, wie die Fotos und die TikToks, die Charlie und ich aufgenommen haben.
»Was ist los?«, fragt Simon. Das Mondlicht besprenkelt sein dunkelblondes Haar mit Silber, in seinen Brillengläsern spiegeln sich die Sterne.
Ich streiche mir eine Locke aus dem Gesicht. »Ich denke an Los Angeles, am liebsten würde ich mit Charlie dorthin zurück.«
»Schon verstanden. Wir sind nicht eingeladen.« Oliver legt den Kopf schief. »Was habt ihr in Los Angeles die ganze Zeit gemacht?«
»Das ist ein Geheimnis unter Schwestern, und dafür solltest du dankbar sein. Wir haben Emily und dir Raum gegeben.« Die Note in dunklem Moll von vorhin echot durch mein Inneres, übertönt das zarte Dur der Erinnerungen an Los Angeles. »Davor habe ich darüber nachgedacht, dass ich froh bin, keine feste Freundin zu haben.«
Simon stupst mich mit der Schulter an. »Vielleicht lernst du in Hamburg eine Co-Darstellerin kennen.«
»Meine Rede«, meint Oliver.
Fragil und pastellfarben, wie eine Seifenblase im Wind, schwebt der Gedanke durch meinen Geist. Eine Co-Darstellerin würde verstehen, dass die Musik meine große Liebe ist. Anders als die Frauen, mit denen ich meine Erfahrungen gemacht habe. Eine richtige Beziehung ist aus ihnen nie gewachsen, und ich vermisse nichts, von dem ich nicht weiß, wie es sich anfühlt. Andererseits würde eine Co-Darstellerin sich nicht damit zufriedengeben, mein Licht zu reflektieren, sondern sich einen Platz neben mir im goldenen Schein wünschen. Die Seifenblase zerplatzt und tropft mir von den Fingern. Lieber strahle ich so hell, dass ich andere blende, als mich in die Schatten zurückzuziehen.
Ich recke das Kinn. »Sicher nicht. Ich bin unabhängig und glücklich, wie grand-mère Marie.«
Simon stupst mich mit der Schulter an. »Das kannst du nicht planen.«
»Doch. Das tut sie, indem sie keine Frau in ihren Eispalast lässt«, meint Oliver.
Ich schnaube, und er weicht lachend einem halbherzigen Schlag meinerseits aus.
»Wer hat Lust, schwimmen zu gehen?«, wechselt Oliver das Thema; meine Miene ist wohl so eingefroren, dass er die Unterhaltung als beendet ansieht.
Emily und ich bleiben am Strand, die anderen stürzen sich in die tiefdunklen Wellen.
Sie wendet sich mir zu, Haar wie aus der Nacht gewoben umrahmt ihr Gesicht, in ihren Augen schimmern Abgründe, und Besorgnis zerrt an ihren Zügen. »Du wirst in Hamburg auf Oliver aufpassen, oder?«
Ihre Worte treffen mich tiefer, als sie sollten. Als ich antworte, fühlen sich meine Lippen an wie mit Steinen beschwert. Dabei sind sie bloß verklebt von dem Marshmallow-Lippenstift-Teig-Gemisch, und es auszusprechen sollte sich selbstverständlich anfühlen. »Natürlich. Das tun wir ein Leben lang.«
Ihr Gesicht glättet sich. Sie schnappt sich ein Marshmallow und beginnt mit vollem Mund zu spekulieren, welches Stück Nicolas und grand-mère Marie für die Weihnachtsaufführung planen. Für Die Eiskönigin würde Emily ihre Elsa fehlen, wenn ich nicht mehr da bin, obwohl es kein Musical gibt, das besser zu Eis und Schnee passt. Falls es Disney wird, passt ihrer Meinung nach auch Die Schöne und das Biest. Nicht, dass ihre Liebe für Disneyfilme ihr Urteilsvermögen färben würde. Grand-mère Marie würde sicher lieber etwas Klassisches wie Les Misérables sehen. Oder sie schreibt Emily ein Musical auf den Leib, jetzt, wo ihr Schatten nicht länger in meinem Rampenlicht verblasst.
Ihre Worte rauschen an mir vorbei, wie die nahen Ostseewellen, an denen mein Blick haftet. Auf den nachtblauen Wogen treiben vereinzelte Lichtpunkte. Ferne Schiffe, welche das Schicksal auf ihre Reise zu neuen Ufern schickt. Scheinbar ziellos folgen sie einem feststehenden Pfad – hoffentlich verhält sich das mit den kommenden Monaten ähnlich. Ich möchte keine drei Monate ziellos umhertreiben.
Wolken schieben sich als schwarzglitzernder Vorhang vor die Sterne, ihre Zeit auf der Bühne ist abgelaufen. Die Silhouetten der wagemutigen Schwimmer unter uns lösen sich aus den Schatten am Ufer, als sich die Wolken für einen ersten wispernden Regenguss öffnen. Zischend perlen die kristallenen Tropfen auf das Lagerfeuer, aufgebracht schwirren Feuerglühwürmchen zum Firmament, ehe sie in Rauchschwaden verdunsten.
»Ostseeklima – unbeständig wie eh und je«, grummelt Oliver.
Emily rückt von ihm ab, als er sich die Wassertropfen aus den Locken schüttelt. Von dem Haargel fehlt, spätestens seit dem Schwimmen, jede Spur. Anschließend lässt sie sich von ihm an der Hand auf die Füße ziehen. »Die spontanen Regenschauer werden dir in Hamburg erhalten bleiben.«
»Ich hätte in Berlin studieren sollen.«
Sie schnappt nach Luft.
»Das war ein Scherz«, versichert er ihr.
Alle, die Schwimmen gewesen sind, ziehen sich an, der Regen löscht das Lagerfeuer, und wir packen in der Dunkelheit unsere Sachen zusammen.
Nasser Sand haftet zwischen meinen Zehen, die Sandalen halte ich auf dem Weg zur Straße in der Hand. Das dünne Kleid klebt an meiner Haut, die Jeansjacke eignet sich bedingt als Regenschutz.
Mein kirschroter Mini Cooper, den mir grand-mère Marie letzten November zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hat, erwartet mich am Straßenrand. Seine Oberfläche bricht das diffuse Silberlicht, schimmernde Muster versprechen eine sichere Fahrt nach Hause.
Wir verabschieden uns voneinander, zuletzt ziehe ich Simon in eine feste Umarmung. »Fahr vorsichtig«, flüstere ich ihm ins Ohr.
»Ich habe den Motorradführerschein nicht seit gestern.«
Ich werfe seinem rauchschwarzen Motorrad, das neben meinem Mini Cooper parkt, einen missbilligenden Blick zu. »Das ändert nichts daran, dass es eine Höllenmaschine ist.«
Er drückt mich an sich, Salzwassergeruch steigt mir in die Nase. »Ich passe auf mich auf.«
»Ruf mich an, sobald du zu Hause bist«, gebe ich ernst zurück.
»Versprochen.« Mit diesen Worten lässt er mich los und wird von der Dunkelheit verschluckt.
Vertraute Finger gleiten zwischen meine. »Du machst dir zu viele Sorgen. Simon fährt immer vorsichtig und sein Weg dauert fünfzehn Minuten.«
Meine Nasenflügel zucken unter einem Schnauben.
»Kommt ihr?« Emily schlingt die Arme um ihren zitternden Körper. »Wenn ich mir ein Bad gewünscht hätte, wäre ich mit euch schwimmen gegangen.«
Ich klaube meine Autoschlüssel aus meiner Handtasche, die Vorderlichter flackern, zwinkern mir zu, als wollten sie mir versichern, dass alles in Ordnung ist.
Oliver lässt meine Hand los, ein mulmiges Gefühl strömt in mein Inneres und sammelt sich in meiner Brust. Er setzt sich mit Emily auf die Rückbank. Ich gleite auf den Fahrersitz und drehe die Lautsprecher auf, um das Prasseln des Regens zu übertönen, welches meine Sinne vernebelt. Während ich den Mini Cooper auf die Straße lenke, erfüllen die Klänge von Die Musik der Dunkelheit aus Das Phantom der Oper das Innere des Wagens.
Schattenfingern gleich, greift die Symphonie nach mir, bringt meine Saiten ins Stocken und will mich durch die Frontscheibe zerren, in von silbern funkelnden Kristallen besprenkelte Düsternis. Wie Donnergrollen hallen die Töne in meinem Kopf nach, übertönen die Unterhaltung von Oliver und Emily. Mit klammen Fingern taste ich nach den Pfeilen auf dem Touchpad, auf der Suche nach einer Melodie in Dur …
Gleißendes Weiß erhellt die Finsternis, nähert sich uns in rasender Geschwindigkeit.
»Lucie, pass auf!«, schreit Oliver.
Vor einem Herzschlag habe ich mir Fackeln gewünscht, welche der Nacht die Finsternis nehmen. Jetzt sind sie der Abgrund, welcher sich vor mir auftut, und ich balanciere auf einem Drahtseil darüber, während tosender Wind an mir reißt.
Mit voller Wucht trete ich auf die Bremse, reiße im selben Moment das Lenkrad herum. Meine Ohren fangen ein Kreischen auf – Emily.
Mit zusammengebissenen Zähnen umklammere ich das Lenkrad, mein Herz rast im Takt des prasselnden Regens. Die Reifen schlittern über den Asphalt. Bevor der Wagen zum Stehen kommt, zerreißt ein ohrenbetäubender Knall mein Trommelfell.
Alles um mich herum explodiert in glühendem Weiß, das sich wie Feuer auf meine Haut legt, an meinen Knochen schabt und meine Beine in Flammen setzt. Licht sticht mir in die Augen, brennende Nadeln, die ich nicht herauszuziehen vermag. Ein Schrei möchte sich meiner Kehle entringen, ich schmecke Metall, will mit den Beinen strampeln. Schmerz flammt in mir auf, als fließe Lava durch meine Adern.
Die Welt kippt zur Seite. Ich bin schwerelos, werde herumgeschleudert und bin nicht in der Lage, meine Flügel auszubreiten. Ein zweiter Knall geht mir durch Mark und Bein. Mein Kopf wird nach hinten gerissen, das Echo des Aufpralls hallt in dessen Innerem nach, wie Pfeilspitzen, die auf meine Schläfen abgefeuert werden.
Schwärze sickert in mein Sichtfeld, frisst das Licht und drückt mich nieder. Erbarmungslose Fluten, die mich von der Kante des Bewusstseins spülen.
***
Ein schriller Ton durchdringt die Finsternis, in der ich treibe, im Crescendo und entreißt mich ihrer Umarmung. Meine Lunge zieht sich einer alten Ziehharmonika gleich zusammen, und mein Verstand stößt träge fließend immer wieder gegen Steine.
Was ist passiert?
Wann bin ich eingeschlafen?
Die Fäden der Erinnerungen zerreißen, wenn ich nach ihnen greife und versuche sie zu verknüpfen. Ein Gefühl der Benommenheit hält mich starr auf dem Untergrund gefangen, der leicht unter meinem Gewicht nachgibt. Behutsam bewege ich meine Finger, einen nach dem anderen, ein Aufatmen löst sich aus meiner Kehle, ich möchte dasselbe mit meinen Zehen tun, versuche, den Großen zu heben …
nichts.
Keine Regung.
All meine Sinne richte ich auf meinen linken Fuß aus.
Kein Zucken.
Auch der Rechte bleibt starr.
Der Atem verfängt sich in meiner Lunge, mir ist als pumpe Gift durch meine Adern. Ich spüre meine Beine nicht, fühle mich fremd in meinem eigenen Körper. Als sei er zersprungen und würde meine Seele abstoßen.
Der Schmerz des Augenblicks schnürt mir mit eisernen Fäden die Brust zu.
Ein Wimmern entringt sich meinem Mund, als ich die Augen aufschlage.
Gleißendes Licht.
Wimpernschlag.
Atemzug.
Staub in meinen Atemwegen.
Wimpernschlag.
Grellweiß, das mir in den Augen brennt.
Tapfer blinzle ich gegen die Helligkeit an. Der Geruch von Desinfektionsmittel sticht mir in die Nase, welche ich rümpfe.
Verschwommene Umrisse formen sich zu sterilen reinweißen Wänden, so abgestumpft und leer, wie ich mich fühle. Den schrillen Ton ordne ich einem Herzmonitor zu, im selben Atemzug bewegt sich die Linie darauf schneller. Meine Handflächen werden schwitzig, mein Herz klopft zum Zerspringen, die Linien sind sein Spiegel.
Ich bin …
im Krankenhaus?
Die Erkenntnis treibt mir Splitter in die Knochen, welche an einer Erinnerung schaben, die unter einer tiefen Schicht Erde begraben liegt …
»Lucie.«
Schwerfällig drehe ich den Kopf in die Richtung, aus der die Stimme gekommen ist. Glühender Schmerz durchfährt mich, schwarze Punkte tanzen vor meinem Blick. Als er sich klärt, schaue ich in grand-mère Maries Gesicht. Kein Stern verirrt sich in der Winternacht in ihren Augen, mit zitternden Händen pfriemelt sie an ihrem samtschwarzen Kostüm. Hat sie immer so viele Falten um den Mund gehabt?
Mein Versuch, ihren Namen zu wispern, endet in einem Krächzen. Sogleich drückt sie mir einen Wasserbecher an die Lippen, kühles Nass spült das Engegefühl fort. Nachdem sie den Becher auf dem Beistelltisch abgestellt hat, streicht sie mir die Locken aus der Stirn.
Ich schmiege mich in die Berührung, das Ziehen meiner Halswirbel ignorierend. »Was ist passiert?«, meine Stimme ist zerbrechlich wie die allererste Eisschicht im Winter.
»Oh Lucie.« Sie schließt die Augen, atmet tief durch.
Meine Kehle schnürt sich zu. Nie habe ich Marie Chevalier um Fassung ringen sehen. »Bitte …«
Tränenkristalle verschleiern ihren Blick. »Ihr hattet einen Autounfall. Oliver, Emily und du. Ihr seid im Regen auf der Landstraße mit einem anderen Auto zusammengestoßen.« Sie beißt sich auf die zitternde Unterlippe. »Du bist notoperiert worden … Sie wissen nicht, ob du je wieder laufen können wirst … Oliver und Emily …« Ihr versagt die Stimme.
Ihre Worte malen erste Pinselstriche auf die Leinwand meiner Albträume – weiß auf weißem Grund für alles, was mir widerfahren ist. Es ist bedeutungslos. Tiefschwarz für Olivers und Emilys Schicksal. »Wo sind sie? Wo sind Oliver und Emily?« Ich möchte die Worte schreien, stattdessen kommt mir ein raues Flüstern über die Lippen. Die Luft im Raum wird dünner, Kälte kriecht unter das Krankenhausnachthemd und die dicke Decke, unter der ich liege.
»Emily liegt im Koma.«
Etwas in meinem Herzen zerreißt …
»Gerade ist ihr Zustand stabil.«
… aus dem Riss sprießen Ausläufer, wie in einer Eisfläche auf einem zugefrorenen See …
»Oliver …« Ihre Stimme bricht. »Monique und Thomas sprechen gerade mit dem behandelnden Arzt … Ihm ist nicht zu helfen gewesen, ma chérie, er konnte nicht wiederbelebt werden …«
… bis das Eis zersplittert.
Ich atme, doch jedes Zusammenziehen und Entkrampfen meiner Lunge fühlt sich wie ersticken an. Mir ist, als würden meine Knochen von innen heraus zerbrechen.
Ich zersplittere. In winzige Teile, die sich immer neu zusammenfügen. An die falschen Stellen. Weil ich nie wieder ganz sein werde.
In den Scherben spiegeln sich die Bilder meiner Erinnerungen, jede schneidet tiefer in mein Herz. Oliver neben mir auf dem Klavierhocker vor grand-mère Maries Flügel, nachdem ich Comptine d‘un autre été fehlerfrei gespielt habe. Unsere erste Aufführung auf der Bühne im Kindergarten. Unsere Einschulung. Unser erster Besuch im Disneyland Paris. Unsere erste Aufführung mit der Musicalgruppe. Unsere Abschlussfahrt nach Edinburgh mit dem Englisch Leistungskurs. Unser achtzehnter Geburtstag letzten November. Unser Abiball. Der letzte fallende Vorhang.
Jedes Bild ist eine Flamme, die auf mich einschlägt. Das Feuer, das sich in mir ausbereitet, verbrennt eine Verbindung, die mein Leben lang da gewesen ist. Lässt mich zurück mit Ascheflocken, die wie schwarzer Schnee in einem düsteren Nichts hinabregnen.
Oliver …
Sein Name als Erinnerung auf meinen Lippen …
Sein Bild nicht länger Teil meiner Realität …
Oliver …
ist …
tot.
Ein Schleier aus Tränen gleitet über meine Augen, Salz brennt auf meinen Wangen. Das Zittern meiner Hände überträgt sich als Beben auf meinen ganzen Körper. Arme ziehen mich behutsam an einen warmen Körper, als wolle grand-mère Marie die letzten Scherben meines Selbst zusammenhalten. Ihrem blumigen Parfum haftet eine welke Note an, als hätte der Herbst den Sommer nicht nur aus meiner Welt vertrieben.
»Je suis désolée, chérie«, murmelt sie undeutlich in mein Haar. »Quelle tragédie…«
Der Rest ihrer Worte geht in dem Knarzen einer Tür unter. Die Stimmen meiner Eltern vermischen sich zu einem Dröhnen in meinem Kopf. Steinkalte Finger streichen mir durch die Locken.
Zuerst verstehe ich nicht, was Mama sagt. Dann dringen ihre Worte als flüchtiger Lichtstrahl durch den Sumpf meiner Gedanken.
»Lucie.«
Mein Name.
Immer wieder mein Name.
Wie ein Gebet.
Weil ich überlebt habe.
»Nein«, bringe ich unter Tränen heraus. Mamas Gesicht ist ein verschwommener Fleck, als würde sie hinter einer regennassen Fensterscheibe stehen, und ich bin der Regen, der ihr ihren Sohn genommen hat. Nicht mehr golden im Scheinwerferlicht, sondern grau. »Oliver hätte überleben müssen. Nicht ich. Das ist m-meine«, Schluchzer zerstückeln meine Worte, »Sch-Schuld …«
Die winterblauen Flecken, welche ich vage als Mamas Augen identifiziere, verschwimmen wie Tinte, die über einem Pergamentblatt verläuft.
Grand-mère Marie lässt mich los.
Mama nimmt mich in den Arm, unruhig hämmert ihr Herz gegen meine Wange. »Sag das nicht, Liebling.« Sie ringt um Atem, zieht sich von mir zurück, nimmt mein Gesicht in die Hände. Mit dem Daumen streicht sie mir die Tränen von den Wagen. »Nie wieder möchte ich das von dir hören. Es ist nicht deine Schuld gewesen, und auch nicht die des anderen Autofahrers. Der Regen … die Dunkelheit …«
Die nehme ich nicht wahr, die Symphonie ihrer Worte hallt tonlos durch mein ausgebranntes Inneres – sie ist leer.
Meine Miene muss spiegeln, was in mir vorgeht. Dass mit jeder Sekunde, in der ich atme, aber Oliver nicht, mehr Stücke aus mir herausbrechen und zu Asche verbrennen, die im Wind davonwirbelt. Mama stößt ein ersticktes Schluchzen aus, ehe sie mich an sich zieht. In dem Versuch, mich zusammenzuhalten, obwohl zerbrochene Dinge nie wieder ganz werden – die Risse bleiben.
»Sie dürfen sie nicht aufregen, Frau Chevalier.«
»Meine Frau weiß, was sie tut.« Papas Stimme ist farblos. »Lucie braucht jeden Halt, den sie bekommen kann. Wir brauchen einander. Als Familie.«
Familie – ein Wort ohne Bedeutung.
Oliver – ein Name ohne Gesicht.
Lieder ohne Noten.
Wie der Missklang der Silben meines Namens.
Lucie … Wer ist Lucie? Nicht mehr die Person, die im Flutlicht badend auf der Bühne gestanden hat.
Mama scheint dasselbe zu denken. Sie bemüht sich nicht mehr um beruhigende Worte, sondern hält mich fest, während ich in einem düsteren Brunnenschacht sitze. Wohlwissend, dass mir kein Licht den Weg nach oben zeigen wird.
Ein Schnitt teilt mein Leben in Davor und Danach.
Davor haben Oliver und ich Seite an Seite auf der Bühne gestanden.
Für die Lucie danach ist der letzte Vorhang gefallen.
Kapitel 3
Taylor Swift – Anti-Hero
Januar, 2 1/2 Jahre später
Regenrinnsale besprühen das kühle Glas des Busfensters mit Ornamenten. Die Landschaft Fehmarns verschwimmt, als hätte eine Malerin zu viel Wasserfarbe für ihr Gemälde genommen, sodass die Konturen verwischen und ineinanderfließen.
Zweieinhalb Jahre lang bin ich nicht auf der Insel gewesen, auf der ich geboren und aufgewachsen bin. Hinter der regennassen Fensterscheibe sollte ich jeden Baum erkennen, stattdessen ist mir Fehmarn so fremd wie mein eigener Körper.
Ich bin aus der Zeit gefallen, in jener regnerischen Nacht, in der Oliver, Emily und ich alle drei gestorben sind. Mein Zwillingsbruder wurde beerdigt. Ich bin nicht dort gewesen, sondern habe im Krankenhaus gelegen, und an keinem Ort hätte ich weniger sein wollen. Einen Grabstein mit dem Namen Oliver Chevalier zu sehen und ein zweites Datum unter dem neunten November zu lesen hätte den Verlust greifbarer gemacht.
Emily hat vier Wochen im Koma gelegen, acht weitere im Krankenhaus und neun Monate in einer Rehaklinik verbracht. Sie möchte mich nicht sehen; ich habe aufgegeben, nach ihr zu fragen. Über ihren genauen Zustand hat mich niemand informieren dürfen. Vielleicht ist es besser so. Aus Grau lassen sich keine bunten Farben mischen – wenn sie derselbe monochrome Schleier umgibt wie mich, würden wir einander weiter in die Tiefe ziehen, statt uns Aufwind zu geben. Emilys Verlust ist eine weitere Grauschattierung auf der Farbpalette meines Schmerzes. Nie werde ich im Zuschauerraum sitzen, wenn sie ihre erste Hauptrolle spielt oder die Trauzeugin auf ihrer Hochzeit mit Oliver sein.
Sie ist vor mir nach Fehmarn zurückgekehrt. Oliver wird nie mehr sehen, wie die Sonne in der Ostsee versinkt und die schäumende Gischt in reines Gold taucht.
Als wir über die Fehmarnsundbrücke gefahren sind, sind die Wellen düster gewesen – Spiegel meines Gemüts im Angesicht unseres Wiedersehens.
Sechs Monate habe ich im Krankenhaus verbracht. Die Ärztinnen und Ärzte haben auf mich eingeredet, als würde es mich kümmern, dass meine Gebärmutter in einer Notoperation entfernt worden ist. Kinder habe ich nie gewollt. Ihnen ist klar geworden, dass sie auf Granit stoßen, sie haben aufgegeben zu graben. Ihr neuer Fixpunkt sind die Nervenschäden in meinen Beinen gewesen. Nach sechzehn Operationen und zehn Monaten in einer Rehaklinik bin ich in der Lage ebene Strecken mithilfe eines Gehstocks zurückzulegen. Seit zweieinhalb Jahren lerne ich, mit der Behinderung umzugehen … und fühle nichts. Was kümmert es mich, dass ich ohne Schmerzen nicht lange stehen kann oder einen Sitz in der Dusche brauche? Dass es länger dauert, mich anzuziehen? Dass ich nie mehr schwimmen oder Inliner fahren werde? Es ist, als hätte ich ein Lied gehört und auf den Wechsel der Tonart hin gefiebert, bis ein Sprung in der Schallplatte es ins Stocken gebracht hat. Dort bin ich hängen geblieben. Wie der Plattensprung hat sich eine Taubheit für das Leben in mir festgesetzt.
Die Narben an meinen Handgelenken pochen im Takt meines Herzens, ich zupfe die Ärmel meines Mantels zurecht, bilde mir ein, dass sie sich scharfkantig darunter abzeichnen. Die Tablettenüberdosis hat keine äußeren Spuren hinterlassen. Meine Handgelenke hinab, über meine Unterarme ziehen sich tiefrote Einschnitte, Noten in einer Tonart, die nur ich spielen kann, und die sich nicht zu einer Melodie zusammenfügen. Sie tragen die tiefen Narben auf meiner Seele tonlos nach außen.
Die Silhouette einer jungen Frau spiegelt sich in der Fensterscheibe. Eine leblose Hülle, die krampfhaft atmet, statt ihren zerrissenen Geist freizugeben. Nicht länger konturiert mich goldenes Scheinwerferlicht, wie die Lucie davor, stattdessen verschwimmen meine Umrisse im Regen, wie der Traum von einer Zukunft auf den Bühnen der Welt. Die Tropfen waschen ihre Farben fort, bis ein regengraues Zerrbild übrig bleibt.
Lucie danach, die zweimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen.
Lucie danach, die bis vor drei Monaten nicht allein ins Badezimmer gedurft hat.
Lucie danach, die keine Rasierklingen oder Nagelscheren ohne Aufsicht benutzen darf.
Lucie danach, die von ihrer Mutter mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach über einem Jahr aus der Psychiatrie in Hamburg abgeholt wird.
Jedes Auto, welches an uns vorbei schlittert, und jedes Aufheulen eines Motors lösen Beklemmung in mir aus. In der Geschwindigkeit der vorbeischnellenden Fahrzeuge rast das letzte Gespräch mit Frau Schwarz, meiner Therapeutin, an mir vorbei.
Die Wand ist in einem hellen Gelbton gestrichen, als wolle sie allen Patientinnen und Patienten, die hierherkommen, einen Funken Sonne spenden. Meiner Welt sind alle Farben entzogen worden, um mich herum gibt es nichts als Schattierungen von Grau, die Zweifel, Trauer und Angst Gesichter verleihen.
Unruhig rutsche ich auf dem gepolsterten Sessel – natürlich ist er ebenfalls sonnengelb – hin und her, setze mich auf meine schwitzigen Handflächen, reibe sie aneinander.
Ich linse zu der Eichenholztür, hinter der Mama auf mich wartet. Sie und der Schritt aus der Psychiatrie.
Ich bin wieder fünfzehn und stehe auf einer Steinklippe, die tosende dunkle Ostsee unter mir. Oliver ist gesprungen, ohne zurückzuschauen, ich habe gezögert. Für ihn ist ein Sprung ins Wasser ein Akt der Befreiung gewesen. Er ist geschwommen, während ich überlegt habe, ob der Sprung es wert ist.
Hinter dem sonnengelb gestrichenen Büro wartet eine Welt auf mich, die sich zweieinhalb Jahre lang ohne mich weitergedreht hat. Wie die aufbrausenden Wellen damals, als ich nach dem schmerzhaften Aufprall aufgetaucht und geschwommen bin. Der Sprung in die Welt, welche draußen lauert, wird meine Knochen zerschmettern. Es wird nicht der Aufprall sein, der am meisten schmerzt, sondern der Versuch, mich danach neu zusammenzusetzen, ohne mir die Finger blutig zu reißen.
Frau Schwarz betrachtet mich aus ihren azurblauen Augen mit einem warmen Lächeln. »Es ist in Ordnung, Angst zu haben.«
Sie hat zum wiederholten Mal meine Gedanken gelesen. Mein Herzschlag beruhigt sich, ich habe die Worte nicht selbst aussprechen müssen und weiß, bei meiner Therapeutin sind sie gut aufgehoben.
In den ersten Wochen habe sie angeschwiegen, wie zuvor den Seelsorger im Krankenhaus sowie die Therapeutinnen und Therapeuten in der Rehaklinik. Als würde es Olivers Tod realer machen, wenn ich das Knäuel meiner Gefühle entwirre und die einzelnen Fäden jemandem zeige. Empfindungen in Worte zu fassen, fühlt sich noch immer an, als müsse ich einen Stein einen Berg hinaufrollen. Immerhin weiß ich, dass jedes meiner Worte bei Frau Schwarz sicher ist. Ohne sie würde ich den Sprung ins Wasser niemals wagen.
»Angst vor«, ich stocke, »meinem eigenen Zuhause … oder eher dem Ort, der einst mein Zuhause gewesen ist?«
»Natürlich. Du würdest nicht entlassen, wenn du nicht bereit für dein altes Umfeld wärst.« Verständnis sickert aus ihrem Blick. »Niemand verlangt von dir, dass du dieselbe Person bist wie vor dem Unfall, deine Familie wird dir Zeit geben.«
Ich ringe die Hände im Schoß. »Das hoffe ich.«
»Gibt es etwas, worauf du dich freust, wenn du zurück auf Fehmarn bist?«
Zurück auf Fehmarn, nicht Zuhause. Ich könnte Frau Schwarz umarmen …
Ihre Frage echot durch meinen Verstand. Worauf freue ich mich? Sicher nicht auf ein Haus, welchem ein Teil seiner Seele entrissen worden ist. Darf ich mich auf etwas freuen?
»Genauso wie es in Ordnung ist Angst zu haben, ist es das, wenn du dich auf etwas freust.«
Ich atme tief durch, fasse die erste Note in Worte, welche mein Herz anschlägt. »Cleo.« Beim Gedanken daran, durch das Fell unserer Familienhündin zu streichen, wird mein Herz warm. Cleo hat mich in den letzten zweieinhalb Jahren selten gesehen. Manchmal haben meine Eltern sie mitgenommen, als ich in der Reha oder in der Psychiatrie gewesen bin, und ich habe Zeit in den dortigen Gärten mit ihr verbracht. Kurz vor Weihnachten – zum Glück hat mich niemand gezwungen, das Fest der Liebe und der Familie auf Fehmarn zu verbringen – hat Frau Schwarz sie kennengelernt. »Ich freue mich darauf, mit ihr am Strand spazieren zu gehen, wenn der Winter es zulässt.«
Aufmunternd nickt sie mir zu. »Cleo wird sich auch freuen, dich zu sehen. Halte dir solche Glücksmomente vor Augen und schreib sie auf, wie wir es geübt haben.«
Feingliedrige Finger auf meinem Arm reißen mich aus dem Kokon, welchen die Erinnerung um mich spinnt. Mamas Versuch, die Mundwinkel zu heben, scheitert, tiefe Ringe liegen unter ihren Augen, ihre Wangen sind so hohl wie die meines Spiegelbildes. »Gleich sind wir zu Hause«, bringt sie mit brüchiger Stimme heraus.
Was für ein Zuhause?
Wessen Zuhause?
Fragen, welche die Krusten über meinen Wunden aufkratzen. Meine Freude, Cleo wiederzusehen, ist verdunstet wie Morgentau.
Oliver sollte sie wiedersehen.
Wieso gehe ich nach Hause und er nicht?
Warum schlägt mein Herz, wenn seins verstummt ist?
Warum habe ich das Lenkrad nicht in die andere Richtung gedreht?
Warum …
Mein Herz schlägt panisch mit den Flügeln, Luft strömt als ätzende Säure in meine Lunge, ich kann nicht atmen …
Ich kralle die Finger um die Armlehnen des Rollstuhls, im Kopf wiederhole ich, was Frau Schwarz mir beigebracht hat, um mich im Jetzt zu verankern.
Drei Dinge, die ich fühle: Metall, das Fleece-Innenfutter meines Sweatshirts, kühles Fensterglas.
Drei Dinge, die ich sehe: verschwommene Häusersilhouetten, die Anzeigetafel, Mamas besorgt schimmernde winterblaue Augen.
Drei Dinge, die ich höre: plappernde Kinder, Musik aus den Kopfhörern eines Jungen schräg hinter mir, Regentropfen, welche gegen die Scheibe prasseln.
Die Fesseln der Angst fallen von mir ab, ich atme tief ein, das Gift in meiner Lunge neutralisiert sich.
»Lucie …«
Frag nicht, ob alles in Ordnung ist! Nichts ist in Ordnung!
Ich beiße die Zähne zusammen und zwinge mich, unter Mamas sorgenvoller Miene nicht den Kopf einzuziehen. »Hm?«
»Niemand kann deinen Weg für dich gehen, aber wir werden gemeinsam weitermachen.«
Ein Stich schlechten Gewissens durchfährt mich. Indem sie wir gesagt hat, bezieht sie ihre Aussage automatisch auf mich. Frau Schwarz hat ihr bei unserem Abschlussgespräch versichert, dass ich bereit bin, nach Fehmarn zurückzukehren. Zweiwöchige Sitzungen sollen mir den Neuanfang erleichtern, im Notfall ist sie rund um die Uhr erreichbar.
Für mich fühlt es sich so an, als müsse ich ohne Sicherheitsnetz auf einem Drahtseil über einer Schlucht balancieren.
Zur Antwort zucke ich die Schultern.
»Dein Vater und dein Großvater haben die Tierarztpraxis am Mittag geschlossen, Simon hat sich frei genommen …«
Meine Finger verkrampfen sich um die Rollstuhllehnen. »Das wird keine Party, oder?«
Behutsam streicht sie mir durch die Locken. »Nein, eine Zusammenkunft unserer Familie.«
»Von mir aus.«
Sie öffnet den Mund, ihr Blick huscht über meine angespannten Züge, seufzend wendet sie sich dem Fenster zu. »Der Himmel klart auf, das muss ein Zeichen sein.«
Goldene Schlieren durchbrechen die Wolkendecke. Die Silhouette der Straße erstrahlt im Glanz eines goldenen Januars. Großartig, die Natur verspottet mich.
Quietschend bremst der Bus, alle Härchen in meinem Nacken stellen sich auf.
»Wir müssen aussteigen.« Mama nimmt meine Reisetasche, ich lenke den Rollstuhl zum Ausgang. Sie bleibt dicht an meiner Seite, stellt den Koffer auf dem Bürgersteig ab und hilft mir über die Lücke zwischen Bus und Bordstein.
Schweigend folgen wir dem Verlauf der Straße, in der ich aufgewachsen bin. Täglich bin ich über den Asphalt gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Nach zweieinhalb Jahren sind die immer gleichen Häuser unverändert, bis auf letzte Überreste von Weihnachtsdekoration in den Fenstern, obwohl wir Mitte Januar haben. Als sei ich nie fort gewesen.
Die nahe Küste salzt den Wind, welcher mit meinen Locken spielt. Der Regen hat aufgehört, die Wintersonne konturiert die Häuser sowie die kahlen Äste der Bäume in strahlendem Licht. Am östlichen Horizont durchstößt ein Regenbogen die zerfasernde Wolkendecke.
An seinem Ende wartet kein Topf voll Gold auf mich, sondern ein Reihenhaus, das sich einst durch nichts ausgezeichnet und unscheinbar zwischen Kopien gestanden hat. Zwei Etagen. Kiesweg. Cremeweiße Fassade. Ebenholzschwarzes Giebeldach. Perlmuttfarbener Holzzaun, hinter dem sich ein Garten mit millimetergenau gestutztem Rasen verbirgt.
Jetzt sind die Fenster tote Augen, welche anklagend auf den Grund meines Seins spähen, als wollten die verschiedenen Graunuancen zählen. Wie ich ist dieses Haus eine leere Hülle, ein Stück seiner Seele ist ihm entrissen worden.
Kies knirscht unter den Rollstuhlrädern, Mama und ich nähern uns der schwarzlackierten Haustür. Prompt wird sie von innen aufgerissen, Papa steckt seinen Kopf durch den Spalt.
Ein kastanienbraun-weißer Hundekörper zwängt sich an ihm vorbei. Cleo schnuppert, die eisblauen Augen auf mich gerichtet, die Ohren aufgestellt. In wenigen großen Sprüngen ist sie an meiner Seite, stößt ein hohes Bellen aus und springt am Rollstuhl hoch.
Mama schnappt nach Luft. »Cleo, aus!«
Wärme rieselt durch meine Adern. Cleos Freude ist so rein und echt, dass sich die Januarsonne auf meiner Haut warm anfühlt. »Nicht so stürmisch.«
Schwanzwedelnd tritt sie von einer Pfote auf die andere, Augen wie Eiskristalle sehen mich erwartungsvoll an.
Ich vergrabe meine Finger in dem weichen Hundefell, und sie schmiegt sich an mich.
»Ich habe dich auch vermisst«, flüstere ich.
Für einige Herzschläge schließe ich die Augen, genieße die Nähe meiner Hündin. Dem Wesen, das ich am meisten sehen möchte. Sie fragt nicht, wie es mir geht oder wie mein Leben weitergehen soll. Sie sucht die Schuld für den Autounfall nicht bei mir, und in ihren Augen machen mich weder die Gehbehinderung noch die Narben zu einem anderen Menschen. Für sie bin ich Lucie, und das ist genug.
»Dürfen wir Lucie auch begrüßen? Oder hat Cleo Exklusivrechte?«, dringt Papas Stimme in unsere Schneekugel der Ruhe.
Cleo bleibt dicht an meiner Seite, als hätte sie Angst, dass ich mich in Luft auflöse. Mein Herz bricht für sie – als Border Collie hat sie einen ausgeprägten Hütetrieb und möchte, dass ihre Herde zusammenbleibt. Dabei gibt es diese Herde nicht mehr, den Zaun habe ich niedergerissen und sie verzehrendem Feuer überlassen.
Nacheinander schließen mich Papa, Simon, grand-mère Marie, und meine Großeltern väterlicherseits – Opa Werner und Oma Anette – in die Arme. Bonnie, Cleos Schwester und die Hündin meiner Großeltern kommt zögernd zu mir, ehe Cleo ihr zu verstehen gibt, dass sie mich begrüßen darf.
Sie sind meine Familie, ich spüre ihre Umarmungen, höre ihre Stimmen, atme ihren Duft ein. Spüre vereinzelt salzige Tropfen auf meiner Haut und fühle mich innerlich betäubt. Ich bin das Teil, welches nicht länger in dieses Puzzle passt, meine Kanten haben sich verformt, und ich fühle mich weiter von den Menschen, die mich mein Leben lang begleiten, entfernt, als in der Psychiatrie.
»Möchtest du erst dein neues Zimmer sehen oder etwas essen?«, fragt Papa, nachdem ich alle begrüßt habe. »Wir haben dir mein altes Büro im Erdgeschoss hergerichtet…«
»Essen«, falle ich ihm ins Wort, ein neues Zimmer macht alles greifbarer. Auf die obere Etage werde ich nie mehr einen Fuß setzen, Treppen sind für mich mit dem Gehstock nicht überwindbar. Wie Oliver werde ich nie mehr an seiner Zimmertür vorbeigehen oder den Raum dahinter betreten, in welchem unsere Eltern die Erinnerungen eingesperrt haben.
Wie die Straße draußen sieht unser Wohn- und Esszimmer unverändert aus. Cremefarbene Wände, lederne schwarze Sessel vor einem Couchtisch, eine Wand mit einem Fernseher, Spielkonsolen und einem DVD-Regal. Durch die angelehnte Küchentür erblicke ich den Küchentresen, an dem ich vor Schulbeginn Früchtetee getrunken habe, bis meine Kinderhände die feingliedrigen einer Frau geworden sind, die eine Tasse schwarzen Kaffee umfassen.
Auf den zweiten Blick bemerke ich die Risse in der Fassade der Normalität, quadratische dunkelverfärbte Flecken an der Tapete. Davor haben dort Fotos gehangen, jetzt sind die Abdrücke Rahmen ohne Bilder, und der Anblick schnürt meine Brust zusammen. Es ist, als hätten unsere Eltern mit Oliver jede Erinnerung begraben.
In der Mitte des Raumes steht der Esstisch mit grau melierter Tischplatte, hinter dem eine Fensterfront den Blick auf unseren Garten freigibt. Zwischen den Gedecken auf dem Tisch stehen Waffeln und ein Apfelkuchen, welcher Zimtduft verströmt und darauf wartet, angeschnitten zu werden.
Auf einem der mit schwarzem Kunstleder gepolsterten Stühle sitzt die Person, welche ich aus meinem Leben ausgeklammert habe. Über sie habe ich mit Frau Schwarz nahezu so oft gesprochen wie über Oliver.
Blinzelnd, als erwache sie aus einer Trance, schaut sie von ihrem iPhone auf. Ihre Muskeln spannen sich an, sie sieht aus, als wolle sie auf mich zustürmen und mir um den Hals fallen, wie nach jeder Musicalaufführung.
In meinem Inneren faltet sich Hoffnung auf wie eine Knospe, die am Ende des Winters den Frühling spürt. Darauf, dass aus unserem verwelkten Schwesternband neue farbprächtige Blumen sprießen.
Unter dem Winter in ihrer Miene stirbt die Knospe den Frosttod, ich schlinge die Arme um die Körpermitte. Die Schwestern aus meiner Erinnerung sind unter einer Schneedecke erstickt, zwei Fremde stehen voreinander.