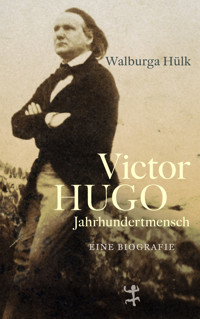
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Hunderttausende feierten am 26. Februar 1881 auf den Straßen von Paris den 79. Geburtstag einer Ikone, die Avenue d'Eylau, die bald in Avenue Victor Hugo umbenannt werden sollte, war erfüllt von den Rufen der Menge: »Vive Victor Hugo! Vive la République!« Wer so bejubelt wird, dessen Leben kann keineswegs nur eine Sache des Papiers sein. Walburga Hülk erzählt einfühlsam und bildreich, elegant und mitreißend von Schicksal und Mythos des grand homme Victor Hugo als Intellektuellem, Schriftsteller und vielfach begabtem Künstler – und von seinen Visionen und Widersprüchen. Er liebte Pomp und Pathos, in seinen Büchern aber, allen voran Les Misérables, die zu Klassikern der Populärkultur wurden, erzählte Victor Hugo vom ganzen Leben. In der Biografie Victor Hugos zeichnet Walburga Hülk das Bild eines Menschen und Autors zwischen Freiheit und Exil – das zugleich die Geschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert birgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 831
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walburga Hülk
Victor HUGO
Jahrhundertmensch
EINE BIOGRAFIE
Matthes & Seitz Berlin
Einen Ozean schöpfen? Tropfen, Wogen, Gischt, eine Brandung vielleicht
Für Theodor, Carlotta, Caspar
Vorwort
Noch am Abend des 15. April 2019, als Notre-Dame brannte, strömten Abertausende Menschen herbei, um das zerstörte Weltkulturerbe, das berühmteste Monument und Symbol des europäischen Mittelalters im Herzen von Paris zu betrachten. Neugier, oft auch Trauer oder Verzweiflung, trieben sie auf den Parvis Notre Dame und in die Viertel rund um die Kathedrale – die ganze Nacht und den darauffolgenden Tag. Einander fremde Menschen fanden sich zu großer Zahl zusammen, so hatten sie es nach den Attentaten vom November 2015 auf der Place de la République getan, so würden sie es in Paris und im ganzen Land immer wieder für Demonstrationen und Proteste tun. Und wer jetzt, in der Karwoche des Jahres 2019, nicht in Paris war, saß vor dem Fernseher, weltweit.
Noch an Ostern verschatteten Rauchwolken den Himmel, 700 Tonnen Trümmer – Sparren und Streben des Dachstuhls, bleiverkleidete Balken, Gewölbesteine, der mit Apostelfiguren, Fabelwesen, Rosen und Lilien geschmückte Vierungsturm – waren herabgestürzt, die Glocken verstummt, die Haupttürme wie durch ein Wunder verschont. Plötzlich stand auch Victor Hugos romantischer Roman Notre-Dame de Paris aus dem Jahr 1831 auf dem ersten Platz der Bestsellerlisten, so wie ein Jahr später, im Corona-Frühling, Albert Camus’ Roman La Peste.
Wie viele Exemplare von Hugos gewaltigem Roman über den buckligen Glöckner Quasimodo und die »Zigeunerin« Esmeralda jedoch wirklich gelesen oder wiedergelesen wurden, das lässt sich nicht sagen. Vielleicht war es einfach tröstlich, Titel und Einband des Buches zu betrachten und zu wissen, dass die »alte Königin« der Kirchen in der Realität gerade so wie in der Literatur jede Bedrohung überdauern würde: Attacken und Raserei, Leichtsinn und missliche Zufälle, lodernde, aus der höchsten Galerie oberhalb der Rosette schlagende Flammen, stiebende Funken, vom Wind losgerissene Brandfetzen, Feuerregen aus den Mäulern der Wasserspeier, glühende Strahlen und Schauer schmelzenden Bleis, flackernde Ungeheuer im aufsteigenden Rauch.
François Chifflart,
L’Attaque de Notre Dame
Victor Hugo war wieder da.
Selten geschieht es, dass ein künstlerisches Werk so eng mit dem Leben des Autors und dieses Leben so eng mit dem Zeitgeschehen verbunden ist wie im Falle Victor Hugos. Und obwohl es eine Weile aus der Mode gekommen war, diese Bezüge herzustellen, sind sie hier unerlässlich, denn dieses Dichterleben war nicht nur Papier. Wohin auch immer man im 19. Jahrhundert blickt, trifft man auf Victor Hugo.1 Er erlebte im eigenen Land Napoleon Bonaparte, die Rückkehr der Bourbonenmonarchie in der Restaurationszeit, die Julirevolution 1830, die Julimonarchie, die Revolution 1848, die Zweite Republik, den Staatsstreich 1851, das Zweite Kaiserreich unter Napoleon III., den Deutsch-Französischen Krieg und die Pariser Kommune, die Dritte Republik, er überlebte drei Könige und zwei Kaiser. Die Stimmen und Stimmungen der Zeit versammelten sich in seinem Werk zu einem einzigartigen, sich immer weiter aufspannenden Kosmos. »Ozean-Mensch«, so nannte Hugo sich selbst, bevor andere es taten.2 Und trotz Fiktions- und Inszenierungsverdacht ist diese Selbstbeschreibung doch reizvoll. Hugo war in steter Bewegung, alles wurde zu Schrift, Zeichnung, Bild. Wer sich seinem Werk und Leben annähert, entdeckt den ganzen Menschen, die Schauspiele der Naturgewalten und des Himmels, den Tumult der Straße und die Energie von Menschenmengen, die Hoffnungen und Irrtümer des 19. Jahrhunderts.
Dieses Buch erzählt von dem Jahrhundertmenschen Victor Hugo. Es handelt von dem, was geschah, vertieft sich in sein Werk, lässt Hugo sprechen und andere, die ihn privat oder öffentlich erlebten. Auguste Rodin, selbst ein in Kunst und Leben Getriebener, verewigte Hugo in dem imposanten Monument à Victor Hugo, »gehauen aus dem geheimnisvollen Block, aus dem ein Leben gefügt ist«;3 es korrespondiert mit Hugos poetischem Programm, das aufs Ganze ging und deshalb ins Offene und in die Zukunft wies. Was also vergangen oder gegenwärtig ist, mögen die Leser Hugos und die Leser dieses Buches entscheiden.
I. VOR DEM EXIL Victor Hugo werden
Mit dem Jahrhundert gehen
Usprungsmythen, Herkunft
Als Victor Hugo zur Welt kam, war »das Jahrhundert […] zwei Jahre alt, schon zerbrach die Stirn des künftigen Kaisers Napoleon die Maske des Ersten Konsuls Bonaparte.«4 Eine Ermächtigung, Hoffnung und Furcht, die Welt in Aufruhr – und mittendrin die Geburt des Kindes, das zum Jahrhundertmenschen wird. Die große Erzählung von Victor Hugos Leben beginnt mit seiner Zeugung. Das kannte man allenfalls aus Schelmenromanen. Wenn der erwachsene Hugo von seinem Ursprung sprach, berief er sich auf die Geschichte, die sein Vater ihm zum 21. Geburtstag eingeflüstert hatte. Léopold Hugo zufolge wurde sein Sohn Victor in hoher Luft auf einem Gipfel der Vogesen gezeugt. Dieser wurde später trotz einiger Widersprüche in der Ortsbeschreibung als Felsengipfel des Donon ausgemacht, nahe den Ruinen eines Vosegustempels, der dem keltischen Gott der Händler und Reisenden, der Diebe und Redegewandten geweiht war, und oberhalb dichter, sagenumwobener Wälder und gewundener Herden- und Schmugglerpfade. Von hier aus erblickt man die Quellflüsse der Saar und die Spitze des Straßburger Münsters und schaut über die Rheinebene, deren linksrheinische, französisch besetzte Gebiete Napoleon Bonaparte 1801 mit dem Frieden von Lunéville dem französischen Territorium rechtlich eingliederte. Noch heute zeigt diese Grenzregion die jahrhundertealten Spuren der wechselvollen deutsch-französischen und europäischen Geschichte. Bei günstigem Licht erscheint in der Ferne hinter den Höhen des Schwarzwaldes die schemenhafte Kette der Alpen. »Geschaffen nicht auf dem Pindos, aber einem der höchsten Gipfel der Vogesen, anlässlich einer Reise von Lunéville nach Besançon, scheinst du dich an diesen fast himmlischen Ursprung zu erinnern, und deine Muse ist ständig erhaben, soweit ich es sehe. Doch was bringen dir deine schönen Verse ein?«5
Die Zeugungsanekdote im Brief vom 19. November 1821, unterzeichnet mit »Ihr Vater, General Hugo«, bestimmte den Sohn zu einer hohen Stellung in Militär oder Politik, zu Reichtum und Würden. Doch der Sohn ließ sein Jurastudium schleifen und blieb bei seinem Wunsch, Dichter zu werden.6 Am 28. November antwortete Victor seinem »lieben Papa«, er habe zahlreiche »Freunde« und leide nicht darunter, nur ihn als »Förderer« zu haben, da gewiss weitere »Ressourcen« hinzukommen würden. Die von seinem mittlerweile finanziell ruinierten Vater erzählte, ansonsten nicht bezeugte Begebenheit aus dem Mai 1801 gehörte fortan zum Familienroman Victor Hugos, bevor ein elsässischer Kunsthistoriker mit Gespür für touristische Attraktionen7 sie 1960 mit einer in einen Sandsteinblock eingelassenen Schrifttafel verbürgen ließ: AN DIESEM ORT WURDE VICTOR HUGO AM 5. FLOREAL DES JAHRES 9 GEZEUGT.
Victor Marie Hugo war der dritte Sohn eines jakobinischen Offiziers aus Lothringen, Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo, und einer Bretonin, Sophie-Françoise »Femme Hugo«, geb. Trébuchet. Léopolds Vorfahren aus der Region Jeanne d’Arcs waren nicht, wie er vorgab, im 16. Jahrhundert geadelt worden, sondern Totengräber und Tischlermeister gewesen. Noch ältere Spuren verlieren sich in der Tiefe der Zeit. Er selbst jedoch lernte Latein, ging nach dem Sturm auf die Bastille als Sechzehnjähriger zum Militär und unterzeichnete mit »Sansculotte Brutus Hugo«, bevor er in der Grande Armée diente. Sophie wurde mit elf Jahren Vollwaise und in einem Pensionat der Ursulinen erzogen, ihre Mutter war im Kindbett gestorben und der Vater, Kapitän der Indienkompanie, vor der Île de France – dem heutigen Mauritius – verschollen. Victor wurde am 26. Februar 1802 – nach dem damals noch gültigen Revolutionskalender am 7. Ventôse des Jahres X – in der ostfranzösischen Garnisonsstadt Besançon geboren. »Es ist ein Junge«, stellte der Geburtshelfer um halb elf abends fest. Da das Kind bleich war, ein kurzes Wimmern anstelle des erwarteten Schreis von sich gab und nur schwach atmete, hielt er es für nicht lebensfähig und riet zur Nottaufe. Niemand aber rief nach einem Priester oder fühlte sich in dieser Situation selbst zu dem Ritual befugt, und auch aus den folgenden Wochen findet sich kein Taufschein. Denn der Empfang des Sakraments widersprach den freigeistigen und revolutionären Überzeugungen des Vaters und dem Willen der Mutter, die zwar an Gott und die Seele glaubte, nicht aber an die Kirche und ihre Würdenträger. An diesem Spätwinterabend und in der darauffolgenden Nacht schneite es, Kälte und Wind drangen durch die Fensterritzen im ersten Stock des hundertjährigen Hauses Nummer 140 in der Grande Rue an der Place Saint-Quentin, heute Place Victor Hugo und an die Rue Victor Hugo grenzend. Die Mutter klagte, der Säugling sei nicht länger und dicker als ein Messer, der dreijährige Abel und der kräftige, siebzehn Monate alte Eugène hielten das Baby, als sie es im Schein flackernder Kerzen erblickten, für einen Kobold oder ein seltsames kleines Tier. Der Vater hatte sich nach zwei Söhnen eine Tochter namens Victorine gewünscht, es war ein Victor geworden.
Wenige Wochen später kehrte Léopold zu seinem Regiment zurück, reiste erst nach Marseille, dann nach Korsika, Italien und Spanien und sonst wohin, nicht immer gab er Auskunft über seinen Verbleib; zuerst schrieb er seiner Frau noch Briefe, auf die diese nur selten antwortete. Die militärischen Verdienste des »Citoyen Léopold Hugo« waren mit dem Rang des Bataillonschefs einer halben Brigade belohnt worden, seine Affären waren Legion. Die meiste Zeit war der Vater abwesend, anders als General Victor Fanneau de Lahorie, den Sophie Hugo zum Paten ihres jüngsten Sohnes erwählte und wohl auch zu ihrem Geliebten. Den Vornamen des Kindes, der auch sein eigener war, kommentierte Lahorie lebhaft: Victor, »der Sieger«, lateinischer Gegenpart zum altsächsischen Hugo, »der Denkende, Kluge«. Der kleine Victor widerlegte die pessimistische Prognose des Geburtshelfers und überlebte alle anderen. Er wuchs heran in einer Familie, deren ständige Ortswechsel, Zerwürfnisse und Geheimnisse ausreichend Stoff für die Einbildungskraft, für Träume und Geschichten boten, und in einer Zeit, in der Napoleon Bonaparte Frankreich und ganz Europa aufwühlte.
Schrecken des Krieges
1802 wurde Napoleon Bonaparte, der bereits den Feldzug nach Ägypten angeführt, mit dem Staatsstreich des 18. Brumaire im Jahre VIII des Revolutionskalenders die Macht an sich gerissen und anschließend Norditalien erobert hatte, 33 Jahre alt und zum Konsul auf Lebenszeit gewählt. Zwei Jahre später krönte er sich im Beisein von Papst Pius VII. zum Kaiser der Franzosen und ließ diesen historischen Augenblick mit einem Monumentalbild Jacques-Louis Davids verewigen. Das Jahrhundert erholte sich nicht von ihm, auf den späteren geostrategischen Interessen und politischen Entscheidungen, Kriegen und Friedensschlüssen in Europa lastete die Erinnerung an die Umwälzungen und Verwüstungen, die er angerichtet hatte. Die Kindheit Victor Hugos ging aus Sicht seiner Mutter im Schatten und in den Augen seines Vaters im Lichte Napoleons einher. Der Krieg legte sich, obwohl er nicht in Frankreich, sondern in anderen Ländern geführt wurde, über das Alltagsleben der Familien, und in den Köpfen von Männern, Frauen und Kindern rumorten die Feldzüge des jungen Heerführers als heroische Vision oder blutiger Schrecken.
Selten geisterte eine historische Figur so beharrlich durch die Fantasie, durch Literatur, bildende Künste und Musik eines ganzen Jahrhunderts:8 Napoleon als Vollender der Revolution, aufgestiegen aus dem Volke und einem der ärmsten Winkel des Kontinents, als glamouröser Held auf der Brücke von Arcole, an der er in Wirklichkeit nie vorbeikam;9 »Buonaparte«, der an der Etsch die Österreicher in die Flucht schlägt und beim Einzug in Mailand als Messias bejubelt wird; der kleine Mann, der sich mit der Sphinx von Gizeh misst; der entfesselte Reiter auf dem Großen Sankt Bernhard, den er in Wahrheit, gekleidet in schützendes Ölzeug, auf einem von einem Bergführer geleiteten Maultier überquerte;10 die »Weltseele« zu Pferde, die in Jena vor den Augen des Philosophen Hegel paradiert (der wenige Tage später sehen muss, dass die ganze Stadt in Flammen steht); der Triumphator der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz und das Genie, das die gewaltigen Absichten der Vorsehung erfüllt. Aber auch das Gespenst im Schneesturm an der Beresina, das Phantom im Schlamm von Waterloo, der weltentrückte Gefangene von Longwood House.
Im Dezember 1820, längst auf dem Weg ins Dichterleben, schaut der achtzehnjährige Victor Hugo zurück auf die Kindheitserfahrungen seiner Generation, die gerade politisch erwacht. Wie der indiskrete Brief des Vaters ist die Atmosphäre der frühen Jahre in den Familienroman und die Legende des Jahrhundertmenschen eingeschrieben. Er war noch jung, als Napoleon fiel, und spürte doch lebenslang seinen Schatten. Sie alle, schrieb er, Kinder des Konsulats, wurden auf den Knien der Mütter groß, während die Väter im Krieg waren, dem Genie der Revolution und dem Genie »Buonaparte« vertrauten und danach fieberten, mit Epauletten geschmückt zu werden. Die royalistisch gesinnten Mütter hingegen schauten mit sanften, tränenreichen Augen auf ihre Söhne, Schüler von acht und zehn Jahren, und hingen dem Gedanken nach, dass sie 1820 achtzehn Jahre alt sein würden und 1828 Oberst oder tot. 1802 erzählten sie ihnen von dem Kinderschreck Robespierre und 1813 von dem Kinderschreck Napoleon. Der kleine Victor, der seinen Vater kaum kannte, vertrat die Meinung der Mutter und war »vendéen«. Das hieß, dass er sich für die Chouans begeisterte, Bauern, Seefahrer und Schmuggler aus der atlantischen Küstenregion der Vendée, die 1793 vergeblich einen Aufstand gegen die Revolution und für die Bourbonen gewagt hatten und so tapfer waren, dass sie den Stoff für Balzacs ersten Roman, Les Chouans, und Hugos letzten Roman, Quatrevingt-Treize, lieferten. Der Vater ließ den Jungen schwärmen und sagte, man müsse nur die Zeit arbeiten lassen.
1820, als Napoleon auf der südatlantischen Felseninsel St. Helena seine Memoiren schrieb und in Frankreich mit dem alten Ludwig XVIII. wieder ein Bourbone auf dem Thron saß, hatte Victor Hugo bereits gestandene Dichter belobigt, Verse Vergils übersetzt, über »Beredtheit« und »Genie« nachgedacht,11 Gedichte verfasst, Preise gewonnen und zusammen mit seinen Brüdern die literarische Zeitschrift Le Conservateur littéraire gegründet. Er hatte mit zehn Jahren eine Burleske über einen Ehekrieg und ein fantastisches Drama skizziert, den Plan einer »einfachen, aber edlen« Tragödie über den Kampf zwischen Volk und Adel nach dem Tod Alexanders des Großen notiert und am Ende des groben Entwurfs den Vorhang fallen lassen.12 Fertig und gedruckt war die Erzählung Bug-Jargal, aus der ein Roman hervorging: über den Sklavenaufstand 1791 in Saint-Domingue, dem späteren Haiti, wo Napoleon 1802 auf Betreiben seiner Gemahlin Joséphine, Tochter eines Plantagenbesitzers, die Sklaverei wieder eingeführt hatte.
Wer den beredten, altklugen jungen Mann zu dieser Zeit hörte und las, ahnte nicht oder vergaß, dass er ein ernstes, bedächtiges Kind gewesen war, das wenig sprach und viel weinte. In den ersten Jahren widerfuhr ihm, was seine unsteten Eltern und die Zeitläufte für ihn bereithielten. Mit sechs Jahren hatte er schon mehr als 7000 Kilometer zurückgelegt; vielleicht ging er als Erwachsener, anstatt sich wie Freunde und Kollegen auf weite Reisen zu begeben, lieber zu Fuß und ließ nur seine Fantasie in die Ferne schweifen, weil sein Körper sich an die Mühsal des Reisens im frühen 19. Jahrhunderts erinnerte: die klamme Kälte und das Rumpeln in Kutschen, den stürmischen Wind auf einem Schiffsdeck, den stockigen Geruch des Bettzeugs in Poststellen, Gasthäusern, palazzi und palacios, die Einsamkeit, wenn Vater oder Mutter oder gleich beide fort waren. Denn nicht nur der Vater führte aufgrund von Abberufungen und Truppenverlegungen ein unstetes Leben, auch die Mutter machte sich zu gewissen Zeiten rar. Im Winter 1802 folgte sie ihrem Mann nach Marseille und überließ ihm die Kinder. Als die väterliche Brigade bald darauf nach Saint-Domingue, Léopold selbst nach Bastia beordert wurde und Sophie auf seine dringenden Briefe nach Paris nicht antwortete, schiffte sich der Vater im Februar 1803 mit seinen Söhnen nach Korsika ein. »Man glaubte, einen riesigen Krieger zu sehen, der in seinem Helm drei kleine Kinder mit rosiger Haut und Engelsgesichtern barg, ganz wie eine Mama es getan hätte.«13 Weiter ging es zum Stützpunkt Portoferraio auf Elba, wo eine lange Liaison mit Catherine Thomas begann und Sophie die Jungen abholte. Es heißt, das erste Wort Victors nach »maman« und »papa« sei ein italienisches gewesen, »cattiva«, für eine böse Frau. 1804 brach Sophie noch einmal auf, um ihren Mann auf Elba zur Rede zu stellen, doch die Reise endete am Hafen in Livorno, da in der Stadt die Pest ausgebrochen und der Fährverkehr eingestellt war.
Zurück in Paris, wechselte sie mit ihren Söhnen die Wohnungen, lebte zunächst mit ihnen in der Rue de Clichy und traf im Geheimen General Lahorie, dem 1804 wegen der Mitgliedschaft in royalistischen Verschwörergruppen die Todesstrafe drohte. Er war flüchtig und wurde steckbrieflich gesucht, »fünf Fuß zwei Zoll, schwarze Haare à la Titus, schwarze Brauen, schwarze Augen, tiefliegend und doch oft weit geöffnet, gelbe Augenringe, die Haut von Windpocken gezeichnet, sardonisches Lachen«.14 Lahorie informierte Sophie über ein geplantes Attentat auf Napoleon, der sich für die Krönungszeremonie in Paris aufhielt. In diesen dramatischen Zeiten spielte Victor Theater in einem Kindergarten in der Rue du Mont-Blanc, der heutigen Chaussée d’Antin. Noch konnte er die mittelalterlichen Legenden kaum verstehen, war aber für sie gewiss ebenso empfänglich wie später der junge Marcel in Prousts À la recherche du temps perdu, der alle Figuren und Geschehnisse, Grausamkeiten und Wunder, die im geheimnisvollen Licht einer Laterna magica an ihm vorbeiziehen, für wahr hält.
Als das Jahr 1807 zu Ende ging, reiste Sophie mit ihren Söhnen nach Italien. Sie überquerten den verschneiten Mont Cenis und den Apennin auf Maultieren und Schlitten, saßen in schwankenden Postkutschen, aßen in einer Almhütte das Fleisch eines Adlers und erschraken über Leichen von Briganten, die man an Bäumen aufgehängt hatte. Sie sahen Ruinen und Statuen, sahen Heilige oder Götter – wer konnte das schon immer unterscheiden – und alle Farben Roms, sie passierten die Abtei Montecassino und erblickten endlich den Golf von Neapel und den Kegel des Vesuvs. Die Fahrt hatte mehrere Wochen gedauert. Léopold Hugo stand in Diensten Joseph Bonapartes, Napoleons älterem Bruder und König von Neapel. Gerade war es ihm gelungen, eine Partisanengruppe unter dem gefürchteten Fra Diavolo, »Bruder Teufel«, gefangen zu nehmen. Die Zusammenkunft der Eheleute führte zu Streitereien über ihr Liebesleben, über Unzuverlässigkeit, Kosten und Unterhalt, und Sophie blieb nach sechs zähen Monaten nichts anderes übrig, als nach Paris zurückzukehren. Bald darauf wurde Léopold nach Valladolid und Guadalajara und dann nach Madrid verlegt, am 4. Dezember 1808 nahmen die Truppen Napoleons die Stadt ein.
Im März 1811 brach Sophie mit den Kindern und zwei Bediensteten noch einmal auf, da Joseph Bonaparte, inzwischen auch König von Spanien, die Familien hoher Offiziere eingeladen hatte. Die Postkutsche verließ Paris in Richtung Südwesten, passierte Blois und Poitiers, dann Angoulême mit seinen vielen Stadttürmen, und wurde an der Dordogne auf eine nächtliche Fähre verladen, die auf dem reißenden Fluss so sehr nach Backbord krängte, dass die Pferde sich laut wiehernd aufbäumten. Sie machte Halt in Bordeaux und setzte die Passagiere im baskischen Bayonne ab, wo die Hugos abends ins Theater gingen.
Von der spanischen Grenze an wurde die Reise in einer Prunkkutsche und mit militärischem Geleit fortgesetzt. Immer wieder kam es zu Überfällen, und in den Albträumen von Reisenden aus dem Land der Besatzer wurden Brunnen vergiftet, Postkutschen ausgeraubt, Frauen vergewaltigt, die Köpfe der Männer am Spieß gebraten und die Bäuche der Kinder aufgeschlitzt. Dass die Gewalt mit Napoleon ins Land gekommen war, vergaßen sie. Die Hugos machten Halt im Dorf Hernani und erblickten an jedem Haus das Wappen eines Don, sie sahen die Kathedralen von Burgos, Valladolid, Segovia und einmal ein Wegkreuz, auf das Franzosen die zusammengeflickten Gliedmaßen eines jungen, noch blutenden Spaniers genagelt hatten. Sie sahen marodierende Soldaten und Leichen von Menschen und Pferden im Staub der Straßen, erreichten schließlich Madrid und wohnten in dem von Franzosen besetzten Palacio Masserano.
Abel, Eugène und Victor entdeckten die Relikte einer altehrwürdigen Etikette, die barocke Pracht des Palastes, ein blaues Boudoir, einen Salon mit Wandverkleidungen aus rotem Damast, Balkone und Balustraden und Schätze aus aller Welt – die imposante Ahnengalerie, Bilder von Märtyrern, marmorne Bäder, venezianische Spiegel, Gläser aus Murano und aus Böhmen, riesige Vasen aus China und Japan. Treppen, Salons und Gemächer: eine große, herrliche Bühne, auf der Galanterie, Wagemut und religiöse Inbrunst ihre starken Auftritte hatten. Victor baute Luftschlösser, châteaux en Espagne. Léopold war inzwischen zum General befördert und geadelt worden. Die Söhne sahen den Vater kaum in seiner mit Epauletten geschmückten Uniform, und die märchenhafte Zeit im Palast endete abrupt, als er sie im Seminar für Adlige, dem Colegio San Antonio, unterbringen ließ. Hier gab es nur Mönche, Gebete, liturgische Gesänge, einen streng geregelten Tag, der um fünf Uhr morgens mit dem Weckruf des »encorvado«, des Buckligen, und mit einer eiskalten Dusche begann – ein Ritual, das Victor Hugo lebenslang beibehalten würde. In den dunklen Schlafsälen über jedem Bett ein Kruzifix, ansonsten karges Essen, freudlose Spaziergänge über den Friedhof und kein bisschen Freiheit. Eine mala educación. Einmal gerieten die Schüler versehentlich unter das Publikum eines Stierkampfs und sahen Ströme von Blut und zerfetzte Eingeweide, hin und wieder warfen sie verstohlene Blicke auf Pepita, die sechzehnjährige Tochter einer Maitresse Joseph Bonapartes.
Nicht weit entfernt von ihnen hatte der Hofmaler Francisco Goya sein Atelier, ohne dass sie davon wussten. Mit der Serie von Radierungen, Caprichos, war er in ganz Europa bekannt geworden, gerade arbeitete er an den Desastres de la guerra, die erst fünfzig Jahre später veröffentlicht werden sollten.15 Sie zeigen Gräuel und Albträume des spanischen Befreiungskrieges und die rohe Gewalt auf beiden Seiten – Massaker, Erschießungen, Vergewaltigungen, Galgen, Gekreuzigte und Leichenberge.
All dies nahm der junge Victor atmosphärisch wahr, als Ahnung, Gerücht, Geräusch oder flüchtiges Schauspiel; die spanische Sprache prägte sich ihm tief ein, und nie mehr vergaß er die Glut und Theatralität des Landes. Das Spanische überlebte in seinen Bühnenstücken, Gedichten, Häusern und Selbstinszenierungen. Im April 1812 kehrten Sophie, Eugène und Victor ohne den dreizehnjährigen Abel nach Paris zurück, der auf Wunsch seines Vaters als königlicher Page in Madrid blieb. Napoleon Bonaparte musste 1814 in Spanien, wie zwei Jahre zuvor in Russland, kapitulieren. Das Ende seiner Herrschaft war nahe. Und auch die Ehe der Hugos war nicht mehr zu retten.
Garten der Kindheit
Wenn Victor Hugo sich in späteren Schriften an seine Kindheit erinnert, ist selten klar, was er hinzudichtete oder verschwieg, tarnte und beschönigte. Zu raffiniert sind die Maskenspiele von Gedächtnis und Dichtung, zu rätselhaft die Überlagerungen und Palimpseste von Wirklichkeit und Traum. Hugos Rückblicke sind deshalb unzuverlässige Zeugnisse, zumal Fantasie, ästhetische Wahrnehmung und Neugier in seinen frühen Jahren gewiss reicher gebildet und bebildert waren als in einem weniger bewegten Leben und es ohnehin trostreich ist, sich die Herkunft groß und die Kindheit glücklich vorzustellen. Später schrieb er, die Kindheit sei nichts anderes als eine lange Träumerei gewesen, und bekannte in ganz unterschiedlichen Phasen seines Lebens, dass vieles, was in seinen Büchern autobiografisch erscheinen könne, nicht erinnert, sondern geträumt sei. Das erschien ihm nicht als Problem. Denn zwischen der Poesie und den exakten Wissenschaften sah er keinen Widerspruch, wie das Meer wiesen Dichtung, Musik und Mathematik ins Unendliche, alles hing mit allem zusammen, alles war vollkommen.16 Er romantisierte.
Das gilt, neben den Eindrücken der frühen Reisen, vor allem für eine Episode seines jungen Lebens, die er unter dem Stichwort Les Feuillantines aufrief oder unter anderen Namen verfremdete. Es geht um die Zeit zwischen Juni 1809 und Dezember 1813, nur unterbrochen von der einjährigen Spanienreise. Zu Beginn des Jahres 1809 zog Sophie Hugo von der Rue de Clichy in die Rue Saint-Jacques, gleich neben der Kirche Saint-Jacques-du-Haut-Pas und nicht weit entfernt vom Jardin du Luxembourg, der Sorbonne am Fuße der Straße, dem Collège de France und dem berühmten Lycée Louis-le-Grand, das zu diesem Zeitpunkt Kaiserliches Gymnasium hieß. Entlang der Straße, einer der ältesten von Paris, hatten sich Druckereien, Buchhandlungen, ein Lesekabinett und Ateliers von Graveuren und Zeichnern angesiedelt. Dass hier, im Quartier Latin, auch die Dichter wohnten, wusste der kleine Victor noch nicht. In dem eng bebauten Viertel standen damals, ein halbes Jahrhundert vor der Haussmannisierung, schiefe, niedrige Häuser, die ihre Fassaden und ihre Substanz seit dem Mittelalter kaum verändert hatten, in den Kurven und an abschüssigen Stellen der ungepflasterten, engen Straßen gerieten Kutschen leicht in eine gefährliche Schieflage und mieden sie deshalb nach Möglichkeit, wie wir aus Balzacs Le Père Goriotwissen.17 Wer die Rue Saint-Jacques weiter Richtung Süden spazierte, sah Überreste von Nonnenklöstern mit dem nach der Revolution als Militärkrankenhaus genutzten Konvent des Val-de-Grace und gelangte in eine noch ländliche Gegend mit Streuobstwiesen.
Im Juni 1809 zog die Familie wieder um, die neue Adresse wenige Meter vom Pantheon entfernt war ein ehemaliges Kloster der Feuillantinerinnen mit einem großen, verwilderten Garten, den man durch ein Gitter von der Rue Saint-Jacques aus betrat: 12, Impasse des Feuillantines. Nach der Revolution war das Anwesen verkauft worden, jetzt mieteten die Hugos eine weitläufige Wohnung mit Blick auf die Kuppel des Domes im Val-de-Grace. Victor war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt. Später schreibt er: »Zu Beginn dieses Jahrhunderts wohnte im verlassensten Viertel von Paris ein Kind in einem großen Haus, das ein großer Garten umgab und abschirmte. Dieses Haus nannte man vor der Revolution ›Kloster der Feuillantinerinnen‹. Dieses Kind lebte dort allein, mit seiner Mutter, seinen zwei Brüdern und einem alten Ordensmann, der beim Gedanken an 93 noch immer zitterte, einem würdevollen Greis, der, einst verfolgt und nun nachsichtig, ihr gütiger Lehrer war und sie viel Latein, ein bisschen Griechisch und gar nichts aus der Geschichte lehrte. ›Ich hatte in meiner blonden, ach! zu kurzen Kindheit / drei Lehrer: – einen Garten, einen alten Priester und meine Mutter.‹18 Ganz hinten im Garten standen sehr hohe Bäume, die eine halb verfallene Kapelle versteckten. Den Kindern war es verboten, bis zu dieser Kapelle zu gehen.19
Die Kindheit als Märchen: ein verwunschener Garten, verlassene Altäre zwischen verwitterten Spalieren, in Mauernischen Madonnen und Reste von Kreuzen, Gebäude, die ihre Geheimnisse vor neugierigen Augen verbergen. Und ein Wink aus der Geschichte, die Plakette mit der Aufschrift: NATIONALES EIGENTUM. Bei Schuleintritt konnte Victor lesen, machte ein halbes Jahr später in einem Diktat der Weihnachtsgeschichte nur einen einzigen Fehler und begann, Liebes- und Abenteuerromane, erotische Literatur und philosophische Werke aus dem Lesekabinett nebenan zu verschlingen. Sein Lieblingsbuch war Tausendundeine Nacht.20 Die Brüder spielten, lauschten dem »lärmenden Ratschlag der Vögel«, schauten vorbeiziehenden Wolken zu und »Blüten, die ihre Augenlider öffneten«, erfanden einen behaarten Monsterkraken, der zwischen alten Steinen hauste, und entdeckten beim Stöbern auf dem Dachboden eine illustrierte Bibel, die noch nach Weihrauch roch. Dann versanken sie in Geschichten und Illustrationen von Joseph und seinen Brüdern, von Ruth, Booz und dem guten Samariter und waren so verzaubert, als hielten sie den »Flaum weicher Vogelfedern« in Händen. Ein Junge, der in Bäumen herumkletterte und nie den Boden berührte, gesellte sich zu ihnen, und ebenso Victor und Adèle Foucher, deren Eltern Sophie Hugo kannten. Victor Hugo umschwärmte Adèle. Léopold Hugo besuchte seine Familie nie, anders als sein Bruder Louis, der seinen Neffen von bravourösen Gefechten in Preußisch-Eylau erzählte. Einmal sah Victor ein Dragonerregiment vorbeimarschieren, mit Napoleon und seinem Vater an der Spitze, Epauletten und Waffen leuchteten in der Sonne. War das nur eine Vision? Einst hatte der junge Parzival vorbeiziehende Ritter gar für Engel gehalten.
Am Tisch der Hugos saß in diesen Jahren Victors Pate Victor Lahorie, den die Mutter als ihren entfernten Verwandten Monsieur de Courlandais vorstellte. Vielleicht war ihr dieses Pseudonym eingefallen, weil Ludwig XVIII. sich unter dem Schutz des Zaren nach Kurland, in die Nähe des alten baltischen Adels zurückgezogen hatte. Lahorie war soeben aus einem mehrjährigen Exil nach Frankreich zurückgekehrt. Die Kinder mochten den eleganten Gast, der ihre Mutter in gehobene Stimmung versetzte und tagsüber lange Spaziergänge durch den fünf Morgen großen Garten machte. Er las ihnen aus Tacitus und Vergil vor, pries die Freiheit als höchstes Gut und übernachtete in der Sakristei der Kapelle.
Im Morgengrauen des 30. Dezember 1810 drang ein Polizeiaufgebot in den Garten ein und stellte Lahorie, er wurde in Handschellen abgeführt und erst in den Turm des Château de Vincennes, dann in das Gefängnis La Force gebracht. In beiden Kerkern hatten berühmte Gefangene gesessen, Staatsfeinde und gefährliche Autoren wie der Marquis de Sade und Choderlos de Laclos. Die Kinder merkten nur, dass der geheimnisvolle Mann verschwunden war. Am 23. Oktober 1812 wurde Lahorie von einem royalistischen Verschwörer aus dem Gefängnis befreit, vertrieb den Polizeichef aus der Präfektur und beteiligte sich an Vorbereitungen für einen Putsch und dem in Kasernen verbreiteten Gerücht, der Kaiser sei in Moskau gefallen. Der Plan wurde verraten. Elf Männer wurden verhaftet, was Madame Hugo erfuhr, als sie sich gerade im Hause Foucher aufhielt. Ausgerechnet ihr guter Freund Pierre Foucher musste den Fall übernehmen und konnte Lahorie nicht retten. Am 27. Oktober wurden die Verschwörer vor dem kaiserlichen Kriegsgericht angeklagt und zwei Tage später vor den Augen einer großen Menschenmenge standrechtlich erschossen.
Damals war jede Hinrichtung ein Massenspektakel. An diesem Tag, es regnete leicht, nahm Sophie Hugo, in einen schwarzen Schleier gehüllt, ihren Jüngsten bei der Hand und ging mit ihm die wenigen Schritte bis zur Kirche Saint-Jacques-du-Haut-Pas. »Lies!«, sagte sie, und er las den Anschlag an den Säulen des Portals: den Urteilsspruch des Kaiserlichen Kriegsgerichts und die Meldung über die Erschießeung von drei Generälen, darunter Lahorie, wegen der Verschwörung gegen das Kaiserreich und den Kaiser. Victor verstand nicht nur, dass Lahorie sein Pate und zugleich der sonderbare Monsieur de Courlandais gewesen war, sondern auch, dass der Ruf nach Freiheit oder eine Revolte gefährlich war.
Die »Generalin Hugo« wurde vom Gericht verschont, obwohl sie offenbar Mitwisserin und Botin der Untergrundgruppe war und diese, wie General Hugo höchst missbilligend argwöhnte, mit unerklärlich hohen Geldausgaben unterstützt hatte. Im Herbst 1815, als Napoleon schon auf St. Helena in der Verbannung saß, schrieb »Mad Hugo« an den »rechtmäßigen« Kriegsminister Ludwigs XVIII., sie hätte sich an jenem fatalen Tag retten können, weil sie den Polizeiminister, einen ehemaligen Verbündeten Lahories, mit gewissen Tatsachen aus seiner Vergangenheit erpressen konnte. Sie erlaube sich nun im Zustand äußerster Not und aus Sorge um ihre Kinder, den Adressaten um seine Fürsprache bei Ihrer Majestät zugunsten einer bescheidenen Unterstützung zu bitten, da ihr Gatte schon lange in einer ehebrecherischen Beziehung lebe, keinen Unterhalt mehr zahle und inzwischen ihre Möbel bis auf Bett und Matratze gepfändet seien. Einzig die Verzweiflung über die elende Situation erkläre, dass eine Mutter die Fehler und das schlechte Benehmen des Vaters ihrer Kinder bekanntgebe.21
Victor Hugo erlebte mit zehn Jahren den ersten Staatsstreich seines Lebens und die große Geschichte als etwas, das ihn mit »du« ansprach. Namen und Orte, Schlachten, Eroberungen und Verträge dieser grundstürzenden Zeit waren fremd und unverständlich, ihr Klang jedoch wurde zum Resonanzraum seiner historischen Fantasie, in der seine Eltern sich als Helden verfeindeter Lager behaupteten – der Vater in glänzender Uniform, die Mutter eine Banditin aus Liebe –, und sein Pate, ein zum Tode verurteilter Rebell, eine Zeit lang im Garten der Kindheit gelebt hatte. Gefängnisse, wirkliche und erdachte, blieben Schicksalsorte seines Schaffens, auch als er längst im tête-à-tête mit der Unermesslichkeit des Ozeans lebte. Napoleon Bonaparte war unterdessen in weiter Ferne. Zu Beginn des Jahres 1812 befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Macht und hatte ganz Europa bis auf Russland und das Osmanische Reich unterworfen. Einige Monate zuvor war sein Sohn geboren worden, viele hatten das Erscheinen eines augenfällig schönen Kometen als Glückszeichen gedeutet. Gerade jedoch hatte die Grande Armee nach heftigen Kämpfen und Verlusten Moskau verlassen und zog nach Südwesten. Bald setzte der russische Winter ein.
Sechzig Jahre später kehrt Victor Hugo als weißhaariger Mann in den Garten seiner Kindheit zurück. Da ist er längst der Jahrhundertdichter und der Mythos, an dem er lebenslang mitdichtete. Dieser Mythos, schrieb Hugo von Hofmannsthal 1901, wurzelt im Garten der Feuillantines. Hier habe der junge Victor Hugo zur wunderbaren Intimität mit Bäumen und Blumen, Vogelnestern, Spinnen und Sternen gefunden, sich fantastischen Wesen hingegeben und tagsüber in einen Faun verwandelt, während nachts der erhabene tiefblaue Abgrund sich über ihm wölbte und die Gestirne mit übernatürlichen Augen starr auf ihn herabschauten. Hier wurde die Natur in »panischer Trunkenheit« zum Symbol und dem Genie der Sprache bestimmt, »mit der Fülle seiner produktiven Kraft die Fülle der Epoche zu treffen«.22
1871 kommt Victor Hugo, um dieses Paradies auferstehen zu lassen, für die jungen Menschen, die es sich nicht vorstellen können, und diejenigen, die mit ihm alt geworden sind und die Überzeugung teilen, dass Herkunft und Kindheit ein Licht auf das Leben eines Erwachsenen werfen. Der Rausch des Fortschritts und der Sturm der Geschichte sind über den Ort hinweggefegt, Bäume, Kapelle und Haus verschwunden. »Die Verschönerungen, die im Jardin du Luxembourg wüteten« setzen sich bis zum Val-de-Grace fort und haben »diese demütige Oase« zerstört. Eine »große, ziemlich nutzlose Straße« geht nun dort vorbei, von den Feuillantines ist nur etwas Gras geblieben und ein verfallenes Mauerstück, sichtbar zwischen zwei neuen, hohen Gebäuden. »Doch nichts davon lohnte mehr, angeschaut zu werden, es sei denn mit dem tiefen Auge der Erinnerung. Im Januar suchte eine preußische Bombe sich dieses Fleckchen Erde aus, um herunterzufallen, eine Fortsetzung der Verschönerungen, und Herr von Bismarck vollendete, was Haussmann begonnen hatte.«23 Noch einmal zehn Jahre später, als zahlreiche Straßen umbenannt sind, was in diesem Jahrhundert oftmals geschah, bittet Hugo den Präfekten, er möge die Feuillantines verschonen, einen der wenigen Reste des alten Paris, der niemandem schade.
Groß sein oder gar nicht
1815 war ein schlimmes Jahr für die Familie Hugo und den Kaiser. Sophie Hugo hatte 1813 mit Eugène und Victor eine kleine Wohnung in der Rue des Vieilles-Tuileries, heute Rue du Cherche-Midi, im 6. Pariser Arrondissement bezogen. Ihren Vater sahen die Kinder nie, die Eltern lieferten sich mittlerweile einen Rosenkrieg und denunzierten sich wechselseitig gegenüber Amtsträgern und Gerichtsbarkeit. In seitenlangen Briefen empörte sich Sophie über die Respektlosigkeit und Sittenlosigkeit ihres Mannes, der offen mit seiner »Konkubine« lebte, in knapperer Form beschuldigte Léopold seine Gattin, »die Tréb.«, der Unstetigkeit und Geldgier. Er entzog ihr die Jungen, brachte sie in der Pension Cordier unter und wies seine Schwester an, die Rückkehr zur Mutter und deren schädlichen Einfluss auf die Erziehung unter allen Umständen zu verhindern. Bald klagten die Brüder, keinen Zeichenunterricht mehr zu bekommen, obwohl sie brav Latein paukten und für Auszeichnungen in Philosophie nominiert wurden. Sie lernten Armut, Enttäuschung und Verlassenheit kennen.
Gemeinsam begannen die »ergebenen und respektvollen Söhne«, Bittbriefe an ihren »lieben Papa« zu schreiben, den sie, wie es die Kinder aus dem Volke taten, duzten. Es lag eine Rechnung über zwei Paar Hosenträger, zwei Zahnbürsten, einen Wasserkrug, eine Waschschüssel und neue Schuhe für Eugène vor, sie hatten kein Geld für Kleidung, konnten nur einmal wöchentlich die Wäsche wechseln und Schulsachen, Bücher, Papier, Rechenschieber und Zirkel nicht bezahlen. Noch dazu schrie die Tante sie mit derben Worten an, gerade so, als seien sie schwererziehbare Flegel, hielt die Adresse des Vaters geheim und entmutigte sie mit der Bemerkung, ihre Briefe kämen ohnehin nicht an. Es war verlorene Zeit, sich als »Ihre sehr bescheidenen und sehr gehorsamen Diener« an diese böse Fee zu wenden. An die »liebe Mama« sind nur zwei Briefe erhalten, sie möge bald kommen, sie wüssten nicht mehr, was sie sagen und tun könnten, und seien ganz verwirrt.24Weitere Briefe an die Mutter wurden wohl beschlagnahmt und vernichtet. Die Summe, die der zunehmend gereizte und von Familie und Politik überforderte Vater am Ende schickte, reichte hinten und vorne nicht. Er lamentierte über ausbleibenden Sold und redete nicht mehr mit Abel, weil dieser sich für seine jüngeren Brüder einsetzte.25 Das Hauptthema der Korrespondenz der Familie Hugo war in diesen Jahren Geld, fehlendes Geld.
Während der Alltag der Heranwachsenden von Sorgen, Ängsten und Peinlichkeiten beschwert war, ging das Empire unter. Der Kaiser hatte im Anschluss an die verheerende Völkerschlacht bei Leipzig und den Frieden von Fontainebleau abdanken müssen und war 1814 ins Exil nach Elba gegangen. Am 1. März 1815 kehrte er für die Herrschaft der »Hundert Tage« nach Paris zurück, verscheuchte den Bourbonen und führte seine Soldaten noch einmal in den Krieg gegen die alliierten Mächte. Am 18. Juni 1815 wurde seine Armee von den Engländern unter General Wellington und den Preußen unter Feldmarschall Blücher 15 km südlich von Brüssel vernichtend geschlagen.
Der dreizehnjährige Hugo ahnte, dass die blank liegenden Nerven seines Vaters und der Anbruch einer neuen Zeit irgendetwas miteinander zu tun hatten. »Vive le Roi!« notierte er am 17. Juli in seine lateinische Grammatik und schrieb einige Verse, in denen er den Kaiser und seinen schändlichen Ruhm verfluchte.26 Viele Jahre später wurde Waterloo zu einem der stärksten Kapitel in seinem berühmtesten Roman, Les Misérables. Stendhal hingegen, der ebenfalls seine großen Romane noch nicht geschrieben hatte, war in diesem weltgeschichtlichen Augenblick bereits 32 Jahre alt und hatte drei Jahre zuvor am Russlandfeldzug teilgenommen. Er erlebte die Turbulenzen des Jahres 1815 von Mailand aus und klagte, alles sei verloren, sogar die Ehre.27 1837 erzählt er im Roman La Chartreuse de Parme die Schlacht als virtuoses, von albtraumhaften Impressionen durchsetztes Schelmenstück: Fabrizio del Dongo, der blutjunge Tor mit den schönen Augen und dem Enthusiasmus des Italieners für Napoleon, will um jeden Preis ein Held werden. Auf einem Klepper nähert er sich dem Kampfgeschehen und überlebt das Gemetzel in der Obhut einer Marketenderin. Kundschafter und Deserteure überbringen Schreckensmeldungen, hier eine verstümmelte Leiche, dort ein ausgeweideter Kadaver. Ich habe Feuer gesehen und Rauch, sinniert Fabrice benommen. War das Waterloo?28 Balzac schrieb dem Autor, er selbst sei an einem Waterloo-Roman gescheitert, doch Stendhal habe beherzigt, was zu einem schönen Roman gehört, »alles Wirkliche im Unwirklichen verschwinden zu lassen. Dann wird alles wirklich.«29 Hugos Waterloo-Vision, das Szenario einer Zeitenwende, konnte Balzac, der 1850 starb, nicht mehr lesen, ebenso wenig wie das Klagegedicht L’Expiation, das Hugo 1851/52 schrieb, als der nächste Napoleon die Macht ergriff:
Waterloo!! Waterloo! Waterloo! Trostlose Ebene!
Wie eine Welle, die in einer zu vollen Urne aufwallt,
In deinem Kessel aus Wäldern, Hügeln, Tälern,
Vereinte der bleiche Tod die düsteren Bataillone. […]30
Neben Pathos und Klage aber konnte er, wie eine spätere Notiz zeigt, auch Sarkasmus. Aus englischen Zeitungen erfuhr er, dass in Hull eine Schiffsladung vom Kontinent eingetroffen war, mehrere Millionen Scheffel übereinandergeworfener Knochen von Menschen und Pferden, eingesammelt auf den Schlachtfeldern von Austerlitz, Leipzig, Jena, Friedland, Eylau und Waterloo. Nun wurden sie industriell zermalmt und das Knochenmehl als Dünger nach Doncaster, Yorkshire, geliefert, soweit es nicht für die Produktion von Zucker verwendet wurde. Der letzte Abfall der Siege des Kaisers: die englischen Kühe mästen.31
1815 lagen die literarischen Visionen und Schreckensbilanzen noch in weiter Ferne; der dreizehnjährige Hugo nahm das Tagesgeschehen mit der Wachheit und Neugier eines Offizierssohnes wahr, ohne bereits die Dimension erfassen zu können – wenn das überhaupt jemand konnte. Die Hundert Tage waren zu Ende, der Wiener Kongress ordnete die Karte Europas neu und vermied es unter der klugen Regie Metternichs, Frankreich zu demütigen. Dass nach Waterloo eine neue Zeit anbrach, die älter zu sein schien als die gerade untergegangene, das zeigte sich jedoch augenblicklich in Paris. Die wichtigen Männer des Empire verloren ihre Posten, soweit sie sich nicht entschlossen, fortan dem König und der Restauration zu dienen. Der Katholizismus wurde erneut zur Staatsreligion und die mehr als zwanzig Jahre zurückliegende Hinrichtung Ludwigs XVI. und Marie-Antoinettes in großen Kreuzwegprozessionen als Passion zelebriert.32
Nach dem Intermezzo der Hundert Tage machte sich der Wandel auch in alltäglichen Dingen und im öffentlichen Raum bemerkbar. Die Trikoloren wurden beschlagnahmt und das Lilienbanner wieder aufgezogen, die Straßen erhielten ihre vorrevolutionären Namen zurück und das traditionsreiche Lycée Impérial, das die Brüder Hugo besuchten, hieß nun wieder, wie noch heute, Lycée Louis-le-Grand. Ludwig XVIII. hatte im Terrorjahr 1793 die Hinrichtung seines Bruders erlebt. Er selbst hatte kein politisches Amt bekleidet, bezeichnete sich als Citoyen, galt als schöngeistig und müßiggängerisch und übersetzte Werke von Horace Walpole. Jetzt, 1815, erbte er mit sechzig Jahren ein von Kriegen erschöpftes Land. Und plötzlich konterkarierte sein entschiedener schwarzer Blick die rosigen Wangen, die gemütliche Leibesfülle und das gutmütige Lächeln, erweckten sein Pragmatismus und die Selbstverständlichkeit seiner Handlungen den Eindruck, als säße er seit Jahrhunderten auf dem Thron. Er entledigte sich seiner Gegner durch Razzien und konnte unerwartet großzügig sein. Einmal, bei einem Besuch in Saint-Denis, als das Volk ihn mit »Vive le roi!« begrüßen sollte, rief ein mit Viktualien beladener Metzger »Vive le cochon!«, wurde verhaftet und dem König vorgeführt. Dieser ließ ihn mit dem Argument laufen, er könne mit »Schwein« unmöglich ihn gemeint haben. Ludwig XVIII. konnte die Abtretung der Stadt Landau, des Saarlandes und Savoyens an Bayern und Preußen nicht verhindern, gewaltige Reparationszahlungen jedoch auf eine geringe Summe herunterhandeln.
1815 war dennoch ein finsteres Jahr. In Indonesien brach der Vulkan Tambora aus und verdunkelte die Sonne, 1816 wurde für Nordamerika und Europa das »Jahr ohne Sommer«, geprägt von schrecklichen Geschehnissen, grausigen Fantasien und großer Not. In der Villa Lord Byrons am Genfer See schrieb die achtzehnjährige Mary Godwin, spätere Mary Shelley, den Roman Frankenstein; am 5. Juli sank vor der senegalesischen Küste die Fregatte La Méduse, deren Mannschaft in Brest mit dem Auftrag an Bord gegangen war, die französische Souveränität in Senegal zu sichern. Der Kapitän war unerfahren, aber Royalist. Die Fregatte führte nur sechs Rettungsboote mit sich, 151 der 400 Mann Besatzung rettteten sich auf ein Floß, unter ihnen brach Kannibalismus aus. Drei Jahre später präsentierte Théodore Géricault im Salon, der großen Pariser Jahresausstellung, sein Kolossalbild Le Radeau de la Méduse. Es wurde zu einem der berühmtesten Bilder des 19. Jahrhunderts.
Der König subventionierte die durch Missernten verarmten Bauern und erließ, da er den Zorn des Volkes fürchtete und sich an den Sturm auf die Bastille 1789 erinnerte, eine Generalamnestie für den Diebstahl von Lebensmitteln. Er begann, eine Armee nach dem Leistungsprinzip aufzubauen, und brüskierte damit den Adel; gleichzeitig kurbelte er die Wirtschaft an. Er beriet sich wöchentlich mit den Ministern und ließ sich im Königsmantel und am Schreibtisch malen. Nach einem Vierteljahrhundert Revolution, Terror, Kriegen, Umstürzen und den Hundert Tagen wirkten die geordnete Amtsführung, die Verfassungstreue und der offensichtliche Fleiß des Königs beruhigend auf das noch immer aufgewühlte Volk.
Sophie Hugo, die das Ende Napoleons herbeigesehnt hatte, wechselte weiterhin ihre Wohnsitze und lebte von Ende 1818 bis Anfang 1821 im dritten Stock eines Hauses in der Rue des Petits-Augustins in Saint-Germain-des-Prés.33 Die dritte Etage war unter dem Aspekt der sozialen Topographie ein Abstieg. Ihr jüngster Sohn hingegen arbeitete an seinem Aufstieg. Bereits 1816, mit vierzehn Jahren, hatte er verkündet, Chateaubriand werden zu wollen oder gar nichts. François-René de Chateaubriand, 1768 als Sohn bretonischer Adliger in Saint-Malo geboren, war Mitglied der Académie Française und Star des Pariser Literaturbetriebs. Er nannte Napoleon ein Genie und zeigte sich zugleich im Unterschied zu diesem als glühender Katholik. 1815 erklärte er sich zum Anhänger Ludwigs XVIII. Chateaubriand war Kosmopolit, bereiste vier Kontinente, überquerte die Weltmeere und schilderte das intensive Erlebnis der nordamerikanischen Wildnis, so wie es zwanzig Jahre später James Fenimore Cooper in The Last of the Mohicans tun würde. Er kannte sich aus mit Bergen, Wüsten und Ozeanen und er erforschte tiefe Empfindungen, Sehnsucht, Schmerz, Einsamkeit; seine Erinnerungen, Mémoires d’outre-tombe, schildern in atemberaubend schöner Sprache sein bewegtes Leben und Denken. 1802, im Geburtsjahr Hugos, erschien René.34 Der Roman erzählt von einem jungen Franzosen heftigen Gemüts, der in den schottischen Highlands nach Spuren des mythischen Sängers Ossian sucht und später, getrieben von unbestimmter Sehnsucht, dem mal du siècle, das erregte Europa verlässt. Bei dem Stamm der Natchez in Louisiana findet er zu sich, kommt jedoch bald in Kämpfen mit französischen Siedlern ums Leben. Den Felsen, auf dem er bei Sonnenuntergängen saß und träumte, halten die Indigenen in Ehren. Damit endet der Roman. Der Name René aber wird zur Chiffre für den Romantiker.
Kein Geringerer als dieser Gigant war das Vorbild des jungen Hugo, dessen kühne Ansage freilich ebenso wenig verbürgt ist wie Flauberts Spruch, er selbst sei Madame Bovary. Dass aber Chateaubriands Romanheld ins Exil ging und dort, wenn er träumte, auf einem Felsen saß, das stand Hugo gewiss vor Augen, wenn er sich später als Träumender im Exil fotografieren ließ. Jetzt, als Jugendlicher, machte er durch die Teilnahme an Poesie-Wettbewerben der Académie Française auf sich aufmerksam, korrespondierte als Fünfzehnjähriger mit den sogenannten »Unsterblichen« der ehrwürdigen Institution und gründete zusammen mit seinen Brüdern die Zeitschrift Le Conservateur littéraire. Damals ähnelte er, wie Fans jetzt feststellen, dem Popstar Taylor Swift.35 Mit achtzehn Jahren schrieb er eine Ode auf die königstreuen Helden der Vendée und widmete sie Chateaubriand, der ihn daraufhin »das sublime Kind« genannt haben soll. Mit zwanzig Jahren folgte eine Ode auf den Duc de Berry, den Neffen des kinderlosen Ludwig XVIII. und potenziellen Thronfolger, der von einem Sattler erdolcht worden war. Es heißt, der König habe bei der Lektüre des Gedichtes geweint, und sein Bruder, der spätere Karl X., vergaß Hugos Huldigung nicht. Der junge Dichter aber vergaß das Gesicht des Mörders nicht; er hasste ihn und empfand doch Mitleid, als er zum Schafott geführt wurde.
Anne-Louis Girodet-Trioson,
Chateaubriand
Wenige Monate nachdem sein Vater ihn brieflich ermahnt hatte, mangels Vermögen einen anständigen Beruf zu ergreifen, wurden Hugo und ein Mitbewerber als vielversprechende, mittellose Dichter mit je einer Jahrespension von 1000 Francs ausgezeichnet – das Mehrfache der Einnahmen eines Arbeiters in diesen Jahren. Im Bewilligungsschreiben des Haushaltsministers wurden sie Hommes de lettres genannt. Das war die Aufnahme in den Club der Dichter.36 Von den zwei jungen Männern machte nur Victor Hugo Karriere. Dass dieser glühende junge Royalist einmal der weltweit gefeierte und kultisch verehrte Dichter des Volkes und der Elenden werden würde, konnte damals dennoch niemand ahnen. Schon fünf Jahre später aber, als Chateaubriand ein Mann von fünfzig Jahren ist, setzt Hugo sich an die Spitze der großen romantischen Bewegung.
Romantik glüht
Auf der Erfolgsspur
Die Pariser Kulturszene des frühen 19. Jahrhunderts war hitzig und kämpferisch. Und auch wenn sich Entwicklungen in Literatur und Künsten gewiss nicht unmittelbar auf die Politik zurückführen lassen, ist es umgekehrt nicht so, dass diese keinen Einfluss auf ästhetische Tendenzen hätte. Hugo wurde zum Dichter in einer Zeit rasanter politischer Umbrüche, die Bewusstsein, Geschmack und Stil der Künstler prägten und oft ihre Lebensläufe grundlegend veränderten. Ohne die Französische Revolution und Napoleon Bonaparte hätte es die europäische Romantik mit ihren philosophischen Idealen Freiheit und Subjektivität nicht gegeben. Der Name »Romantik« ging auf mittelalterliche Texte in romanischer Volkssprache und Volkslieder, »Romanzen«, zurück und bezog sich im 17. und 18. Jahrhundert auf Liebes- und Abenteuergeschichten mit »romanhaftem« Charakter; die romantische Bewegung wurde jedoch aus dem Norden, aus Deutschland und England, nach Frankreich importiert.
Daran hatte eine einflussreiche Frau wesentlichen Anteil: Madame de Staël. Germaine de Staël wurde 1766 als Tochter des Genfer Bürgers, Pariser Bankiers und zeitweiligen Finanzministers Ludwigs XVI., Jacques Necker, geboren und genoss eine umfassende Bildung im Geiste der Aufklärung und des Kosmopolitismus. Sie wuchs in Paris auf, saß mit fünf Jahren im Salon ihrer Mutter, den die Philosophen besuchten, verbrachte als Kind einen längeren Aufenthalt in England und heiratete mit zwanzig Jahren den schwedischen Botschafter Erik Magnus Staël von Holstein. Als 1792 die Revolution in Terror mündete, floh sie in das Schloss Coppet am Genfer See. Ihr Liebes- und Familienleben waren Gegenstand des Klatsches, immerhin bekam sie fünf Kinder von vier Vätern. Zu ihren Liebhabern zählten der Staatsmann Talleyrand sowie Benjamin Constant, der mit dem Roman Adolphe über einen zaudernden, in Liebesdingen und den Wirren der Zeit ratlosen jungen Mann einen heute modern anmutenden Klassiker schrieb. Gleichzeitig behauptete sie sich als Schriftstellerin und Philosophin in der von Männern beherrschten Kulturszene, ließ sich von Goethe und Lord Byron bewundern, reiste mit dem Hauslehrer ihrer Kinder, August Wilhelm Schlegel, nach Italien und sah souverän darüber hinweg, dass der spöttische Heinrich Heine diesen als ihren Mamelukken bezeichnete. Als Napoleon Bonaparte Europa mit Krieg überzog, sah sie in ihm immer weniger den Vollender der Revolution, als der er ihr, wie vielen anderen, zuerst erschienen war. Napoleon seinerseits misstraute der furchtlosen Salonnière und Netzwerkerin, deren Romane von emanzipierten Frauen handeln, die leidenschaftlich und kunstbegeistert sind und Sophie, Delphine und Clélia heißen. Er ließ sie bespitzeln, und 1802, zwei Jahre bevor er sich zum Kaiser der Franzosen wählen ließ, verbannte er sie und sorgte dafür, dass die »Metze« nicht mehr in die Nähe von Paris kam.
François Gérard,
Madame de Staël
In den Folgejahren unternahm Madame de Staël zweimal eine Winterreise nach Deutschland und arbeitete an der Abhandlung De l’Allemagne, in der sie Franzosen und Deutsche nach politischer Ordnung, Kultur, Temperament, Charakter und Sitten unterscheidet. Dieser Ansatz gründet in der damals anerkannten, von Gemeinplätzen nicht freien Völkerpsychologie. Im zentralistischen Frankreich und den französischen Künsten des Empire beobachtete Madame de Staël das Fortleben eines in formaler Strenge erstarrten Klassizismus. In der »rückständigen Kleinstaaterei« Deutschland hingegen sah sie die Heimat des Romantischen. Darunter verstand sie: Poesie der Seele, Enthusiasmus und den Traum vom Unendlichen, die sie eher im einfachen Volk als in der geistreichen und spöttischen »guten Gesellschaft«, in der Provinz eher als in der Stadt, im christlichen Glauben eher als im freigeistigen Verstand entdeckte.37
De l’Allemagne und die englische Übersetzung wurden 1813 in London gedruckt. Die Autorin hatte die Druckfahnen vor der französischen Zensurbehörde retten können und über Österreich, Russland und Schweden nach England gebracht. 1814 erschien das Buch in Deutschland und 1815 in Paris. Zu diesem Zeitpunkt war es im übrigen Europa längst ein Bestseller. Während jedoch die deutsche Romantik in Literatur, Malerei und Musik seit Jahren ihre schönsten Werke hervorbrachte, war der Roman René bislang ein einsamer Höhepunkt der französischen Romantik und sein Autor Chateaubriand der Einzige, dem der junge Hugo Enthusiasmus zugestand. 1815 war der Kulturkampf zwischen Klassizismus und Romantik in vollem Gange, acht Jahre später spitzte Stendhal ihn in seinem Traktat Racine et Shakespeare zu: Der große Racine, dessen Tragödien im 17. Jahrhundert am Hofe Ludwigs XIV. brillierten, verkörpere den Klassizismus und das Alte, das Genie Shakespeare, wenngleich noch vor Racines Geburt verstorben, die Romantik und das Neue. Stendhal forderte, endlich alle Verbote in den Künsten zu streichen. Aber sein Manifest war, obwohl es von Theaterregeln und einer überholten Korrektheit der Repräsentation handelte, ein Text zum Lesen. Dass die romantische Schlacht auf der Bühne entschieden werden musste, das wusste Hugo und sicherte 1830 mit dem Spektakel und Tumult um Hernani seine steile Karriere.
Am 28. Juni 1821 starb Sophie Hugo mit 49 Jahren an einer verschleppten Lungenentzündung. Seit drei Jahren geschieden, lebte sie völlig verarmt in einer von Abel gemieteten Wohnung in der Rue de Mézières, nahe dem Jardin du Luxembourg. Beim Gärtnern hatte sie sich unterkühlt und nicht mehr erholt. Victor kannte seinen Vater nur als großen Abwesenden, nannte sich Vollwaise und trauerte. Für die Kosten der Beerdigung verpfändete er eine Uhr und Tafelsilber; um die Arztkosten zu bezahlen, schrieben die Brüder wieder Bittbriefe an den Vater und Pierre Foucher.
Der Tod ebnete den Weg für die Heirat mit Adèle Foucher. Die Mutter hatte Briefe Victors an das junge Mädchen gefunden und sich der Brautwerbung entgegengestellt, weil sie dem einstigen Freund Foucher den Prozess gegen Lahorie nachtrug. Die Liebe ihres Sohnes, der sich in vollendeter Galanterie »Sklave« eines »Engels« nannte, konnte sie dennoch nicht unterbinden. Jetzt warb er beherzt um Adèle, und dabei fiel auf, dass er nicht getauft war – untragbar für die sehr katholische Familie Foucher. Léopold Hugo beteuerte fadenscheinig, die Taufe seines jüngsten Sohnes sei damals in Italien erfolgt, und ließ von Pater Lamennais, dem Vorreiter katholischer Soziallehre und der Trennung von Staat und Kirche, eine Gefälligkeitsbescheinigung ausstellen. Lamennais lebte in einer Wohnung der Feuillantines. Victor besuchte ihn an diesem verklärten Ort seiner Kindheit, und Lamennais schrieb einem Freund, er habe mit dem jungen Dichter, der schon auf sich aufmerksam mache und gewiss zu Ruhm gelange, die reinste und ruhigste Seele inmitten der Pariser Kloake kennengelernt. Überdies empfahl er ihn dem einflussreichen Kritiker Saint-Victor.38
Für Victor lief alles bestens. Sein Bruder Eugène hingegen litt unter psychischen Störungen. Schon während der Schulzeit hatte Victor geistige Absencen und plötzliche Schwindelanfälle Eugènes notiert, der in artigen Briefen an den Vater seinen labilen Zustand verbergen konnte. Sein Verhalten aber wurde unberechenbar, hin und wieder verschwand er. Die Brüder rivalisierten um literarische Anerkennung, möglicherweise liebte Eugène auch heimlich Adèle. Doch es war Victor, der in Literatur und Liebe triumphierte. Die Hochzeit fand am 12. Oktober 1822 in der Kirche Saint-Sulpice statt. Zwei Monate später verschlimmerte sich Eugènes Zustand, man brachte ihn ins Militärhospital des Val-de-Grace. Als Kind hatte er vom Garten der Feuillantines aus dorthin schauen können, nun suchten ihn hier Wahnvorstellungen von Folterungen in den Kellergewölben heim. Viktor und Abel wechselten sich am Krankenbett des Bruders ab und protokollierten sein Elend: untröstliche Betrübnis, Delirium, Gehirnfieber, geistige Umnachtung. Die Behandlungen: Aderlass und Brechmittel.39
1823 war erneut ein schlimmes Jahr für die Hugos. Der Vater wohnte inzwischen mit seiner zweiten Frau Catherine in Blois, hatte sich aber seinen Söhnen wieder angenähert, selbst Adèle nannte ihn »mon cher papa«. Als sich Eugènes Zustand zu bessern schien, holte Léopold ihn zu sich. Und dann geschah es: Beim Diner am 4. Mai stürzte sich der Sohn plötzlich auf eine junge Dame, die zu Gast war, zerschmetterte ihren Teller und versuchte anschließend, seiner Stiefmutter die Kehle durchzuschneiden. Die stumpfe Spitze des Messers zerstach nur das Halstuch, die beiden weiblichen Opfer jedoch mussten sich vom herbeieilenden Arzt Beruhigungsmittel verabreichen lassen, das Fräulein wurde nach Hause begleitet, Catherine, am Rande eines Nervenzusammenbruchs, bekam hohes Fieber.
Die Tat erschütterte alle, auch Eugène selbst: Er habe, wie sein Vater berichtet, Catherine töten wollen, da sie ihm, seines Übergewichtes wegen, nur Kräutersuppen vorsetzte, gewürzt mit Koriander aus dem Garten, der stank wie Läuse. Außerdem wäre sie gar nicht seine Mutter. Eugène wurde in das Militärhospital in Charenton eingewiesen und von Étienne Esquirol behandelt, einem der einflussreichsten französischen Psychiater des 19. Jahrhunderts, Spezialist für Halluzinationen und mörderische Monomanien. Er wohnte in der Nervenklinik, studierte die Einzelschicksale seiner Patienten und verfasste seine Krankenberichte als Erzählungen40 – gerade so wie später Sigmund Freud, der empfahl, seine Fälle wie Novellen zu lesen. Eugène verfiel in Schweigsamkeit, ließ Aderlässe, Eisbäder, die harten Strahlen von Kopfduschen und quälende Befragungen über sich ergehen und starb mit 36 Jahren.41 Zum ersten Mal hatte sich in der Familie Hugo der Wahnsinn auf dramatische Weise gezeigt. Ein weiterer großer Schmerz kam hinzu: Im Oktober 1823 starb mit drei Monaten Léopold Victor, das erste Kind der jungen Eheleute.
Bevor all dies geschah, konnte der zwanzigjährige Victor Hugo mit einer Sammlung von Oden und sonstigen Gedichten literarische Erfolge verbuchen.42 Oden sind seit alters eine festgelegte Gattung, ihr feierlicher Ton in strenger Form eignet sich für den Ausdruck religiöser Gefühle und politischer Ideen oder das Andenken an heroische Taten. Das machte sie keineswegs zu zukunftsweisender Literatur. Lyrik galt aber auch als Medium subjektivster Empfindungen, und einige Balladen der Sammlung lassen schon im Titel zarte innerliche Motive erkennen: »An ein junges Mädchen«, »Spaziergang«, »Träume«, »Erster Seufzer«, »Sommerregen«. In anderen klingt die Nachtseite der Einbildungskraft an, da ringt ein Riese mit Gebirge und Ozean, lungern Gespenster und Fledermäuse über dem Abgrund, legt sich ein Nachtmahr schwer auf die Brust. Hugo enthüllte 1822 die zwei Gesichter der Romantik und würde es mit unvergleichlicher Intensität lebenslang tun: auf der einen Seite Sehnsucht, Schwermut und die Tröstungen der Natur, auf der anderen Seite das Unheimliche und Zerstörerische des Schmerzes, der Wut und der Elemente. Träumereien und Nocturnes, so wie in der Musik Schuberts, Schumanns, Chopins. Adèle erhielt ein Exemplar mit einer Widmung an die »Geliebte, den einzigen Engel, das einzige Glück«; der Vater riet dem Sohn, zukünftig einen weniger melancholischen Ton anzuschlagen; König Ludwig XVIII., dem die Sammlung beim ersten Durchblättern nicht gefiel, übernahm sie nach eingehender Lektüre in seine Privatbibliothek und gewährte dem jungen Dichter das lebensnotwendige Grundgehalt.
Damals aber galt, was heute gilt: Mit Gedichten wird man nicht reich, wenn man nicht schon berühmt ist. Das Buch kostete 3,50 Francs, für jedes verkaufte Exemplar entfielen 50 Centimes an den Autor. Hugo musste bald eine Familie ernähren und vom Schreiben leben. Letzteres verband ihn mit dem drei Jahre älteren Balzac, der nach erfolglosen Theaterstücken begann, Erzählungen und Romane im Akkord zu schreiben und diese in Zeitungen zu veröffentlichen, was im Gegensatz zu Gedichten Geld einbrachte.
Der Roman kannte, anders als Theater und Dichtung, keine festen Regeln und zog ein großes lesehungriges Publikum an. Das galt besonders für die Romane des Schotten Walter Scott, die unter Rittern und Edelfräulein spielen und mit ihren Intrigen vom Game of Thrones vormoderner Fürstenhöfe erzählen. Auch die Hugos und die Fouchers schmökerten Scotts Bücher und tauschten sie untereinander aus. Genauso beliebt waren »gothic novels« aus England: Schauerromantik, neblige Landschaften, düstere Abteien, Burgruinen, monströse Gelüste, Ströme von Blut. Dass diese Art von Romanen, ja Romane generell wenig galten bei Gralshütern der Literatur, bei Preisjurys und allen, die symbolisches Kapital verteilten, vermochte nichts gegen ihren Aufstieg zur Leitgattung des 19. Jahrhunderts. Hugo, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, sie alle wurden mit Romanen zu Unsterblichen der Literatur.
Im Januar 1823 kündigte die ultraroyalistische Zeitschrift Le Réveil43 Victor Hugos ersten Roman an: Han d’Islande. Nach dem Vorabdruck in der Zeitung der Hugo-Brüder, Le Conservateur littéraire, war er untergegangen, seitdem hatte der junge Autor ihn komplett überarbeitet. Ausgeliefert wurden 1000 Exemplare auf grobem, gräulichem Papier, voller Druckfehler, anonym herausgegeben als »Findelkind eines unbekannten Vaters«, der vom Literaturbetrieb schnell als Victor Hugo identifiziert wurde – als jener Autor, der jüngst mit ernsten Oden eine alte, gerade dem Taumel der Zeitläufte entronnene Gesellschaft getröstet habe, um sie nun mit allen Monstrositäten und moralischen Krankheiten der Wilden und der Zivilisierten zu erschrecken.
Han d’Islande basiert auf einer skandinavischen Sage und führt in die Stadt Trondheim. Es ist das Jahr 1699, Norwegen eine Provinz des Königreichs Dänemark. Ordener Guldenlew, Sohn des norwegischen Vizekönigs, liebt Ethel Schumacher, deren Vater trotz niederer Herkunft zum Großkanzler aufgestiegen und zum Grafen von Griffenfeld geadelt wurde. Jetzt aber wird er, entehrt und zusammen mit seiner Tochter, in der Festung Munckholm an den äußersten Grenzen des Königreichs gefangen gehalten und sitzt oft gedankenvoll auf einem Felsen. Der schwerste Vorwurf lautet, er sei Hintermann eines Aufstands der Minenarbeiter, angeführt von Han dem Isländer, gegen den König. Einige Papiere könnten Schumacher retten, wären sie nicht in der Hand des monströsen Han, Sohn einer Hexe und Enkel Ingolfs des Exterminators. Kein Lebender hat Han je gesehen, in Gerüchten und Ängsten geistert er umher als Riese, der seit der Ermordung seines Sohnes auf einem Rachefeldzug ist, von Menschenblut lebt, seine Opfer mit gewaltigen Zähnen zerreißt, mit den langen Nägeln seiner Klauen enthäutet und in Begleitung seines Eisbären Friend ganze Landstriche verheert. Nach einem Besuch in der Festung Munckholm macht sich Ordener in den Bergen Nordnorwegens auf die Suche nach dem Monster; das Liebesgelöbnis der frommen Ethel – die Adèle Hugo ähnelt – und eine Haarlocke der Geliebten verleihen ihm übermenschlichen Mut und traumwandlerische Sicherheit. Als Schumacher nach einem Angriff der Minenarbeiter und weiteren Intrigen zum Tode verurteilt wird, nimmt Ordener alle Schuld auf sich und bereitet sich auf das Schafott vor. Doch alles wird gut. Wer den Roman gelesen hat, erinnert sich an die Schilderungen erhabener Natur, großer Gefühle und finsterer Ränke- und Machtspiele, und niemand vergisst folgende Szene, obwohl heutige Bildwelten vergleichbaren Horror in Fülle bieten: In der Grotte von Walderhog sitzt der winzige Han und trinkt das Blut seines letzten Opfers aus einem





























