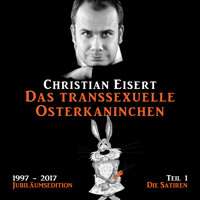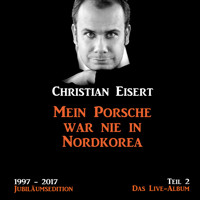8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach seinem Nordkorea-Trip wollte Christian Eisert friedlich Ferien machen — in einem Land ohne Gefahr für Leib und Leben und ohne Paranoia. Stattdessen fuhr er in die Schweiz ... Auf der Berg- und Talfahrt des Bestsellerautors entpuppt sich das reichste Land der Welt auch als eines der bizarrsten: Es gibt mehr Plätze in Bunkern als Einwohner, die Armee erringt ihre größten Siege in der Küche, und Rückwärtsfahren ist gesetzlich verboten. Drum fährt Eisert vorwärts durch die Schweiz, mit Bus, Bahn und Boot. Seine Reiseroute soll am Ende den Landesnamen ergeben, inklusive i-Punkt. Eisert bei den Eidgenossen — ein Abenteuer voller Wahrheit und Wahnwitz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Schneebedeckte Berge, dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein – die Schweiz ist Idylle pur. Außerdem mischte sie jahrhundertelang in jedem Krieg Europas mit, führte legale Prostitution Jahrzehnte vor dem Frauen-wahlrecht ein und verminte noch bis vor kurzem ihre Brücken nach Deutschland. In dem Land, das kleiner ist als Niedersachsen, sind die Gegensätze groß. Und die Menschen großartig – findet jedenfalls Christian Eisert, nachdem er sie auf Ziegenausstellungen, im Kloster oder in unterirdischen Verstecken besuchte. Jeden Tag an einem anderen Ort, jede Nacht in einem neuen Bett behält er stets seinen Plan im Blick, das Wort „Schweiz“ abzureisen. Das Vorhaben droht zu scheitern. Bis sich ihm eine echte Eidgenossin anschließt …
Der Autor
Christian Eisert, geboren 1976 in Berlin (Ost), ist TV-Autor, Satiriker und Comedy-Coach. Er war acht Jahre Autor für Harald Schmidt und schreibt für die Fernsehshows Alfons und Gäste und Grünwald Freitagscomedy sowie für Shopping Queen und Löwenzahn. Sein Reisebericht Kim und Struppi stand über ein Jahr lang ganz oben in der Spiegel-Bestseller-Liste.
www.christian-eisert.de
Christian Eisert
Viele Ziegen und kein Peter
Eine Ferienfahrt zu den Schweizern
ullstein extra
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1333-7
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016Covergestaltung: semper smile MünchenCovermotiv: © Javier Brosch; Vaclar Volrab; Sebastian Knight; Severe tanshtyl/ShutterstockKarte: Peter Palm
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für C.
7,587
Punktezahl der Schweiz im World Happiness Report
Den Rüssel aufgestellt, Vorder- und Hinterbeine in entgegengesetzte Richtungen gestreckt, sprang ein Elefant über den See.
Ich kniff die Augen zu. Ins linke war mir eine der vielen Hundert Fliegen geflogen, die mich umschwirrten.
Als ich wieder sehen konnte, war aus dem Elefanten eine Kaffeekanne geworden. Der Wind spielte mit den Wolken.
Die spätsommerliche Wärme war frühherbstlicher Frische gewichen. Bald würde ich frieren. Ich hatte ja nichts an. Trotzdem war ich glücklich.
Barfuß bahnte ich mir den Weg durchs Dickicht.
Ein Spinnennetz legte sich über mein Gesicht, ich wischte es fort. Die Fliegen nahmen vor meiner Hand Reißaus und kehrten zurück. Eine schwarze brummende Wolke, die stetig auf Kopfhöhe blieb. Roch ich halsabwärts anders?
Dornensträucher machten das Durchkommen fast unmöglich. Auf beiden Seiten ging es abwärts. Zurück wollte ich nicht, da war ich ja schon. Also weiter. Vorsichtig teilte ich die stechenden Zweige. Wenn sie ohne Druck über meinen Körper strichen, hinterließen sie keine Spuren. Ich bewegte mich wie in Zeitlupe. Das Brummen der Fliegen wurde lauter. Ich hatte Hunger. Und Durst. Mich fror. Aber ich war glücklich.
Das Brummen steigerte sich zu einem hämmernden Dröhnen.
Im Formationsflug hielten drei Hubschrauber der Schweizer Armee auf mich zu.
Genau sechs Wochen zuvor, auch an einem Dienstag, forderte mich die großformatige Digitaluhr auf meinem Schreibtisch in Berlin zum Sterben auf: »05:00 – 15. 07. – DIE«.
Dafür fehlte mir die Zeit. Noch. Fernseharbeit ist ein Saisongeschäft. Wenn ich diesen letzten Auftrag abgeschlossen hatte, dann war – von zwei Tagen Drehbuchbesprechung im August abgesehen – bis Mitte September Flaute.
Oder positiver ausgedrückt: Ferienzeit!
Und ich wusste auch schon, wo ich meine Ferien verbringen würde. Und mit wem nicht.
Im Moment beschäftigten mich andere Probleme. Ich tüftelte am Schlusssatz der Freitagsfolge eines täglichen Reality-Formats, bei dem die Fernsehzuschauer Frauen beim Anziehsachen-Einkaufen zugucken. Ich schreibe dafür die Texte des Off-Sprechers, der das Geschehen launig kommentiert, ohne dass der Zuschauer ihn sieht. Ein Routinejob, der meine Miete finanziert und mir die Freiheit gibt, Drehbuchstoffe ohne Auftrag zu entwickeln, zum Beispiel fürs Kinderfernsehen.
Das Anziehsachen-Einkaufen stand diesmal unter dem Motto: »Holladrio, der Berg ruft! Kombiniere zwei Klassiker, und sei mit Jeans und Dirndl das fescheste Madl beim Hüttenzauber.«
Die einzelnen Folgen, fünf je Wochenblock, schickt mir die Produktionsfirma fertig geschnitten zu. Auf für meine Texte frei gelassene Bildstrecken muss ich sekundengenau formulieren. Der letzte Satz einer Einkaufsfernsehfolge soll zum einen Bezug zum Bild haben – die Gewinnerin der Woche im Sieger-Outfit, umgeben von ihren Konkurrentinnen – und zum anderen das Wochenmotto aufnehmen sowie einen Ausblick auf die nächsten Folgen bieten.
»Hulli«, ploppte eine kleine Sprechblase am unteren Rand des Monitors auf, und ich tippte ins Chat-Fenster ebenfalls die Begrüßung, die wir irgendwann erfunden hatten: »Hulli«.
»Geht’s gutli?«
»Stressli. Schreibli!«
»Späterli?«
Damit, bei solchen Kompakt-Dialogen ein -li an alle Wörter zu hängen, hatten wir begonnen, nachdem Amara vor ein paar Jahren aus Zürich das erste Mal zu mir nach Berlin gekommen war und sich fürs Frühstück ein »Müs’chen« wünschte.
Im Bestreben, besonders gutes Hochdeutsch zu sprechen, hatte sie die schweizerdeutsche Verkleinerungsendung -li durch das hochdeutsche -chen ersetzt.
Wie meist um diese Tageszeit war ich schon und Amara noch wach. Oft nehmen wir dann zusammen vor unseren Webcams die Mahlzeiten ein. Ich das Frühstück in Berlin, sie in Zürich ihren Kaffee vor dem Schlafengehen.
Heute hätte ich gerne auf ein gemeinsames Frühstück verzichtet. Andererseits wollte ich es hinter mir haben. Je später ich ihr von meiner Urlaubsplanung erzählte, desto unangenehmer würde es. Also schrieb ich: »Letzter Satz. Dann durchlesen. In 30 Min?«
»Okeli.«
Ich probierte allerlei Assoziationen zu Bergen, Schnee und Almromantik aus. Im Duktus des Sprechers laut lesend testete ich, ob mein Schlusssatz in die vorgegebene Neun-Sekunden-Lücke passte. Dann überflog ich den gesamten Text, änderte hie und da ein Wort und schickte die Folge, meine fünfundneunzigste, an die Produktion.
»Fertig! :-)«
Amara klingelte umgehend an. Ich klickte aufs Kamera-Icon. Ihr Gesicht erschien auf meinem Monitor.
»Spatzeli, nicht weglaufen!«, rief sie, den Zeigefinger erhoben, und verschwand aus dem Fokus ihrer Webcam.
Wäre Angelina Jolie nicht so mager, könnte man sie leicht mit Amara verwechseln. Die gleiche braune Mähne, das gleiche Augenrund und dieser atemberaubende Schwung der Lippen, die nur jene zu dick finden, die sie noch nicht geküsst haben. Ich zum Beispiel. Ich hatte sie noch nie geküsst.
Die Angelina.
Schweizer Vögel tirilierten aus den Lautsprechern meines Computers. Wie üblich stand Amaras Balkontür offen. Damit der Zigarettenqualm abzog. Obwohl ich Rauchen für eine höchst unsinnige Angewohnheit halte, gerate ich ständig an Raucherinnen. Möglicherweise habe ich einen Hang zum Unsinn.
Aus den Lautsprechern drang nun ein Klirren, dann ein Aufschrei und die Information: »Nichts passiert!«
Kurz darauf saß sie mit einer Tasse in der Hand vor der Webcam: »Sorry, musste Kafi machen.« Hin und wieder rutschen schweizerdeutsche Ausdrücke in ihr Hochdeutsch. Aber selbst ohne helvetische Wörter schimmerte ihre Herkunft bei jedem R und A durch. Das eine klapperte wie der Zeiger am Glücksrad, das andere klang, als halle es aus einem Verlies herauf.
»Was gibt’s?« Sie pustete in ihren Kaffee.
»Du hast angerufen.«
»Ach so, ja … Wie läuft’s?« Sie trank einen Schluck.
»Müde. Aber rechtzeitig fertig geworden.« Eigentlich hätte ich gestern Abend abgeben müssen. Doch da hatte ich Gags für einen Franzosen geschrieben. Dabei kann ich gar kein Französisch. »Hauptsache, der Text ist da, bevor sie ins Büro kommen.«
»Lies mal vor. Den letzten Satz.« Sie fingerte eine Parisienne aus der Packung.
Ich deklamierte: »Friede, Freude, Alpenglühn. Danielas blaues Denim-Dirndl gefällt sicher auch dem Ziegenpeter! Für heute hat sich’s ausgejodelt. Servus und bis nächste Woche!«
Amara zündete ihre Zigarette an. »Es heißt Geißenpeter.«
»Früher in den Zeichentrickfilmen hieß es immer Ziegenpeter.«
»Wer hat die Filme gemacht?«
»Japaner.«
»Eben.« Amara-Logik.
»Und wenn schon, die Deutschen kennen ihn als Ziegenpeter. Es geht ja nicht darum, was stimmt, sondern was die Menschen zu wissen glauben.«
»Worüber?«
»Über Ziegen. Über die Schweiz.«
»Und die Leute glauben, wir sagen Ziege zur Geiß?«
»Nein, sie glauben, Ziegen heißen bei euch genauso wie bei uns«, erklärte ich.
»Warum?«
»Weil ihr für uns Deutsche seid, die an jedes zweite Wort ein -li hängen.«
»Wir sind keine Deutschen, Spatzeli!«
»Siehste!«
Amara schwankte zwischen Schmunzeln und Schimpfen. Trank Kaffee. Verschluckte sich, hustete. Es schwappte.
»Ui, nei! Ah!« Sie sprang auf. Rannte weg. Kam wieder. Küchenpapier in der Hand. Wischte vor dem Bildschirm herum.
Ich googelte derweil Ziegen und Schweiz. »Ha, hier: Ziegenschau in Rothenthurm«, griff ich wahllos einen Link heraus, »Vierzehnte TOGESA, Ausstellung und Markt für Toggenburgerziegen, Saanenziegen, Gämsfarbige Gebirgsziegen …«
»Det äne am Bergli«, trällerte Amara, »det schtat e wissy Geiss …«
Im Refrain – »Holeduli, duliduli« – unterbrach ich sie: »Es steht hier kein Wort von Geißen!«
»Das ist Schriftdeutsch. Mündlich heißt es Geiß.«
»Mein Text ist ja schriftlich«, trumpfte ich auf.
»Und wird dann im Fernsehen gesprochen«, hielt sie dagegen und schob hinterher: »Heidis Freund heißt Geißenpeter. Punkt.« Sie nahm einen tiefen Lungenzug. Blies den Rauch zur Balkontür hinaus. Ich trank einen Schluck Fencheltee und wagte es. »Du, ich hab mir überlegt, im August Urlaub in der Schweiz zu machen.«
»Schau mal, das Amseli!« Sie drehte ihr Laptop mit der Webcam in Richtung Vogel. »Jööö, schau, wie es guckt!«
»Ich seh nur ein schwarzes Pixelquadrat.«
Das Quadrat flog weg, Amara wandte sich um. »Warum?«
»Was?«
»In die Schweiz …«
»War ich noch nie richtig. Und Zürich zählt ja nicht.«
»Hm.« Sie drückte ihre Zigarette aus und steckte eine neue an.
»Warum fährst du nicht weiter weg? Wieder nach Nordkorea?«
Meine letzte große Ferienreise hatte ich durch Nordkorea gemacht.
»Ich will einfach wohin, wo es schön ist, ungefährlich und nicht anstrengend. Fremdes Essen, fremde Sprache, exotische Landschaft – alles fein, aber stresst.«
»Blödsinn, du hast überall Schiss.«
Den hatte ich jetzt auf jeden Fall. Vor ihr. »Du, ich weiß noch nicht, wo ich genau hinfahren werde oder wie, ich weiß nur, dass ich gerne …«
»Das kannst du gleich knicken!«, sagte sie bestimmt.
»Aber sieh mal, wir kennen uns jetzt schon so lange und …«
»Eben genau deshalb.«
»Mann, ich habe dich wirklich gern.«
»Spatzeli, ich dich auch. Aber ich fahre trotzdem nicht mit!«
Sie beugte sich weit zur Webcam vor, riss ihre grünen Augen auf: »Du und ich: Horrorferien!«
»Ja, genau das wollte ich doch sagen!«
Die nächsten Minuten freuten wir uns darüber, wie gut wir uns verstehen. Solange tausend Kilometer zwischen uns liegen.
Nachdem das Gespräch derart glimpflich verlaufen war, widmete ich mich den ganzen Vormittag meinem Urlaubsziel. Und schrieb Amara: »Welches ist das zweitglücklichste Land der Welt?«
Gleich nach dem Aufwachen, gegen drei Uhr nachmittags, beantworte sie meine Frage mit einem kurzen: »Schlaraffia.«
Ich schrieb »Sküppi?«, was Skype meinte, gleich darauf hatte ich Amaras verschlafenes Gesicht auf dem Monitor.
»Das zweitglücklichste Land der Welt ist … na?«, fragte ich.
Sie nickte Richtung Balkon: »Muss man den Vermieter fragen, wenn man Vogelhäuschen aufstellen will?«
»Bei uns untersagen die meisten Vermieter das Füttern von Vögeln.«
»Er muss es ja nicht wissen.«
»Er sieht es aber«, warnte ich.
»Ich würde es tarnen. Als Briefkasten zum Beispiel.«
»Sehr unauffällig. Vor allem, wenn da ständig Vögel landen.«
»Luftpost?«
Ich gab auf. »Das zweitglücklichste Land der Welt ist: Island!«
»Sagt wer?«
»Der aktuelle World Happiness Report.«
»Ist das ’ne Frauenzeitschrift?«
»Nein, das ist eine wissenschaftliche Studie zum Glücksempfinden.« Ich scrollte durch das Dokument. »Sehr viele Balkendiagramme und Tabellen. Sieht eindrucksvoll aus.«
»Und wer ist auf Platz 1?«
»Die Schweiz.«
»Haa-haa …!«, machte Amara und steckte sich kopfschüttelnd eine neue Zigarette an.
»Steht hier aber. Unter Berücksichtigung der Gesundheitsversorgung, der Freiheit, eigene Lebensentscheidungen zu treffen, dem Bruttoinlandsprodukt – in der Schweiz: Bruttoinlandprodukt, ohne s – und der Lebensleiter lebst du im glücklichsten Land der Welt. Herzlichen Glückwunsch!«
»Lebensleiter?« Sie steckte eine Zigarette an.
»Eintausend Befragte mussten ihr Leben auf einer von zehn Leitersprossen einordnen. Ganz unten das schlechtestmögliche Leben, dass sie sich vorstellen können, ganz oben das bestmögliche. Die Schweizer ordneten sich im Durchschnitt auf Sprosse siebeneinhalb ein.«
»Das geht ja gar nicht.«
»Das ist Statistik.«
»Und wo steht Deutschland?«
»Auf Sprosse sechseinhalb.«
»Es nimmt mich Wunder, woran das liegt.«
»Ich vergess es immer wieder: Heißt dieses nimmt mich Wunder, es wundert dich oder es interessiert dich?«
»Es interessiert mich!«
Ich überflog die Daten zu Deutschland. »Ach, du Schreck! Im Gesamtranking der glücklichsten Länder der Welt steht Deutschland auf Platz 26. Zwischen Panama und Chile.«
»Würdest du so viel rauchen und Alk trinken wie ich, dann wärst du auch glücklich.«
Darauf ging ich schon lange nicht mehr ein. »Ich habe noch etwas herausgefunden. Klick mal den Link an, den ich gerade geschickt habe.«
»Spatzeli, darf ich eben Kafi machen gehen?«
»Gleich, erst klicken.«
Gähnend tat sie, was ich verlangte. Das kam nicht oft vor.
»Oh, die Schweiz«, stellte sie fest.
Vor mir war die gleiche Karte geöffnet, und ich sagte, was mir aufgefallen war. Weil es Amara nicht gleich sah, ging ich ins Detail: »Der Zipfel mit Schaffhausen sind die Ohren. Die Spitze nach unten …«
»Das Tessin!«
»… bildet die Vorderbeine. Über die Hinterbeine kann man diskutieren. Sie überschneiden sich eben und wirken deshalb etwas klobig.« Bevor ich dazu kam, Genf im Schwanz zu verorten und alles rechts von Davos als Rüsselnase zu bezeichnen, schnaubte Amara: »Die Schweiz ist kein Schwein – never!«
»Das habe ich auch nicht gesagt!«
»Sondern?«
»Sie ist ein Wildschwein!«
Amara blieb der Mund offen stehen. Genau wie dem Wildschwein.
»Das ist doch eindeutig«, führte ich geduldig aus, »rechts die Schnauze, links …«
»Rechts von mir aus oder von dir aus?«
»Von uns beiden aus, wir gucken ja beide auf die Schweiz.«
»Neineinein, ich gucke aus der Schweiz heraus. Also ist dein Rechts bei mir links.«
»Bring mich nicht durcheinander, ich bin froh, dass ich das hinbekommen habe mit links und rechts.«
Amaras Logik kann einen in den Wahnsinn treiben. Ausnahmslos nimmt sie vermeintlich Unwichtiges wichtiger als das vermeintlich Wichtige. Deshalb kommt sie auch nie rechtzeitig von zu Hause los. Bei unserem ersten Date tauchte sie zwei Stunden zu spät auf. Wenn ihr etwas ge- oder missfällt, reagiert sie unmittelbar. Gern laut. Ich versuche dann – speziell in Supermärkten, Kinos oder Cafés –, ihr Einhalt zu gebieten, was sie noch mehr reizt, da sich »HIER KEIN MENSCH FÜR UNS INTERESSIERT!«
Was Umstehende meist sehr interessant finden.
Sie ist die einzige Frau, die ich je vor Wut angeschrien habe, aber auch der erste Mensch, dem ich meine Manuskripte vorlese. Gerade weil sie Prioritäten verschiebt und das Gespür für die wichtigen Winzigkeiten hat. Sie sieht, ehe es andere überhaupt ahnen, wenn etwas nicht im Lot ist. Eine Fähigkeit, mit der Amara ihren Lebensunterhalt bestreitet. Seit einigen Jahren sucht sie nach einer treffenden Berufsbezeichnung. Lebensberaterin, Life-Coach oder Heilerin nennen sich schon andere. Sie ist einzigartig.
Wir hatten uns allerdings nicht in beruflichen Zusammenhängen kennengelernt.
»Oh nein!« Ihre Augen weiteten sich. »Jetzt seh ich’s auch.« Sie schien erschrocken über sich selbst. »Es ist eine Art Comic-Wildschwein.«
»Es gähnt.«
»Was … äh … wie bitte?!«
»Nein, es hustet«, berichtigte ich mich. »Ihr seid ja nicht für Schlaftabletten berühmt, sondern für Hustenbonbons.«
Sie konnte nicht darüber lachen.
»Die Schweiz sieht aus«, fasste ich die neue Erkenntnis zusammen, »wie ein hustendes Wildschwein.«
Sie drückte lange ihre Zigarette aus.
»Versprich mir eines.« Ihr Augengrün kam nah. »Das sagst du niemals öffentlich!«
Meine Ferienreise sollte nicht in, sondern durch die Schweiz gehen. Die touristischen Hotspots abzureisen fand ich zu simpel; mich einfach durchs Land treiben zu lassen barg die Gefahr, mich zu verzetteln.
Außer Amara kenne ich – aus beruflichen Zusammenhängen – weitere Schweizerinnen. Sie bat ich um Insidertipps. Als Erste antwortete Charlott(e) (das e wird nicht gesprochen), der ich vor einigen Jahren auf der Kinderfernsehproduzenten-Party der Berlinale begegnet war. Charlotte liebt ihr Land im gleichen Maße, wie sie daran leidet. Mails und SMS unterzeichnet sie mit CH. Sie versorgte mich mit zahllosen Empfehlungen. Eine davon war ihr Vater, der ins Visier der Schweizer Stasi geraten war, die anders hieß, aber Schweizer Bürger ähnlich intensiv ausforschte wie die DDR die ihren.
Was Überwachung im Urlaub betrifft, war ich reich an Erfahrung. Auf meiner letzten großen Ferienfahrt passten von morgens acht bis abends spät zwei als Reiseleiter getarnte Geheimdienstler darauf auf, dass ich nicht vom rechten Weg abkam in Nordkorea – wie die Schweiz ein Hort des großen Glücks. Das behauptet jedenfalls die Staatsführung. Die Wahrheit sieht deutlich düsterer aus. In Nordkorea.
Anders in der Schweiz, da war das Glück der Einwohner ja wissenschaftlich bewiesen. Zudem ist die Schweiz das Gegenteil einer führerzentrierten Diktatur. Ja, Schweizer trennt gar, was Einwohner anderer Länder verbindet: Die Schweizer sprechen weder alle dieselbe Sprache, noch gehören sie derselben Volksgruppe an, noch einer einzigen Religion. Dennoch muss es etwas geben, das stärker ist als ihre Unterschiede. Etwas, das sie gemeinsam einen Staat bilden lässt.
Einen Staat, der in seiner West-Ost-Ausdehnung zwischen Bremen und Berlin passt und von Nord nach Süd zwischen Ostsee und Berlin.
Einen Staat, der so außergewöhnlich und besonders ist, dass er zu den wenigen Ländern der Erde gehört, die nur mit Artikel genannt werden. Genau wie dieUSA, die Mongolei und der Vatikan – eine Staatenunion, das dünnstbesiedelte Land der Welt und ein Kirchenstaat. Und was ist die Schweiz?
Eine »Willensnation«.
Ein Land, dessen Einwohner irgendwann beschlossen haben, zusammenzugehören. Ein Land, in dem ein Viertel der Bevölkerung Ausländer sind, angelockt vom Prinzip Schweiz. Ein Prinzip, das alle Gegensätze zu überwinden scheint. Und jeden Einwohner glücklicher macht als den Rest der Welt.
Was lag für glückliche Ferien in der Schweiz näher, als den Landesnamen als Reiseroute zu wählen?
Weil gemessen an der zurückgelegten Distanz überdurchschnittlich viele tödliche Verkehrsunfälle durch Rückwärtsfahren verursacht werden, soll dieses auf das Notwendigste beschränkt werden. Es soll nur noch dann rückwärts gefahren werden dürfen, wenn die Weiterfahrt oder das Wenden nicht möglich ist.
Art. 17 Abs. 3 der Schweizer Verkehrsregelnverordnung 2016
In ein fremdes Land per Flugzeug zu reisen spart Zeit. Dafür plumpst der Passagier gleich mitten ins Land, ohne dessen Grenze zu sehen, ohne die Veränderung von Vegetation und Architektur mitzuerleben. Das Flugzeug bietet dem Reisenden nur diesen »So sieht’s hier also aus«-Moment im Anflug auf den Zielort, wenn tief unten braune und grüne Flächen vorbeiziehen und kleine Häuser und das Gewerbegebiet und der Zaun und die Betonbahn. Es rummst, es rumpelt, es folgen Durchsagen, gegen die alle verstoßen, um anschließend halb angezogen zwischen den Sitzen zu stehen.
Aus diesem Grund hatte ich mich gegen den fünfundsiebzigminütigen Flug in die Schweiz und für eine achteinhalbstündige Bahnfahrt entschieden. Berlin 22:14 ab, Basel 7:47 an.
Der Zug rollte aus dem Berliner Hauptbahnhof, und ich schöpfte Hoffnung, die Nacht allein und ungestört in meinem leeren Liegewagenabteil verbringen zu können.
Da polterte ein Junge im Grundschulalter ins Abteil: »Ich will oben! Ich will oben!«
Seine Mutter antwortete: »Wir schlafen ja oben, Konstantin.«
»Cooool.«
»Möchtest du links oder rechts?«
»Ich nehme, ich nehme, ich nehme …« Sein Kopf schnellte hin und her. Er sprang und landete.
»Aua«, sagte ich.
»Konstantin, entschuldige dich bei dem Mann!«
»Ist schon gut«, brummte ich, zog die Schuhe aus und dann die Knie bis hoch unters Kinn. Halb verschattet von der Liege über mir hockte ich auf meiner blauen Matratze und sah aus wie ein Kindergartenkind, das nicht aus seiner Höhle will.
»Ich schlafe links! … Nein, rechts! … Nein, links!« Das Kind hüpfte herum, als hätte es einen verzweifelten Frosch verschluckt. »Oder rechts! Oder links! Nein, rechts.«
»Konstantin, ich finde links cool«, behauptete die Mutter.
Ich fand links auch cool. Ich schlief rechts.
Konstantin fand links nicht so cool.
Er war eines jener Kinder, das die Namen aller Planeten aufzählen kann und weiß, warum Pluto keiner mehr ist.
Seine Mutter umwehte ein blasses Batikkleid und die Tragik geplatzter Lebensträume.
Kaum waren die beiden in ihre Betten über mir geklettert und verstummt, quartierte die Schaffnerin einen Mann bei uns ein.
Er schlief sehr, sehr laut, und ich dachte die ganze Nacht darüber nach, warum Agatha Christie ein so kompliziertes Motiv für den Mord im Orient Express konstruiert hatte.
Gesetzeskonform fuhren wir vorwärts in die Schweiz ein.
Eine graue Wand verlief seit einigen Hundert Metern parallel zur Fahrtrichtung. Bunte Parolen lockerten das Einerlei hin und wieder auf. Sollte es jemandem gelingen, die bis zur Dachkante des Zuges reichende Wand zu erklimmen, würde er es trotzdem kaum schaffen, von dort auf das Zugdach zu springen, dazu war der Abstand zu groß. Gerade als es schien, die graue Wand würde nie enden, verlor sie an Höhe und gab den Blick frei auf einen Fluss.
Die Zugfahrt über die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz glich verblüffend der von Nordkorea nach China. Meine Nordkorea-Reise lag mehr als zwei Jahre zurück, doch jedes Detail hatte sich eingebrannt.
Im Fernen Osten trennt der Fluss Tumen die Nachbarländer, hier war es der Rhein. Weiterer Unterschied: Der Zweck der grauen Wand: In Nordkorea verhindert sie Fluchtversuche, hier die Belästigung durch Zuglärm der Menschen in den Wohnhäusern dahinter. Das Graffiti ließ sich allerdings genauso wenig entziffern wie die nordkoreanischen Kampfparolen.
Das Gesicht im Wind der langsamer werdenden Fahrt, lehnte ich mich weit aus dem Gangfenster von Wagen 62. Neben mir standen ausstiegsbereit Konstantin und seine Mutter.
»Basel EssBeeBee«, las Konstantin das Bahnhofsschild vor und erklärte: »EssBeeBee bedeutet Schweizerische Bundesbahnen.« Basel SBB roch nach Kaffee und machte schwindlig. Ein halbes Dutzend Bahnsteige zwischen Spalier stehenden Eisensäulen unter dem lichten Dach einer fünfschiffigen Bahnhofshalle. Jede Dachwölbung krönte über die gesamte Länge eine Glashaube, die auf gekreuzten Streben ruhte. Darunter hingen wie ein kubistisches Spinnennetz senkrecht und waagerecht verlaufende Metallrohre, die in kleine Lautsprecher mündeten.
Die Bremsen kreischten. Die Welt vor dem Türfenster blieb stehen. Konstantins Zeigefinger bearbeitete den grünen Türöffnerknopf wie ein Specht den Baum. Die Tür seufzte und schwang zur Seite. Mutter und Sohn kletterten hinaus. Ich verharrte auf den Gitterstufen des Wagens und zog mit der linken Hand – in der rechten balancierte ich auf einer sogenannten Frühstücksbox aus dem Bordbistro einen Becher mit Tee – die Riemen meines schwarzgrünen Tourenrucksacks stramm. Der leichteste der Welt. Laut Prospekt 980 Gramm Leergewicht. Er verfügte über einen »Airspeed-Netzrücken« und bot statt einer profanen Plastikklickschnalle am Hüftgurt einen »Single-ErgoPull-Verschluss« mit dem ich »mächtig Druck auf die Hüften bekommen« sollte und einen »satten Sitz«.
Schon auf dem Marsch zum Hauptbahnhof in Berlin hatte ich diesem Sitz, hin und wieder hüpfend, nachgespürt. Drückte mein Rucksack? War er zu schwer?
Ich hatte großen Aufwand betrieben, um das Gewicht meines Gepäcks zu reduzieren. Hatte den Stiel meiner Zahnbürste abgesägt und das Besteck auf ein einziges Teil aus Leichtkunststoff reduziert, das Messer, Gabel und Löffel vereinigte. Ich taufte es »Megaffel«.
Auch der Rest meines Outfits war neu: ein sandfarbenes Basecap, ein grauer Kapuzenpullover, eine moosgrüne Trekkinghose und Wanderschuhe mit rot-gelben Schnürsenkeln und roter Sohle, die ich zwei Wochen lang, drinnen und draußen, eingelaufen hatte. Bis jetzt fühlte sich meine Ausrüstung gut an. Amara, der ich gestern Abend ein Selfie geschickt hatte, hatte meine Erscheinung als »alpenelegant« gelobt.
Ich stieg die letzte Gitterstufe hinab und betrat Schweizer Boden. Von meinem Gürtel nestelte ich die Digicam und knipste mein Gesicht vor dem Baseler Bahnhofsschild. Weiße Schrift auf dunkelblauem Grund. Das wollte ich an jeder Umsteigestation machen. Nach aktuellem Planungsstand würden es siebenundachtzig Fotos werden.
Da ich mir eine Reiseroute in den Kopf gesetzt hatte, die den Landesnamen in Schreibschriftbuchstaben ergeben sollte, musste ich in Basel beginnen, weil wir von links nach rechts schreiben. Ganz links, also im Westen der Schweiz, da wo sie an Frankreich stößt, konnte ich nicht anfangen, weil der Anfang des S weiter vorne liegt.
Es hatte Tage gedauert, bis ich herausgefunden hatte, wie sich eine Route planen lässt, die ein Wort aus zusammengeschriebenen Buchstaben ergibt. Die gängigen Reiseplaner bieten immer den kürzesten Weg vom Start- zum Zielort an. Damit die Software machte, was ich wollte, statt effizient zu sein, fügte ich Zwischenstationen ein. Um die Namen kleinerer Orte lesen zu können, musste ich bei Google Maps in die Karte hineinzoomen, was dazu führte, dass ich die große Übersicht verlor und nicht mehr wusste, wo ich mich sowohl im Wort als auch im Land Schweiz befand.
Als ich es endlich geschafft hatte, ein halbwegs vernünftiges S zu bauen, nahm es die Hälfte des Landes ein. Doch die restlichen sechs Buchstaben fehlten.
Eigentlich heißt die Schweiz gar nicht Schweiz.
Um keine der Volksgruppen zu benachteiligen, bekam das Land offiziell einen lateinischen Namen: Confoederatio Helvetica. Deshalb lauten Postcode und Landeskennzeichen international »CH«. Gleichwohl existieren offizielle Bezeichnungen in allen vier Landessprachen. Und da heißt das Land auf Deutsch eben nicht »Schweiz«, sondern »Schweizerische Eidgenossenschaft«.
Das sagt im Alltag kein Mensch. Außerdem bereitete mir das kurze Wort »Schweiz« schon genug Probleme.
Ich plante ein kleineres S und stellte fest, dass ich meine Route an Straßen ausrichtete. Eine große Autoferienreise hatte ich schon gemacht (mit einem Porsche, den ich längst nicht mehr besaß). Fürs Radeln fehlten mir Lust und Kondition, zu Fuß würde meine Reise zu viel Zeit kosten. Blieben öffentliche Verkehrsmittel: Eisenbahn, Schiffe, Bergbahnen, Straßenbahnen, Omni- und Oberleitungsbusse – sowie die PostAutos, wie in der Schweiz die motorisierten Nachfolger der Postkutsche genannt werden –, außerdem eine U-Bahn-Linie. Damit kam ich in fast jeden bewohnten Winkel der Schweiz.
Die ersten Streckenpläne, die ich fand, waren schematische Darstellungen: Netzspinnen, Verkehrswaben oder Tarifringe. Für mein Schreibschriftwort benötigte ich jedoch zwingend den tatsächlichen Streckenverlauf im Gelände. Die Schweizerischen Bundesbahnen halfen mir. Unter anderem schickten sie eine zwar vereinfachte, aber letztlich topographische Streckenkarte, die außer Bahnstrecken auch alle wichtigen Schiffs-, PostAuto- und Bergbahnverbindungen darstellte. Auf Scans malte ich im Computer darauf herum. Häufig gelang mir ein perfekter Einzelbuchstabe, aber ich fand keinen Übergang zum nächsten. Weitere Schwierigkeit: Gerade Senkrechten. Die Schweiz besitzt bloß zwei durchgehende Nord-Süd-Strecken: den Lötschberg-Tunnel über dem Hinter- und den Gotthardtunnel über dem Vorderbein. Ansonsten stellen sich die Alpen quer, weshalb mein w fragwürdig weit nach oben rutschte.
Größtes Problem war der i-Punkt. Ihn musste ich – wollte ich korrekt sein – ohne Verbindung zum Boden erreichen. Nur wie?
Die Schleifen und Schnörkel des Wortes zu gestalten, gelang mir zunehmend besser. Der Internet-Fahrplaner der SBB bot die Funktion von A nach B »via C«, und ich überlistete seine Effizienz mit bis zu 12 »via«-Angaben. Praktischerweise berücksichtigte er sämtliche Verkehrsmittel, also auch Nahverkehr, Schiffe und Bergbahnen.
Nach zwei Wochen Planung – allein drei Tage brauchte ich für das h – hatte ich es geschafft, eine Reiseroute durch die Schweiz zu planen, die das Wort »Schweiz« ergibt.
Nur der i-Punkt fehlte. Der i-Punkt blieb ein Problem.
5500 Franken Mindestlohn für Maurer. Wir stehen dazu!Ihre Baumeister – LMV: Fair im Bau
Plakat an einer Baustelle in Basel
In der Passarelle, einer überdachten Verbindungsbrücke über den Gleisen, gesäumt von Geschäften in Glaskästen für Reise- und Speisebedarf, schlenderte ich von Schaufenster zu Schaufenster. Mein Hotelzimmer konnte ich frühestens mittags beziehen. Ich hatte Zeit. Keine Termine, kein Stress. Ein stilles »Juchuuu!« auf den Lippen, drehte ich mich auf dem Absatz einmal um die eigene Achse. Das Gepäck auf meinem Rücken verstärkte meinen Schwung und schleuderte mich in einen Passanten.
»Exgüsi«, entschuldigte sich der bei mir.
Die wenigen Menschen, die an diesem Sonntagmorgen unterwegs waren, hielten Schwätzchen miteinander oder teilten am Telefon mit, wo sie gerade waren. Die Sätze hatten oft eine ausgeprägte Melodie. Sie begannen in Mittellage, schwangen sich auf in höchste Höhen und stürzten sofort wieder in die Tiefe. Bisweilen alles innerhalb einer Vokallänge, als gebe es einen Zusammenhang zwischen Aussprache und der Schweizer Berg-und-Tal-Landschaft. Dazu krachte es bei jedem ch, die st wurden zu »scht«, und der Umgang mit Zwielauten war undurchsichtig. »Bleibst du?« wurde zu »Bliebsch du?« (manchmal fiel das »du« auch weg), »zwei« blieb jedoch »zwei« und tönte trotzdem anders.
»Tönen« ist auch ein typisch Schweizer Ausdruck, den Deutsche häufiger im Zusammenhang mit Haarefärben verwenden.
Meine in den letzten Jahren auf Besuch bei Amara in Zürich erworbenen Kenntnisse über die sprachlichen Eigenheiten der Schweiz galten in Basel, Bern und den vielen Seitentälern des Landes sicher nur eingeschränkt. Dennoch, anders als die Menschen in Nordkorea würde ich die Schweizer verstehen.*
Unverständlicher waren die Schweizer Preise.
Anfang 2015 hatte die Schweizer Nationalbank die seit 2011 bestehende Kopplung an den Euro aufgehoben. Bis dahin musste 1 Euro mindestens 1,20 Franken kosten. Das hielt für europäische Handelspartner, besonders Deutschland, Waren aus teurer Schweizer Produktion halbwegs bezahlbar. Bedauerlicherweise verlor der Euro gegenüber dem Dollar zunehmend an Wert. Der Franken wäre gegenüber dem Euro gestiegen. Um das künstliche Euro-Franken-Verhältnis aufrechtzuerhalten, kaufte die Schweizer Nationalbank täglich Euro für mehrere Milliarden Franken, so dass der Franken weiterhin weniger wert war als der Euro. Anfang 2015 stieg das dafür benötigte Kapital auf 100 Milliarden Franken – pro Tag. Die Schweizer Nationalbank beendete deshalb die Eurobindung zum Entsetzen der Schweizer Wirtschaft, die zu Recht fürchtete, ihre nun noch teureren Produkte im Ausland nicht mehr loszuwerden. Was nicht nur Folgen für die Schweiz hatte, sondern auch für das im Osten angrenzende Fürstentum Liechtenstein, in dem der Schweizer Franken offizielle Währung ist.
Wenigstens erleichterte der neue Euro-Franken-Kurs das Rechnen. Die Währungen standen fast im Verhältnis eins zu eins. Was nicht bedeutete, dass es für denselben Zahlenwert dieselbe Warenmenge gab.
Die im Bordbistro meines deutschen Zuges erworbene Frühstücksbox enthielt zwei Brötchen, dazu Leberwurst, Marmelade und Margarine in Portionspackungen, ein Päckchen Orangensaft, Plastikbesteck und ein Heißgetränk. Preis: 6 Euro 60. In den Basler Bahnhofsbackshops gab es für 6 Franken 60 ein kleines belegtes Brötchen.
Falls das Touristen nicht genug abschreckte, hingen in der gewaltigen Schalterhalle von Basel SBB meterlange Landschaftsgemälde in erdigen Farben: Sie zeigten den Ort Gstaad, den Silser See, das Jungfraujoch und, als fünfzehn Meter breites Panorama, den Vierwaldstättersee. Die Bilder waren so düster, dass, wäre ich Konstantins Mutter, ich ihm die Augen zugehalten hätte.
Heißen Tee schlürfend, bummelte ich durch eine Ladenpassage, geriet in eine Seitenhalle und stand mit einem Mal vor einer Milchglasscheibentür, die mit »FRANCE« überschrieben war. Aber nur, wenn man darüber hinwegsah, dass sich das E bockig gab und zu den übrigen halbmeterhohen Metalllettern sichtbar Abstand hielt.
Vom Schriftzug auf der oberen Türkante bis zur Hallendecke war der Raum offen, und man erahnte die Weite hinter der Tür.
Neben ihr ragte ein zweistöckiger roter Kubus auf, groß wie ein Einfamilienhaus. An seiner Seite steckte ein Fahnenmast, an dem die französische Trikolore baumelte. Mutig hielt ich auf die Milchglasscheiben zu. Sie teilten sich rechtzeitig.
Aus dem Reich des Franken schritt ich nach Frankreich.
Genauer gesagt, auf französisches Hoheitsgebiet.
Ich marschierte vorbei an den unbesetzten Zollschaltern im Erdgeschoss des roten Kubus und auf eine hölzerne Flügeltür zu, die so alt aussah, dass ich zusammenfuhr, als sie automatisch aufschwang. Der Saal dahinter war breiter als lang und sehr hoch. Holzpaneele und Stuckkanten gliederten die Wände. Zwei mächtige Kronleuchter, schlank und schlicht, hingen von der Decke. In einer Ecke blätterte der Putz ab. An den Längsseiten des Wartesaales standen Sitzbänke, die schmalen Landschaftsbilder an der Wand waren so düster wie die in der großen Schalterhalle. Das »Buffett« überschriebene Holzhäuschen in der hinteren Ecke hatte sicher schon lange nicht mehr seinem Zweck gedient.
Durch eine zweite automatische Holztür trat ich ins Freie.
Als sei er das Zuneigung suchende Stiefkind, drängte sich ein kleiner Kopfbahnhof von hinten an den großen Basel SBB. Das Stiefkind heißt »Basel SNCF«. Die vier Großbuchstaben stehen für die französische Staatsbahn Société Nationale des Chemins de fer Français – auf Deutsch: »Vereinigte Nationale Französische Eisenbahnen«.
Schilder versprachen die Gleise 30 bis 35. Doch die Gleise, die den linken Bahnsteig flankierten, waren als 30 und 31 nummeriert, die am rechten als 33 und 35. Gleis 32 und 34 fehlten. Ähnlich war es damals in Nordkorea. Da hatten im Aufzug meines Hotels in Pjöngjang auf dem Etagentableau die Ziffern 1 und 5 gefehlt.
Von der Unterseite des Bahnhofdaches schälte sich die Farbe. Auf dem Bahnsteigboden waren die Markierungen verblasst. Einzig die Abfallbehälter glänzten wie gerade aus der Fabrik gekommen. Nirgends sah ich Menschen. Ich drehte mich um zu den Prellböcken am Ende der Gleise und hob meine Kamera.
Um die lückenhaften Gleisbezeichnungen ganz aufs Bild zu bekommen, beugte ich mich, Gesicht und Kamera nach oben gerichtet, seitwärts über die Bahnsteigkante.
Hinter mir pfiff jemand. Ich experimentierte mit dem Zoom herum. Es pfiff erneut, deutlich näher. Dann ein scharfer Ruf und eine Druckwelle. Ich riss instinktiv meinen Körper Richtung Bahnsteigmitte. Ein Eisenbahnwagen rauschte Zentimeter entfernt an mir vorbei, das Ende eines Zuges, der rückwärts in den Bahnhof geschoben wurde. Der Rangierer stand in der offenen Verbindungstür am Wagenende, den Fuß auf einem Puffer. Er sprang auf den Bahnsteig und ließ französische Schimpfwörter auf mich niederprasseln.
»Exgüsi«, entschuldigte ich mich bei ihm.
Das Rätsel der Basler Bahnhofsbenennung ist einfach zu erklären. Sofern man Kompliziertes mag.
Der Basler Hauptbahnhof hieß früher »Centralbahnhof«. Heute heißt er »Basel SBB« und im Englischen »Basel Swiss Station«, um ihn von »Basel German Station« (einem weiteren multinationalen Fernbahnhof in Basel) zu unterscheiden und von dem Bahnhof, auf dem ich gerade herumirrte: Basel SNCF, im Englischen »Basel French Station«, ursprünglich »Elsässischer Bahnhof«, weil hier früher die Züge aus dem Elsass ankamen.
Zugabfertigung und Fahrkartenverkauf betreiben die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Auch die Müllentsorgung liegt in Schweizer Händen, was die gepflegten Abfallbehälter erklärt. Der Ursprung des komplizierten Bahnhofsbesitztums liegt im 19. Jahrhundert.
1838 begannen die Betreiber der Elsass-Bahn aus Frankreich mit dem Bau einer Strecke von Strasbourg Richtung Basel, 1840 reichte sie bis an die Schweizer Grenze. Die Stadt Basel wünschte eine Verlängerung, es dauerte aber einige Jahre, bis sich der »Grosse Rat«, die Regierung des Kantons Basel, dazu durchringen konnte, ein ausländisches Unternehmen auf Schweizer Boden tätig werden zu lassen. 1845 bekam Basel schließlich als erste Stadt der Schweiz Eisenbahnanschluss.
Der erste Französische Bahnhof befand sich etwas entfernt vom heutigen Standort auf dem Schällemättli, das so heißt, weil auf den dortigen Feldern, auch »Matten« genannt, Strafgefangene arbeiteten, die – um eine Flucht zu erschweren – Glocken, also Schellen, um den Hals trugen. Ein Prinzip, mit dem die Schweizer schon bei Kühen gute Erfahrungen gemacht hatten.
Auch der ausländischen Bahn trauten die Basler nicht. Deshalb sicherten sie ihre Stadt durch ein Eisenbahntor, dessen Fallgitter von einer durch die französische Bahngesellschaft zu bezahlenden Wache vor dem ersten Zug am Morgen hochgezogen und am Abend nach dem letzten Zug abgesenkt wurde. Außerdem behielt sich Basel eine komplette Schließung des Tores bei Krieg, Aufstand oder Seuchen vor. Nach einigen Umbauten und Standortverlegungen wurde 1907 das aktuelle Gebäude im Rücken des damaligen Centralbahnhofs errichtet.
Auf dem Weg zurück ins Bahnhofsgebäude durchschritt ich zum dritten Mal eine hölzerne, automatische Flügeltür. Sie war mit »Schweiz« überschrieben, und falls jemand beim Durchschreiten einen Anfall von Amnesie erlitt, hatte man auf ein drinnen gleich rechts auftauchendes Glashäuschen große Metalllettern gesetzt, die noch einmal verkündeten, wohin der Weg führte. Nämlich in die »SCHWEIZ«. Im Unterschied zu »FRANC E« tanzte hier keiner der Buchstaben aus der Reihe.
Zollbeamte sah ich nirgends. 2008 ist die Schweiz dem kontrollfreien Schengen-Raum beigetreten. Dennoch hielt ein Schreibpult an der Wand Zollformulare bereit. Wer mehr als 10000 Euro in das Nicht-EU-Land Schweiz bringt, muss dies anmelden.
Meine Reisekasse überschritt diesen Grenzwert nicht. Unter dem T-Shirt, direkt auf der Haut, barg ich in einer flachen Bauchtasche neben Ausweis und Kreditkarte je 600 Euro und Franken in bar. Damit ich mir in der Schweiz täglich eine Mahlzeit leisten konnte – zumindest in der ersten Woche. Deutsche Touristen geben in der Schweiz durchschnittlich 150 Schweizer Franken pro Tag aus. Chinesische 350.
»Kann ich Ihnen helfen?« Inhaltlich gab es an der Frage des Uniformierten, der aus einer Tür des roten Kubus geschossen kam, nichts auszusetzen. Akustisch klang es wie »Hände hoch!«
Ich hatte bei meiner Inspektion des französischen Zollgebiets unablässig Fotos geschossen, mal unauffällig aus der Hüfte, wie ich es in Nordkorea perfektioniert hatte, mal ganz offen.
Wichtig war jetzt, die Aufmerksamkeit von mir abzulenken.
Dabei half mir der Affenkäfig, den ich durch die offene Tür im Raum hinter dem Uniformierten erspähte. Anderthalb Meter hoch, stabile Gitterstäbe, Holzfußboden. Ohne Affen.
Dessen Gewicht hätte man auf der Kreisskala einer altertümlichen Zeigerwaage ablesen können, die vor dem Käfig postiert war. Daneben stand ein roter Tisch, dessen Platte ein zerkratztes Schweizer Kreuz zierte. Es schienen schon einige Affen darübergerutscht zu sein.
»Ist der Käfig für Affen?«
»Nein«, sagte der Zollbeamte misstrauisch, aber abgelenkt.
»Sondern?«
»Für den Hund.«
»Welchen Hund?«
»Den Spürhund.«
»Ach, den.« Ich bedankte mich und flüchtete durch eine Milchglasscheibentür, beschriftet mit »SCHWEIZ«.
Als ich auf den Bahnhofsvorplatz trat, zeigten die Uhren in den dicken Türmen beiderseits der gläsernen SBB-Bahnhofsfassade halb neun. An der höchsten Stelle des Steingiebels, der die Uhrentürme verband, prangte, umschlungen von steinernen Girlanden, ein Schweizer Kreuz auf rotem Grund. Auffällig und zurückhaltend zugleich. Ich stellte mir ein solches Wappen an einem deutschen Bahnhof vor, schwarz-rot-gold-gestreift. Es würde aussehen, als habe jemand ein Sommerkleid eingerahmt.
Ein buntes Hotelsammelsurium umgab den Centralplatz. Rechts hellgelb das Victoria, daneben der blassrote Schweizerhof und links hinten, himmelblau, das Hotel Euler. Gemindert wurde die Fröhlichkeit der farbigen Fronten von einem dunklen Büroturm. Halbverdeckt vom Schweizerhof, erinnerte er an einen Footballspieler, der versucht, sich hinter einer Kindergartengruppe zu verstecken.
Die Kurven der im Boden eingelassenen Tramschienen bedeckten den Platz wie ein verunglücktes Mandala. Im Schatten der Haltestellendächer fegte ein Straßenkehrer kaum sichtbaren Staub zusammen. Nach jedem zweiten Besenstrich schlug er das Querholz aufs Pflaster, um Schmutz aus den Borsten zu lösen. »Sch-sch-tock. Sch-sch-tock.«
Ich setzte mich auf eine Haltestellenbank, klappte meine Frühstücksbox auf und schmierte mir ein Leberwurstbrötchen. Außer mir und dem Straßenkehrer waren noch zwei weitere Menschen auf dem Platz – Herren ohne Unterleib, die reglos hinter den Scheiben am Kopf ihrer grünen Tramschlangen auf Fahrgäste warteten.
Der Besenjazz des Straßenkehrers verstummte. Er machte auf den Stiel gestützt Pause. Meine Leberwurstbrötchenhand stoppte auf halbem Weg zum Mund. Nun bewegte sich nichts mehr auf dem Platz. Alles war ruhig. Ruhig und sauber. So sehr, dass man misstrauisch werden musste. Ich stand auf.
Dem Architekten des Büroturms hinter dem Schweizerhof hatte wohl einer jener Sitzhocker aus einem Elefantenfuß zum Vorbild gedient, die gern als Beispiele geschmackloser Afrika-Souvenirs in Zeitschriften abgebildet werden. Klobig, kreisrund, unten zunehmend breiter.
Jeder der achtzehn Etagenringe bestand aus gleich großen Betonsegmenten mit fünf schmalen dunklen Fenstern. Auf der dem Bahnhofsplatz zugewandten Seite umschlang die unteren Etagen ein fensterloser Vorbau. Er ruhte auf einer dicken Säule, so dass sich darunter ein höhlenartiger Raum ergab. Dort verbarg sich, weit nach hinten versetzt, der Eingang.
Zur Seite floss der Turm ab der siebten Etage in einen gestuften Erweiterungsbau aus, jedes Stufendach begrünt. Weitere Gartenpracht bot ein kleiner Park am Fuß des Turms.
Unzählige Kameras überwachten das Areal. Außer »Ausfahrt Tag und Nacht freihalten« und »Warenanlieferung BIZ« wies nichts darauf hin, dass im Inneren des Baus die Finanzpolitik der Welt bestimmt wird.
Alle zwei Monate fährt sonntagnachmittags eine Kolonne schwarzer Limousinen in die Tiefgarage des Turms. Sie kommt vom eine Autostunde von Basel entfernten Flughafen Zürich und bringt die Chefs der Deutschen Bundesbank, der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds, der Bank of England, der US-amerikanischen Federal Reserve und anderer wichtigen Notenbanken, zum Beispiel der chinesischen.
Die Einfahrt zur Tiefgarage fand ich in der Gartenstraße. Zwei Security-Leute in einem Wachhäuschen hatten mich bereits im Blick. Einer griff zum Telefon. An seiner Stelle hätte ich das auch getan, wenn auf der anderen Straßenseite im Schatten einer Parkhauseinfahrt ein Mann mit Rucksack herumschleicht und Fotos knipst von Zugängen und Überwachungstechnik der Mutter aller Banken. Statt mich aus dem Staub zu machen, spazierte ich über die Straße aufs Gebäude zu. Ich hatte ja nichts zu verbergen. Ich nicht.
Ecke Gartenstraße/Nauenstraße hantierten im Erdgeschoss zwischen chromblitzenden Arbeitstischen Köche mit weißen Mützen herum. War heute wieder einer dieser wichtigen Sonntage, an dem die Bankbosse zusammen speisten? Vor dem Dinner treffen sie sich im abhörsicheren Konferenzraum E, wo sie ohne Störung durch unqualifizierte Finanzminister oder ihre Wähler fürchtende Regierungschefs die internationale Geldpolitik absprechen.
Der Zweimonatsturnus der Treffen wurde schon im Gründungsabkommen 1930 festgeschrieben, als die »gehörig bevollmächtigten Vertreter der Regierungen Deutschlands, Belgiens, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, Italiens und Japans einerseits und die gehörig bevollmächtigten Vertreter der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits« die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ins Leben riefen. Die Interessen der USA vertraten Bevollmächtigte der Banken J.P. Morgan, Nationalbank of Chicago und Nationalbank of New York. Formell trat die Notenbank der USA erst 1994 bei.
Die neue Bank sollte die deutschen Reparationszahlungen gegenüber den Siegermächten des Ersten Weltkriegs abwickeln.
Das »gehörig« betonte nicht etwa, dass in der Bank nichts Ungehöriges vorgeht, sondern dass die Vertreter ihren Regierungen hörig, also rechenschaftspflichtig waren.
Die Gründungsmitglieder spendierten der BIZ ein Startkapital von 500 Millionen Schweizer Franken, was 1930 einem Wert von 14516,13 Kilogramm Feingold entsprach. So viel wiegen drei erwachsene afrikanische Elefantenbullen.
Mit der Schweizer Bundesregierung wurde – bis heute geltend – vereinbart, die BIZ von »gegenwärtigen und künftigen wie immer bezeichneten Steuern, gleichgültig, ob diese vom Bund, von Kantonen, von Gemeinden oder von anderen öffentlichen Körperschaften auferlegt werden«, zu befreien.
Vorteil von Basel außerdem: Die Stadt liegt in einem neutralen Land und ist einer der Eisenbahnknotenpunkte Europas. Die Bänker trafen sich zunächst in direkt am Hauptbahnhof gelegenen Hotels.
1931 wäre das große Banken-Brimborium beinahe wieder zu Ende gewesen, denn Deutschland stellte im Zuge der Weltwirtschaftskrise die Reparationszahlungen ein. Doch die BIZ nutzten inzwischen zwei Dutzend nationale Zentralbanken als Mittler bei Geschäften mit Deutschland. Und umgekehrt stand die BIZ Deutschland als Kapitalverwahrer und Kreditgeber bei Auslandsgeschäften zur Seite.
Bis März 1945 liefen über die BIZ sämtliche Devisen- und Goldgeschäfte Nazideutschlands – von den Gründungsmitgliedern, besonders den amerikanischen, ausdrücklich gebilligt. Ob das deponierte Geld von den Banken besetzter Länder stammte oder das Gold von herausgebrochenen Zähnen, interessierte niemanden.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges orientierte sich die BIZ erneut um. Kunden wurden nach und nach alle Zentralbanken Europas, auch aus sozialistischen Ländern – mit Ausnahme der DDR und der Sowjetunion. Hauptaufgabe war die Verwaltung von Währungsreserven für Nationale Notenbanken, die Koordination von Notfallkrediten bei Währungskrisen sowie die treuhänderische Verwahrung von Kapital bei Umschuldungen oder binationalen Streitigkeiten. So koordinierte die BIZ2003 die Entschädigungszahlungen Libyens an die USA im Zusammenhang mit dem Lockerbie-Anschlag 1988, als libysche Terroristen eine amerikanische PANAM-Maschine über dem schottischen Lockerbie zum Absturz brachten.
Die Notenbanker Europas trafen sich regelmäßig – ab 1977 im Elefantenfußturm. Hier bereiteten sie die Einführung des Euro und die Gründung der Europäischen Zentralbank (EZB) vor.
Die Regelwerke, die das weltweite Bankenmiteinander seit den siebziger Jahren steuern, wurden ebenfalls in der BIZ ausgearbeitet. Sie trugen der Einfachheit halber den Namen Basel. Seit 2013 gilt Basel III. In den Nachrichten sind seit Jahren die Europäische Zentralbank (EZB) und der Internationale Währungsfonds (IWF) als Hüter der weltweiten Finanzpolitik täglich präsent. Derweil eröffnete die BIZ weitgehend unbemerkt Repräsentanzen in Hongkong und Mexiko und baute und bezog in Basel weitere Bürogebäude. Mitglied bei der BIZ sind heute 60 Zentralbanken, die 95 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts repräsentieren. Seit November 2015 steht der BIZ der deutsche Bundesbankchef Jens Weidmann vor. Sein Vize ist Raghuram Rajan, Leiter der indischen Notenbank und ehemaliger Chef des IWF.
Ohne ausdrückliche Zustimmung der BIZ dürfen Schweizer Behörden kein BIZ-Gebäude betreten, denn die Schweizer Regierung garantiert internationalen Organisationen Handlungsfreiheit. Die 623 Mitarbeiter der BIZ können also ganz in Ruhe ihr großes Geschäft erledigen. Es sei denn, es brennt in der mächtigsten Bank der Welt. Für diesen Fall liegt eine vorab erteilte Zutrittsgenehmigung für die Basler Feuerwehr vor.
Was immer BIZ-Mitarbeiter in Ausübung ihres Dienstes tun, sie bleiben straffrei. Zusätzlich besitzen nichtschweizerische Mitglieder des Topmanagements samt ihren Angehörigen volle diplomatische Immunität, sind damit befreit von Zollkontrollen, Zöllen und Steuern und müssen, wenn sie falsch parken, keine Strafe zahlen. Dürfen aber.
Wie umgedrehte Schildkröten klebten im dunklen Eingangsbereich unter dem fensterlosen Vorbau Kameras unter dunkelbraunen Glashauben an der Decke. Ich winkte ihnen zu. Ganz hinten an der Wand entdeckte ich ein schallplattenhüllengroßes Schild. Dort stand in goldenen Buchstaben auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch: »Bank für Internationalen Zahlungsausgleich« – im Dämmerlicht kaum und von der Straße aus gar nicht zu lesen.
So viel stand fest: Am ersten Tag in Nordkorea hatte ich mich halb so oft gewundert wie in der ersten Stunde meiner Schweiz-Reise.
* Sprachwissenschaftler haben in den Schweizer Dialekten allein 22 Vokalfarben nachgewiesen. Unser lateinisches Alphabet kennt nur sechs Zeichen für Vokale. Zudem unterscheiden sich die Dialekte eklatant. Nicht alle Unterschiede kann eine Verschriftlichung abbilden. Und die meisten Einheimischen kennen nicht mal die korrekten Rechtschreib- und Grammatikregeln für ihre Dialektvarianten. Dennoch: Auf Dialekt in einem Buch über die Schweiz zu verzichten ist wie die Zeugung eines Kindes im Reagenzglas. Es ist möglich, aber kühl und leidenschaftslos. Der Dialekt ist das Herz der Schweiz. Und wie bei allen Herzensangelegenheiten droht das Risiko, dass Außenstehende nicht alles verstehen und Insider behaupten, es sei alles ganz anders. Die in diesem Buch verwendeten Dialekte wurden alle von kompetenten Schweizern geprüft. Die Verantwortung für Fehler liegt allein beim Autor. Proteste mögen bitte durch Bewerfen des Verantwortlichen mit weich verpackter Schokolade zum Ausdruck gebracht werden. Da ich des Englischen mächtig bin, sind englische Sätze korrekt wiedergegeben, alle anderen Sprachen lautmalerisch. So, wie ich sie gehört habe.
NÄI JETZT MACHSCH DIE BAZ WIDER IN DIS WÄGELI UND FAHRSCH WYTER. SUNSCHT GIBS E LÄSERBRIEF.
Aufkleber an einem Basler Briefkasten
Wider Erwarten konnte ich schon kurz vor zwölf mein Zimmer beziehen. Sonntags wohnen in Businesshotels keine Geschäftsleute und nur wenige Wochenendgäste. Die WLAN-Nutzung war kostenlos, die Verbindung stabil und schnell.
»Zeig mal die Aussicht«, bat Amara, während sie ihre Wimpern mit einer martialischen Metallzange in Form presste. Sie hatte mich gefragt, ob es mich störe, wenn sie sich »parat macht«. Es störte mich nicht. Sie schminkt sich oft, wenn wir skypen. Auf ihrem Bildschirm sieht sie nicht nur mich, sondern auch ein Kamerabild von sich. Das ersetzt den Spiegel. Sie hatte in zwei Stunden einen Kundentermin. Mit wem, verriet sie nicht. Das macht sie nie.
Stolz hatte ich ihr von meinem Eckzimmer im fünfzehnten Stock berichtet, dessen verglaste Außenwände theoretisch einen atemberaubenden Blick über die Basler Skyline boten. Tatsächlich schaute ich auf die schmutzig roten Dächer grauer Wohnhäuser.
»Das Problem ist: Ich bin die Hälfte der Skyline.«
Amara machte große Augen. Links schon mit mondänem Schwung.
»Der Messeturm, in dem mein Hotel ein paar Etagen belegt, ist das zweithöchste Haus von Basel. 105 Meter, 31 Etagen. Die andere Hälfte von Basels Skyline steht da drüben …« Ich drehte das Handy in Richtung eines weißen, an einer Seite treppenförmigen, Wolkenkratzers. »178 Meter, 41 Etagen. Basels höchstes Haus.«
Falkengleich stieß Amara in die Logiklücke. »Hä? Siebzig Meter höher als deins und nur zehn Etagen mehr?«
»Vielleicht haben sie in den Büros mehr Platz vom Boden bis zur Decke. Oder Geheimetagen. Würde mich hier nicht wundern. Da drin sitzt Hoffmann-La Roche, das ist ein Pharma –«
»Ich weiß«, unterbrach Amara.
Schweizer über ihr Land zu belehren – immer heikel.
»Jedenfalls ist das im Wesentlichen alles an Skyline.«
»Gut, dann zeig mir die Berge.«
Ich schwenkte das Handy hin und her. »Die Vogesen, das Jura und der Schwarzwald.«
»Ich sehe nur Grau.«
»Du musst dir den Nebel wegdenken.«
»Wie viel kostet noch mal dein Vogelnestzimmer?«
»Executive Double-Room, bitte schön! 164 Franken, ohne Frühstück.« Ein Hot-Deal-Schnäppchen aus dem Internet, inklusive lächerlicher 3,8 Prozent Mehrwertsteuer.
Ich stellte das Handy auf das Kopfteil des Bettes.
»Spatzeli, was machst du?«, schepperte Amaras Stimme aus dem kleinen schwarzen Telefonapparat.
»Auspacken.« Ich schnürte den Rucksack auf. »Sag mal, was ist eigentlich die BaZ?«
»Die Basler Zeitung. Warum?«
»Ich bin vorhin an einem Haus vorbeigekommen, da waren fast alle Briefkästen mit Anti-BaZ-Parolen beklebt.«
Ich hatte es fotografiert und las ihr den handgeschriebenen Zettel vor mit der Weiterfahraufforderung fürs Wägli.
Vor Lachen vermalte sie sich beim Lidstrich.
»An einem anderen Briefkasten stand: ›Keine BaZ! Auch nicht geschenkt!‹ Nur ein einziger Briefkasten war ohne Anti-BaZ-Parolen. Da klebte über dem Namensschildchen ein zweites gedrucktes. Darauf stand: ›Musterschweizer.‹«
Amara glaubte mir nicht, also schickte ich ihr mein Foto.
Inzwischen lagen auf meinem Bett drei kleine Plastikdosen mit blauen Deckeln, ein Rollkragenpullover, ein Stapel T-Shirts, schwarze, superleichte Sportschuhe, weiße Frottéschlappen, drei Paar Socken, vier Boxershorts, meine Schlafhose und eine volle Tüte. »Was haben die Leute gegen die Basler Zeitung?«
»Sie hassen Christoph Blocher. Weißt du, wer das ist?«
Ich packte die Tüte aus: eine schwarze Stoffhose samt Ledergürtel, ein blaukariertes Hemd und ein T-Shirt mit V-Ausschnitt, welches man unter dem Hemd nicht sah. Dazu ein himmelblauer Pullover. Meine guten Sachen für Restaurants und Frühstückssalons. Zur Vermeidung von Falten hatte ich alles umeinander gerollt.
»Blocher ist ein Strolch?«, vermutete ich.
»Nein! Mehrfacher Milliardär und Vizepräsident der SVP.«
»Schweizer … Volkspartei?«
»Früher war er ihr Vorsitzender und saß fast fünfundzwanzig Jahre im Nationalrat!«
»Das ist euer Parlament?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.