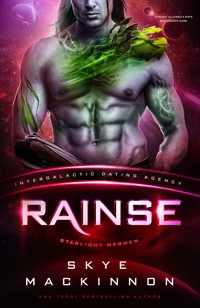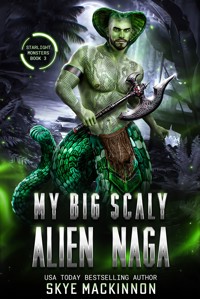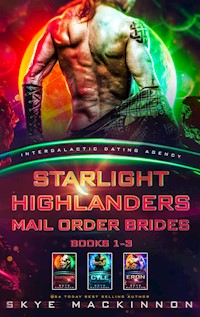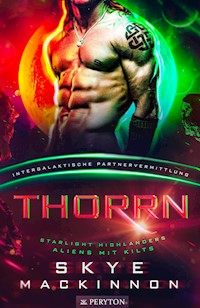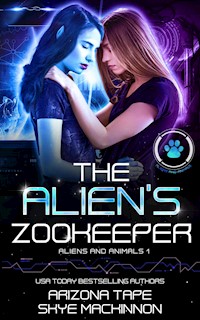Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Peryton Press
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Highland Shifters
- Sprache: Deutsch
Diese Bären haben sie zum Fressen gern...Allein, fast erfroren und weit weg von zu Hause, findet sich Isla in der Obhut von vier höchst anziehenden (wenn auch oft nicht angezogenen) Bärenwandlern wieder. Sie scheinen bereit, ihr zu helfen, aber Isla findet bald heraus, dass nicht alles so ist, wie es scheint.Auf einer einsamen schottischen Insel müssen sie gemeinsam versuchen, die Katastrophen einer untergehenden Welt zu überleben. Wenn die Bären in den Männern die Kontrolle übernehmen, muss Isla sich fragen, ob sie bei ihnen sicher ist... oder ist ihr Leben schon wieder in Gefahr?Gerettet von Bären ist ein Reverse-Harem-Roman mit einer starken Heldin und vier sexy Bären-Shiftern (darunter ein Eisbär!). Freut euch auf starke Alpha-Männer mit einer Spur von Verletzlichkeit, ein episches Abenteuer, Wikinger-Bärte, sehr heiße Szenen, schottische Landschaften, Mythologie und ein post-apokalyptisches Setting.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine liebe Übersetzerin -
sorry für all die heißen Szenen
Von Bären gerettet
Diese Bären haben sie zum Fressen gern...
Allein, fast erfroren und weit weg von zu Hause, findet sich Isla in der Obhut von vier höchst anziehenden (wenn auch oft nicht angezogenen) Bärenwandlern wieder. Sie scheinen bereit, ihr zu helfen, aber Isla findet bald heraus, dass nicht alles so ist, wie es scheint.
Auf einer einsamen schottischen Insel müssen sie gemeinsam versuchen, die Katastrophen einer untergehenden Welt zu überleben. Wenn die Bären in den Männern die Kontrolle übernehmen, muss Isla sich fragen, ob sie bei ihnen sicher ist... oder ist ihr Leben schon wieder in Gefahr?
Highland Shifters
Von Bären gerettet
Von Bären beschützt
Von Bären begehrt
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Vorschau: Von Bären beschützt
Die Autorin
Prolog
London und New York waren unter den ersten Städten, die versanken. Berlin und Mumbai folgten bald darauf.
In der Vergangenheit wurden Städte dicht am Meer gebaut, weil der Seeweg Zugang zu Rohstoffen gewährte und Handel ermöglichte. Jetzt wurde ihnen ihre geografische Lage zum Verhängnis.
Was angeblich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern sollte, geschah in wenigen Monaten. Als in der russischen Tundra der Permafrostboden zum ersten Mal seit Zehntausenden von Jahren auftaute, setzte das Milliarden Tonnen Methan frei. Das Gas entwich in die Atmosphäre und verursachte einen Treibhauseffekt, der größer war als der durch das gesamte CO2, das die Menschen seit Beginn der Industriellen Revolution in die Atmosphäre abgegeben hatten. Das führte zu einem Turbo-Klimawandel. Die Polkappen schmolzen schnell ab, der Meeresspiegel stieg.
Großbritannien versank. Im Norden ist einzig eine Gruppe von Inseln übrig geblieben, die einmal die Berggipfel der schottischen Highlands waren. Die meisten sind von der Außenwelt abgeriegelt und isoliert. Als die Große Flut kam, brach die Gesellschaft zusammen. Bankiers und Politiker wurden überflüssig. Das war vor dreizehn Jahren, ich kann mich kaum noch daran erinnern.
Heutzutage werden wir Bauern, Handwerker, Köche, Mechaniker. Und Heiler, wie ich eine bin. Es gibt keine Universitäten mehr und damit auch keine Ausbildung für Ärzte, also macht man uns zu Heilern. Das ist eine neue Form der Medizin – obwohl, es ist eigentlich eine sehr alte. Es gab sie schon im Mittelalter. Keine Röntgengeräte mehr, keine Chirurgie unter sterilen Bedingungen, keine Antibiotika außer den paar Flaschen, die uns noch geblieben sind. Stattdessen lerne ich jetzt alles über Kräuter, Wurzeln und Blumen, mit denen man Patienten behandeln kann. Der einzige Arzt auf unserer Insel versucht mir beizubringen, was er weiß; aber ohne Labore, Computer und Roboter fällt ihm das sehr schwer. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn alle Ärzte, die noch in der alten Welt ausgebildet wurden, gestorben sind.
Ich bin nicht normal. Auf Salvation Island erwartet man von dir, dass du mit 14 die Schule verlässt und dich dann für die Gemeinschaft nützlich machst. Und als Mädchen solltest du heiraten. Und Kinder bekommen, so viele wie möglich. Bis jetzt bin ich verschont geblieben. Aber das ist jetzt vorbei.
Kapitel Eins
Vergangene Nacht hat mir mein Onkel eröffnet, dass ich Markus heiraten werde. Er hat mich nicht gefragt, ob ich will. Es war eine Feststellung. Was er vorgibt, wird getan. Auch wenn es bedeutet, seine Nichte an den Meistbietenden zu verschachern. Irgendwie hatte ich mir eingeredet, dass dieser Tag nie kommen würde. Dass er meine medizinische Ausbildung für wichtiger halten würde, als die Bevölkerungszahl der Insel weiter nach oben zu treiben. Obwohl es nicht nur darum geht. Nein, eine Frau ist wertvoll – für den Mann, der sie besitzt. Mich an einen Mann zu vergeben bedeutet für meinen Onkel, dass er irgendetwas als Gegenleistung erhält. Macht. Einfluss. Loyalität. Und offenbar ist ihm das wichtiger, als eine Heilerin für seine Leute zu haben. Zumindest bin ich keine Kinderbraut. Erst eine Woche nach meinem zwanzigsten Geburtstag hat mich die gute Nachricht ereilt. Glück gehabt.
Manchmal wünschte ich, ich hätte Cousinen und Cousins, denen er seine Wünsche aufdrücken könnte, dann würde er mich vielleicht in Ruhe lassen. Aber er konnte keine Kinder zeugen. Vielleicht sollte ich froh darüber sein.
Nachdem er mir gestern Abend Bescheid gesagt hatte, hat er mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Es hat keine Fenster, so vorausschauend ist er. Er weiß, dass ich nicht geblieben wäre, wenn ich nicht müsste. Abgesehen von unserer Blutsverwandtschaft verbindet mich nichts mit ihm.
Es gibt nur wenige Menschen, denen man erlaubt hat, die Insel zu verlassen. Das waren meistens Männer, die woanders eine Frau gefunden hatten und versprachen, Rohstoffe zurückzuschicken. Manchmal gab es auch einen Tausch mit einer Insel, auf der es einen Frauenüberschuss gab. Nicht alle Orte waren so von Männern dominiert wie unsere Insel.
Und dann waren da Leute, die ohne Genehmigung fortgegangen sind. Ich kenne zwei von ihnen: George war Ende vierzig und hatte sich zum Hauptgegner meines Onkels entwickelt. Er war nicht einverstanden damit, wie jener die Insel regierte. George wollte demokratische Verhältnisse statt Tyrannei, was meinem Onkel natürlich nicht gefiel. Deshalb verschwand George eines Nachts und nahm eines der Boote mit. Ein paar Tage danach fanden wir seine Leiche unten am Strand. Ich weiß nicht mit Gewissheit, ob sein Boot gekentert ist oder ob man ihn umgebracht hat. So wie ich meinen Onkel kenne, vermute ich letzteres.
Die zweite Flüchtige war Julie. Als Kind habe ich sie vergöttert, obwohl sie nur wenige Jahre älter war als ich. Aber mir kam sie immer perfekt vor. Sie kannte so wunderbare Spiele und scheute nicht davor zurück, auch Erwachsenen einen Streich zu spielen. Meine Eltern waren erst vor kurzem gestorben, und sie gab mir die Liebe und Zuwendung, die ich glaubte verloren zu haben. Als ich heranwuchs, wurden wir zu Freunden. Wir waren unzertrennlich. Meinem Onkel missfiel das; er wollte nicht, dass ich so frei herumlief, hätte seine Nichte lieber als kleines, schüchternes Mädchen gesehen. Er schränkte meine freie Zeit immer mehr ein, aber wenn ich mich davonstehlen konnte, war ich immer mit Julie zusammen.
An ihrem sechzehnten Geburtstag verkündete mein Onkel dann aber, dass sie heiraten würde. Sie weigerte sich. Ihre Mutter unterstützte sie, hatte aber als Frau nichts zu sagen. Julies Vater war in der Großen Flut ertrunken, und als alleinerziehende Mutter, stand sie auf der untersten Stufe der Inselhierarchie.
Mein Onkel beschloss, den Männern der Insel etwas Gutes zu tun und organisierte eine Versteigerung – mit Julie als dem zu steigernden Objekt. Zehn Männer boten für sie in der schändlichsten Zeremonie, der ich je beigewohnt habe. Sie stand auf der Bühne des Gemeindezentrums, zitternd, während die Männer sie wie ein Stück Vieh lüstern umringten. Ich stand hinten in der Menge und weinte still um meine Freundin, die dort so erniedrigt wurde. Sie war immer die stärkere von uns gewesen, aber jetzt nur noch ein wimmerndes Häufchen Elend in der eisernen Faust meines Onkels.
Der Mann, der sie ersteigerte, wartete nicht einmal die Hochzeitszeremonie ab. Er nahm sie unter dem Beifall seiner Freunde direkt mit sich nach Hause, zog sie an ihren Haaren hinter sich her. Ich weinte die ganze Nacht.
Am nächsten Morgen verließ sie nicht das Haus ihres selbsternannten Ehemanns. Auch nicht am darauffolgenden. Am dritten Tag habe ich mich durch ein offenes Fenster hineingeschlichen. Sie lag auf dem fleckigen Bett, die Arme an die Bettpfosten gebunden. Ihr Gesicht war angeschwollen, die Kissen blutverschmiert. Scham sprach aus ihren Augen, und gleichgültig, wie oft ich ihr versicherte, dass alles gut werden würde, wussten wir doch beide, dass dem nicht so war.
Ich machte sie los, und sie umarmte mich zitternd, bevor sie aus dem Fenster stieg. Sie verschwand, und mit ihr eines der Boote. Mein Onkel war wütend. Er konnte nicht beweisen, dass ich Julie befreit hatte, bestrafte mich aber dennoch dafür.
Und er versprach dem Mann, der Julie so misshandelt hatte, dass er eine andere Frau an ihrer Stelle bekäme.
Und heute löst er sein Versprechen ein. Diese Frau soll ich sein. Er will seine einzige Nichte dem Mann geben, der ihre beste Freundin mit Schlägen gefügig gemacht hat. Dreimal darf geraten werden, warum mich diese Aussichten nicht gerade froh stimmten.
Ich verbrachte den ganzen Vormittag im Zimmer, auch den halben Nachmittag und las in einem alten Anatomiebuch, versuchte mich abzulenken; davon, dass ich nun auch an den höchsten Bieter verschachert werden sollte wie ein Stück Vieh. Dass ich heute Abend verheiratet werden sollte und, nach den Plänen meines Onkels, bald darauf Mutter werden würde.
Heute ist ein besonderer Tag, die Wintersonnenwende, der kürzeste Tag des Jahres. Und wahrscheinlich auch der kälteste. Mein Hochzeitstag. Alle haben aus diesem besonderen Anlass ihre schönsten Kleider angezogen. Es ist jetzt fast dunkel, Fackeln erleuchten den Nachthimmel. Von den Bäumen hängen Lampions, und Kerzen flackern auf langen Holztischen, die man auf dem Dorfplatz aufgestellt hat.
Dies wird das größte Fest seit der Sommersonnenwende sein. Ich wünschte nur, ich könnte es ebenso genießen wie die Leute, die hier zum Klang der Fiedeln tanzen. Stattdessen sitze ich auf einer Bank mit vor Kälte klappernden Zähnen und schaue tief in meinen fast leeren Bierkrug. Es ist Mitchs Starkbier, und ich fühle mich schon leicht auf Wolken schwebend. Vielleicht kann ich mit der richtigen Menge Alkohol irgendwie diesen Abend überstehen, ohne jemanden umzubringen. Mich auch nicht.
Ich stehe auf und gehe an den nächstgelegenen Tisch. Dort sitzt Jane, von Männern umgeben, und hütet die Whisky-Flaschen. Sie lächelt mich traurig an. Sie hat schon hinter sich, was mir noch bevorsteht. Nur, dass sie an einen anderen Mann weitergereicht wurde, nachdem sie vom ersten nicht schwanger wurde. Und an noch einen. Jetzt, wo jeder weiß, dass sie unfruchtbar ist, betrachtet man sie als Freiwild. Sonst dürfen nur die wichtigsten Männer der Insel sich fortpflanzen, aber wenn keine Gefahr besteht, dass sie Nachkommen zeugen… Ich hoffe beinahe, dass es Markus gelingen wird, mich zu schwängern. Mit diesem aufmunternden Gedanken im Sinn nehme ich eine der Flaschen und gehe zurück zu meiner Bank. Das wird ein langer Abend werden.
Eine halbe Flasche Whisky später geht mein Onkel aufs Podium. Aller Augen sind auf ihn gerichtet. »Am heutigen Abend wird meine geliebte Nichte Isla sich mit… vermählen…blablabla… Ich bin sicher, auch ihr wünscht dem Paar… blabla…«
Ich höre nicht hin. Alles ist so verschwommen. Ich will hier weg. Ich stehe auf und gehe davon. Keiner bemerkt, wie ich in der Dunkelheit verschwinde. Ich stolpere und rutsche beinahe auf der dünnen Schneeschicht aus, die den Boden bedeckt. Alle sind auf dem Fest. Vielleicht hat man die Boote unbewacht zurückgelassen. Das kommt sonst nie vor. Ich erreiche den Strand. Und vergesse die Boote. Das Meer besteht nicht mehr aus Wasser. Sondern Eis. Vor mir liegt eine dicke Eisschicht. Wow, wann ist das denn passiert?
Das Eis zieht mich an. Ich kann nicht weit sehen; dichter Nebel bedeckt alles. In der Ferne gibt es Inseln, ich habe sie auf den Landkarten gesehen. Viele sind unbewohnt, aber vielleicht kann man auf ihnen überleben? Als Überlebenskünstler bin ich gut – zwanzig Jahre Training!
Ich betrete vorsichtig das Eis. Es ist dick und gibt nicht nach. Ich hüpfe ein Stückchen hoch. Keine Risse. Scheint sicher zu sein. Noch ein Blick zurück. In der Ferne brennen die Feuer, Lachen dringt bis zu mir. Mein Zuhause. Das war einmal. Ich kann nicht bleiben. Ich lache vor mich hin. Weiß nicht genau, warum, aber mir ist gerade danach.
Ich gehe weiter. Manchmal stolpere ich und verliere etwas die Balance. Das macht nichts, solange ich mich weiter von der Insel entferne. In die Dunkelheit hinein. Ich bin müde. Und mir ist kalt, sehr kalt. Mein Onkel hat darauf bestanden, dass ich meine schönste Jacke anziehe, die aber zu dünn ist und nicht für den Winter geeignet. Ich zittere vor Kälte. Bin müde. Will schlafen. Ich drehe mich um. Die Insel ist nicht mehr zu sehen. Ich muss schon eine ganze Weile unterwegs ein. Vielleicht sollte ich mich kurz setzen? Nur einen Augenblick lang, eine kleine Pause.
Das Eis ist gar nicht so kalt wie ich dachte. Sogar relativ warm, und weich. Ganz bequem. Ich strecke die Beine aus und beobachte meine Atemwolken. Weiche, niedliche kleine Wolken. Wenn ich schnell ausatme, kann ich eine ganze Kette von Mini-Wolken produzieren. Wolkenkinder. Hätte nie gedacht, dass Atmen so viel Spaß machen kann.
Vielleicht sollte ich mich etwas bewegen. Mein Onkel könnte schon auf der Suche nach mir sein. Aber es ist so schön bequem hier auf dem Eis, und ich bin so müde. Ich will nicht mehr laufen. Das ist zu anstrengend. Ich habe mir eine Pause verdient. Ich könnte aus dem Schnee auf dem Eis ein Bett für mich machen. Ihn zu einer weichen Matratze zusammenpressen. Oder noch besser, zu einem Sofa. Einem Schneesofa. Ich kichere. Das ist doch noch besser, als einen Schneemann zu bauen. Ich fange an, so weit meine Arme reichen, Schnee zusammenzuschieben. Das ist nicht sehr viel. Ich muss wohl aufstehen, um mehr Schnee zu bekommen. Aber ich bin müde. Ich muss schlafen. Vielleicht geht das auch ohne Bett? Das Eis ist schließlich gar nicht so kalt. Mein Leben lang dachte ich, Eis sei kalt. Ist es aber nicht. Vielleicht ist dies ein besonderes Eis? Nur für mich gemacht. Ich lächle den Himmel durch den Nebel hindurch an und danke den Schneegöttern für ihre Güte.
Geräusche stören mich, bevor ich richtig einschlafen kann. Rufe in der Ferne. Gebell – sind das die Hunde? Ich muss weiter. Ich stolpere auf die Füße und mache ein paar Schritte. Ich taumele mehr, als dass ich gehe. Meine Beine bewegen sich nicht, wie sie sollten. Sie fühlen sich hart an, als würde ich auf Stöcken gehen. Immer einen Fuß vor den anderen.
Jetzt, wo ich wieder gehe, ist mir nicht länger warm. Im Gegenteil, ich friere. Ich berühre meine Wangen mit den Fingern, kann aber nicht entscheiden, was kälter ist, meine Haut oder die Hände. Alles ist kalt. Selbst das Denken fängt an wehzutun. Der Nebel wird wieder dichter, und ich bin mir nicht sicher, dass ich in die richtige Richtung gehe. Bewege ich mich immer noch von der Insel fort? Oder gehe ich im Kreis, wie das Menschen in der Wüste oft widerfährt? Ich kann keine Sterne sehen, die als Anhaltspunkte dienen könnten. Ich bin allein, eine einsame Gestalt, in Schnee und Nebel eingehüllt.
Vielleicht war das doch eine schlechte Idee. Vielleicht hätte ich bleiben sollen. Aber dann erinnere ich mich an Markus‘ faulen Atem und bereue gar nichts. Dann lieber erfrieren, als an diesen schrecklichen Mann gekettet zu sein. Ich bezweifle nicht, dass mein Onkel mich buchstäblich an Markus gekettet hätte, wenn er von meiner Absicht wegzulaufen erfahren hätte. Sollte er mich jetzt fangen, wäre ich nie wieder frei. Er kümmert sich nicht um seine Nichte, wie man das von einem Onkel erwarten könnte. Ich bin für ihn nur eine Ware, die man nach Belieben eintauschen kann. All das Essen, das ich für ihn gekocht habe … jetzt wünschte ich, ich hätte ihm etwas Tollkirsche darunter gemischt. Ein süßer, qualvoller Tod.
Die Geräusche hinter mir sind nicht mehr zu hören, aber ich schleppe mich weiter. Ich habe kein Gefühl mehr in meinem Gesicht, meine Augenlider drohen zuzufrieren. Gefrorene Tränen kleben an meinen Wangen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch laufen kann.
Der Himmel wird langsam heller. Klart nur der Nebel auf oder wird es endlich Tag? Meine Beine bewegen sich weiter vorwärts, während mein Geist dahintreibt. Wenn ich jetzt sterbe, wird mich dann das Meer verschlingen, wenn das Eis schmilzt? Werde ich auf den Meeresgrund sinken und mein Körper sich langsam zersetzen? Werden mich die Fische fressen?
Der Nebel zieht sich zurück. Da hinten ist etwas. Land.
Im Eis erscheinen Risse, wie Blitze. Sie sind überall. Ich schaue nach unten, sie werden größer. Wasser tritt durch sie hindurch und lässt den Schnee schmelzen, der sich auf dem Eis angesammelt hat. Da ist etwas unter dem Eis. Ich beuge mich vor, blinzele, um das Eis aus meinen Wimpern zu entfernen. Ein Gesicht… ich starre auf mein ertrinkendes Ich. Das Eis bricht und ich falle, falle in die Tiefe, und – aber da ist kein Wasser. Ich knie auf dem Eis. Da sind keine Risse. Ich werde wohl verrückt.
Ich krieche. Nicht mehr weit.
Irgendwie weiß ich in meiner Benommenheit noch, dass ich nicht im Schnee liegenbleiben darf. Ich finde einen umgestürzten Baum. Bett. Ich breche auf ihm zusammen und ergebe mich der Weiße des Winters.
Kapitel Zwei
Mir ist nicht mehr kalt. Im Gegenteil, ich fühle mich wohlig warm. Noch etwas erschöpft, aber ich lebe.
Mich umgibt etwas Weiches, und vor meinem Gesicht strahlt Wärme. Ich öffne die Augen und blinzele. Alles ist orange-rot. Da ist ein Feuer mitten in – ja, wo eigentlich? Ich versuche, mich aufzurichten, kann mich aber nicht bewegen. In der Falle! Ich gerate in Panik. In meinem verwirrten Zustand dauert es eine Minute, bis mir einfällt, doch einmal an mir herabzuschauen. Ich seufze erleichtert. Ich bin in Felle eingewickelt, sehr viele Felle. Ich kann jeder Raupe Konkurrenz machen. Ich versuche, einen Arm aus diesem Fell-Kokon zu befreien, dann den anderen auch, bis ich mich endlich hinsetzen kann. Ich liegen in der Mitte eines aus Holz gebauten Raumes – hölzerne Decken, hölzerne Wände, ein Holzboden, Holzregale, Möbel aus Holz. Und es riecht nach Holz. Alles ist braun und rustikal, aber auf gemütliche Art. In der Mitte des Raumes befindet sich eine Feuerstelle. Schon ein bisschen gefährlich, in einem Holzhaus ein offenes Feuer zu entzünden. Aber es ist warm, also ist mir das egal. Nach der vergangenen Nacht will ich nur nicht länger frieren.
Ich winde mich aus den übrigen Fellen – und bemerke, dass ich in meiner Unterwäsche dastehe. Nur in meiner Unterwäsche. Wer immer mich in diese Hütte gebracht hat, muss mich ausgezogen haben. Ich hoffe, es war eine Frau. Hoffe das inständig. Kein Mann hat mich je nackt gesehen. Das gehört sich nicht. Ich sehe mich panisch nach etwas um, mit dem ich mich bedecken kann – außer Fellen. So schön warm sie auch sein mögen, so langsam fange ich an, hier drinnen zu schwitzen. Hinter dem Feuer befindet sich ein großes Fenster (natürlich mit Holzrahmen), durch das die verschneite Landschaft zu sehen ist. Das Haus scheint am Waldrand zu stehen. Es gibt nicht viele bewaldete Inseln; ich habe noch nie so viele Bäume an einem Ort gesehen.
Draußen hängen Eiszapfen herunter, schön und potentiell tödlich. Ich habe einmal einen Patienten behandelt, der von einem Eiszapfen am Kopf getroffen worden war und habe seither großen Respekt vor ihnen. Linker Hand stehen ein Tisch und passende Stühle, offenbar von derselben Person gefertigt. Und dort auf dem Tisch liegen meine Sachen, säuberlich zusammengefaltet. Ich war noch nie in meinem Leben so froh, Kleidungsstücke zu sehen. Meine sind nichts Besonderes, aber sie verdecken.
Nachdem ich mich angezogen habe, setze ich meinen Erkundungsgang fort. Es gibt zwei einander gegenüberliegende Türen. Die eine muss nach draußen führen, den Dreckspuren nach zu urteilen, die vor ihr zu erkennen sind. Mich zieht nichts hinaus in die Kälte, also beschließe ich, den Rest des Hauses zu erkunden. Die andere Tür führt in eine kleine Küche – wenn man einen Campingkocher, ein wackliges Schränkchen und ein paar auf dem Boden aufgestapelte Teller als Küche bezeichnen kann. Sollte man wohl eher Kochnische nennen. Ja, das ist viel besser.
Da ist eine Leiter, die nach oben führt, durch ein Loch in der Decke. Gibt es einen Dachboden?
Ein Quietschen verkündet, dass jemand die Eingangstür geöffnet hat.
»Hallo?«, ruft eine männliche Stimme. »Verdammt, wo…«
Ein junger Mann kommt in das Zimmer. Oh Gott. Sieht der toll aus! Sein blondes Haar fällt auf die dicken Wimpern, die seine blassblauen Augen umgeben, die Kinnpartie hat genau die richtige Form, und seine wunderschönen vollen Lippen sagen gerade – »Da bist du! Ich hatte schon Angst, du wärst wieder rausgegangen. Es ist sehr kalt da draußen, und du hättest dich leicht verlaufen können. Mir wäre das beim ersten Mal auch beinahe passiert, es gibt hier keine Wege, weißt du?«
Ich starre ihn an. Ist der echt?
»Entschuldige, ich bin den Kontakt mit Fremden nicht gewöhnt, deshalb quatsche ich so dumm rum. Tut mir leid. Ich hör schon auf.« Er schweigt, dann grinst er und platzt heraus:
»Wie geht’s dir?«
»Mir…ähm… wer bist du?«
»Oh, entschuldige, ich heiße Finn. Eigentlich Finnean, aber alle nennen mich Finn.« Er macht eine knappe Verbeugung, was mich ihn nur noch mehr anstarren lässt. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Isla. Ich heiße Isla. Wohnst du hier?«
Er sieht sich um, als sei er sich nicht so ganz sicher. Dann nickt er. »Ja, meine Freunde und ich. Sie sind noch draußen, sollten aber bald zurück sein…« Er sieht zerstreut aus.
»Hast du mich am Strand gefunden?«
»Wie? Nein, das war Torben, der… mein Freund. Er hat einen Spaziergang gemacht und dich im Schnee liegen sehen. Du sahst ganz schön blau aus. Also blau. Und schön auch. Himmelzackra – tut mir leid, ich habe lange nicht mehr mit einem weiblichen Wesen gesprochen.« Er grinst mich an, unsicher. Er bedeutet mir, ihm zurück ins Wohnzimmer zu folgen. Das Feuer ist einladend, und ich setze mich auf die Felle neben ihn. Der Schein des Feuers gibt seinem Haar goldenen Glanz. Er ist schön, auf eine ganz feine, engelsgleiche Art und Weise. Allerdings ein Engel mit Muskelpaketen – Schluss, Isla. Du hast keine Ahnung, wer er wirklich ist. Wer wohnt denn schon auf einer Insel nur mit Freunden? Wovon leben sie?
Er räuspert sich. Umwerfend. »Also, was bringt dich hier auf die Insel?«
»Also, ich musste irgendwie von zu Hause fort, und das Meer war zugefroren, also bin ich einfach losgelaufen und dann hier angekommen. Ich hab nicht weiter darüber nachgedacht. Es war wahrscheinlich ein Fehler, aber… ich konnte dort nicht bleiben.«
»Wieso?«, fragt er sanft und sieht mir in die Augen.
»Man wollte mich zu etwas zwingen, das ich nicht wollte.« Ich halte inne und lache freudlos. OK, das klang jetzt wie ein Kind, das seine häuslichen Pflichten nicht erledigen wollte. »Um genau zu sein, mein Onkel wollte mich mit einem Kerl aus unserer Gemeinde verheiraten. Und das wollte ich nicht. Dieser Mann – der macht mir Angst. Ich konnte nicht bleiben.«
Er sieht mir immer noch direkt in die Augen, und ich glaube, die haben ihm viel mehr darüber verraten, weshalb ich hier bin, als ich mit Worten ausdrücken kann.
»Wieso würde dich dein Onkel zu so etwas zwingen? Ich nehme an, ihr seid euch nicht sehr nahe?«
»Wir uns nahe? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, er sieht in mir nur ein junges, unverheiratetes Ding, das man meistbietend an den Mann bringen kann. Auf unserer Insel wohnen nicht viele Frauen, und noch weniger, die jung genug sind, um noch Kinder bekommen zu können. Die Inselbevölkerung wird immer älter, und wir brauchen junge Arbeiter, die noch genug Kraft haben und geformt…« Ich halte abrupt inne, erschrocken, wie ich die Worte meines Onkels so exakt wiedergegeben habe. Ich bin normalerweise so vorsichtig, erwähne nie, was ich mitbekommen habe, wenn er bei uns mit den Männern zu ihren Treffen zusammengekommen war. Dieser Kerl mit seinen blauen Augen verwirrt mich total. Ich weiche seinem Blick aus und schaue aus dem Fenster hinter ihm – in ein Paar Augen, große braune Augen, umgeben von Fell, sehr viel Fell. Ich schreie.
Finn wirbelt herum, ist auf den Beinen, bevor ich es mich versehe. Er beugt sich vor, ist sprungbereit, als er sieht, was ich auch sehe. Einen großen schwarzen Bären, der vom Haus wegläuft. Ich habe noch nie einen echten Bären gesehen, aber er sieht genauso aus wie auf den Fotos. Groß, zottelig, furchterregend.
Finn stößt ein spitzes Lachen aus. »Ah, da hast du gerade einen unserer …. Nachbarn getroffen.«
»Eure…Nachbarn? Sind die nicht gefährlich?«
»Nee, nicht, wenn man sie näher kennenlernt. Dann sind sie sogar recht knuffig.«
Er lacht, und ich will ihn gerade ungläubig anlächeln, als ein weißer Bär aus dem Wald hervorbricht, der hinter dem schwarzen herjagt.
»Ist das ein Eisbär? Hier? In Schottland?«
»Ähm, ja, ich glaube schon.« Er zuckt mit den Schultern. »Der muss hierher geschwommen sein.«
Ich will ihn gerade weiter ausfragen, als die Tür auffliegt und von einem hünenhaften Mann an die Wand gedonnert wird. Er ist riesig. Gigantisch. Gewaltig. Mir fällt kein weiteres Wort ein für diese Ausmaße. Er besteht nur aus Muskeln, über denen sein schwarzes T-Shirt zum Zerreißen gespannt ist. Moment mal, T-Shirt? Es ist eiskalt da draußen, und der Kerl da trägt - beinahe nichts? Ich friere schon, wenn ich ihn nur ansehe.
»Ist dir kalt?«, fragt Finn hinter mir mit besorgter Stimme. Er muss mich sehr genau beobachtet haben, dass ihm der kleine Schauer auffiel, der über meinen Körper gelaufen ist.
»Mir geht’s gut. Ähm… wer bist du?«
»Das könnte ich dich auch fragen«, grummelt der Riese. Es hört sich an, als würde ein Berg den Morgentau begrüßen. »Du bist hier die geheimnisvolle Frau. Du schienst tot zu sein, erfroren. Und jetzt sieht du … lebendig aus. Hast du Hunger?«
Erst jetzt bemerke ich den Fisch, den er in einer seiner Pranken hält.
»Ja, ich glaube schon. Danke.«
Er sieht mich verwirrt an und räuspert sich dann. »Schon gut. Glaube ich.«
Seine Schuhe hinterlassen nasse Spuren auf dem Holzboden, als er sich in die Küche bewegt.
»Das ist Ràn«, flüstert Finn. »Du hast ihn an einem seiner gesprächigeren Tage erwischt.«
»Läuft der immer nur im T-Shirt herum?«
Finn wirft den Kopf zurück und lacht los. »Normalerweise hat er noch weniger an.«
»Aber es ist Winter! Ist ihm nicht kalt?«
»Er hat einen ziemlich guten Stoffwechsel«, kichert er. »Also, wo haben wir die Teller hingestellt?«
Ich zeige in Richtung Küche. »Da waren welche auf dem Boden.«
»Ah ja, die sind lange nicht benutzt worden. Aber nichts, was Einmal-Unter-Den-Wasserhahn-Halten nicht lösen könnte.«
Männer.
Ràn kommt aus der Küche zurück; der Fisch liegt in einer großen eisernen Pfanne, seine Schuppen wurden schon entfernt. Ich bin es nicht gewöhnt, viel Fisch zu essen, oder Fleisch im Allgemeinen. Mein Onkel sieht es nicht gern, wenn die Boote zum Fischfang genutzt werden. Vielleicht befürchtet er, es würden nicht alle zurückkehren. Es gibt ein paar Hühner auf der Insel, aber sie werden hauptsächlich der Eier wegen gehalten und nur zu besonderen Anlässen geschlachtet. Wie zum Beispiel zur Wintersonnenwende.
Ràn legt ein gusseisernes Gestell über die Feuerstelle und stellt die Pfanne darauf. Mein Magen rumort allein bei dem Gedanken an Essen. Das letzte Mal, dass ich etwas gegessen habe, war kurz bevor mich mein Onkel in seine Pläne eingeweiht hat. Danach war mir der Appetit vergangen. Zwei Tage ohne Essen. Wie kommt es, dass ich überhaupt noch stehen kann?
Finn legt ein Stück des gegarten Fischs auf einen Teller und reicht ihn mir. Er sieht belustigt zu, wie ich ihn ihm aus der Hand reiße. Meiner. Einfach fantastisch. Keine Ahnung, wie Ràn es geschafft hat, diesen Fisch so gut schmecken zu lassen, ohne weitere Zutaten zu verwenden. Mein Teller ist viel zu schnell leer. Ein weiteres Stück liegt darauf, aus dem Nichts. OK, Ràn hat es daraufgelegt. Er sieht mich wieder verwirrt an. Offenbar kennt er keine anderen Mädchen, die gerne essen. Oder vielleicht Mädchen im Allgemeinen.
Jetzt, wo der Fisch glücklich in meinem Bauch schwimmt, kommt die Müdigkeit wie ein guter alter Freund. Ich gähne und kuschele mich in die Felle, um es möglichst bequem zu haben. Vielleicht sollte ich wieder in die Raupen-Hülle schlüpfen. Aber dann müsste ich wahrscheinlich einen der Männer bitten, die Felle um mich herum einzustecken. Und das wäre doch peinlich. Ich kenne sie ja noch nicht einmal.
Ich bin zu müde für weitere Gedanken. Ich rolle mich auf den Fellen zusammen und genieße die Wärme, die das Feuer ausstrahlt. Gemütlich.
Ich blinzele, während ich langsam wach werde. Fahles Wintersonnenlicht dringt durch das Fenster über mir. Ich kenne dieses Fenster nicht. Ich sehe mich um. Ich kenne dieses Zimmer nicht. Ich bin auf einer Art Dachboden, der Kniestock reicht mir ungefähr bis zur Hüfte, dann folgt die Dachschräge. Es dauert einen Augenblick, bevor ich mich erinnere. An das zugefrorene Meer, den Marsch, den Fisch. Besonders an den Fisch. Ich habe wieder Hunger. Ich sehe mich um und finde die Leiter, die nach unten führt und hinter einem niedrigen Regal versteckt ist. Als ich den Fuß auf die erste Sprosse setze, höre ich die Stimmen. Männliche Stimmen. Ich kann gerade so verstehen, was sie sagen; sie müssen im Wohnzimmer sein. Es macht Spaß zu lauschen.