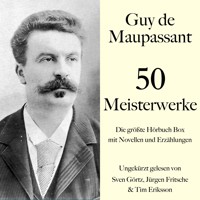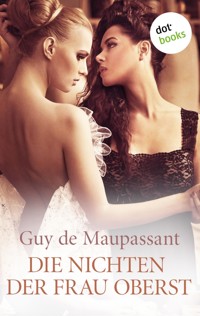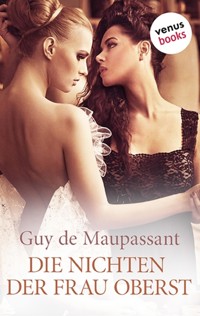8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeitlose Meisterstücke der Weltliteratur Verbotene Liebesabenteuer, tödliche Angelleidenschaften, unheimliche Begegnungen mit einem vampirähnlichen Wesen: In diese Welt führen uns die ironischen, skurrilen und heiteren Geschichten Maupassants. Seine kleinen Meisterstücke beleuchten Außergewöhnliches, Unheimliches, aber vor allem auch Alltägliches. Dabei sind sie so fein gesponnen und vielschichtig angelegt, dass sie gerade auch im Alltäglichen immer das Besondere aufzeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Guy de Maupassant
Von der Liebeund anderen Kriegen
Neu übersetzt,mit einem Nachwort und Anmerkungenvon Hermann Lindner
Deutscher Taschenbuch Verlag
Neuübersetzung 2014
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© der deutschsprachigen Ausgabe:
2014 Deutscher Taschenbuch Verlag, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-42268-0 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14316-5
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
SCHMALZKÜGELCHEN
Mehrere Tage lang waren schäbige Überbleibsel einer Armee in wilder Flucht durch die Stadt gezogen. Das waren keine geordneten Heeresteile mehr, sondern nur noch uniformierte Horden, die Hals über Kopf türmten. Es waren Männer mit langen, schmutzigen Bärten, in zerlumpten Uniformen, und statt in Reih und Glied zu marschieren, schleppten sie sich ohne Fahne in kleinen Grüppchen matt vor sich hin. Sie alle wirkten niedergeschlagen, todmüde, unfähig zu irgendeinem Gedanken oder zu einem Entschluss, trabten nur noch mechanisch weiter, und sobald sie irgendwo zum Stehen kamen, fielen sie sofort vor Müdigkeit um. Zu sehen waren vor allem in aller Eile eingezogene, kriegsunerfahrene Leute, behäbige Privatiers, die unter dem Gewicht des Gewehrs leicht einknickten, ferner Nationalgardisten der unteren Ränge, deren militärische Wendigkeit darin bestand, schnell in Panik und genauso schnell in Begeisterung zu geraten, ebenso überstürzt anzugreifen wie vor dem Feind davonzulaufen; inmitten all dieser gingen einige Rothosen, Überbleibsel einer Division, die in einer großen Schlacht aufgerieben worden war, dazu dunkelgraue Artilleristen zusammen mit Infanteristen aus verschiedenen Truppenteilen; und hier und da sah man auch noch den glänzenden Helm eines Dragoners, der mit schwerem Schritt den leichtfüßigeren einfachen Infanteristen hinterherschlurfte.
Dann waren große Scharen von Freischärlern an der Reihe; sie trugen heldenhafte Namen – »die Rächer der Niederlage«, »die Bürger des Grabes«, »die Teilhaber des Todes« – und sahen doch nur aus wie Straßenräuber.
Ihre Anführer, teils ehemalige Tuch- oder Kornhändler, teils Kaufleute, die früher mit Talg oder Seife gehandelt hatten, allesamt Gelegenheitskrieger, die ihren Offiziersrang ihren dicken Geldbörsen oder ihren langen Schnurrbärten verdankten, hielten, in Flanell gekleidet und mit Waffen und Offizierstressen reich bestückt, hochtönende Reden, diskutierten untereinander alle möglichen Feldzüge und gaben prahlerisch damit an, sie allein würden das fast tot darniederliegende Frankreich retten; dabei hatten sie oft vor nichts größere Angst als vor ihren eigenen Soldaten, lauter Gaunern, die zwar sehr tapfer sein konnten, aber noch lieber die Leute ausplünderten und die Beute sogleich wieder verprassten.
Das Gerücht ging um, die Preußen würden demnächst in Rouen einmarschieren.
Die Mitglieder der Nationalgarde, die seit zwei Monaten in den umliegenden Wäldern überaus vorsichtig Aufklärung betrieben, dabei mitunter auch mal die eigenen Wachposten erschossen und immer schon dann zu den Waffen griffen, wenn auch nur ein kleiner Hase im Gebüsch raschelte, hatten sich mittlerweile wieder ins eigene Wohnzimmer zurückgezogen. Ihre Waffen, ihre Uniformen, der ganze todbringende Plunder, mit dem sie vor Kurzem alle Nationalstraßen drei Meilen im Umkreis gesäumt und alle Passanten in Furcht und Schrecken versetzt hatten, all das war auf einen Schlag wie vom Erdboden verschwunden.
Schließlich hatten die letzten französischen Soldaten vor Kurzem die Seine überquert, um sich über Saint-Sever und Bourg-Achard nach Pont-Audemer abzusetzen; und als Letzter hinter allen anderen ging zu Fuß, zwischen zwei Ordonnanzoffizieren, der verzweifelte General, der mit diesen lumpigen Resten aus unterschiedlichen Heeresteilen nichts mehr ausrichten konnte, auch er völlig niedergeschlagen angesichts des großen Debakels, das da über ein Volk gekommen war, das daran gewöhnt war, zu siegen und das nun trotz seiner legendären Tapferkeit so vernichtend geschlagen worden war.
Danach hatte sich eine große Ruhe, eine ängstliche und schweigende Erwartung über die Stadt gelegt. Viele korpulente, vom bloßen Geschäftsleben verweichlichte Bürger der Stadt sahen der Ankunft der Sieger voller Angst entgegen und zitterten schon bei dem bloßen Gedanken, diese könnten ihre Bratenspieße oder die großen Küchenmesser irrtümlich als Waffen auffassen.
Das Leben schien stillzustehen; die Läden waren geschlossen, die Straßen stumm. Hin und wieder schlich sich ein Bewohner der Stadt, eingeschüchtert von dieser Stille, an den Mauern entlang.
Vom Warten wurde den Leuten so angst und bange, dass sie die Ankunft des Feindes geradezu herbeisehnten.
Im Laufe des Nachmittags jenes Tages, der auf den Abmarsch der französischen Truppen folgte, durchquerten einige Ulanen, die plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht waren, die Stadt im Eilmarsch. Dann, kurze Zeit darauf, zog sich eine schwarze Masse vom Hügel Sainte-Catherine hinunter, während zwei andere Ströme von Eroberern auf den Straßen von Darnetal und Boisguillaume her auftauchten. Die Vorhut dieser drei Heereseinheiten stieß exakt im gleichen Augenblick auf dem Rathausplatz aufeinander; und von allen Nebenstraßen her marschierte nun die deutsche Armee in Rouen ein, Bataillon für Bataillon, deren harte und rhythmische Schritte laut über das Pflaster dröhnten.
Befehle, die in unbekannter Sprache und aus rauen Kehlköpfen geschrien wurden, stiegen an den Häusern hoch, die wie ausgestorben dastanden, während hinter den Fensterläden Augen auf diese siegreichen Männer hinunterlugten, die kraft des ›Kriegsrechts‹ nunmehr die Herren über die Stadt, über die Vermögen und die Menschenleben waren. In ihren abgedunkelten Wohnungen waren die Bewohner der Stadt von der Kopflosigkeit befallen, die die Katastrophen, die großen mörderischen Umwälzungen, die es auf der Welt mitunter gibt, auslösen, gegen die auch die größte Weisheit und die stärkste Kraft nichts ausrichten können. Denn immer dann, wenn die bestehende Ordnung umgestürzt wird, wenn keine Sicherheit mehr besteht, wenn alles, was die Gesetze des Menschen oder der Natur beschützte, einer unbewussten und wilden Brutalität ausgeliefert ist, stellt sich dieser immer gleiche Gefühlszustand ein. Das Erdbeben, das unter den zusammenbrechenden Häusern ein ganzes Volk erdrückt, der Fluss, der sintflutartig über seine Ufer tritt und die ertrunkenen Bauern mit den Kadavern der Rinder und den losgerissenen Dachbalken fortschwemmt, oder die siegreiche Armee, die jene, die sich ihr entgegenstellen, massakriert und die restlichen gefangen nimmt, die im Namen des Säbels plündert und einem Gott beim Klang der Kanonen Dankgottesdienste darbringt, das alles sind gleichermaßen fürchterliche Geißeln, die uns Menschen allen Glauben an eine göttliche Gerechtigkeit, jedes Vertrauen in die schützende Hand Gottes und die Vernunft des Menschen, die man uns in der Schule gelehrt hat, zerstören.
Aber was half es – an jeder Haustür erschienen kleine Abordnungen, die erst anklopften und sodann in den Häusern verschwanden. Das war eben die Besatzung nach der Besetzung. Und damit begann auch die Pflicht der Besiegten, den Siegern gegenüber eine gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Als dann etwas Zeit vergangen war und sich der erste Schock gelegt hatte, kam allmählich eine neue Ruhe in der Stadt auf. In nicht wenigen Familien saß der Offizier beim Essen mit am Tisch der Familie. Bisweilen bewies er eine gute Kinderstube, indem er aus Höflichkeit sein Mitgefühl mit Frankreich bekundete und seinem Unbehagen, an diesem Krieg teilnehmen zu müssen, Ausdruck verlieh. Für diese Gefühlsbezeugung waren ihm seine Gastgeber demonstrativ dankbar; schließlich war ja nicht ausgeschlossen, dass man eines Tages seiner Protektion bedurfte. Die bevorzugte Behandlung, die man ihm angedeihen ließ, half vielleicht dabei, die Anzahl der gewöhnlichen Soldaten, die man durchzufüttern hatte, etwas zu verringern. Und warum sollten sie auch jemanden verletzen, von dem sie völlig abhängig waren? In dieser Richtung aktiv zu werden, das wäre schließlich weniger ein Zeichen von Heldenhaftigkeit als von Tollkühnheit! Und die Tollkühnheit – so etwas gab’s mal zu der Zeit, als sich die Stadt durch ihren heldenhaften Mut bei der Verteidigung gegen einen Feind auszeichnete –, gehört nun mal nicht mehr zu den Fehlern der Bürger von Rouen. Als bestes Argument für französische Höflichkeit führten sie im Stillen an, dass es sehr wohl erlaubt sei, innerhalb der eigenen vier Wände Zuvorkommenheit walten zu lassen, solange man sich dem fremden Soldaten gegenüber in der Öffentlichkeit keinerlei Vertraulichkeiten gestattete. Draußen, da kannte man sich nicht mehr, aber im Hause, da war man zu jeder Plauderei bereit, und der Deutsche blieb jeden Abend ein bisschen länger im Wohnzimmer sitzen, um sich aufzuwärmen.
Auch in die Stadt kehrte allmählich wieder Leben ein. Die Franzosen gingen noch nicht allzu oft aus dem Haus; dafür wimmelte es in den Straßen vor Preußen. Im Übrigen legten die Offiziere der blauen Husaren, die ihre großen Tötungswerkzeuge arrogant über das Straßenpflaster zogen – so schien es den einfachen Bewohner Rouens –, auch nicht übermäßig viel mehr Herablassung an den Tag als die französischen Offiziere des Jägerregiments, die im Jahr zuvor in den gleichen Cafés herumgesessen hatten.
Allerdings lag etwas in der Luft, ein schwer fassbares und unbekanntes Gefühl, eine unerträgliche fremde Atmosphäre, wie ein über die ganze Stadt versprühter Duft, der Duft der Invasion. Er erfüllte die Wohnungen, die öffentlichen Plätze, veränderte den Geschmack der Lebensmittel, vermittelte den Eindruck, von weither, von barbarischen und gefährlichen Stämmen zu kommen.
Die Sieger verlangten Geld, viel Geld. Die Einwohner der Stadt zahlten immer; im Übrigen waren sie reich. Aber je größer in der Normandie der Reichtum eines Geschäftsmanns wird, umso schwerer fällt es diesem, davon etwas zu opfern, und sei es auch nur ein kleines Quäntchen seiner Habe, das in den Besitz eines anderen übergeht.
Allerdings kam es vor, dass zwei bis drei Meilen unterhalb der Stadt in Richtung Croisset, Dieppedalle oder Biessart die Seeleute und die Fischer vom Grund des Flusses diesen oder jenen Kadaver eines Deutschen in mit Wasser vollgesogener Uniform herausfischten, der mit einem Messerstich oder dem Schlag eines Holzschuhs getötet worden war, oder dem jemand mit einem Stein den Schädel eingeschlagen hatte oder ihn von einer Brücke ins Wasser hinabgestoßen hatte. Der Schlamm des Flusses begrub diese dunklen, wilden und legitimen Racheakte, diese unbekannten Heldentaten, diese stummen Attacken, die ja gefährlicher waren als die bei Tageslicht ausgetragenen Schlachten, und denen kein Ruhmesgesang zuteil wurde, unter sich.
Denn der Hass auf den Fremden stachelt immer ein paar unerschrockene Naturen, die bereit sind, für eine Idee in den Tod zu gehen, dazu an, die Waffen zu ergreifen.
Nachdem die Eroberer die Stadt zwar ihrer unbeugsamen Disziplin unterworfen, aber auf ihrem Triumphzug keine einzige der Schreckenstaten begangen hatten, die die Gerüchteküche prophezeit hatte, bekamen die Leute wieder etwas Mut, und der Drang zum Geschäftemachen gewann in ihren Krämerherzen wieder die Oberhand. Einige von ihnen waren mit ihrem Vermögen an Geschäften in Le Havre beteiligt, das noch die französische Armee besetzt hielt, und so wollten sie den Versuch machen, zu diesem Hafen zu gelangen; hierfür mussten sie es über Land bis nach Dieppe schaffen, um sich von dort aus nach Le Havre einzuschiffen.
Zu diesem Zweck bedienten sich die entsprechenden Interessenten des Einflusses der deutschen Offiziere, deren Bekanntschaft sie gemacht hatten, und kamen so in den Besitz einer Reiseerlaubnis, die der Ortskommandeur für sie ausstellte.
So war denn also eine große vierspännige Kutsche für diese Reise reserviert worden, und zehn Personen hatten sich dafür beim Kutscher angemeldet; um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, wurde beschlossen, eines Dienstagsmorgens, noch vor Sonnenaufgang, aufzubrechen.
Seit ein paar Tagen schon war der Erdboden vom Frost hart geworden, und am Montag brachten gegen drei Uhr große schwarze Wolken vom Norden her dichte Schneemassen herbei, die während des Abends und der ganzen Nacht ohne Unterlass vom Himmel fielen.
Um halb fünf Uhr früh versammelten sich die Reisenden im Hof des »Hôtel de Normandie«, wo sie die Kutsche besteigen sollten.
Sie waren alle noch ziemlich verschlafen und schlotterten vor Kälte unter ihren Decken. Sie konnten einander in der Dunkelheit schlecht sehen; und mit den vielen Schichten schwerer Wintersachen, die sie trugen, wirkten all diese Körper wie fettleibige Pfarrer in ihren langen Soutanen. Aber zwei Männer erkannten sich doch, ein dritter sprach sie an, und so kamen sie ins Gespräch: »Ich habe meine Frau dabei«, sagte der eine. »Ich auch.« – »Und ich ebenso.« Der erste fügte noch hinzu: »Wir werden nicht nach Rouen zurückkehren, und wenn die Preußen auch noch weiter in Richtung Le Havre vorrücken, dann setzen wir nach England über.« Da sie alle eine ganz ähnliche Einstellung hatten, hatten sie auch die gleichen Pläne.
Unterdessen war die Kutsche immer noch nicht angespannt worden. Von Zeit zu Zeit wanderte eine kleine Laterne, die ein Stallknecht in der Hand hielt, aus einer dunklen Tür, um sogleich wieder in einer anderen zu verschwinden. Pferdehufe schlugen auf den Boden, gedämpft durch das auf der Erde liegende Streu, und dazu war die Stimme eines Mannes, die mal zu den Tieren sprach, mal fluchte, im Inneren des Gebäudes zu hören. Ein leises Bimmeln zeigte an, dass jemand dabei war, den Pferden das Geschirr anzulegen, aus diesem Gebimmel wurde ein klares und anhaltendes Geklapper, dessen Rhythmus durch die Bewegung des jeweiligen Tieres bestimmt wurde, die manchmal aufhörte, um dann gleich wieder mit einem Ruck einzusetzen, begleitet vom matten Klang eines Hufeisens, das am Boden aufschlug.
Mit einem Mal ging die Tür zu und sogleich war keinerlei Geräusch mehr zu hören. Die verfrorenen Wartenden hatten ihre Gespräche eingestellt; steif und starr standen sie da.
Ein dichter Vorhang aus weißen Flocken sank ohne Unterlass glitzernd zur Erde; er ebnete alle Formen ein, überlagerte alle Dinge mit eisigem Schaum; und in der großen Stille der ruhig daliegenden und vom Schnee bedeckten Stadt war nicht mehr zu hören als jenes unbestimmbare, unbenennbare, herumschwirrende Knistern des herabfallenden Schnees, das eher ein Gefühl als ein Geräusch darstellt, ein Gemisch von leichten Atomen, die die Luft erfüllten, ja den ganzen Kosmos zu bedecken schienen.
Der Mann mit der Laterne tauchte wieder auf und zog an einer Schnur ein trauriges Pferd hinter sich her, das sich nur höchst widerwillig bewegte. Er stellte es neben die Deichsel, befestigte die Gurte, ging hinum und herum, um sich zu vergewissern, dass das Geschirr fest und sicher saß, denn er konnte das alles nur mit einer Hand ausführen, in der anderen hielt er ja seine Lampe. Als er sich anschickte, das zweite Pferd herauszuholen, bemerkte er all die reglosen Reisenden, die schon ganz eingeschneit dastanden, und sagte zu ihnen: »Warum steigen Sie denn nicht ein; dann sitzen Sie wenigstens im Trockenen.«
Daran hatte wohl niemand gedacht, und so stiegen sie hektisch in die Kutsche. Die drei Herren brachten ihre Frauen im Fond unter und stiegen dann auch ein; dann kamen die anderen dieser undeutlichen menschlichen Formen, die teils verschleiert waren, an die Reihe und nahmen die verbliebenen Plätze ein, ohne eine Silbe zu sagen.
Der Boden der Kutsche war mit Stroh ausgelegt, in dem die Füße versanken. Die Damen im hinteren Teil hatte kleine, mit künstlicher Kohle geheizte Fußwärmer aus Kupfer mitgebracht; sie setzten diese sogleich in Betrieb und wurden nicht müde, mit leiser Stimme immer wieder deren Vorzüge zu rühmen, wobei sie ständig Dinge voreinander wiederholten, die sie alle schon lange wussten.
Als die Kutsche endlich irgendwann dann doch angespannt war, mit sechs statt mit vier Pferden, um die Nachteile der winterlichen Straße auszugleichen, da fragte eine Stimme von draußen: »Sind alle eingestiegen?« Eine Stimme von drinnen antwortete: »Ja.« Und die Kutsche setzte sich in Bewegung.
Sie kam nur langsam voran, sehr langsam, Schritt für Schritt. Die Räder versanken ständig im Schnee, der ganze Gepäckraum ächzte und krachte dumpf bei jeder Gelegenheit; die Tiere rutschten ständig aus, schnaubten, dampften; und die riesige Peitsche des Kutschers knallte pausenlos, flog in alle Richtungen, verfing sich und entwirrte sich wie eine kleine Schlange, um gleich darauf wieder auf einen prallen Pferderücken niederzusausen, der sich dann mit neuer Kraft anspannte.
Aber so langsam zog dann doch der Tag herauf. Diese leichten Flocken, die einer der Reisenden, ein lupenreiner Bewohner Rouens, mit einem Baumwollregen verglichen hatte, fielen nicht mehr. Ein schmutziger Lichtschein drang durch dicke, dunkle und tiefhängende Wolken hindurch, die die weiße Farbe der Landschaft noch strahlender erscheinen ließen, in der mal eine Reihe großer Bäume mit einem Mantel aus Raureif, mal eine Hütte mit einer Kapuze aus Schnee zu sehen waren.
In der Kutsche beäugten sich die Mitreisenden voller Neugier im traurigen Licht dieses Morgengrauens.
Ganz hinten im Fond dösten – sich gegenüber – auf den besten Plätzen Herr und Frau Loiseau, Weingroßhändler aus der Rue Grand-Pont.
Angefangen hatte Loiseau als Gehilfe eines Geschäftsmanns; als dieser an den Rand der Pleite geriet, hatte er den Laden aufgekauft und ein blühendes Unternehmen daraus gemacht. Er verkaufte Wein sehr schlechter Qualität zu sehr günstigen Preisen an die kleinen Landgasthöfe und galt bei seinen Bekannten und Freunden als gerissener Schlawiner, eben als echter Normanne, der voller Tricks steckte und immer einen Witz auf Lager hatte.
Sein Ruf als Gauner war so verbreitet, dass Tournel, ein stadtbekannter Verfasser von Fabeln und Liedern, ein witziger Kerl mit spitzer Zunge, eines Abends in der Präfektur den anwesenden Damen, als diese schon ein wenig gelangweilt vor sich hin schauten, vorgeschlagen hatte, eine Partie »Loiseau fliegt, Loiseau betriegt« zu spielen; das Wortspiel fand alsbald seinen Weg durch die Räume der Präfektur, danach durch die ganze Stadt, und hatte einen ganzen Monat lang alle Kinnladen der ganzen Provinz vor Lachen zum Wackeln gebracht.
Loiseau war ebenfalls wegen seiner Witze und Späße jeden Kalibers berühmt, ob sie nun gut oder eher von schlechtem Geschmack waren, und niemand konnte über ihn sprechen ohne die obligatorische Formel anzufügen: »Der ist wirklich unbezahlbar, dieser Loiseau.«
Er war von geringem Wuchs und trug einen kugelförmigen Bauch vor sich her, über dem ein von einem grauen Backenbart umrahmtes rotes Gesicht thronte.
Seine großgewachsene, stämmige, resolute Frau war mit ihrer lauten Stimme und ihrer Entschlussfreudigkeit die organisatorische und geschäftstüchtige Seele des Ladens, in dem er vorne mit seinem munter-jovialen Auftreten schaltete und waltete.
Neben ihnen saß Monsieur Carré-Lamadon, ein Herr mit mehr Würde, gehörte er doch einer höheren Kaste an, denn er war ein bedeutendes Mitglied der Gesellschaft, beruflich als Besitzer von drei Spinnereien im Baumwollhandel tätig, überdies Offizier der Ehrenlegion und Mitglied im Bezirksrat. Während der gesamten Kaiserzeit war er Anführer der wohlwollenden Opposition geblieben, einzig und allein, um sich seine Zustimmung zu der politischen Sache, die er mit Samthandschuhen bekämpfte, wie er selbst zu sagen pflegte, nur umso teurer bezahlen zu lassen. Madame Carré-Lamadon, die um einiges jünger war als ihr Gemahl, diente den Offizieren aus guter Familie, die das Pech hatten, in die Garnison von Rouen abkommandiert zu werden, als Seelentrösterin.
Mit ihrem ziemlich kleinen, recht niedlichen, überaus hübschen Körper, den sie in ihre Pelze eingemummelt hatte, saß sie ihrem Mann gegenüber und betrachtete scheelen Auges das jämmerliche Innere der Kutsche.
Ihre Nachbarn, der Graf und die Gräfin Hubert de Bréville, trugen einen der ältesten und edelsten Namen der ganzen Normandie. Der Graf, in seinem Auftreten ein alter Adeliger bis in die Fingerspitzen, gab sich große Mühe, unter Einsatz kosmetischer Hilfsmittel seine physische Ähnlichkeit mit König Heinrich IV. zu betonen, der, einer ruhmreichen Legende der Familiengeschichte zufolge, eine verheiratete Tochter aus der Dynastie derer von Bréville geschwängert hatte, woraufhin deren Ehemann als Belohnung zum Grafen und Gouverneur seiner Provinz befördert worden war.
Wie Monsieur Carré-Lamadon war Graf Hubert ebenfalls Mitglied des Bezirksrats, vertrat allerdings die orléanistische Partei im Département. Die Frage, wie es zu seiner Heirat mit der Tochter eines mickrigen Reeders aus Nantes gekommen war, gehörte zu den großen gesellschaftlichen Rätseln Rouens. Aber da die Gräfin standesgemäß aufzutreten wusste, bessere Empfänge als sonst jemand gab, ja sogar im Rufe stand, zeitweise die Geliebte eines Sohns von Louis-Philippe gewesen zu sein, verneigte sich der gesamte Adel vor ihr, und ihr Salon blieb die Nummer Eins in der ganzen Gegend, der einzige, in dem noch die alte Galanterie in Ehren gehalten wurde, und wo die Leute sich schwertaten, überhaupt eingeladen zu werden.
Das Vermögen derer von Bréville, das zur Gänze in Liegenschaften angelegt war, belief sich, wie man hörte, auf ein jährliches Einkommen von fünfhunderttausend Pfund.
Diese sechs Personen nahmen also den hinteren Teil der Kutsche ein, und sie repräsentierten den begüterten, selbstzufriedenen und mächtigen Teil der Gesellschaft, jene Schicht, die über Religion und auch sonst über klare Prinzipien verfügte und sich folglich auf ihre sittliche Größe viel zugutehielt.
Wie es der Zufall so wollte, saßen alle Frauen auf der gleichen Bank; und die Gräfin hatte neben sich auch noch zwei Klosterschwestern, die lange Rosenkränze herunterleierten und dazu immer auch noch ein »Pater noster« und ein »Ave Maria« vor sich hin brummelten. Die eine von ihnen war alt und hatte ein Gesicht, das die Pocken so mit Narben übersät hatten, als hätte sie eine volle Salve Schrotkugeln mitten ins Gesicht bekommen. Die andere, von sehr schmächtiger Figur, hatte ein hübsches und kränkliches Köpfchen über einer schwindsüchtigen Brust, die von jener Art Gläubigkeit innerlich zerfressen wurde, wie sie nur Märtyrer und religiöse Schwärmer haben.
Gegenüber den beiden Nonnen befanden sich noch ein Mann und eine Frau, die die Blicke aller anderen auf sich zogen.
Der Mann, den natürlich alle kannten, war Cornudet, der Demokratenheini, das Schreckbild aller Menschen, die etwas auf sich hielten. Seit zwanzig Jahren tauchte er seinen rötlichen Rauschebart in die Biergläser aller demokratischen Stammtische. Mit seinen Gesinnungsbrüdern und Freunden hatte er ein ganz hübsches Vermögen durchgebracht, das er von seinem Vater, einem ehemaligen Konditor, geerbt hatte, und nun erwartete er ungeduldig die Ankunft der Republik, um endlich den Platz in der Gesellschaft einnehmen zu können, den er sich mit so viel revolutionärem Essen und Trinken redlich verdient hatte. Am 4. September hatte er – vielleicht hatte ihm da jemand einen üblen Streich gespielt – geglaubt, er wäre zum Präfekten ernannt worden; als er aber seine Amtsgeschäfte aufnehmen wollte, weigerte sich das Personal der Präfektur, das ja nun Herr im Hause war, ihn als neuen Präfekten anzuerkennen, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als einen geordneten Rückzug anzutreten. Von Haus aus ein guter Kerl, ein harmloser und hilfsbereiter Zeitgenosse, hatte er sich mit unvergleichlicher Hingabe für die Landesverteidigung eingesetzt. Er hatte auf dem freien Feld Löcher graben lassen, die mit frischen Laub und Astwerk von den umliegenden Wäldern aufgefüllt wurden, hatte so auf allen Straßen und Wegen Fallen ausgelegt, und als dann der Feind anrückte, hatte er sich in großer Zufriedenheit über seine vorbereitenden Maßnahmen in Windeseile wieder zurück in die Stadt abgesetzt. Nun war er der Auffassung, in Le Havre von noch größerem Nutzen zu sein, wo demnächst neue Verschanzungsarbeiten notwendig werden würden.
Die Frau, eine von jenen, die im Volksmund Liebesdienerinnen genannt werden, war berühmt für ihr Bäuchlein, das ihr in jungen Jahren schon gewachsen war und das ihr den Spitznamen Schmalzkügelchen eingetragen hatte. Kleingewachsen, mit vielen Rundungen und überall mit Fettpölsterchen versehen, mit wulstigen, an den Gelenkstellen eingeschnürten Fingern, die aussahen wie aus Würstchen gebastelte Rosenkränze, mit einer glänzenden, glatten Haut, einem mächtigen Busen, der sich unter ihrem Kleid nach oben hin wölbte, war sie dennoch eine ungemein appetitliche Erscheinung und hatte dementsprechend großen Zulauf, so herrlich anzusehen war ihr frisch anmutender Körper. Ihr Gesicht hatte die Röte eines Apfels und glich der Knospe einer Pfingstrose kurz vor dem Aufblühen; in der oberen Partie taten sich zwei wunderschöne schwarze Augen auf, über die dichte große Augenbrauen ihre dunklen Schatten warfen; und in der unteren Hälfte lockte ein schmaler, zauberhafter Mund, dessen feuchte Lippen zum Kuss einluden, und dessen Inneres mit glänzenden klitzekleinen Zähnchen ausgestattet war.
Auch sonst, hieß es, verfüge sie über eine Fülle von unschätzbaren Vorzügen.
Sobald die übrigen Kutscheninsassen sie erkannt hatten, setzte ein heftiges Geflüster unter den ehrbaren Frauen ein, und die Wörter »Prostituierte« und »öffentliche Schande« wurden so laut geflüstert, dass sie den Kopf hob. Dann ließ sie einen derart provokanten und selbstbewussten Blick über ihre Nachbarn schweifen, dass es mit der ganzen Flüsterei gleich wieder vorbei war, und die ganze Gesellschaft senkte den Blick – mit Ausnahme von Loiseau, der sie mit kecker Miene musterte.
Aber das Schweigen unter den drei Damen, die die Anwesenheit dieser Dirne urplötzlich zu Bundesgenossinnen, ja, zu ganz engen Freundinnen zusammengeschweißt hatte, hielt nicht lange an. Es war ihre sittliche Pflicht, so schien es ihnen jedenfalls, angesichts dieser schamlosen Person aus ihrer Würde als legitime Ehefrauen ein Bündnis zu schmieden, denn schon immer hat die eheliche Liebe auf ihre freischaffende Kollegin von oben herabgeschaut.
Auch die drei Männer, die beim Anblick Cornudets vom gemeinsamen Instinkt, die Ideale des Konservativismus zu teilen, einander angenähert wurden, kamen ins Gespräch; sie unterhielten sich über Geld, und zwar in einer für die Armen ziemlich herablassenden Art und Weise. Mit der Arroganz des Grandseigneurs und des zehnfachen Millionärs, der er war, zählte Graf Hubert die Verwüstungen auf, die er durch die Preußen erlitten hatte, die Verluste, die aus Viehdiebstahl und Ernteschäden resultierten und merkte an, dass das alles nicht mehr als die Bilanz eines Jahres belasten würde. Monsieur Carré-Lamadon, der die Baumwollindustrie wie seine Westentasche kannte, war so schlau gewesen, sechshunderttausend Francs nach England zu transferieren, so quasi als finanziellen Notnagel für alle Fälle. Was Loiseau betraf, so hatte dieser sich mit der französischen Finanzverwaltung darauf verständigt, dass diese ihm seinen kompletten Bestand an einfachen Tischweinen abkaufte, den er noch auf Lager hatte, weshalb der Staat ihm eine horrende Summe schuldete, die er in Le Havre einzustreichen gedachte.
Und alle drei blinzelten sich kumpelhaft zu. Obwohl aus unterschiedlichen Gesellschaftskreisen stammend, fühlten sie sich über das Geld brüderlich verbunden, als Brüder der großen Freimaurerei all jener, die Geld haben, bei denen das Gold anfängt zu klimpern, sobald sie ihre Hand auch nur in die Hosentasche stecken.
Die Kutsche kam so langsam voran, dass sie um zehn Uhr nicht mehr als vier Meilen zurückgelegt hatten. Die Männer stiegen drei Mal aus, um zu Fuß einen Berg hinaufzugehen. In der Kutsche kam langsam Unruhe auf, denn es war eigentlich vorgesehen, dass sie zum Mittagessen in Tôtes sein sollten, und mittlerweile hatten sie kaum noch Hoffnung, vor Einbruch der Nacht dort anzukommen. Alle Augen spähten hinaus in die Landschaft, um dort irgendwo ein Wirtshaus auszumachen; da blieb die Kutsche in einem riesigen Schneehaufen stecken, und es vergingen zwei Stunden, bis sie wieder daraus befreit werden konnte.
Der Appetit wuchs, schlug sich auf die Gemüter; und nirgendwo kam eine offene Kneipe oder eine Schenke in Sicht; die bevorstehende Ankunft der Preußen und der Durchzug der ausgehungerten französischen Truppen hatten alle Wirte und Händler völlig verschreckt.
Die Männer klapperten die Bauernhöfe am Rande der Straße nach Lebensmitteln ab, aber sie kamen nicht einmal mit Brot zurück, denn der misstrauische Bauer versteckte all seine Restbestände aus Angst, von Soldaten geplündert zu werden, die nichts mehr zum Beißen hatten und deshalb mit Gewalt alles nahmen, dessen sie habhaft wurden.
Gegen ein Uhr mittags erklärte Loiseau unumwunden, einen Mordshunger zu haben. Seit Langem litt die ganze Kutschenbesatzung genauso wie er; und das heftige Bedürfnis, etwas zwischen die Zähne zu bekommen, das mit jeder Minute zunahm, hatte alle Gespräche zum Erliegen gebracht.
Von Zeit zu Zeit musste jemand gähnen; sofort tat es ihm ein anderer nach; und jeder und jede öffnete wechselweise, gemäß seinem Charakter, seiner Lebensart und seiner gesellschaftlichen Stellung den Mund entweder mit Getöse oder aber diskret und hielt sogleich die Hand vor das offene Loch, dem ein unguter Dunst entströmte.
Schmalzkügelchen bückte sich mehrfach, ganz so als ob sie unter ihren Röcken etwas suchte. Dann zögerte sie noch eine Sekunde, warf nochmals einen Blick auf ihre Nachbarn und richtete sich dann seelenruhig wieder auf. Die Gesichter waren blass und verkrampft. Loiseau erklärte, er würde tausend Francs für ein schönes Stück Schinken geben. Seine Frau machte Anstalten, zu protestieren; sie beruhigte sich aber gleich wieder. Sie konnte es nicht ausstehen, wenn jemand auch nur in Gedanken das Geld zum Fenster hinauswarf und verstand diesbezüglich keinerlei Spaß. »Tatsache ist, dass mir nicht gut ist«, sagte der Graf, »wie konnte ich nur vergessen, etwas zum Essen für unterwegs mit einzupacken!« Diesen Vorwurf machten sie sich alle.
Cornudet hatte immerhin eine Flasche Rum dabei; er bot sie den Mitreisenden an, diese lehnten kühl ab. Nur Loiseau genehmigte sich zwei Tropfen, und als er die Flasche zurückgab, bedankte er sich mit den Worten: »Das tut trotzdem gut, es wärmt den Magen und überdeckt den Hunger.« Der Alkohol heiterte ihn auf und so schlug er vor, es so zu machen wie in dem Lied vom kleinen Schiff: nämlich den dicksten der Passagiere zu verspeisen. Diese verdeckte Anspielung auf Schmalzkügelchen schockierte die besser Erzogenen unter den Reisenden. Keiner reagierte darauf; nur Cornudet rang sich ein Lächeln ab. Die beiden Nonnen hatten in der Zwischenzeit aufgehört, ihren Rosenkranz herunterzurattern und saßen bewegungslos da; sie hatten ihre Hände in ihre großen Ärmel vergraben, hielten hartnäckig den Blick gesenkt und nahmen offenbar das Leid, das der Himmel ihnen schickte, gottergeben an.
Um drei Uhr schließlich, als die Kutsche gerade eine schier endlose Ebene durchfuhr, ohne ein Dorf weit und breit, bückte sich Schmalzkügelchen schwungvoll und holte unter der Bank einen großen Korb hervor, auf dem eine weiße Serviette lag.
Als Erstes entnahm sie ihm einen kleinen Faïence-Teller sowie einen silbernen Becher, danach eine geradezu riesige Terrine, in der zwei ganze eingemachte Hühnchen, in ihre Teile zerlegt, unter einer Geleeschicht schlummerten; und dann kamen im Korb noch weitere eingewickelte Köstlichkeiten zum Vorschein: Pasteten, Obst, Süßigkeiten, Vorräte für eine dreitägige Reise, die ihre Besitzerin von der Küche der Gasthäuser gänzlich unabhängig machten. Durch die Nahrungspakete spitzten vier Flaschenhälse. Sie nahm einen Hühnerflügel und machte sich ganz behutsam daran, ihn zusammen mit einem dieser Brötchen, die man in der Normandie »Régence« nennt, zu verspeisen.
Alle Blicke waren auf sie gerichtet. Dann zog der Geruch durch die Kutsche, erfüllte die Nasenlöcher, produzierte in den Mündern Speichel im Übermaß, während sich gleichzeitig die Kiefer schmerzhaft an den Ohren zusammenzogen. Die Verachtung der feinen Damen für diese Dirne steigerte sich bis an die Grenze zur Gewalttätigkeit; am liebsten hätten sie sie erwürgt, oder zumindest aus der Kutsche geworfen, hinab in den Schnee, sie, ihren Trinkbecher, ihren Korb und all die Essensvorräte dazu.
Loiseau dagegen verspeiste mit seinen Blicken die Hühnerterrine und sagte: »Bravo, Madame waren schlauer als wir und haben für alle Fälle vorgesorgt. Es gibt eben Menschen, die immer rechtzeitig an alles denken.« Sie hob den Blick in seine Richtung und antwortete: »Möchten Sie etwas davon, Monsieur? Es ist schon schlimm, wenn man den ganzen Tag nichts in den Magen bekommt.« Sogleich verbeugte er sich mit den Worten: »Ja, Madame, da sage ich nicht nein; ganz offen gestanden, ich kann nicht mehr. Not kennt eben kein Gebot, nicht wahr, Madame?« Er blickte im Kreis herum und fügte dann hinzu: »In Augenblicken wie diesem tut es wirklich gut, auf Menschen zu treffen, die einem aus der Patsche helfen.« Er hatte eine Zeitung bei sich, die er vor sich ausbreitete, um seine Hose vor Fettflecken zu schützen, und mit der Spitze eines Messers, das er immer dabei hatte, fischte er sich eine ganz von glitzernder Geleemasse umhüllte Keule heraus, zerlegte sie mit den Zähnen in kleine Portionen und kaute sie dann mit einer so unüberhörbaren Lust, dass die übrige Kutschenbesatzung in ihrem Elend darauf mit einem großen Seufzer reagierte.
Und schon lud Schmalzkügelchen in unterwürfigem und sanftem Ton die Nonnen ein, sich doch auch an ihrem Imbiss zu beteiligen. Die beiden zögerten keine Sekunde, das Angebot anzunehmen, und langten, ohne auch nur aufzuschauen, kräftig zu, nachdem sie noch schnell ein Vergeltsgott gestammelt hatten. Auch Cornudet schlug die Einladung seiner Nachbarin nicht aus, und so bildeten sie mit den Nonnen eine Art Tisch, indem sie Zeitungen wie ein Tischtuch über ihre Knie ausbreiteten.
Die Münder öffneten und schlossen sich ohne eine Pause, schlangen in sich hinein, kauten, schluckten das Gekaute in wildem Eifer. Aus seiner Ecke heraus gab sich Loiseau alle Mühe, mit leiser Stimme seine Frau dazu zu bringen, es ihm gleichzutun. Sie leistete lange Widerstand, dann, nachdem eine Welle konvulsivischer Zuckungen ihren Unterleib durchlaufen hatte, gab sie schließlich auf. Ihr Ehemann übernahm es, mit einem wohlgeformten Satz an ihre ›bezaubernde Reisegefährtin‹ die Frage zu richten, ob sie wohl auch die Güte hätte, Madame Loiseau ein kleines Stück zu überlassen. »Aber gern, natürlich«, sagte Schmalzkügelchen mit einem freundlichen Lächeln und hielt ihr die Terrine hin.
Als die erste Flasche Bordeaux entkorkt worden war, herrschte eine gewisse Verlegenheit, es gab nämlich nur einen einzigen Trinkbecher. Also wurde dieser nach jedem Schluck abgewischt und dann weitergereicht. Nur Cornudet setzte, wohl aus Galanterie, seine Lippen an die von den Lippen seiner Nachbarin noch feuchte Stelle.
Von lauter essenden Leuten umgeben und an den Ausdünstungen der Speisen beinahe erstickend, litten der Graf und die Gräfin de Bréville wie auch das Ehepaar Carré-Lamadon jene hässlichen Qualen, die von jeher den Namen Tantalus tragen. Plötzlich stieß die junge Fabrikantengattin einen Seufzer aus, der die Blicke aller Übrigen auf sich zog; sie war so bleich wie der Schnee draußen; ihre Augen waren geschlossen, ihr Kopf kippte nach vorn; sie hatte das Bewusstsein verloren. Völlig außer sich flehte der Ehemann die anderen um Hilfe an. Alle waren ratlos, als die ältere der beiden Nonnen den Kopf der Kranken leicht nach oben hielt, ihr Schmalzkügelchens Becher an die Lippen setzte und einige Tropfen Wein einflößte. Da kam gleich wieder Leben in die hübsche Dame; sie schlug die Augen wieder auf, lächelte und erklärte mit ersterbender Stimme, dass sie sich nun schon wieder ganz gut fühle. Aber um einen neuen Schwächeanfall zu verhindern, nötigte ihr die Nonne ein komplettes Glas Bordeaux auf und fügte hinzu: »Schuld daran ist nur der leere Magen, sonst gar nichts.«
Schmalzkügelchen lief rot an und stammelte mit verlegenem Blick auf die vier Mitreisenden, die noch völlig ausgehungert dasaßen: »Oh mein Gott, darf ich es denn überhaupt wagen, diesen Damen und Herren …« Aus Angst, diese Leute zu beleidigen, hielt sie mitten im Satz inne. Da ergriff Loiseau das Wort: »Ach was, in solchen Fällen sind wir doch alle Brüder und Schwestern, wo der eine eben dem anderen hilft. Nun machen Sie schon, meine Damen, nur keine Umstände, greifen Sie doch zu, zum Donnerwetter! Wissen wir denn überhaupt, ob wir ein Haus finden werden, wo wir übernachten können? Bei dem Tempo, mit dem wir dahinschleichen, sind wir nicht vor morgen Mittag in Tôtes.« Die Herrschaften zierten sich ein wenig, niemand wollte der Erste sein und die Verantwortung dafür übernehmen, die Einladung angenommen zu haben.
Aber der Graf war es, der schließlich der leidigen Frage ein Ende machte. Er drehte sich zu der völlig verschüchterten rundlichen Frau hin, setzte seine vornehmste adelige Miene auf und sprach: »Madame, wir nehmen Ihre Einladung gerne an, wir sind Ihnen sehr verbunden.«
Schwierig war nur der allererste Schritt. Als der Rubikon aber einmal überschritten war, langten alle mächtig zu. Schnell war der Korb leer. Zum Vorschein kamen noch eine Leberpastete, eine Taubenpastete, ein Stück geräucherte Zunge, langstielige Herbstbirnen, eine Packung Pont-l’Évêque-Käse, einige Zuckertörtchen und ein Glas mit in Essig eingelegten Gürkchen und Zwiebeln: Wie alle Mitglieder des zarten Geschlechts hatte Schmalzkügelchen eine Schwäche für Rohkost.
Natürlich konnte man die Vorräte dieser Dirne nicht essen, ohne ab und an das Wort an sie zu richten. Also ließ man sich auf eine Plauderei ein, anfangs mit Zurückhaltung, doch nach einiger Zeit, da Schmalzkügelchen sich als angenehme Gesprächspartnerin erwies, tauten auch die anderen immer mehr auf. Die Damen Bréville und Carré-Lamadon, die viel Wert auf Anstand hielten, bedachten sie mit allerlei Nettigkeiten. Vor allem die Gräfin legte diese liebenswürdige Herablassung an den Tag, über die vornehme Damen nun einmal verfügen und die nie in Gefahr geraten, sich beim Umgang mit der Welt zu beschmutzen, und so packte sie ihren ganzen Charme aus. Nur die derbe Frau Loiseau, die das Naturell eines Dorfpolizisten hatte, blieb reserviert und einsilbig, langte dafür umso mehr beim Essen zu.
Natürlich drehte sich das Gespräch um den Krieg. Man erzählte sich die schrecklichen Vergehen der Preußen, die Heldentaten der Franzosen, und alle diese Leute, die da auf der Flucht waren, erwiesen dem Mut der anderen ihren Respekt. Es dauerte nicht lange, und die privaten Erlebnisse kamen zur Sprache, und dabei erzählte Schmalzkügelchen mit ungespielter innerer Erregung, mit dieser Gefühlsaufwallung, die Frauen manchmal ergreift, wenn sie von ihren spontanen Wutanfällen berichten, wie es kam, dass sie Rouen verlassen musste: »In der ersten Zeit dachte ich, ich könnte bleiben«, sagte sie. »Ich hatte eigentlich ausreichend Vorräte im Haus gelagert, und lieber hätte ich ein paar Soldaten durchgefüttert als mich irgendwohin abzusetzen. Aber als ich sie dann gesehen habe, diese Preußen, da sind meine Gefühlte doch mit mir durchgegangen! Ich hatte eine Mordswut im Bauch über diese Kerle und habe den ganzen Tag geweint, so geschämt habe ich mich. Oh! Wäre ich bloß ein Mann, na dann! Von meinem Fenster aus schaute ich sie mir an, diese fetten Schweine mit ihren Pickelhauben, und mein Dienstmädchen musste mich an den Händen festhalten, sonst hätte ich ihnen doch glatt meine Möbel an den Kopf geworfen. Dann sind welche bei mir aufgetaucht, um Logis zu nehmen; da bin ich gleich dem ersten an die Gurgel gegangen. Die sind auch nicht schwerer umzubringen als alle anderen! Und dem hätte ich auch den Garaus gemacht, wenn mich nicht jemand an den Haaren weggezogen hätte. Danach musste ich natürlich untertauchen. Als sich dann endlich die passende Gelegenheit ergeben hat, habe ich mich davongemacht, und so sitze ich nun hier.«
Von allen Seiten bekam sie hierfür Komplimente. Sie wuchs im Ansehen ihrer Reisegefährten, die ihrerseits nicht so viel Mumm aufgebracht hatten; und Cornudet hörte ihr mit einem zustimmenden Lächeln und einem huldvoll-wohlwollenden Schmunzeln zu, ganz so wie ein Priester einem Frömmler lauscht, wie dieser den lieben Gott lobt und preist; denn die Demokraten mit den langen Bärten haben das Monopol des Patriotismus so wie die Herren in der Soutane jenes der Religion haben. Er redete seinerseits in oberlehrerhaftem Tonfall, mit dem Pathos, das er aus den Aufrufen gelernt hatte, die seinesgleichen tagtäglich an die Hauswände klebten, und er schloss mit einem rednerischen Leckerbissen, bei dem er süffisant über diese »Kanaille von Badinguet« herzog.
Aber Schmalzkügelchen protestierte sofort ganz wütend, denn ihr Herz gehörte den Bonapartisten. Sie lief roter an als eine Kirsche und stotterte ganz entrüstet: »Ich hätte Sie alle gern an seiner Stelle gesehen, Sie alle hier. Das wäre eine schöne Pleite geworden, und was für eine! Sie sind es, die ihn verraten haben, diesen Mann! Wenn wir von Nichtsnutzen wie Ihnen regiert würden, dann könnten wir ja gleich die Koffer packen und Frankreich verlassen!« Ohne seine Miene zu verziehen, behielt Cornudet sein herablassendes und hoffärtiges Lächeln im Gesicht, aber es war nicht zu übersehen, dass diese deftigen Worte ihre Wirkung nicht verfehlten, als plötzlich der Graf sich einmischte und nicht ohne Mühe die aufgebrachte Frau wieder beruhigte, indem er mit seiner ganzen Autorität erklärte, dass alle ehrlichen Auffassungen es verdienten, respektiert zu werden. Nichtsdestoweniger fühlten sich die Gräfin und die Fabrikantenfrau, die in ihrer innersten Seele den für gehobene Kreise typischen unüberlegten Hass auf alles Demokratische und diese instinktive Schwäche aller Frauen für despotische Regierungsformen mit glänzenden Uniformen kultivierten, unbewusst zu dieser würdevollen Prostituierten hingezogen, deren Gefühle ihren eigenen so ähnelten.
Nun war der Korb völlig leer. Zu zehnt hatten sie mühelos die Bestände aufgezehrt, voll Bedauern, dass der Korb nicht größer war. Das Gespräch ging noch ein wenig weiter, tröpfelte allerdings nur noch so vor sich hin, seit nichts mehr zu essen da war.
Schon wurde es Abend, die Dunkelheit wurde allmählich undurchdringlich, und die Kälte, die sich beim Verdauen besonders unangenehm bemerkbar macht, führte dazu, dass Schmalzkügelchen trotz ihrer Fettschicht immer wieder zu zittern anfing. Da bot ihr Madame de Bréville ihren Fußwärmer an, in dem die Kohle seit dem Vormittag mehrfach nachgelegt worden war, und die andere nahm das Angebot sofort an, denn sie hatte eiskalte Füße. Die Damen Carré-Lamadon und Loiseau stellten die ihrigen den beiden Nonnen zur Verfügung.
Der Kutscher hatte mittlerweile seine Laternen angezündet. Diese warfen ein helles Licht auf eine Dampfwolke über den schweißgebadeten Rücken der Deichselpferde und den Schnee, der zu beiden Seiten der Straße unter dem unruhigen Schein der Lampen mitzuwandern schien.
In der Kutsche konnte man nun nichts mehr sehen; plötzlich aber gab es ein Gerumpel zwischen Schmalzkügelchen und Cornudet; und Loiseau, der mit seinem Auge den Schatten absuchte, glaubte erkennen zu können, dass der Kerl mit dem üppigen Bart auf einmal auf die Seite rutschte, als wenn er soeben einen starken, aber geräuschlos ausgeführten Schlag abbekommen hätte.
Vor ihnen auf der Straße kamen kleine helle Punkte in Sicht. Das war Tôtes. Sie waren elf Stunden unterwegs gewesen, was zusammen mit den zwei Stunden Rast, die den Pferden in vier Etappen zum Fressen ihrer Portion Hafer und zum Verschnaufen gewährt worden war, vierzehn Stunden ausmachte. Sie fuhren in den Ort hinein und blieben vor dem »Hôtel du Commerce« stehen.
Der Schlag der Kutsche ging auf! Ein Geräusch, das sie alle gut kannten, ließ die Reisenden erzittern; es war das Scheppern einer über den Boden schleifenden Säbelscheide. Und da war auch schon die Stimme eines Deutschen zu hören, der etwas rief.
Obwohl die Kutsche keinen Meter mehr fuhr, stieg niemand aus, so, als würden sie alle damit rechnen, draußen gleich massakriert zu werden. Da erschien der Kutscher mit einer seiner Laternen in der Hand, die plötzlich die beiden Reihen von verschreckten Köpfen, deren Münder offen standen und deren Augen vor Überraschung und Angst weit geöffnet waren, im Inneren der Kutsche hell anstrahlte.
Neben dem Kutscher stand voll im Lichtschein ein deutscher Offizier, ein großer, hellblonder, extrem schmaler junger Mann, der in seine Uniform gezwängt war wie ein Mädchen in sein Korsett, und der an der Seite seine flache Mütze aus Wachstuch hielt, wodurch er aussah wie der Hausdiener eines englischen Hotels. Sein überdimensionaler Schnurrbart, der aus langen geraden Haaren bestand, die auf jeder Seite in Form eines einzigen blonden Härchens so spitz zuliefen, dass man das Bartende gar nicht mehr richtig erkennen konnte, schien auf seine Mundwinkel zu drücken und die Backen so nach unten zu ziehen, dass die Lippen eine merkwürdige Schnute bildeten.
Er forderte die Reisenden in einem elsässisch anmutenden Französisch auf, die Kutsche zu verlassen und sagte in schneidendem Tonfall: »Wollen die Herrschaften denn nicht aussteigen?«
Als Erste gehorchten die beiden Nonnen mit der Willfährigkeit von gottgeweihten weiblichen Geschöpfen, denen die Unterwürfigkeit schon längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Danach erschienen der Graf und die Gräfin, gefolgt vom Baumwollhändler und seiner Frau, danach kam Loiseau, der seine imposante bessere Hälfte vor sich herschob. Als er seinen Fuß auf den Boden setzte, sagte er mehr aus Vorsicht denn aus Höflichkeit zum Offizier: »Guten Tag, mein Herr.« Wie alle allmächtigen Leute schaute ihn der andere nur an, ohne ihn einer Antwort zu würdigen.
Obwohl sie eigentlich am nächsten an der Türe saßen, stiegen Schmalzkügelchen und Cornudet als Letzte aus und traten mit ernster und stolzer Miene vor den Feind hin. Die gut gefüllte Prostituierte gab sich alle Mühe, sich zu beherrschen und Ruhe zu bewahren; der Herr Demokrat dagegen nestelte verlegen und mit zittriger Hand an seinem langen rötlichen Bart herum. Sie wollten beide ihre Würde bewahren, wohl wissend, dass bei Begegnungen wie dieser ein jeder ein wenig sein eigenes Land repräsentiert, und gleichermaßen empört über die Anbiederung ihrer Reisegefährten versuchte sie mit mehr Stolz aufzutreten als ihre Nachbarinnen, die Vertreterinnen der ehrenwerten Gesellschaft, während er aus dem Gefühl heraus, dass er so etwas wie ein Vorbild abgeben musste, in seinem ganzen Auftreten jenes aufmüpfige Sendungsbewusstsein vor sich hertrug, das er seit den Tagen kultivierte, als er die Landstraßen unpassierbar gemacht hatte.
Sie begaben sich in die geräumige Küche des Gasthofs, und der Deutsche ließ sich erst die von der Ortskommandantur ausgestellte Reisegenehmigung, auf der die Namen und der Beruf eines jeden Reisenden vermerkt waren, vorlegen und nahm sich dann viel Zeit, um die ganze Reisegruppe zu mustern und die einzelnen Personen mit den Eintragungen auf der Liste zu vergleichen.
Dann sagte er plötzlich: »Alles so weit in Ordnung«, und verschwand.
Da atmeten alle auf. Sie hatten immer noch Hunger; also wurde das Abendessen bestellt. Dessen Vorbereitung nahm eine halbe Stunde in Anspruch, und während zwei Küchenhilfen den Eindruck erweckten, sich dieser Aufgabe zu widmen, inspizierten die Gäste ihre Zimmer. Diese befanden sich ausnahmslos in einem langen Korridor, der auf eine Glastür zulief, deren Nummer deutlich machte, was sich dahinter verbarg.
Endlich war es so weit; sie waren im Begriff, sich am Tisch niederzulassen, als der Wirt des Gasthofs höchstpersönlich seine Aufwartung machte. Er war ein ehemaliger Pferdehändler, ein dicklicher asthmatischer Mann, aus dessen Kehlkopf fortwährend Pfeiftöne, Geräusper und das Orgeln eines verschleimten Halses tönten. Sein Vater hatte ihm den Namen Follenvie vererbt.
Er fragte: »Fräulein Élisabeth Rousset?«
Schmalzkügelchen zuckte zusammen und drehte sich um: »Das bin ich.«
»Mein Fräulein, der preußische Offizier möchte Sie auf der Stelle sprechen.«
»Mich?«
»Ja, Sie, falls Sie Fräulein Élisabeth Rousset sind.«
Verängstigt zögerte sie und überlegte einen Moment lang, dann erklärte sie rundheraus: »Kann schon sein, aber ich werde da nicht hineingehen.«
Um sie herum entstand nun ein unruhiges Hin und Her; in einer längeren Diskussion gab jeder seine Meinung zum Besten, was wohl die Ursache für diese Aufforderung sein mochte. Da trat der Graf mit den Worten auf sie zu: »Madame, ich kann Ihnen da nicht Recht geben, denn Ihre Weigerung kann beträchtliche Schwierigkeiten nach sich ziehen, nicht nur für Sie, sondern auch für alle Ihre Mitreisenden. Es hat keinen Sinn, sich Leuten zu widersetzen, die am längeren Hebel sitzen. Die Maßnahme, um die es geht, ist ganz bestimmt völlig harmlos; wahrscheinlich ist nur noch eine übersehene Formalität zu regeln.«
Alle anderen pflichteten ihm sogleich bei, baten sie und bettelten sie an, redeten ihr ins Gewissen, bis es ihnen schließlich gelang, sie herumzukriegen; denn alle befürchteten irgendwelche Komplikationen als Folge einer stur ablehnenden Haltung. So sagte sie schließlich:
»Na gut, ich tue es, aber nur für Sie!«
Die Gräfin ergriff ihre Hand: »Und wir sind Ihnen von Herzen dankbar dafür.«
Sie verschwand. Die Übrigen warteten mit dem Essen, bis sie wieder herauskäme.
Alle waren ein wenig beleidigt, dass es nicht sie, sondern diese temperamentvolle und reizbare Person getroffen hatte und bereiteten insgeheim schon ein paar banale Formulierungen vor für den Fall, als Nächste da hineingerufen zu werden.
Aber nach zehn Minuten erschien sie wieder, nach Atem ringend, feuerrot und außer sich vor Wut. Sie brachte nicht mehr heraus als: »Oh, so ein Widerling! So ein Widerling!«
Alle umringten sie, um Näheres zu erfahren, aber sie hüllte sich erst einmal in Schweigen; und als der Graf nicht lockerließ, antwortete sie mit großer Würde: »Nein, das geht Sie nichts an, darüber kann ich leider nicht sprechen.«
Sie versammelten sich um eine hohe Suppenschüssel, der ein Aroma von Kohl entströmte. Trotz dieser aufregenden Einleitung verlief das Abendessen in heiterer Stimmung. Der Cidre schmeckte gut, das Ehepaar Loiseau und die Nonnen hielten sich aus Sparsamkeit daran. Die anderen bestellten Wein; Cornudet verlangte Bier. Er hatte eine ganz besondere Art, die Flasche zu entkorken, die Flüssigkeit zum Schäumen zu bringen, sie zu betrachten, wobei er das Glas schräg hielt, es danach zwischen seine Augen und die Lampe hob, um die Farbe in aller Ruhe zu würdigen. Wenn er dann trank, schien sein wallender Bart, der den Farbton des von ihm so heiß geliebten Getränks angenommen hatte, vor Zärtlichkeit zu beben; keine Sekunde ließ er sein Bierglas aus den Augen, und wie er so dasaß und Bier trank, konnte man meinen, das wäre der einzige Grund, aus dem er auf der Welt war. Es sah so aus, als würde er in seinem Kopf eine Verbindung und eine Wesensgleichheit zwischen den zwei großen Leidenschaften herstellen, die sein Leben erfüllten: Bier trinken und Revolution machen; und mit Sicherheit konnte er keinen Schluck zu sich nehmen, ohne gleichzeitig an das andere zu denken.
Monsieur und Madame Follenvie nahmen das Essen am unteren Ende des Tisches ein. Er, der Wirt, röchelte wie eine kaputte Lokomotive und hatte zu viel Druck auf der Lunge, als dass er neben dem Essen auch noch hätte sprechen können; seine Frau dagegen redete pausenlos, ohne Punkt und Komma. Sie erzählte ihre gesammelten Eindrücke vom Einmarsch der Preußen, was sie so machten, was sie so sagten, bedachte sie mit wüsten Schimpfworten, zum einen, weil diese sie Geld kosteten, und zum anderen, weil sie zwei Söhne in der Armee hatte. Mit ihrem Redeschwall richtete sie sich vor allem an die Gräfin, nachdem sie nun schon mal die schmeichelhafte Ehre hatte, es mit einer Dame von Stand zu tun zu haben.