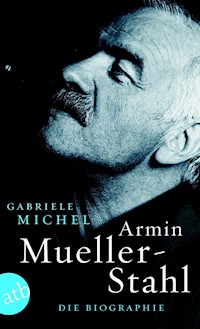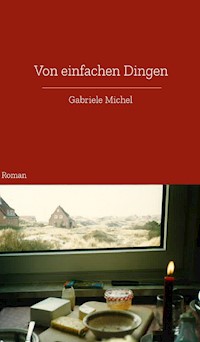
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Frauen einer Familie, die Schwangerschaft und Muttersein als beglückende Erfahrung erleben und zugleich als heftige Auseinandersetzung mit Selbstzweifeln, Ängsten und dem Gefühl, schuldlos schuldig zu werden. Vier Generationen, vier Lebenswege, die deutlich machen, wie einflussreich bis heute das Bild von der umsorgenden Frau und hingebungsvollen Mutter ist, die Güte und Heilung verkörpern soll. Ein starres Bild, das in der jüngeren Geschichte besonders machtvoll wurde durch kollektive Schuldabwehr und ein damit einhergehendes panisches Harmoniebedürfnis. Den Figuren des Romans aber gelingt es, sich diesen rigiden Erwartungen zu entwinden, zu widersetzen - und sich dabei gegenseitig respektvoll und mutig zu unterstützen. Doris Schuster verweigert sich einer für sie unwürdigen Existenz, Marie findet als Eva zu einem glückenden Leben, Hannah verwirklicht ihren Traum als Künstlerin und Fabia versöhnt sich mit sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michel · Von einfachen Dingen
© 2021 Gabriele Michel
Ungekürzte Taschenbuchausgabe
Umschlaggestaltung: Bobby Budäus, unter Verwendung
einer Fotografie von Egon Clute-Simon
Layout & Satz: Die Buchprofis der Buch&media GmbH, München
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
Paperback: 978-3-347-31288-3
E-Book: 978-3-347-31613-3
Gabriele Michel
VoneinfachenDingen
Roman
… es war, als sollte die Scham ihn überleben.
Franz Kafka
Marie
28. Mai 1955
Nicht mal ihre Augen hat sie gesehen. So verschrumpelt und verborgen, der winzige Mensch. So fern inzwischen – und doch sieht sie, wenn sie »Elke« denkt, das Gesicht ihrer Tochter genau vor sich: die hellblauen Augen wie Herbert, mit einer feinen dunklen Linie rundum, hauchdünne blonde Haare, so wie in ihrem Traum gerade.
Frau Taraschewsky lehnt ihr Kopfkissen gegen die Wand und schaltet das Radio ein. Schlafen kann sie jetzt sowieso nicht mehr.
Elke. Im Frühjahr hätte sie ihr eine Schultüte gebastelt, mit Himbeerbonbons, bunten Maoams, zwei Cola-Lutschern. Und für den Einschulungstag hätten sie im Kaufhof das fröhlich blau-weiß-karierte Trägerkleidchen aus dem Schaufenster gekauft.
Wolkenloser Himmel. Wenn die Sonne scheint, kann sie im Innenhof die Wäscheleine aufspannen. Draußen ist alles ruckzuck trocken und riecht auch ganz anders; als hätte der warme Wind frischen Blütenduft in die Fasern geblasen. Frau Taraschewsky schlüpft in die Kleider von gestern und schnappt sich den Korb mit den ordentlich zusammengelegten Laken, Hemden und Handtüchern.
Als sie fast schon in der Waschküche ist, schrillt oben in ihrer Wohnung die Klingel. Sie eilt die Kellertreppe hoch. Vor der Haustür stehen zwei Männer in grüner Uniform: »Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung so früh am Morgen. Wir suchen Taraschewskys hier im Haus.«
»Ja?«
»Bei denen wohnt wohl ein Fräulein Schuster.«
»Ja. Sie ist verreist.«
»Ach, dann sind Sie Frau Taraschewsky?«
»Ja.«
»Und seit wann ist Fräulein Schuster weg?«
»Was ist denn mit ihr?«
»Das können wir Ihnen nicht sagen. Aber wir müssten einen Blick in ihr Zimmer werfen.«
Die Stufen knarren unter den schweren Schritten des Dicken. Im ersten Stock der hässliche Fleck auf dem Treppenläufer. Das Schweigen der beiden Polizisten hinter ihr bedrückt Frau Taraschewsky. Ihre Hand zittert, als sie den Schlüssel an dem hellblauen Bändchen aus der Schublade holt und Fräulein Schusters Zimmer aufschließt – es ist tiptop aufgeräumt.
Die Polizisten schauen sich unschlüssig um. Der Ältere öffnet mit seinen behaarten Händen eine der Nachttischschubladen und nimmt ein Buch heraus, blättert darin und legt es kopfschüttelnd zurück, während sein jüngerer Kollege einen Blick in den Kleiderschrank wirft. Offenbar gibt es nichts Bestimmtes, das sie suchen.
»Es hat mich schon gewundert, dass Fräulein Schuster mit einem so kleinen Koffer aufgebrochen ist. Aber dann hab ich nicht mehr daran gedacht, weil die Kohlen geliefert wurden. Die sind ja jetzt viel billiger als im Herbst, wenn alle bestellen.«
Die beiden Männer beachten sie nicht, schauen flüchtig die Papiere auf dem kleinen Schreibtisch durch, verständigen sich mit einem Blick und wenden sich dann zum Gehen. Erst in der Haustür nennen sie ihre Namen und geben Frau Taraschewsky eine Karte mit einer Adresse in Köln-Deutz und zwei Telefonnummern. Falls sie etwas von Fräulein Schuster hört, soll sie sich umgehend melden.
Das »umgehend« beunruhigt sie – überhaupt ging das alles zu schnell. Unheimlich, wenn der Tag so beginnt. Auf den Schreck muss sie erst mal einen Tee trinken. Vielleicht ist alles auch ganz harmlos. Doch ihr schwindelt, als sie die Gasflamme anzündet und den Wasserkessel auf den Herd stellt. Gut, dass Herbert zum Mittagessen nach Hause kommt. Sie muss das unbedingt loswerden – und für die Polizisten wird er sich sicher interessieren.
Über Elke sprechen kann sie nicht mit ihm. Er dreht sich weg, macht den Kühlschrank auf oder das Radio an.
Immerhin hat er ihr letztes Jahr am ersten April, als Elke vor fünf Jahren hätte zur Welt kommen sollen, die Tapete geschenkt, die ihr so gefiel. Bunte Dreiecke, durch schwungvolle schwarze Linien miteinander verbunden. Das sei jetzt modern und von einem berühmten Maler inspiriert, hat ihnen der Verkäufer erklärt. Eigentlich versteht sie nichts von Malerei und Herbert schon gar nicht. Aber die Tapete gefällt ihr, besonders das Lichter-Spiel, wenn die Sonne darauf fällt. Das Wasser blubbert, Frau Taraschewsky zieht rasch ihren Kittel an. Nylon, das ist praktisch, schützt Rock und Bluse und sieht immer adrett aus, auch wenn die Taschen am Rand schon etwas gelblich sind.
Zum Tee eine Schnitte mit Brombeermarmelade, selbst gekocht. Die Brombeeren hat sie letztes Jahr zusammen mit Herbert am Bahndamm gepflückt. Wenn sie das Brot sofort isst, braucht sie keine Margarine und kann Sonntag mit gutem Gewissen etwas mehr davon nehmen. Es geht ihnen ja nicht schlecht inzwischen, aber das Sparen sitzt einfach drin.
Frau Taraschewkys Blick folgt einem jungen Kerl, der auf seinem Motorroller am Küchenfenster vorbei saust und dabei geschickt den großen Löchern im Straßenbelag ausweicht. Genauso ist sie mit dem Fahrrad manchmal durch die Straßen gefegt. Früher. Hoffentlich werden die Asphaltschäden noch vor dem Sommer ausgebessert. Wenn es erst mal richtig heiß ist, trocknet der Teer nicht, und man bleibt mit den Absätzen hängen.
Sie hatte sich schon eine Wiege ausgeliehen. Und dann war plötzlich alles vorbei. Mit niemandem hat sie darüber sprechen können. Weil sie zu leicht war, ist Elke nicht einmal beerdigt worden. Jetzt gibt es einen Baum am Waldrand, wo Frau Taraschewsky einen Elke-Stein hingelegt hat, den sie besuchen kann.
Das leere Zimmer zu vermieten ist ihr schwer gefallen, aber jetzt kann sie dafür ab und an richtig zum Friseur gehen. Und nächstes Jahr könnte es für einen Fernseher reichen. Mit Fräulein Schuster kamen die Erinnerungen. 1945 bei Metzger Künkelmann in Gladbach. Bei denen waren sie die Fremdlinge. Zu zehnt in einer Dreizimmerwohnung, immer eng und immer das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. An Karneval sangen die Leute auf offener Straße »Am dreißigsten Mai geht ein Flüchtlingstransport – mer lache uns kapott, dann sin se wieder fott.«
Frau Künkelmann war oft garstig, aber sie hatte es auch schwer, die vier Kinder, das Geschäft und dann noch wir. Der Mann kam manchmal abends und brachte Mutter ein Stück Wurst oder einen Knochen mit Fleisch für Suppe.
Sieben Monate ist Fräulein Schuster jetzt schon bei ihnen – und eigentlich inzwischen ja eine Frau. Seit ihr Kind auf der Welt ist. Hat sich für die Schachtel mit Knusperpralinen nett bedankt, als sie nach der Geburt wieder nach Hause kam und erzählt, dass es ein gesundes Mädchen sei und alles in Ordnung.
Mehr wollte Frau Taraschewsky damals nicht fragen. Aber sie hat sich schon gefreut, mal auf das Kind aufzupassen. Man denkt ja solche Sachen. Schließlich ist sie fast immer zu Hause. Doch das Fräulein hat ihre Kleine in dem Heim vom Krankenhaus gelassen, ist gleich wieder arbeiten gegangen. Und dann so plötzlich verreist.
»›Ganz Paris träumt von der Liebe …‹ – mit diesem wunderschönen Lied von Caterina Valente wollen wir den Tag beginnen. Es ist 7.12 Uhr, und es kündigt sich ein sonniger Frühlingstag an.«
Das Radio ist ihr gutes Stück. Ein Loewe-Opta, das sollte es dann schon sein. Herbert hat es ihr gekauft, weil sie so viel allein ist. Dafür hat sie ihm versprochen, dass die Flasche tagsüber im Schrank bleibt. Ganz hält sie sich nicht daran, aber bei dem schönen Wetter kann sie heute Nachmittag in den Park gehen oder auf der Schildergasse Schaufenster gucken. Dann ist die Versuchung nicht so groß.
Jetzt muss sie aber runter, sonst ist die Wäscheleine voll. Nur rasch noch das Zimmer wieder in Ordnung bringen, falls das Fräulein gerade heute zurückkommt.
Frau Taraschewsky wischt sich die Marmeladenreste von den Fingern, die offene Tür am Ende des dämmrigen Flurs, der Schlüssel steckt noch.
Der Dicke hat sich beim Durchsuchen des Nachttisches aufs Bett gesetzt, ganz verkrumpelt sieht das jetzt aus. Als sie das Deckbett aufschüttelt, fällt ihr Blick auf etwas Dunkelblaues, das unter dem Kopfkissen hervorlugt.
Sie zögert, legt das Plumeau ordentlich aufs Bett, greift rasch darunter und zieht ein Schulheft hervor. Es ist abgegriffen, der Umschlag hat Eselsohren, die Frau Taraschewsky glatt zu streichen versucht. Dabei schlägt sie, wie aus Versehen, die erste Seite auf – und sofort wieder zu.
»Bitte nicht lesen« steht da.
Das ist privat, sie muss das Heft zurücklegen. Ihre Hände zittern. »Bitte nicht lesen.« Vielleicht ein Tagebuch. Das Tagebuch eines fremden Menschen lesen, das darf man nicht.
Aber vielleicht enthält es wichtige Informationen. Ob Fräulein Schuster zusammen mit der kleinen Marie weggefahren ist? Schnell, als könnte jemand sie sehen, steckt Frau Taraschewsky das Heft in ihre große Kittel-Tasche, streicht noch mal die Bettdecke glatt, verschließt die Zimmertür und geht ins Schlafzimmer. Dort schiebt sie das Fundstück unter die Arztromane in ihrem Nachttisch, klopft die Betten auf, wischt Staub auf den Nachttischen, legt Herberts Hosen zusammen und die Bettvorleger gerade.
Wenn das Tagebuch Hinweise darauf enthält, wo Fräulein Schuster ist, müsste sie es der Polizei bringen. Umgehend. Aber vielleicht steht auch drin, was mit dem Mädchen ist. Frau Taraschewsky zieht das schmale Heft zögernd wieder aus der Schublade, legt es aufs Bett und geht ins Bad. Sie putzt das Becken, stellt die Zahnbürsten gerade, holt neue Handtücher. Sie wird schnell lesen. Und wenn Fräulein Schuster am Ende des Hefts noch nicht zurück ist, wird sie es der Polizei geben.
12. Dezember 1954
Eklig der modrige Geschmack im Mund. Auch noch solche Träume!
Wie sie da hockte, genau in der Kuhle, in der ich immer liege, die fette schwarze Spinne mit ihren gefräßig ausholenden Kraken-Beinen. Da wächst etwas in mich hinein, frisst mich von innen weg.
Ich will kein Kind. Aber ich will auch nicht so träumen von diesem Kind, das die Leute bald »dein Kind« nennen werden. Mein Kind. Nie wird es Hans-Jürgens Kind sein, für niemanden. Immer nur meins! Als hätte nur ich diese paar Male die Berührungen genossen, die Gier und die Lust.
Er war schnell weg, der Herr Abteilungsleiter, als ich versucht habe, mit ihm zu sprechen.
Jetzt ist alle Schuld bei mir. Bald wird sie sichtbar sein. Wo soll ich hin? Das Kind darf mir nicht so zu Leibe rücken. Schlafen. Schlafen bis morgen, bis Sonntag, über Weihnachten weg, aus dem Leben raus schlafen. Mit dem Kind. Dann wäre es mein Todesschlafkind.
Ihr Herz wummert. Dachte sie sich doch, das Buch führt sie zu der Kleinen, zu Marie. Aber jetzt muss sie sich erst mal beruhigen.
Frau Taraschewsky klemmt sich den Wäschekorb wieder unter den Arm und geht mit zitternden Beinen in den Keller, um die Leine zu holen.
Das Tagebuch ist ein Beweisstück, egal wofür. Was sie tut, ist Unrecht. Aber sie will wissen, was mit dem Kind ist. Vielleicht kann sie das Heft schon morgen zum Revier bringen. Im Hof ist noch niemand, die Leinen sind rasch gespannt. Sie klammert die Handtücher und Unterhemden zusammen, rasch, ein Topflappen fällt ihr aus der Hand, sie schlägt die Blätter ab, rubbelt einen frischen Fleck weg, nun steht auch noch Frau Schwamborn schnaufend mit einem Stapel Bettwäsche auf dem Hof, die blonden Haare gewellt wie bei Lilo Pulver.
Mit einem kurzen Gruß huscht Frau Taraschewsky an ihr vorbei, früh habe der Metzger ja immer die besten Stücke.
Die feuchten Oberhemden hängt sie auf Kleiderbügeln ins Bad und geht dann schnurstracks ins Schlafzimmer, schlägt das Tagebuch auf und findet auf Anhieb die Stelle, an der sie vorhin aufgehört hat zu lesen.
13. Dezember
Wenn mir nur nicht so übel wäre. Aber kotzen werd ich nicht, weiß ich ja. Bleibt immer im Würgen stecken. Würgen, und niemand darf etwas merken. So elend allein. Aber wenigstens ein Zimmer. Und die Vermieterin hat gütige braune Augen, mütterliche Arme und immer adrett frisiertes Haar. Also ordentlich. Sehr ordentlich: »Herrenbesuch ist nach 20 Uhr verboten!« Als sie das sagte, hat ihre Stimme nach jedem Wort ein Ausrufezeichen gesetzt. Dafür säuft der Mann nicht, ist zumindest noch nie laut geworden. Wenn nur das Bett nicht so weich wäre. Aber alles besser als die Schreierei zu Hause.
»Ein Bastard! Ein Bastard in unserer Familie.« Was ich mir dabei denken würde, wo er sich abrackert Tag für Tag. Ein Flittchen sei ich. Eine Schande!
Vater in einen Zwerg zu verwandeln, ein sich im Zorn verzerrendes Rumpelstilzchen – der Kinderzauber hat nicht mehr funktioniert. Wie er sich aufgebaut hat und geschrien, die Adern an seinem Hals traten wulstig hervor: »Du bist nicht mehr meine Tochter! Eine Hure, eine elende Hure, das bist du, ja!«
In dem Moment hätte ich gehen sollen. Wusste ja, was jetzt kommt: Zucht, Anstand, die feigen Wehrkraftzersetzer. Die hätten die Deutschen in den Dreck gezogen, so wie jetzt ich ihn in den Dreck ziehen würde. »Aber wir sind eine ehrbare Familie. Und das bleiben wir auch!«
Den ganzen Schmodder auf dem Papier abladen? Klappt genauso wenig wie Schäfchen zählen.
Frau Taraschewsky geht zur Vitrine und schenkt sich ein Glas ein. Das braucht sie jetzt. Auf ihrem Bett sitzend, trinkt sie die goldbraune Flüssigkeit in zwei großen Schlucken weg. Warme Ruhe breitet sich in ihr aus.
16. Dezember
Ha, ehrbare Familie. Ich hab’ doch gesehen, wie sie es getrieben haben, die Nachbarn rundum, als der Krieg vorbei war. Wie sie gegrapscht haben, schon nachmittags betrunken. Wie zu Frau Krings gegenüber abends immer neue Männer kamen. Dagmar im Zimmer neben ihrer Mutter musste alles mit anhören. Gebetet hat sie, dass ihr Vater endlich aus der Gefangenschaft zurückkommt. Aber jetzt will davon natürlich niemand mehr etwas wissen. Da muss ich dann eine Schande sein!
Sollen sie sich doch anständig fühlen, von mir aus, für den Rest ihres Lebens.
Mutters Gesicht, so schmal, ihre Augen, aufgerissen vor Schreck, als Vater schrie: »Raus, raus«. Seine Stimme überschlug sich: »Nicht unter meinem Dach!«
Rausgehen, packen, nichts denken. Die beiden haben nebenan weiter gestritten, später rannte Vater Richtung »Simons«. Nach einer Weile das Knarren von Mutters Bett.
Mein Brief für sie auf dem Kopfkissen, so einsam.
»Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.«
Morgens beim »Früh« Tee mit Rum. Der Alkohol war mir egal. Hab mir gewünscht, das Kind würde den ganzenAufruhr nicht überstehen, ich ginge aufs Klo, plötzlich Schmerzen, Blut, ein kleiner Klumpen und alles wäre vorbei. Ich war dreimal auf dem Klo. Wehgetan haben nur meine abgefrorenen Finger.
Kalt ist ihr auch. Frau Taraschewsky greift zum Glas, stellt es schnell wieder weg, ist ja eh leer. Sie kann jetzt nicht aufhören zu lesen.
18. Dezember
Schon wieder Betrunkene unten. Diese penetrante, schrille Stimme, die nach ihrem Dieter schrie: »Du kannst doch nicht ohne deine Irene nach Hause gehen.«
Ausgerechnet Irene. Wie Hans-Jürgens Frau. Feiger Typ. Kein Wort wert. Heile Familie. Spielt sonntags sicher mit seiner Püppchen-Frau und dem misstrauisch blickenden Sohn Autoquartett oder Canasta.
Ein Schreck fährt ihr in die Bauchgrube. Irene heißt auch die Frau von Hans-Jürgen, dem Stolz ihrer Schwester. Dass der kleine Klaus misstrauisch guckt, hat sie zwar noch nicht bemerkt, aber der Name und die Püppchen-Frau passen hundert Prozent auf Hans-Jürgens Irene, so hochnäsig und etepetete, wie die ist.
Jetzt braucht sie doch noch ein Glas. Es gerät ein bisschen groß, aber bis zum Mittagessen sind es noch vier Stunden. So ein Durcheinander. Sie muss weiterlesen. Darüber kann sie ja nicht mal mit Herbert sprechen.
24. Dezember
»Kommet ihre Hirten, ihr Männer und Frauen.« Wenn jemand mich so sähe. Flöte spielen unter der Bettdecke! Aber so hören die beiden nebenan nichts. Dass in fast allen Weihnachtsliedern das kleine Kind rumgeistert, ist mir früher nie aufgefallen.
In der Rosenstraße essen sie jetzt Braten mit Rotkohl und Kartoffelpüree, exakt um sieben Uhr. Das Exakte war ihm immer wichtig. Kein Satz von Mutter an mich. Geht ja auch nicht, ohne Adresse. Im Büro nachzufragen, war ihr wohl zu unangenehm. Könnte sich ja jemand etwas denken! Ich hätte es wissen können. Immer schon war ihnen das Wichtigste, dass die Nachbarn rechts und links nichts zu reden haben. Etwas zu gelten.
Dass es so wehtut!
Die Glocken, das muss der Weihnachtsgottesdienst sein. Jetzt drehen Taraschewskys auch noch ihr Radio laut. Schön, die helle Stimme der Frau. So innig. Die singt gern – auch wenn ihr Herbert keinen Ton trifft.
Im Wohnzimmer auf und ab gehend, versucht Frau Taraschewsky, sich mit kleinen Schlucken zu beruhigen. Das Fräulein hat recht, Herbert kann nicht singen. Wenn sie das gewusst hätte, wie das Mädchen allein in seinem Zimmer …
Eigentümlich, von Weihnachten zu lesen – und draußen so hell. Die Sonne hat sie völlig vergessen. Und sie weiß immer noch nicht, wo Marie ist.
7. Januar
Gestern mit Hans-Jürgen ein Bier getrunken. Dass ich in den Mann mal verliebt war. Na ja, wohl eher geschmeichelt, dass er sich für mich interessiert hat. Und ich wollte berührt werden, ja, das wollte ich.
Ahnte nicht, wie weh es tut, wenn jemand nah ist und dann plötzlich so fern, feindselig. Angst bekommen hat er, wollte sich und seine traute Familie in Sicherheit bringen. Schon im Stehen, sein anzüglich Gemeines: »Du warst eine aufregende Überraschung. Eigentlich schade, dass ich schon vergeben bin.«
Arschloch.
Hoffentlich hat das Kind keine blonden Haare.
Sie muss sich einen Tee machen, sonst verliert sie ganz die Fassung, vom Cognac und all den Gefühlen. Aber jetzt weiß sie immerhin, warum dieser Mann nicht ihr Neffe sein kann. Hans-Jürgen trinkt kein Bier. Stößt höchstens an Geburtstagen mal mit einem Sekt an. Ihm schmecke der Alkohol nicht. Sagt er. Hans-Jürgen. Immer erfolgreich. Immer gut gelaunt.
Der nächste Eintrag ist nicht lang.
20. Januar
Heute auf den Ämtern. Formulare ausgefüllt, Absprachen getroffen, beinahe ohne Gefühl. Sonst könnte ich das nicht. Der Sachbearbeiterin klebte ein grünes Blatt am Zahn, das gab ihr etwas Hexenhaftes. Die trinkt sicher auch ohneSchwangerschaft nur Pfefferminz-Tee und löst abends Kreuzworträtsel. Aber sie war fair, hat keine blöden Fragen gestellt oder versucht, mir ins Gewissen zu reden. Danach bin ich ewig durch die Stadt gelaufen. Spüre das Kind und lass es doch nicht richtig auf die Welt kommen. Nicht in meine Welt. Aber die gibt es ja auch nicht mehr.
Frau Taraschewsky kramt in ihrer Schürze nach einem Taschentuch, wischt sich die Tränen ab, legt das Heft eine Schublade tiefer, ganz nach hinten – ihre Binden fasst Herbert nicht an.
Draußen gießen zwei Männer in fleckigen Arbeitsanzügen vorsichtig schwarz glänzenden Teer in die Schlaglöcher. Wie Rübenkraut sieht er von hier oben aus. Sie öffnet das Fenster, saugt den ölig-heißen Geruch ein, wird ruhiger.
Herberts Schritte erkennt sie schon im Treppenhaus. Bedächtig, schwer, dabei ist er nicht mal fünfzig. Sein leises Schnaufen, als er im Flur seine Jacke auszieht. Nur im Hemd würde Herbert nie ins Büro gehen.
Im Vorbeigehen legt er ihr kurz eine Hand auf den Rücken, schaut zufrieden in den dampfenden Topf und rutscht auf die Eckbank.
Zwei Teller Nudeln verputzt er. Frau Taraschewsky betrachtet ihn, essen kann sie nicht. Seine kräftigen Unterarme mit dem blonden Flaum gefallen ihr immer noch.
Während sie die Küche aufräumt, legt Herbert sich immer zu einem Nickerchen hin. Kaum ist er wieder aus dem Haus, schließt sie die Vitrine mit zwei Umdrehungen ab, holt die Trittleiter und legt den Schlüssel oben auf den Kleiderschrank. Dann schiebt sie die Gardine beiseite, rückt den schweren Sessel ans Fenster, wo die helle Mittagssonne hinfällt, und sucht blätternd das nächste Datum:
12. Februar
Ich will nicht allein sein, ich will keine Geburt, ich habe Angst. Es ist kalt, Frau Taraschewsky knappst mit den Kohlen. Und natürlich hat sie was gesehen, als ich gestern zum Wäscheaufhängen im Keller war. Dabei war es noch fast Nacht.
An das Zusammentreffen im Keller erinnert sich Frau Taraschewsky gut. Sie war einen Moment lang wütend, als sie den gewölbten Bauch unter Fräulein Schusters Bademantel sah. Ja, sie wollte sich nicht mit bissigen Bemerkungen der Leute im Haus herumschlagen. Aber dann hat sie doch gefragt, wie es heißen soll.
»Marie oder Michael, je nachdem« hat Fräulein Schuster gemurmelt und ist rasch nach oben verschwunden.
Das Bäuchlein hat sie neidisch gemacht, doch das konnte sie sich damals nicht eingestehen.
Im Hof wollte sie an der Teppichstange eine Schaukel für Elke aufhängen und in den Garten einen kleinen Waschzuber stellen.
2. März
Schon wieder so ein Lärm unten. 2.23 Uhr. Wenn das so weiter geht, klapp ich zusammen. Zusammenbruch und Klinik, dann würde man sich wenigstens um mich kümmern.Die Blicke der Kollegen! Tun so, als wäre der Bauch nicht da – aber niemand spricht mit mir. Niemand, der mir wenigstens mal einen Tee kocht.
Die Bonifatia, ja, die hat immer zugehört. Auch wenn ich etwas ausgefressen hatte. Hat mich sogar, wenn ich weinte, manchmal in den Arm genommen. War ein bisschen peinlich, ihr weicher Busen unter dem rauen Stoff. Sie wäre total entsetzt, todsicher. Aber wenigstens jemand, mit dem ich reden könnte.
23. März
Dass ich damit ins Internat fahren würde! Richtig schlecht war mir, als ich die hohe Klostermauer sah.
Kaum waren wir am Rhein unten, hat die Bonifatia geradeheraus gefragt, wann das Kind kommen wird. Plötzlich war dieser 6. Mai furchterregend nah, wie ein Henkers-Datum.
Bis zur Schiffsanlegestelle kein Wort. Kleine, schmutzige Wellen zwischen den Kieselsteinen. Einmal fuhr ein Frachtschiff mit Kohle vorbei, schwarz und schwer. Auf dem Uferweg ließ ein Junge seinen Ball titschen. Am Fährhaus stand immer noch die wackelige Bank, eine zerbeulte Bierdose rollte auf den Planken des Stegs.
»Jedes Kind ist ein Kind Gottes«, hat sie als erstes gesagt. Ausgerechnet!
Wut, so eine Wut auf mich, auf die Bonifatia, auf meine verdammte naive Hoffnung.
»Die Geburt musst du allein durchstehen. Wenn du danach Hilfe brauchst – ich werde alles versuchen.«
»Durchstehen«, das Wort, als hätte ausgerechnet Mutter Bonifatia eine Ahnung von dem, was mir bevorsteht. Diese wahnsinnige Angst! Sterben, am liebsten sterben.
»Du kannst auch bis zur Geburt bei uns wohnen, wenn du das willst. Wir könnten dich schützen.«
Das hat mich ganz umgehauen. Als hätte sie was gespürt. So geheult hab ich in all den Monaten nicht. Und sie hat mich in den Arm genommen, wie früher.
Danach war nicht mehr viel Zeit, sie musste zur Abendandacht. Als wir vom Rhein weg den Abhang hoch stiegen, drehte Mutter Bonifatia sich plötzlich um, blieb stehen und schaute mich direkt an: »Das ist das einzige, was ich am Kloster bereue. Ich hätte gern ein Kind gehabt.«
Legte ihre Hand auf meinen Bauch und hat ihn kurz gestreichelt. »Ich werde für euch beten.«
Niemand hat für ihre Elke gebetet. Wieder verschwimmen Frau Taraschewsky die Buchstaben vor den Augen. Die Tränen tropfen auf die fließende Handschrift von Fräulein Schuster, es sind nur noch ein paar Zeilen.
2. Mai
Heute in der Klinik. Ich war sehr ruhig. Als eine Schwester gefragt hat, warum ich allein komme, war der Vater leider »dienstlich verhindert«. Da fand ich mich gut.
Schreiben macht mich weich, traurig. Ich muss aufhören damit. Ich darf auf keinen Fall schwach sein.
Dann nur noch eine Zeile
6. Mai
Marie ist geboren. Mein Leben ist zu Ende.
Frau Taraschewsky geht zum Fenster, schaut den Mädchen im Hof zu, die Gummitwist spielen.
Nein, sie wird das Heft niemandem geben. Sie wird es zurücklegen. Und sie wird die Kleine suchen, Marie. Oder Fräulein Schuster nach ihr fragen, wenn sie wieder zurück ist. Wenn. Alles so verworren. Es klang unheimlich, wie die Polizisten von ihr sprachen.
Jetzt muss sie sich sputen, sonst ist das Abendbrot nicht fertig, wenn Herbert nach Hause kommt. Von der Spüle aus fällt ihr Blick auf die Straße. Ist das nicht …? Die Kartoffel rutscht ihr aus der Hand, unten steuert der jüngere der beiden Polizisten, Herr Klausner, auf das Haus zu. Das Tagebuch …
Es klingelt, einmal, zweimal dreimal. Sie muss öffnen, sieht an sich hinunter: Die verwaschene Kittelschürze, das Küchenmesser mit den Kartoffelkrümeln in der Hand – wenn sie so verhaftet wird!
»Guten Abend, es tut mir leid, ich störe, es ist Essenszeit, ich weiß, aber …«
Herr Klausner spricht merkwürdig hastig.
»Haben Sie Fräulein Schuster gefunden?«
»Ja.« Er macht eine Pause. Eine lange Pause.
»Wir hatten heute früh nur eine Vermisstenmeldung. Inzwischen hat man sie gefunden.«
Frau Taraschewsky greift zum Türrahmen. Sie kennt diesen Tonfall, sie kennt solche Sätze aus den Hörspielen im Radio. Herr Klausner kommt nicht wegen des Tagebuchs. »Das arme Ding.« Sie wischt sich mit der Schürze über die Augen.
Herr Klausner steht ihr mit hängenden Armen gegenüber: »Ja, das war sie wohl.«
Dann ist es still in dem abgeblätterten Hausflur.
Doch Herr Klausner kommt rasch wieder in Bewegung. »Es gibt Anlass zu der Annahme, dass Fräulein Schuster ein Kind hatte, ich meine hat«, sagt er mit amtlichem Nachdruck und fragt in Frau Taraschewskys verweintes Nicken hinein: »Kennen Sie das Kind?«
»Ja, es heißt Marie, und Fräulein Schuster hat es erst mal dem Heim des Krankenhauses übergeben.«
»Das ist ja sehr gut«, fällt ihr Herr Klausner ins Wort. Sein behördlicher Eifer lässt sie zurückschrecken.
»Was ist denn mit Marie?«
Mit dem Kind sei gar nichts, versichert Herr Klausner, der wohl nicht richtig zugehört hat, das sei bei ihr ja offenbar in guten Händen. Fräulein Schuster habe nur für das Kind, bevor, also, als sie noch lebte, einen Brief geschrieben. Den hätte die Polizei auf Helgoland in ihrem Pensionszimmer gefunden. Auf dem Briefumschlag stehe auch ihr Name, Taraschewsky. Wenn das Schriftstück hier sei und eine Abschrift vorläge, brächte er es vorbei.
Beim letzten Satz wendet er sich Richtung Treppe. »Entschuldigen Sie, ich muss wieder zur Wache, wollte Sie nur möglichst umgehend informieren.«
Benommen hebt Frau Taraschewsky das Kartoffelmesser auf, geht zurück in die Wohnung, sieht aus dem Küchenfenster Herrn Klausner in der Beethovenstraße verschwinden.
Für einmal ist sie froh, dass Herbert abends meist müde und mundfaul ist.
Dass sie es mit ihm nun schon seit fünfzehn Jahren gut hat, obwohl sie beide so verschieden sind! Begreifen kann sie das nicht – aber sie legt ihm fast das ganze Siedewürstchen zu seinen Bratkartoffeln, nimmt sich selbst nur einen Zipfel.
Herbert schläft schon lange, sie sitzt immer noch im Wohnzimmer, das Tagebuch auf den Knien. Manche Sätze kann sie jetzt schon auswendig. Marie zu suchen ist nicht mehr nur eine Idee, sondern eine Aufgabe. Sie wird das Mädchen suchen und finden und zu sich nehmen. Herr Klausner hat das quasi abgesegnet, als Polizist. Tausend Gedanken kreisen durch ihren Kopf, dann wird sie doch müde. Tastet sich ins Schlafzimmer, schlüpft vorsichtig unter ihre Decke.
Im Wegdämmern ziehen immer neue Pläne durch ihren Kopf:
Sie wird sich die Haare legen lassen und einen neuen Lippenstift kaufen.
Sie wird zu Frau Maschek gehen und fragen, wann die Kinder Geburtstag haben. Und ob die Mädchen nächste Woche wohl zum Kuchenbacken zu ihr kommen wollen.
Sie wird die Vitrine leer räumen und nun doch im Hof eine Schaukel aufhängen. Und vielleicht, ja, vielleicht, wird sie sich auch so ein Heft kaufen.
Eva
6. Januar 1976
Was war das für ein Blick gerade, im Fenster, als der Zug schon anfuhr? Ein Blick, der sich nicht mehr durch einen Kuss besänftigen, durch Worte in ein Lächeln verwandeln ließ.
Eva hört erst auf zu grübeln, als der Bodensee und die Berge längst verschwunden sind, Pferdewiesen das eintönige Gemisch aus Wohnhäusern, gesichtslosen Bahnhöfen und giftigen Industrievierteln ablösen. Sie wird Ralf morgen anrufen, die Gespenster mit ihm zusammen vertreiben.
Ihre Gedanken zerfasern, werden zu Traumfetzen. Als sie das nächste Mal nach draußen schaut, sind »Norddeich« und die Fähre schon ausgeschildert.
»Wir weisen die Inselbesucher darauf hin, dass die fahrplanmäßige Rückkehr aufs Festland bei anhaltenden Witterungswidrigkeiten nicht garantiert werden kann.«
In großen roten Lettern hängt das Schild neben dem Ticketschalter. Kaum hat Eva die Warnung gelesen, drängen andere Fahrgäste sie beiseite. Draußen am Kai reiht sie sich in die Schlange vor der Fähre ein. Im Schiffsbauch angekommen, deponiert sie ihren Koffer am Fenster unter einer der Bänke und geht, die kalten Hände reibend, zum Kiosk. Dort bestellt sie einen Tee und fragt: »Wenn die Fähre nicht mehr eingesetzt wird, kündigt sich das nicht an?«
»Ankündigen tun wir es ja, haben Sie das Schild nicht gelesen?«
»Ich meine, kann das schnell gehen?«
»Bin ich Hellseher? Seien Sie doch erst mal froh, dass Sie hier sind«, brummt der Kioskbetreiber. Eisblaue, scharf blickende Augen. Der Mann antwortet nicht nur, er will sie einschüchtern.
»Wenn das Meer richtig zufriert, sitzen Sie fest. Dann brauchen Sie Geduld und Rum.«
Er schiebt ihr das heiße Wasser mit dem Teebeutel zu, kassiert, dreht sich wortlos um und räumt weiter seine Fläschchen ins Regal.
Sie wird sich nicht verunsichern lassen, nicht von so einem. Männer, die sich vor ihr aufbauen, kann sie gut abperlen lassen. Gefährlich sind eher die Smarten, die mit Komplimenten und Versprechungen locken.
Vielleicht ist Geduld ja genau das, was sie braucht. Die Entscheidung wachsen lassen.
Im Herbst mit Ralf an den See zu ziehen, wäre ein »Ja« zu allem: Heiraten, Kinder, Familie. Er sagt das nicht so, aber er liebt das Vertraute und Geerdete. Schlaghosen sieht er an ihr gern, aber er selbst bleibt bei Jeans.
Seit Ralf ihr vor mehr als zwei Jahren außer Atem und mit einem verschmitzten Lächeln die Sonnenbrille gereicht hat, die sie beim Bäcker hatte liegen lassen, ist das Umherirren zwischen immer neuen fernen, verheirateten oder sich entziehenden Liebhabern vorbei. Das tut ihr auch gut. Aber muss sie deshalb gleich mit ihm in eine Konstanzer Altbauwohnung mit Flügeltüren und Stuck an der Decke ziehen? Vorbei an Rucksäcken und Kinderwagen schlängelt sich Eva zu ihrem Platz zurück. Der bärbeißige Insulaner hat sie doch verwirrt. Ihr ist übel. Auf der Suche nach einem Kaugummi durchwühlt sie ihren Rucksack. Tief unten liegt der Brief, in dem ihr Vater Telefonnummer und Lageskizze des Restaurants in Köln aufgezeichnet hat, in dem sie sich heute in einer Woche treffen werden.
»Liebe Marie, ich freue mich …« drei knappe Sätze.
Dass er sie noch mit Marie anspricht, nimmt sie ihm nicht übel. Schließlich kann er nicht wissen, dass sie sich schon lange Eva nennt; froh, dass ihre Mutter ihr durch das »Eva-Marie« in den Dokumenten eine Wahl eröffnet hat.
Skeptisch macht sie eher das Lapidare seiner Worte, die Unbefangenheit. Raumgreifende Buchstaben, selbstbewusste Schwünge nach oben und unten, die aussehen, als hätte der Schreibende einen festen Platz im Leben.
Auf dem einzigen Bild, das Mutti ihr kurz vor ihrem Auszug gegeben hat, ist ihr Vater etwa 30 Jahre alt. Kurz geschorene braune Haare und ein rundes Gesicht. Sein breites Lächeln schmeißt sich an den Betrachter heran. Das ist lange her. Hoffentlich erkennt sie ihn überhaupt.
Der Tee ist bitter, vielleicht sollte sie besser einen Schnaps trinken, aber dann müsste sie wieder zum Kiosk.
Unter ihr rumpelt und bebt es. Ob sie auf Eis gelaufen sind – oder schon ankommen?
Tatsächlich, der Motor wird gedrosselt, rundum Gewusel, die Passagiere sammeln ihre Gepäckstücke und Jacken ein, bringen Tassen und Teller zum Tresen. Ein kleines Mädchen in einem pinkfarbenen Anorak balanciert ein Tablett mit Colaflaschen und Kuchentellern zwischen den Tischen hindurch, ein stolzes Lächeln über die gelingende Aktion im Gesicht.
Vorn sieht man jetzt ein Stück Küste.
Schon vom Schiff aus spürt sie es, das Ehrliche, Raue, das sie immer wieder an die Nordsee zieht. Nicht mal Stella, mit der sie seit Schulzeiten sogar absurde Vorlieben wie die für Quarkbrot mit Rübenkraut teilt, versteht, was Eva daran gefällt, tagelang durch feuchten Sand zu stapfen, Muscheln zu sammeln und eilig davon trippelnde Strandläufer zu beobachten.
Doch heute ist es wirklich stechend kalt, die dicke rote Jacke reicht kaum. Erst im Zug hat sie bemerkt, dass die rechte Außentasche eingerissen ist. Sie muss Nähzeug auftreiben. So will sie ihrem Vater nicht begegnen.
Ruckelnd und schwankend legt die Fähre an. Die Menge um sie herum strömt zum Hafen hin, sie lässt sich mitziehen bis zum Gepäckcontainer Nr. 5. Ein freundlicher Mitreisender hat ihren Koffer auf dem Festland nach oben gehievt, aber der ist jetzt nicht da, und der Fährangestellte verhandelt mit einer aufgeregten Dame wegen eines Kratzers auf ihrem silbernen Samsonite.
Eva lässt ihren Blick über die erwartungsvollen Urlauber gleiten – niemand, den sie ansprechen mag.
»Kann ich helfen?«
Klare braune Augen, sein Blick schwenkt ins Innere des Containers, hoch zum letzten, ihrem Koffer, dann zurück zu ihr – er grinst: »Ihre große Schwester?«
Sie schüttelt verwirrt den Kopf, spürt, wie sie rot wird, das Bild von Romy Schneider am Adressanhänger – eine typische Stella-Idee.
Beherzt greift der junge Mann nach ihrem Koffer und stellt ihn vor ihren Füßen ab, immer noch lächelnd.
»Danke, das ist nett«, murmelt Eva. Er muss sie für eine Diva halten.
»Wohin?«
»Wie, wohin?«
»Ich meine, werden sie von Ihrem Hotel abgeholt oder brauchen Sie einen Pferdewagen?«
»Nein, danke, die Pension ist hier in der Nähe des Hafens.« »Komisch.«
»Was ist daran komisch?«
»Ach nichts, ich wohne nur auf der Insel und wusste gar nicht, dass es in Hafennähe eine Pension gibt.«
»Ich werd sie schon finden!«
Etwas zuckt durch sein Gesicht, mit einem knappen »Okay« dreht er sich um, rückt seinen grauen Rucksack zurecht und verschwindet Richtung Fährhaus.
Eine Böe weht Eva die Haare ins Gesicht. Als sie das Gewirr neu gebändigt hat, ist der graue Rucksack verschwunden. Plötzlich fühlt sie sich elend. Die leeren Container scheppern im Wind und der Wüppspoor, in den sie jetzt einbiegt, ist fast menschenleer. Leicht ist es nicht, allein in diese eisige Kälte hinein anzukommen. Wenn wenigstens Stella hier wäre. Vielleicht war die Winter-Insel doch keine gute Idee.
Immerhin, da vorn hängt ein Plan, damit wird sie auch ohne einen Besserwisser ihre Pension finden.
Aber der Mann hat recht. Sie muss ein ziemliches Stück nach Westen, und es zeigt sich nirgends ein Elektrowagen, der zumindest ihren Koffer mitnähme. Im Hafen lehnt nur noch der Kioskbetreiber vom Schiff an einem Mast, rauchend, die Hände in seiner dicken schwarzen Windjacke vergraben.
Sie fühlt sich beobachtet, stapft entschlossen los – schließlich hat sie noch immer geschafft, was sie sich vorgenommen hat. Und den Wind, der ihr nadelstichfeinen Regen ins Gesicht weht, den hat sie doch gewollt!
Ein paar hundert Meter weiter, vorn am Dorfeingang, steht ein Kneipenpaneel: »Happy Hour im Blanken Hans, jeder Grog nur 3 Mark.«
Zwei Schankräume, Holz und Kerzen, keine Lichterketten-Gemütlichkeit. Drei Männer vor einem Nachmittagsbier, sie rutscht auf die Bank am Fenster, bestellt einen Kakao, Blick durch die grobe Gardine auf den menschenleeren Deich.
Warum ist sie so unsicher? Warum fühlt sie sich bedroht von der Aussicht, mit Ralf in einer gemeinsamen Wohnung zu leben? Tag und Nacht in seinem Blickfeld, will sie das? Kann sie das? Seine Wohlgeordnetheit verschreckt sie oft auch. Er kennt es nicht anders. Auch wenn er seine großbürgerlichen Eltern flieht – sie haben ihn geprägt.
Sie selbst dagegen! Groß geworden in einer Siedlung mit Hinterhof, abends Bratkartoffeln und an Festtagen selbstgemachte Bonbons. Fast-Waise. Eine Mutter, die geflohen ist vor dem Leben mit ihr, und ein Vater, der nichts von ihr wissen wollte.
Die Neugier, mit der sie diesem Vater im Herbst geschrieben hat, ist verwirrenden Zweifeln gewichen. Sie hätte sich mehr Vorsicht bei ihm gewünscht, mehr Scheu, vielleicht auch Fragen, ja, aber zurückhaltende. Stattdessen eine dampfwalzenbreite Selbstzufriedenheit. Lichtjahre entfernt von dem Vater ihrer kindlichen Tagträume, der vor Spielwarenläden stand und Geschenke für sie aussuchte, mit ihr auf den Spielplatz ging und später ins Kino.
Aber genau deshalb will sie ihn ja kennen lernen, damit das Träumen und Wünschen endlich in eine Wirklichkeit mündet.
Läuft da draußen nicht der junge Mann vom Schiff vorbei? Nein, er hat nur ähnliche Haare. Aber irgendwie blond sind hier ja fast alle.
Nach dem wärmenden Kakao ist der Koffer nicht mehr so schwer und der Weg zur Pension nicht mehr so weit. Am Inselmuseum hängt ein handgeschriebenes Schild: Geschlossen bis zum 3. März. Zwei Häuser weiter ein kleiner Supermarkt Sanders, im Fenster buttrige Schweins-Öhrchen, daneben Rum, Friesen-Geist und Holunder-Likör. Weißer Schriftzug auf einer Schiefertafel, auch die Mauern in blankem Weiß, darüber ein dickpolstriges Reetdach.
»Moin moin« begrüßt die Pensionswirtin Frau Södermann sie, steigt behände die steilen Stiegen vor ihr hinauf und öffnet die schwere Holztür: »Frühstück ist bis elf Uhr, wir kochen ihnen auch gern ein frisches Ei. Die Luft hier macht hungrig.«
Um die siebzig, klein und schmal, unter dem orange-roten Kittel trägt sie einen weißen Rollkragenpullover, der sie jugendlich wirken lässt, trotz des Stützstrumpfs am rechten Bein.
»Und wenn Sie sonst etwas brauchen – Sie finden mich in der Küche oder in meiner Wohnung, unten rechts.«
Das Zimmer ist klein, eine Schräge macht es gemütlich. Eva lässt sich aufs Bett fallen: Sechs ganz und gar freie Tage unter bergendem Dach! Das Knacken der Fahnenstangen, der Geruch nach gebratenem Fisch, die salzige Meer-Luft und der zackige Dialekt erinnern sie ans Kinderheim. Damals hat sie Fisch noch gehasst. Sonntags gab es Kartoffelklöße und dienstags Nudeln, da konnte sie sich satt essen.
Die Möbel hell furniert, Raufaser, ein Regal mit Stövchen, verschiedenen Tees und zwei riesigen Tassen. Schlichter Möbelhauscharme. Alles besser als Eiche.
Dunkle Eiche erinnerte sie immer, sofort und verbunden mit einem Klumpen im Magen, an das Wohnzimmer ihrer Großeltern.
Dreimal ist sie dort gewesen. Einmal an Ostern und zweimal an ihrem Geburtstag. Mit einem schicken Auto haben die beiden sie bei Taraschewkys abgeholt. Fritz und Hildegard von Schwamborns oben beneideten sie um den glänzenden Schlitten. Sie hatten keine Ahnung, wie schlecht ihr wurde, weil Großvater im Auto rauchte.
Oma und Opa sollte sie zu ihnen sagen. Oma und Opa waren für sie aber die lustigen Großeltern von Steffi in ihrem Geschichtenbuch. Die übernachteten sogar mit im Zelt, wenn Steffi sommers bei ihnen zu Besuch war.
Sicher haben es ihre Großeltern gut gemeint. Aber mit einem Enkelkind, das kaum sprach, kein Fett und Fleisch mochte, wussten sie nichts anzufangen. Schließlich hatte die Großmutter extra einen Braten geschmort und auf dem Kartoffelpüree war oben eine große Kuhle mit geschmolzener Butter.
Das ganze Mittagessen über musste sie an die kleine nackte Figur denken, die im Schneidersitz auf dem Fernseher saß, mit riesigem Hängebauch und einem feisten Grinsen in dem mondrunden Gesicht. Dass es ein indischer Gott war, wie Opa erklärte, half ihr nicht. Sie ekelte sich vor dem Buddha, der Butter und dem fetten Braten auch.
Eva verteilt ihre Siebensachen im Schrank, dort sind sogar noch zwei Decken – aufs Wärmen verstehen sich die Inselbewohner.
Mit einer Tasse »Weihnachtszauber«, das Zimmer voll Zimt- und Koriander-Duft, kuschelt sie sich in den Korbsessel unter dem Dachfenster.
Das würde Ralf auch gefallen. Er weiß nicht, dass das Gemütliche, Heimelige in ihr einem Sog ins Finstere und Zerstörerische abgerungen ist. Sie sagt es ihm nicht, will nichts gefährden. Wenn sie zusammen fernsehen und Eva sich in Ralfs Arm schmiegt, fühlt sie sich fast so geborgen wie als Kind mit Mutti und Onkel Herbert. An den Feiertagen, wenn sie schon nachmittags Karten spielten – und samstagabends bei »Einer wird gewinnen«. Diese Abende waren heilig. Der witzige Moderator, den sie oft nicht wirklich verstand, hatte ein schönes Lächeln, und auch Mutti schwärmte für ihn, das sah sie genau.
Rumpelnder Staubsaugerlärm von unten reißt Eva aus ihren Träumereien. Schnell schlüpft sie in ihre Stiefel, der Strand kann nicht weit sein. Im Flur gießt Frau Södermann die Blumen. Ein rascher Blick in den Frühstücksraum, auch dort steht auf jedem der vier Tische ein kleines, silberfarbenes Stövchen.
Der Weg zum Strand führt sie durch die überschaubare Einkaufsstraße. Außer dem Lebensmittelladen sind zwischen Silvester und Karneval nur der Fleischer, der Bäcker und der Fischladen geöffnet, morgens zwischen 10 und 12 Uhr. Auf dem Dünenweg kaum Spaziergänger. Die meisten zu zweit, die Gesichter schützend umhüllt. Jetzt ist sie froh um den zweiten Schal, den Stella ihr, ungewohnt fürsorglich, in den Koffer gestopft hat.