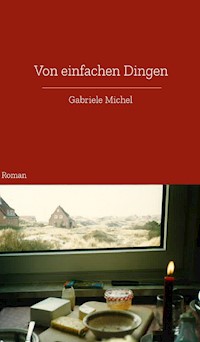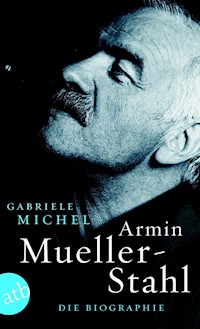
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geboren im ostpreußischen Tilsit, avancierte Armin Mueller-Stahl zu einem der beliebtesten Schauspieler der DEFA, bis er die DDR verließ und schließlich Hollywood eroberte. Daneben hat er als Autor und als bildender Künstler Erfolg beim Publikum. Diese erste umfassende Biographie basiert auf zahlreichen Gesprächen mit Mueller-Stahl selbst sowie vielen seiner Weggefährten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gabriele Michel
Armin Mueller-Stahl
Die Biographie
Impressum
ISBN E-Pub 978-3-8412-0117-1
ISBN PDF 978-3-8412-2117-9
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2659-8
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über dasInternet.
Umschlaggestaltung capa, Anke Fesel
unter Verwendung © Mathias Bothor/photoselection
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
Trailer
Hautnah
1 Wege übers Land
2 Der erste Geiger
3 Geschlossene Gesellschaft
Der Prinz betritt die Bühne
Neue Wirkungsstätte Babelsberg
Alltag in der DDR
Ein nationaler Star
Zwei Schauspielwelten
Eiszeit und Nestbau
»Ich kauf’ dir eine Blume«
»Du sollst keinen fremden Herren dienen«
Gewitterwolken ziehen auf
Freunde und Verbündete
Abgesang
Schreibend einen Schlusspunkt setzen
Zwei Briefe und ein Abschied
4 Kämpfer und Sieger
Fremd im neuen Leben
Bewährungsproben und erste Triumphe
Serienheld – nein danke
TV-Rollen mit Profil
Kinofilm im Kampf mit Gesetz und Quote
Wer fortgehen will, muss Wurzeln schlagen
Intellektuelle unter sich
Erfolg macht Erfolg
Flugtickets nach Amerika
5 Der Westen leuchtet
»… in den USA bleiben mir jetzt noch die Großväter«
Mythos Hollywood
Drehtage in Amerika
Ein verlorener Clown
Die schönsten Nebenrollen
Flüchtige Wohnstatt für fahrendes Volk
Hauptrollen sind keine Erfolgsgarantie
Unter kalifornischem Himmel
Highlights
… und Ärgernisse
6 Thomas Mann und Tom Tykwer
Rückkehr mit Thomas Mann
Tödliche Versprechen
Die Buddenbrooks
The International
Illuminati
Taktstock, Bogen, Melodie
Bücherwelten
Malerei
Die beste Entscheidung seines Lebens
7 Im Glanz der Sonne
Achim Detjen trifft Erich Mielke
Würdigungen im Westen
And the oscar goes to
Doctor honoris causa
8 The Power of One
9 Weltbürger und Brückenbauer
10 Schlussbild
ANHANG
Zeittafel
Ausstellungen
Filmografie
Bibliographie
Danksagung
Personenregister
Für Arved und Veza,
Egon und Jan
Phantasie ist Erinnerung
James Joyce
Trailer
»Gefällt es Ihnen hier?« Neugierig forschend wendet sich die alte Dame dem Mann zu, der neben ihr auf der Parkbank Platz genommen hat: »Wissen Sie, es macht mir Spaß herauszufinden, in welcher Stimmung einer ist. Ob es ein lustiger Mensch ist oder ein trauriger. Ob es jemand ist, der beschäftigt ist und laut oder mehr von der stillen Art.«
»Und was bin ich für einer?«, erwidert ihr Gegenüber halb belustigt und doch von der Ungezwungenheit der alten Dame offenkundig auch berührt.
»Das kann ich noch nicht wissen. Einer von trauriger Natur scheinen Sie nicht zu sein. Aber dann sind Sie auch ein Mensch, der keine festen Bindungen eingeht. Nur traurige Menschen sind anhänglich. Und traurig sind sie, weil sie wissen, dass alles, woran sie ihr Herz hängen, eines Tages verloren geht. Ich glaube auch, Sie sind unverheiratet.«
»Da haben Sie allerdings Recht«, lacht Dr. Schmith. »Ich bin nicht von hier«, fährt er dann nachdenklich fort. »Ich komme aus der DDR und fahre morgen wieder zurück.«
Ratlos, fast ein wenig erschrocken zuckt die muntere Greisin mit ihrem ganzen Körper zurück: »Was, dann sind Sie ja aus dem Osten.« Mit so viel Fremdheit hat sie nicht gerechnet. »Vielleicht gehöre ich doch zu den traurigen Menschen«, erwidert Schmith gedankenverloren, »und man sieht es mir nur nicht an.«
Dr. Schmith, der ehrgeizige und unzugängliche Gynäkologe in Roland Gräfs Spielfilm »Die Flucht« wird gespielt von Armin Mueller-Stahl. Und so wie die anderen Ärzte nicht recht schlau werden aus dem verschlossenen Kollegen Schmith, so hat auch Mueller-Stahl Generationen von Journalisten zwar durchaus Antworten, aber immer auch Rätsel mit auf den Weg gegeben.
Wer ist dieser Mann, der eine viel versprechende Laufbahn als Konzertviolinist abbricht und sich bald darauf als Schauspieler auf der Bühne zeigt? Der, nach einigen Monaten von der Schauspielschule verwiesen, ein gutes Jahrzehnt später als einer der bekanntesten und beliebtesten Bühnen- und Leinwandakteure seines Landes jede Menge Sympathie, Lob und Preise erntet. Der später als einziger Schauspieler der ehemaligen DDR den Schritt von Babelsberg über Deutschlands Westen nach Hollywood wagt und mit Bravour bewältigt. Der schließlich, siebzigjährig, als professioneller bildender Künstler an die Öffentlichkeit tritt.
Ein eindrucksvoller Weg. Gleichwohl entspricht Armin Mueller-Stahl nicht unserem Bild von einem »Star«. Er war nie ein Star, ist es bis heute nicht, da er in Los Angeles wohnt, der Filmstadt schlechthin, und mit den renommiertesten Regisseuren der Welt dreht. Zurückgezogen, unspektakulär lebend, zeigt er sich in der Öffentlichkeit nur dosiert und dann möglichst als ganz gewöhnlicher Mensch, nicht als unerreichbare Berühmtheit. Er arbeitet eher, als dass er sich in seinem Glanz sonnt. Dennoch hat er, bei aller Strenge, offenbar eine eigene Form entwickelt, sein Leben und sich selbst zu genießen. Er ist überzeugter Einzelgänger; gebildet, begabt, berühmt – und immer distanziert. Als »wortkarger Zeitgenosse, unzugänglich, bisweilen sogar schroff« wird er mitunter bezeichnet – und kann doch ebenso freundlich wie geistreich und charmant sein.
Auch wenn er selbst sein Leben und die Schauspielerei entschieden auseinanderhält: Armin Mueller-Stahl ist schwer zu trennen von seinen Rollen. Rollen, die oft extrem gegensätzlich sind. Wer den gutmütigen Wolfgang Pagel (»Wolf unter Wölfen«) und den gequälten Höfel (»Nackt unter Wölfen«) gesehen hat, den eisigen Thronfolger Franz Ferdinand (»Oberst Redl«) und den grobschlächtigen Bauern Leon (»BittereErnte«), Laszlo (»MusicBox«), Krichinsky (»Avalon«), Peter Helfgott (»Shine«), Helmut Grokenberger (»Night on Earth«) und Thomas Mann (»Die Manns. Ein Jahrhundertroman«) in all ihrer Unterschiedlichkeit, der fragt sich: Wie macht er das?
Eine erste Antwort ist rasch gefunden: Mueller-Stahl hat Freude an der Verwandlung. »Ich selbst bin ich ja sowieso immer«, kommentiert er diese Lust. Seine Methode ist die genaue Beobachtung und ein präzises Gefühl für Details, für Stimmigkeit und Timing. Die zweite, tiefer reichende Antwort ergibt der Blick auf sein Leben. Hier zeigen sich die unterschiedlichen Quellen, Entwicklungen, Brüche und Ziele. Derer gibt es viele bei jemandem, der so unermüdlich tätig ist wie Armin Mueller-Stahl und der das Glück hat, gleich in mehreren Bereichen künstlerisch produktiv sein zu können. Er braucht die Aktivität. Für ihn ist die Arbeit eine Passion, sein Lehrmeister ist das Leben.
Auch dazu gibt es einen Film mit Armin Mueller-Stahl: »Im Glanz der Sonne«. Hier nimmt er sich als großväterlicher Freund des kleinen P.K. an, den nach dem Tod der Eltern und Freunde die »Einsamkeitsvögel« heimgesucht haben. Heiter und zurückhaltend zugleich nähert er sich dem trostlos grübelnden Jungen und fragt: »Hey, was ist denn mit dir los, mein Kleiner?« Als P.K. nicht reagiert, fügt er nach einer kleinen Pause hinzu: »Weißt du, mein Esel Beethoven hat mir mal ein Mittel gegen Traurigkeit bei kleinen Jungen verraten. Würdest du es gern kennen lernen? – Ja? Gut, du musst auf einem Bein stehen. Sehr gut. Nun sag dreimal: absududel, absududel, absududel. – Na, hat’s geholfen?« Missmutig schüttelt P.K. den Kopf. »Ich finde, das beweist zumindest eins«, räumt der sympathische Alte schmunzelnd ein: »Nimm niemals einen Rat von einem Esel an.« Da muss der Kleine dann doch lachen, und fortan sind die beiden unzertrennlich. Doc, der Professor, Pianist und Kakteenzüchter aus Deutschland, zeigt P.K. ein neues Afrika und erklärt ihm, wie er sich die Welt eigenständig erschließen kann: »Weißt du, das Gehirn hat zwei Funktionen. Es ist zum einen das beste Nachschlagewerk der Welt, das ist schon ein großer Vorteil. Aber dann bringt der Mensch auch noch seine ganz eigenen Gedanken hervor. Die Schule stopft dich voll mit Tatsachen. Hier draußen aber wirst du lernen, was du zu fragen hast und wie du zu fragen und wie du zu denken hast. Die Natur gibt die Antwort auf alle Fragen, du musst nur lernen, richtig zu fragen, dann wirst du so viel Verstand bekommen, wie du nur haben kannst. Es gibt so viele Dinge zu lernen, dass wir keine einzige Sekunde vergeuden dürfen.«
Wer hat sich als Kind nicht irgendwann einen Vertrauten gewünscht, der wie Doc mit so viel Humor und Verständnis die Neugier auf das Leben und die Faszination des Lernens verkörpert und verkündet hätte. Mueller-Stahl selbst hat diese stärkende Initiation erfahren: als Kind in seiner Familie und Verwandtschaft, später durch Lehrer und Kollegen – vor allem aber durch sich selbst. Er weiß, was er an sich hat und von sich erwarten kann, er ist sich selbst eine zuverlässig treibende Kraft. Impulse von außen erreichen ihn nur gefiltert. Der Aufbruch, die Suche nach immer neuen Lebens- und Ausdrucksmöglichkeiten, ist ihm zum Prinzip geworden. Dabei genießt er das Glück des Tüchtigen. Das ist mehr als Erfolg. Es ist schöpferische Erfüllung, die jede Mühe vergessen lässt.
»Leben bleibt anstrengend, bis zum Schluss. Es ist wie Rad fahren: Wenn man aufhört zu treten, fällt man um.« So ist er bis heute ein Mensch, der sich immer wieder neu entwirft. Im Spiel, im Traum und durch harte Arbeit.
Ja, ich erinnere mich an eine frühe Szene. Ich stehe da, noch ganz klein und mit einem ziemlich blonden Schopf, und schaue einem Schmetterling nach. Da habe ich geträumt und mich gefragt, ob ich vielleicht auch der Schmetterling bin oder eine Stachelbeere. Und wer ich bin, wenn ich ich bin. Viele Fragen habe ich mir da gestellt. Und heute sehe ich den Jungen, der ich nicht mehr bin, und ich verstehe ihn.
Armin Mueller-Stahl
»Es war Armins fünfter oder sechster Geburtstag«, erinnert sich sein älterer Bruder Hagen. »Es waren eine Reihe Kinder eingeladen und die Gäste fein angezogen eingetroffen. Arglos ging unsere Mutter in die Küche, um Kakao zu richten. Als sie zurückkam, war die Stube leer. Armin hatte alle rausgeprügelt. Warum, war nicht mehr zu ermitteln.«
Hautnah
Was einen zu Beginn eines Buches beim Schreiben
gefesselt hat, was es auch sei, man darf es nie
aus den Augen verlieren.
William Goldman
Es begann mit seinem Buch. Als ich im Frühjahr 1997 Mueller-Stahls impressionistischen Erinnerungstext »Unterwegs nach Hause« las, faszinierten mich die Spontaneität und Direktheit, mit denen sich der berühmte Schauspieler hier dem Leben zuwendet. Die Unmittelbarkeit, mit der er Beobachtungen, Erlebnisse, Gedanken und auch ganz kleine und persönliche Inhalte dem Gedruckten anvertraute, schuf eine besondere Verbindung. Es war, als würde er mir seine Begegnungen mit dem afroamerikanischen Dauerredner in Los Angeles selbst erzählen, auch die Erinnerungen an gewesene Freunde in der DDR und an die jetzigen in den USA. Ich hörte regelrecht, wie er die Briefe seiner Mutter vorliest oder mit seinem jüdischen Freund disputiert, und fühlte mich von all dem direkt angesprochen.
Natürlich gab es die Filme. Mehr als die viel besprochenen blauen Augen war mir von all seinen Figuren ein Klang zurückgeblieben, seine tiefe und wohltönende Stimme. Am meisten liebte ich Helmut Grokenberger in »Night on Earth«, die kindliche, schutzlose Zutraulichkeit dieses heimatlosen Taxifahrers inmitten des trostlosen New York.
»Unterwegs nach Hause«, diese Mischung aus Erinnerung, Reflexion und Bilanz vergegenwärtigte mir aber auch erstmals, wie spannend und außergewöhnlich das Künstlerleben dieses Schauspielers verlaufen ist. Dabei beeindruckten mich anfangs mehr als seine vielseitigen Begabungen die so unterschiedlichen Stationen seiner Karriere: seine Erfolge in der DDR, der Bundesrepublik und in Amerika.
Was bedeutet es, in drei Systemen, in drei Filmwelten Erfahrungen zu machen? Was bedeutet es, jahrzehntelang über alle Brüche hinweg produktiv zu sein und immer wieder berühmt zu werden? Wie sieht dieser Lebensweg genau aus, und wo liegen die Brüche?
In einem kurzen Brief trug ich Mueller-Stahl mein Anliegen vor, eine Biographie über ihn schreiben zu wollen, ohne große Hoffnung, je eine Antwort zu erhalten. Aber schließlich ist »Alltag nur durch Wunder erträglich«, wie es bei Max Frisch heißt. Andererseits muss, wer am kindlichen Wunsch nach Wundern festhält, auch die allzeit lauernden Enttäuschungen ertragen.
Tatsächlich hörte ich monatelang nichts und hatte das ganze Projekt schon in der hintersten inneren Schublade vergraben. An einem regnerischen St. Martinstag aber traf die Antwort ein. Telefongespräche, erste Konzeptabsprachen, zögernd und vorsichtig kristallisierte sich über Wochen ein »Ja« zu meinem Vorschlag heraus. Als die Zusage dann aktenkundig war, hatte ich das Gefühl, einen Glückstreffer gelandet zu haben. Das reiche Leben eines verehrten Künstlers zu beschreiben – etwas Schöneres konnte ich mir beruflich kaum vorstellen.
Wir ahnten wohl beide zu Beginn kaum, auf was für ein waghalsiges Unternehmen wir uns da einließen. Die Biographie eines lebenden Menschen schreiben zu wollen, den man gar nicht kennt, ist im Grunde tollkühn. Ein Abenteuer und eine Herausforderung, die mich anfangs ungeheuer belebten. Aber im Laufe der Monate wich die Euphorie allmählich einem Berg von Fragen, Zweifeln und Irritationen.
Wie erschließt man sich das Leben eines fremden, viel beschäftigten Menschen, der zudem die meiste Zeit des Jahres rund 9000 Kilometer entfernt lebt? Der Hauptgewinn erwies sich streckenweise eher als Hindernislauf, das fremde Leben als Labyrinth. Überall tauchten Figuren auf und wieder ab – wie sollte ich ihnen Gesicht und Gestalt geben? Kaum hatte ich in der Fülle der Erinnerungen und Erlebnisse einen der begehrten »roten Fäden« gefunden, verästelten sich die Möglichkeiten. Auch die persönlichen Gespräche entwickelten eine aufreibende Dynamik. Lange Sequenzen des entspannten, informationsreichen Austauschs endeten unvermittelt an einer Schranke: »No entrance« stand darauf geschrieben. Manchmal schien es mir, als blinkte zugleich in roten Lettern: »It’s your fault«, es ist Ihr Fehler. Meist wusste ich nicht, warum. Da die Zugänge über weite Strecken geebnet und neue Terrains leicht zu erschließen waren, bemerkte ich die verbotenen Türen immer erst, wenn ich schon dagegen geprallt war.
Gott sei Dank gab es weite Räume, in denen die sachlichen Informationen im Vordergrund standen, gut dokumentiert und irgendwie handfest. Je mehr ich über die produktiven Kräfte Mueller-Stahls erfuhr, desto größer wurden Neugier und Respekt. Nach jedem persönlichen Kontakt trug ich eine Menge Tonbänder und neue Rätsel davon. Wohl wissend, dass das alles ganz normal ist. Interviews mit Schauspielern sind notwendig eine diffizile Angelegenheit. Natürlich tun sie das, was sie am besten können – sie spielen eine Figur. Einer der ersten bleibenden Eindrücke, der sich allmählich herauskristallisierte, war: Helmut Grokenberger gibt es nur im Film – und im Verborgenen.
Nach etwa einem Jahr reiste ich nach Los Angeles. Wollte Armin Mueller-Stahl an dem Ort, in dem Wirkungsbereich erleben, wo er jetzt am meisten und wohl auch ehesten zu Hause ist. Ich habe eine Menge gesehen – nur ihn selbst nicht. Dabei wartete er auf mich. Aber eine schwer zu entwirrende Mischung aus falscher Telefonnummer sowie fehllaufenden Faxen und Deutungen hielt uns voneinander fern. Nachdem ich aufgehört hatte, nach Gründen für diese gescheiterte Begegnung zu forschen, erschien mir die absurde Ansammlung von Stolpersteinen wie ein materialisierter Ausdruck der wohl notwendig ambivalenten Beziehung zwischen Biograph und Objekt, insofern stimmig.
Schließlich konnte ich mich nicht beklagen. Ein Fan von Bob Dylan, der sich dessen Lebensbeschreibung widmen wollte, wurde niemals vorgelassen. In seiner Verzweiflung plünderte der so erbarmungslos Abgewiesene auf der Suche nach verwertbarem Material sogar die Mülltonnen vor dem Haus seines Idols. Und von den Biographen Stanley Kubricks hieß es in einem Nachruf, »sie waren Wahnsinnige, Orchideenforscher am Polarkreis«. Kubrick weigerte sich lebenslang, überhaupt mit ihnen zu reden.
Wir dagegen trafen uns weiterhin, sogar zu ausführlichen Gesprächen. Manche unserer langen Sitzungen ließen mich an den Interviewmarathon von François Truffaut und Alfred Hitchcock denken, aus dem »Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?« entstanden ist. Nach und nach wurde dabei deutlich, dass Mueller-Stahl seinerseits auch ein Anliegen mit diesem Projekt verband. Natürlich wollte er die Chance nutzen, unausgegorene Geschichten sowie Missdeutungen seiner Person zu korrigieren, wollte seine Version von seinem Leben festgehalten wissen.
Somit wuchs unser beider Engagement von Gespräch zu Gespräch. Als Arbeitspartner kannten wir einander nun. Ich konnte alle Fragen stellen. Wenn er wollte, dachte er lange nach. Wenn er nicht wollte, lenkte er ab; zu erzählen gab es immer viel.
Irgendwann begann sich der wachsende Text zwischen ihn und mich zu stellen. Als wirkliches Medium. Von da an hatte ich ein zweites, konstantes Objekt – und Korrektiv. Ein Korrektiv, das mir deutlich machte, wie unterschiedlich beheimatet und kompetent ich mich in den vielen Lebensbereichen fühlte, in die mich die Arbeit für dieses Buch führte. Nicht nur, dass ich nie in Ostpreußen gelebt oder vor einer Filmkamera gestanden habe. Im Grunde, so wünschte ich mir zwischendurch, müsste ich Filmwissenschaftlerin, Regisseurin und Historikerin sein. Mindestens. So aber war ich verwiesen auf mein Handwerkszeug, folgte den Geboten der wissenschaftlichen und journalistischen Recherche, hoffte auf die Solidität der Quellen und auf korrekte Schlüsse meinerseits.
Immerhin konnte ich die Unklarheiten bei dem, was ich vermitteln wollte, nun auch an meinen eigenen Sätzen ablesen. Damit löste sich die Fixierung auf mein Gegenüber. Neben das Ziel, das Leben Armin Mueller-Stahls und seine Person angemessen darzustellen, trat als zweites das gelungene Buch – »gelungen« in dem Bewusstsein, dass man »immer ein besseres Buch im Sinn hat, als man zu Papier bringen kann« (Michael Cunningham, »Die Stunden«).
Und allmählich, je mehr sich das Bild rundete, stellte sich eine neue Vorstellung von Verbindung zwischen uns beiden ein: Eines Tages säßen wir uns gegenüber mit dem fertigen Text und begegneten einander in dem Gefühl von Zufriedenheit; über dieses Leben, über dieses Buch.
1 Wege übers Land
Das Gelb der blühenden Rapsfelder wird ihn sein Leben lang begleiten. Zur Weite und Ruhe der Ostsee wird er immer wieder zurückkehren. In Tilsit, am östlichen Rand des damaligen Ostpreußen wurde Armin Mueller-Stahl am 17. Dezember 1930 geboren. Als Nebenprodukt des Käses, wie er gern ironisch anmerkt.
Ostpreußen, das bedeutet vor allem: Wasser. Das unbegrenzte Meer, verzweigte Flüsse und die reglosen, beinahe entrückten Seen im Süden des Landes. Dazu Alleen, die sich durch gelbe Getreidefelder ziehen, gesäumt von Linden, Birken, Eschen und Eichen. Kopfsteinpflaster, Pferdegetrappel, Hahnenfuß am Dorfteich und die zahllosen Störche, die hier als Haustiere gelten. Kehren sie heim aus Afrika, Ende April, dann feiert man ein Fest. Schulfrei für die Kinder, das ganze Dorf versammelt sich auf der Straße und begrüßt die Heimkehrer, die hoch über den Dächern kreisen.
Die kalten Winter schufen eine weithin weiße, gedämpfte Welt. Die Sommer waren heiß, lichtdurchflutet und weit.
»Erntezeit in Ostpreußen. Durch die Luft trieb der mehlige, trockene Staub der reifenden Ähren. Zeit der Pferdebremsen, der weißen Tücher auf den Feldern und der Strohhüte, der Vesperstunden im Gras am Feldrain, der polternden Leiterwagen. Anschirren in der Morgendämmerung. Das einsame Dengeln einer Sense, die die Vormahd schneidet. Staubwolken über den Feldwegen wie in einem Sandsturm. Kannen mit Buttermilch im Schatten einer Hocke. Kinder, die auf Erntewagen mitfahren. Feldmäuse huschten unter den Roggengarben. Strohberge bauen. Sonnenuntergang, Feierabend. Die Pferde in die Schwemme reiten.« Man meint, die Sonne zu spüren und den Staub auf der Haut, wenn Arno Surminski in dem Bildband »Im Herzen von Ostpreußen« seine Heimat beschwört.
Doch es ist nicht nur der Zauber der Natur, der das erste Zuhause so prägend werden ließ, es sind auch die Menschen. In all ihren Widersprüchen. Kein Landstrich Europas, in dem sich im Laufe der Jahrhunderte so viele unterschiedliche Völker und Temperamente vermischten. Böse und aufbrausend konnten sie sein, die Leute hier, und der harte Schnaps machte im lieblichen Ostpreußen nur allzu oft die Runde. Aber sie waren auch gutmütig, verlässlich, von rührender Gastfreundschaft und Zugewandtheit, erinnert sich Surminski, »zärtlich wie ihre Sprache, die die rauhesten Worte mit ihrer Endung ›chen‹ besänftigte, die das Hundchen einen Schnudel nannte, den unartigen Jungen Lorbaß und die für das kühle Wort ›streicheln‹ den warmherzigen Ausdruck ›puscheien‹ erfunden hat.«
Ostpreußen war sein Nest. Die Geborgenheit und die Freiheit, die er hier fand, sind ihm zum Inbegriff von Heimat geworden. Immer wieder wird er sich an Orten niederlassen, an denen er etwas davon wiederfindet. Das Wasser, die Weite, das Gefühl von Ungebundenheit. Das Bild, das sich ihm in seinen ersten Lebensjahren eingeprägt hat, ist ihm teuer und bewahrenswert. So sehr, dass er eine Konfrontation mit der heutigen Gestalt des ehemaligen Ostpreußen fürchtet:
Nein, ich bin noch nicht wieder zu meinen Ursprüngen zurückgekehrt. Ich habe wohl Angst, genau das dort nicht mehr zu finden, was mich so beeindruckt und geprägt hat. Die Ruhe, die Herzlichkeit, die Offenheit. Aber vielleicht ist das auch eine Frage des Alters, vielleicht bin ich irgendwann ja so weit. Vielleicht.
Seine Mutter ist in Estland aufgewachsen und kam später nach St. Petersburg, der Vater lebte in Memel. Nach der Oktoberrevolution floh die Familie der Mutter aus St. Petersburg ins Baltikum und kam 1918 nach Tilsit. Dort lernte Editha Maaß ihren späteren Mann kennen. 1926 kam der erste Sohn, Hagen, zur Welt, 1928 Roland und zwei Jahre darauf der dritte, Armin, gefolgt von Gisela 1936 und Dietlind 1938, der jüngsten Schwester.
Eine wahre Phalanx nordisch-germanischer Namen, mit denen sich das Ehepaar Mueller-Stahl einem zu jener Zeit vorherrschenden Trend anschloss. Den alarmierenden Beigeschmack erhält diese Entscheidung erst im Nachhinein durch die Bedeutung germanischen Namensguts für den Nationalsozialismus. Vorher waren Namen wie Hagen, Roland oder Dietlind Ausdruck jenes klassischen liberalen Nationalbewusstseins, das sich auf Herder berief und frei war von völkischen oder gar rassistischen Konnotationen. Für Armins Eltern signalisierten sie neben der nationalen Komponente vermutlich vor allem das Anknüpfen an Bildungstraditionen, denen sie sich verbunden fühlten.
Die ersten Jahre lebten sie in Tilsit. Prägende, stärkende Jahre, wie es scheint. Zwar ist der Mythos von der »glücklichen Kindheit« mittlerweile durch vielerlei Erkenntnisse und Erfahrungsberichte gründlich demontiert worden. Insofern fiel es bisweilen schwer, die Idylle zu akzeptieren, die manche von Mueller-Stahls Kindheitserzählungen evozierten. Aber es gab und es gibt sie eben doch, die unbeschwerten ersten Jahre. Zumal für vitale Kinder, denen es gegeben ist, dem Leben angstfrei und offensiv zu begegnen, die wissen, was ihnen guttut, und die sich schützen können vor dem, was sie schwächt. Ein solches Kind war Armin. Ausgestattet mit einer großen Portion Unternehmungslust und Phantasie eroberte er sich die Welt. Immer vornweg und sehr mutig sei er gewesen, erinnert sich der Bruder Hagen. Auch seine Unabhängigkeit habe sich bald gezeigt. Als Ältester hatte Hagen früh Verantwortung tragen müssen. Nachdem der Vater gleich zu Beginn des Krieges eingezogen worden war, hieß es für ihn oft vernünftig sein und der Mutter helfen, während Armin draußen spielte, seinen Träumen nachhing und Abenteuer suchte. Kein Wunder, dass Hagen dem jüngsten Bruder dessen Freiheit und Unbefangenheit manchmal auch neidete. Ein Luftikus und Draufgänger sei er gewesen, um keinen Streich verlegen. Die Anekdoten, die man von ihm erzählt, gleichen jenen Schelmengeschichten, mit denen Astrid Lindgren ihren Michel aus Lönneberga ausgestattet hat, auch er ein liebenswerter Tunichtgut. Zwar zog Armin nicht gerade seine Schwester am Kirchturm empor wie Michel Klein-Ida. Zur Verzweiflung hat er seine Mutter aber schon manches Mal gebracht: Was der Maler kann, das kann ich schon lange. Alles frisch gestrichen, und kaum war der Profi weg, nahm Armin den Mostrich und tat es ihm nach. Wand für Wand hat er sorgfältig bedacht. Spaß hat’s gemacht. Das Gesicht seiner Mutter kann man sich vorstellen.
Und so etwas passierte laufend. Schlimm können die Strafen nicht gewesen sein. Denn Mueller-Stahl denkt gern an seine Kindheit. Weit zurück reicht dabei die Erinnerung. Das Erste, was er sieht, ist die Kinderfrau, die »ihr Bübche« im Wagen umherfährt. Sie hat Zeit, sie bleibt stehen und lässt den Kleinen in Ruhe die Blätter an dem riesigen Baum bestaunen. Die Fliege, den Schmetterling und das fremde Gesicht, das sich über ihn beugt. Wie wichtig all diese ersten Wahrnehmungen sind, die das Kind in seiner Neugier aufnimmt. Wir können nur ahnen, wie sehr vielleicht schon diese erste geduldige Begleiterin den Grundstein gelegt hat für die Lust am Schauen, Wahrnehmen und Beobachten, die das (Schauspieler-)Leben Mueller-Stahls später so sehr prägen wird.
Und die Frau hat nicht nur Muße, sie hat den Kleinen auch gern. Liebevoll tauft sie ihn Minchen. Dieser Name wird ihn in der DDR begleiten, unter Freunden und auch beim Publikum. Minchen, das nimmt dem ernsten, oft höflich unnahbaren Gesicht die Distanz. Minchen, das ist der, den sie lieben. Allerdings wird es später auch Menschen geben, die das »Minchen« gegen ihn wenden. Bei ihnen wird es zum Spitznamen, steht für das, was man dem Mimen vorwirft: seine skrupulöse, zögernde, komplizierte Art. Nein, zupackend ist ein »Minchen« nicht. Und so wehrt er sich denn auch mehr und mehr gegen diesen Namen, wenn er nicht mehr freundlich gemeint ist. Ob er sich den Ausdruck zärtlicher Zuwendung, der zu Beginn darin steckte, hat erhalten können und damit ein Stück innerer Heimat?
Immer war jemand da, der mich empfangen und umsorgt hat. Zu Hause und dann vor allem bei den Eltern meiner Mutter. Wenn die Schwalben Junge bekamen, wurde ich regelmäßig nervös und dachte, jetzt kann ich bald nach Jucha. Dort in Masuren hatten sich meine Großeltern nach einem Herzinfarkt meines Großvaters niedergelassen. Meine Tante Ena empfing mich in der Tür und sagte: »Nun setz dich mal, Jungchen, hier ist ein Guggelmuggel für dich.« Guggelmuggel ist verrührtes Eigelb mit Zucker. Das mochte ich sehr.
1938 ging die Familie nach Prenzlau, in dessen Nähe Hagen schon seit zwei Jahren zur privaten Erziehung in einem fremden Haushalt untergebracht war. Doch das beruhigende Gefühl, beschirmt zu sein, wurde auch durch den Ortswechsel offenbar nicht zerstört. Familiensitz wurde die Brüssowerstraße, Haus Nummer 2. Allzu lange sollten sie zwar hier nicht bleiben, dennoch wurden diese Räume für Armin zu einem richtigen Zuhause, an das er sich auch nach Jahrzehnten noch bis ins Detail erinnern kann: An die Küche, in der es nachmittags Kakao gab, an die Schlafräume, in denen sich die Kinder vor dem Einschlafen Geschichten erzählten, und an das Ess-, Herren- oder Wohnzimmer, in dem die Familie sich zusammenfand.
Spielzeug gab es wenig, dafür draußen den Uckersee und den Hinterhof mit geheimen Ecken, Ungebundenheit in Hülle und Fülle und im Herbst gegen Abend die Kartoffelfeuer. Da knisterten die Flammen in die allmählich aufziehende Nacht, man drängte sich um die flackernde Glut, und die schwarz verbrannten Kartoffeln, deren Inneres ein wenig den salzigen Geschmack der Asche angenommen hatte, waren köstlich.
In der großen Geschwistergemeinschaft gab es nur selten Einsamkeit oder Langeweile. Zwar hatte nicht jeder sein eigenes Zimmer, aber zusammen war es sowieso spannender. Und belebt, unterhaltsam war es in diesen Räumen tatsächlich oft. Der letzten Bleibe, die alle sieben gemeinsam bewohnten und in der Armin, für einmal, all die kreativen Kräfte seiner Familie in ihrer Fülle erleben sollte. Denn die Wurzeln der vielseitigen Begabung und Produktivität dieses Künstlers liegen offenkundig hier. In einer Familie, in der jeder irgendwie Theater spielte, sang, ein Instrument spielte, zeichnete oder schrieb.
Da ist zuerst einmal die Großmutter mütterlicherseits, die mit der einen Hand den Kochlöffel und mit der anderen den Pinsel hielt. Wie muss sich dieses Bild dem Kind eingeprägt haben! Eine Erwachsene, die so ganz selbstverständlich das Spielerische mit dem Notwendigen, den Alltag mit der Kunst verband. Und es zudem verstand, das Kind an dieser glückenden Synthese teilnehmen zu lassen. Sie, die die ganze Welt als Malerin erfasste, zeigte Armin, wie reizvoll diese Perspektive sein kann.
Noch heute vermittelt mir der Geruch von Terpentinöl das Gefühl von Heimat. Kam Besuch, so fertigte Großmama statt einer Begrüßung bisweilen rasch ein Porträt des Gastes. Schmollte einer von uns, dann sagte sie nur: »Bleib so, bleib so, das wütende Gesicht will ich malen.« Meist verflog dann der Unmut rasch angesichts so viel schöpferischer Energie. Einmal, da war ich so acht, neun Jahre alt, habe ich sie porträtiert, wie sie mich malt. Das Bild gibt es noch. Die Haare sind mir nicht gelungen, da habe ich ihr eine Mütze aufgesetzt – aber sonst sieht es ihr sogar ein bisschen ähnlich.
Da klingt noch heute der Stolz des Kindes durch und lässt ahnen, welcher Reichtum hier schon früh und ohne Druck zugrunde gelegt wurde. Den Skizzenblock wird Mueller-Stahl sein Leben lang bei sich tragen, doch erst spät, sehr spät, wird er mit seinen Bildern an die Öffentlichkeit treten.
Von Tante Toni, der Großtante der Mutter, die ebenfalls malte, hat Armin neben der Begeisterung für die Welt der Formen und Farben noch ein zweites (inneres) Bild mitgenommen. Denn diese Tante, die später bis zu ihrem Tod bei Armins Mutter in Leipzig lebte, verkörpert in seiner Erinnerung die Würde in Person.
Distinguiert, immer aufs sorgfältigste gekleidet, fütterte sie die Kaninchen mit weißen Handschuhen und verlor nie die Contenance. Die Streiche der Kinder nahm sie ebenso gelassen hin wie die Widrigkeiten des Alltags. Sie wusste, wo die Bonbondose stand, und auch sonst sehr genau, wie man Kindern Gutes tut. Stolz und voller Selbstdisziplin nahm sie Schicksalsschläge und Krankheiten ohne jede Wehleidigkeit hin. Für alles, was Literatur und Theater war, hat auch sie sich immer sehr interessiert. Sie war dabei in gewisser Weise auch eine typische alte Jungfer, denn geheiratet hat sie nie. Aber sie wurde nie schrullig, sondern blieb vornehm, Respekt einflößend.
Diese Tante, Toni Nelissen von Haken, hat ein Erinnerungsbuch geschrieben, in dem neben Wissenswertem über die Geschichte Livlands auch eine durchaus problematische politische Einstellung zum Ausdruck kommt. In ihrem unbedingten nationalen Stolz richtete sie einen emphatischen Appell an ihre Nachfahren, Livland als deutsche Vorburg zu begreifen und niemals zu vergessen, »dass unsere Väter siebenhundert Jahre lang das bekannte Wort Bismarcks wahr gemacht haben: ›Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts in der Welt.‹«
»Aber so etwas darf man nicht als Antizipation nationalistischen Gedankenguts sehen. Sie hat das ganz lauter und in gewissem Sinne naiv gemeint«, betont der Neffe sechzig Jahre später. Dabei weiß er natürlich, dass in der verzweigten Verwandtschaft baltischen Adels Nationalismus und auch eine konservative oder elitäre Haltung verbreitet waren. Das ist sein Ding nicht. Aber Berührungsangst hat er dem gegenüber ebenso wenig wie gegenüber dem »linken«, sozialistischen Umfeld, in dem er sich später bewegte. Politisch wird Mueller-Stahl immer auf seiner Intuition und Unabhängigkeit beharren. Entscheidungen trifft er nicht vor dem Hintergrund von Gruppenzugehörigkeit, sondern dem eigenen Urteil folgend. Und er ist nicht bereit, andere Menschen aufgrund von Vorurteilen oder Freund-Feind-Schemata zu bewerten. Stattdessen wird er immer versuchen, bei wohlfeilen Klischees durch Tiefenschärfe die Konturen der einzelnen Bestandteile eines Bildes sichtbar zu machen und Menschen, die seiner Meinung nach Achtung verdienen, differenziert und fair zu behandeln. Dazu gehört seine Tante Toni ganz entschieden. Weil sie sich noch in Alter und Krankheit durch Selbstbeherrschung und Dignität auszeichnete. »Ich habe diese Frau nie, nie klagen gehört«, erzählt er voller Hochachtung, und man ahnt in diesem Augenblick, wie sehr sie ihm auch Vorbild geworden ist.
Musikalisch war vor allem die Mutter aktiv, und Armin bekam schon mit sechs die erste Geige: neben dem Pinsel das zweite künstlerische Instrument, das ihn sein Leben lang begleiten wird. Die Musik macht ihm Spaß. Er lernt rasch, so wie er überhaupt begierig aufgreift, was ihm an kreativen Möglichkeiten in seiner Umgebung angeboten und vorgelebt wird.
Was die Schauspielerei betrifft, so ist die Familie gleich mehrfach »belastet«. Der Großvater mütterlicherseits war allgemein als »Theaterpfarrer« bekannt, seine Frau malte die Kulissen, eine Tante schneiderte die Kostüme, und schon konnte es losgehen. Die Liebe zum Theater verband auch Vater und Mutter. Denn Alfred Mueller-Stahl, Bankkaufmann von Beruf, wollte eigentlich Schauspieler werden. Schon in Tilsit hatte er als Laie beim dortigen Stadttheater und in einem Film mitgespielt. Aber fünf Kinder wollten ernährt werden, und da keine der beiden Familien Vermögen hatte, hieß es, einen soliden Broterwerb zu garantieren. Eine bittere Entscheidung. Denn die eintönige und so gar nicht inspirierende Beschäftigung mit Geld, Konten und Formularen fiel dem expressiven und künstlerisch begabten Mann schwer. Aber er ließ sich nicht entmutigen. In seiner Freizeit nutzte er jede Gelegenheit, um seine schauspielerische Leidenschaft auszuleben. Den Besuch bei Freunden gestaltete er nicht selten zur improvisierten Theatervorführung um, und auch zu Hause begeisterte er sein Publikum in immer neuen Szenen und Sketchen vor allem als Komiker.
Einprägsame Erlebnisse waren für Armin auch die Besuche im Theater oder Kino. Da alle fünf Kinder mitwollten, blieben solche Ausflüge ein rarer Luxus. Anfangs, zu den Märchenfilmen, durften die Kinder manchmal allein gehen. Später, im Krieg, gab es dann all die großen Ufa-Filme mit Marika Rökk und Zarah Leander, Hans Albers, Johannes Heesters.
Den Film »Der gefährliche Frühling« mit Paul Dahlke habe ich fünfmal gesehen. Winnie Markus spielt darin eine Chemikerin. Sie hat mich so beeindruckt, dass ich dann eine Zeit lang auch Chemiker werden wollte.
Identifikation und Faszination, dazu der Zauber des verdunkelten Zuschauerraums und das Schaudern, wenn sich der Vorhang für die Leinwand oder die Schauspieler hob. Ferne, aufregende Welten, an denen man für ein paar Stunden teilnehmen konnte. Als Schauspieler zu leben, darin waren sich Kinder und Eltern einig, müsste wunderbar sein.
Noch während des Krieges verging kein Heimaturlaub, in dem der Vater nicht auf die kleine Bühne stieg. Ja, sein Sohn bewunderte ihn, wie er so mitreißend und selbst voller Spaß das häusliche Publikum zum Lachen brachte. Des Vaters Begeisterung und die Kraft des (unerfüllten) Wunsches, Schauspieler zu sein, haben sich dem jungen Armin eingeprägt – und wurden eine der Quellen seiner späteren beruflichen Entscheidung. Gibt es doch kaum eine beglückendere Art, den geliebten Menschen über dessen Tod hinaus lebendig zu erhalten, als dessen Träume zu verwirklichen.
Es war Krieg, und durch die Einberufung des Vaters war er auch in die Familie Mueller-Stahl eingedrungen. Aber der Alltag der Kinder war noch nicht wirklich davon tangiert.
Der Krieg war für mich fern in dieser Zeit. Ich konnte mir konkret darunter nichts vorstellen. Einmal habe ich Zigaretten geklaut und für ein Gewehr eingetauscht. Das habe ich dann, ganz im Karl-May-Fieber, »Stutzen« genannt und Cowboy gespielt. Wir sind auf den Schützenplatz gegangen und haben auf Konservendosen geschossen. Ich war damals völlig ahnungslos und unbefangen. Für Kinder, die Gefahr und Tod nicht selbst erlebt haben, erscheint der Krieg eben wie eine Zeit der Abenteuer und aufregenden Unordnung.
Alltag in Kriegszeiten. Für die Mutter war es nicht immer leicht, allein mit den fünfen über die Runden zu kommen. Da musste auch schon mal ein Kind ausquartiert werden. 1941 kam Armin für knapp zwei Jahre in die Familie von Bekannten. Dort wuchs er in Pankow in der Prignitz zusammen mit dem fast gleichaltrigen Gisbert von und zu Putlitz auf. Hilfsbereitschaft auch über die verzweigte und zu Teilen adlige Verwandtschaft hinaus war selbstverständlich. Das Kind wurde aufgenommen, bekam seine Schulbildung und verbrachte die Freizeit mit seinem Freund. Er fühlte sich nicht allein, wie sein ältester Bruder, der fünf Jahre zuvor das Haus hatte verlassen müssen. Für Hagen war das ein schmerzhafter Bruch. Armin dagegen befähigte ein glückliches Naturell schon damals, Neues eher als eine belebende Herausforderung denn als Beunruhigung zu erleben.
Obwohl der Weg von Prenzlau nach Jucha, wo die Eltern der Mutter lebten, weit und damit teuer war, reisten alle zusammen dorthin, wann immer es ging. Da lag dann Toll, der Schäferhund, vor seiner Hütte, da waren Tante Ena und die Großmutter und eine Schublade mit verlockenden Süßigkeiten. Hier probierte Armin an einem Vormittag dreißig Zigaretten auf Lunge und lag danach drei Tage mit einer Nikotinvergiftung im Bett. Und wenn des Großvaters Predigt am Sonntag mal wieder zu lang ausfiel, dann spielte der Lütte auf der Empore mit der Orgel oder spuckte Bonbons auf die ehrwürdigen Köpfe unter ihm. Einmal blieb so ein buntes Zuckerwerk auf einer Glatze kleben, das gab dann natürlich Ärger. Aber der Grundton im großelterlichen Haus war eine zwanglose Herzlichkeit.
Auch hier war der Krieg kaum unmittelbar zu spüren. Was Krieg wirklich bedeutet, das habe ich erst gegen Ende zu ahnen begonnen, als meine Klasse zum Panzervernichtungstrupp eingezogen wurde. Ja, genau wie der Film »Die Brücke« von Bernhard Wicki es zeigt.
Er selbst blieb nur durch einen Zufall verschont, von dem er später im »Verordneten Sonntag«, seinem ersten Roman, als Erlebnis Arno Arnheims erzählt. Für Arno fiel der Krieg aus wegen eines Bratens, »den er sich am Abend, bevor es losgehen sollte, an die Front von Pasewalk (Panzervernichtungstrupp), aus dem Keller, wo die Mutter das Eingeweckte aufbewahrte, stahl. Es handelte sich dabei um eingeweckte Ente, fettes Geflügel, das Arno mit Stumpf und Stiel verputzte, auch das Fett holte er sich mit dem Zeigefinger aus den Rändern des Glases, daran konnte keiner was ändern, Arno fraß alles alleine, denn Arno wollte satt und beflügelt an die Front. Am nächsten Tag wurde die Klasse feierlich verabschiedet. Und während der Feierlichkeit stand Arno blaß an einem Pflaumenbaum und kotzte. Der Stammführer persönlich schickte ihn nach Hause, und Arno heulte, er träumte von einem Ritterkreuz, er wollte ein Held werden und er nahm sich vor, mit dem nächsten Zug zu folgen. Doch es gab keinen nächsten Zug. Das war März 1945.«
Am 20. April 1945 fiel die erste Bombe auf Prenzlau. »Die Kinder schliefen. Plötzlich ein dumpfer Knall, ein Aufblitzen, Klirren von Glas, Schreien auf der Straße. Die Kinder, die Kinder, schrie Ena und stürzte ins Kinderzimmer. Die dreiteilige Balkontür war aus dem Mauerwerk gerissen. Das zersplitterte Glas hatte sich über die Kinderbetten ausgestreut. Armin erzählte, dass er vom Luftdruck hochgehoben wurde. Und das Seltsamste war, dass das herausgestürzte Fenster unter ihm lag. Am nächsten Morgen verließen wir unsere kalte, ungemütliche Wohnung. Alles war plötzlich fremd und grau: die leeren Fensterrahmen, die schiefen Türen, der weiße Kalkstaub auf den Möbeln«, berichtet seine Mutter in ihrem Tagebuch.
Wieder ist die Familie unterwegs. Dieses Mal auf der Flucht. Nun wird auch für die Kinder das Elend des Krieges offenbar. Die Kranken und Verletzten, die Hungernden, die Sterbenden und die Toten. Doch bei allem Entsetzen hat sie auch in dieser Zeit die Kraft der Mutter wie ein Schutzmantel umgeben. Denn diese Mutter war eine jener Frauen, die in der Gefahr, am Rand des Abgrunds, eine besondere Stärke entwickeln. »Meiner Mutter Kräfte stiegen ins Unermessliche, wenn sie helfen konnte.« Und dazu hatte die couragierte Frau, die Russisch sprach, praktisch und lebensklug handelte und in ihrem tiefen Gottesglauben offenbar eine nicht versiegende Zuversicht fand, in den Wirren der Flucht jede Menge Möglichkeiten. Dadurch vermittelte sie den Kindern die Erfahrung, dass man auch in schwierigen Situationen durch Überlegung, Geschick und Zupacken das Schicksal beeinflussen kann. Eine Botschaft, die für ihren jüngsten Sohn in Krisenzeiten immer wieder bestimmend sein sollte.
Das Ende des Krieges zeichnet sich ab. Zusammen mit ihren vier Kindern flüchtet die Mutter nach Goorstorf. Dort, so war vereinbart, wollte man sich mit dem Vater wiedertreffen. Am 30. Mai ziehen die Russen in Goorstorf ein. Der Krieg ist aus. Was das Wort »Frieden« fortan bedeuten wird, weiß noch niemand so genau. Erst einmal beginnt die mühsame Zeit des Neuanfangs. Aber der Vater, der Vater kommt nicht. Sie ziehen weiter bis Rostock, kommen dort in Quarantäne, brechen schließlich wieder auf nach Prenzlau. Dort, so hofft die Mutter, wird sich auch der Vater endlich einfinden. Doch der Weg zur Brüssower Straße endet mit einer Enttäuschung: Das Haus ist nur noch eine Ruine. Unterschlupf finden sie in der Winterfelder Straße, direkt gegenüber der Schule, in der die Mutter später als Lehrerin arbeiten wird. Wieder beginnt das Warten. Im September kommt Hagen aus russischer Gefangenschaft zurück. Aber der Vater, wo bleibt der Vater? Er wird nicht kommen. Nicht in diesem Monat, nicht in den nächsten. 23 Jahre wird es dauern, bis die offizielle Todesmeldung eintrifft: »… bedauern wir mitteilen zu müssen, daß Alfred Mueller-Stahl am 1.5.1945 im Reserve-Lazarett in Schönberg/Mecklenburg verstorben ist. Die Todesursache ist uns nicht bekannt.« Die Familie wird er gesucht haben, vermuten seine Söhne, und dabei als Deserteur erschossen worden sein. In den letzten Tagen des Krieges, als die, die sich nicht verloren geben wollten, immer neue Verluste heraufbeschworen.
So wächst der junge Armin vaterlos auf, unter der Ägide der rührigen, warmherzigen Mutter. Nach den Schrecken des Krieges kehrt der Fünfzehnjährige zurück in eine Welt versuchter Normalität. »Eine wirkliche Normalität konnte es ja damals nicht geben«, erzählt Hagen später, »wir hatten ja alle nichts und mussten improvisieren. Materiell war das schwierig, aber zugleich herrschte nach der Bedrängnis und Bedrohung des Krieges doch ein enormes Gefühl von Aufbruch und Freiheit. Man musste nicht mehr Angst haben und um einen sicheren Platz bangen, sondern konnte sich frei bewegen und die Suche nach einem Stuhl oder Bett wurde zum Abenteuer. Wir lebten zu viert in zwei Zimmern und hatten ja nichts, gar nichts. Also sind Armin und ich losgezogen, um Einrichtungsstücke für unsere Bleibe zu finden. Allerdings war Armin auch damals bei solchen Unternehmungen nicht besonders pragmatisch orientiert. Einmal zum Beispiel brachte er von solch einem ›Beutezug‹ aus einer Schule einen ausgestopften Adler mit. Der war schön, aber nicht gerade nützlich. Doch so etwas war typisch für ihn. In jener Zeit sind wir auch viel unterwegs gewesen und haben Musik gemacht. In kleinen Kapellen, er hat Geige gespielt und ich Klavier und wir hatten so viel Spaß zusammen.«
Ja, es war eine Zeit des Neuanfangs. Da Mangel und Leid alle betraf, war auch die Hilfsbereitschaft zunächst groß. Umso härter der Bruch, als später diese Solidarität einer zunehmenden Egozentrik wich.
Das waren für uns Kinder ja doch sehr eindringliche Erfahrungen. Erst all das Elend, das wir im Krieg und auf der Flucht gesehen hatten. Der Schmerz in den Gesichtern, die Angst und Verzweiflung, das Sterben. Dann die Erleichterung. Man war zwar mittellos und lebte kümmerlich, aber man konnte sich wieder bewegen und auch etwas gegen das Elend tun. Doch dann, irgendwann, galten die Werte, die die Menschen während des Krieges und die ersten Jahre danach miteinander verbunden hatten, plötzlich nicht mehr. Die Einzelnen zogen sich immer mehr zurück und versuchten, ihre Schäflein ins Trockene zu bringen. Vom vormaligen Zusammengehörigkeitsgefühl blieb kaum noch etwas zurück.
Orientierung und emotionale Stabilität bot auch jetzt die Mutter. Trotz der vielen Aufgaben und des eigenen Kummers, der immer größer wurde. Denn während Editha Mueller-Stahl noch ins Ungewisse hinein auf ihren Mann wartete, kündigte sich schon der nächste Verlust an. Bald nach dem Abitur legte sich der zweitälteste Sohn, Roland, in ein Krankenhausbett und stand nicht mehr auf. Der Tumor im Gehirn, der ihn über Monate hin gequält hatte, wurde übermächtig. Vor den Kindern hielt die Mutter die lebensbedrohliche Diagnose fern.
Ich wusste zwar, dass Roland sehr schwer krank war, aber ich ging irgendwie selbstverständlich davon aus, dass er wieder gesund würde. Und ich glaube, bei meinen Geschwistern war das ebenso.
Auch der Kranke selbst hat die Hoffnungslosigkeit seines Zustands nicht realisiert. Noch am Geburtstag seines ältesten Bruders, kurz vor seinem Tod, schreibt er einen Brief an die Familie, der viel über den emotionalen und spirituellen Kontext aussagt, in dem die Kinder aufwuchsen.
»Ach, man könnte so unglücklich sein«, heißt es da, »aber ich zwinge mich, es nicht zu sein. Ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl, keinen schöneren Gedanken als: Gott ist mit dir, seinem Kinde, fürchte dich nicht. Und jetzt soll ich über das Ungewisse, das über meiner Krankheit schwebt, über das Heimweh, das immer wieder aufkommen will, unglücklich sein. Ich glaube ganz stark, mein Befund wird in den nächsten Tagen lauten, daß meine Krankheit ungefährlich ist und im lieben Zuhause vollständig ausheilt. (…) Ach, liebste Mutti, bete für mich, daß ich bald wieder zu Hause bin. Nun sitze ich in einem Café und schreibe diesen Brief. Punkt. Das ist meine Leidensgeschichte. Für Hagen will ich jetzt zum Sekretariat gehen. Ach wäre ich dem lieben Gott dankbar, wenn Hagen hier studieren könnte. Hoffentlich habe ich mit den Theaterkarten Glück, dann hinein ins Vergnügen. Die herzlichsten Grüße an alle Lieben in Prenzlau – Dein Dich liebender Roland.«
Mit dem Leben verbunden bis zum Schluss. Vielleicht nahm er den nahen Tod nicht wahr, aber er hat ihn auch nicht angstvoll angestarrt. Zwei Monate später, am Geburtstag seiner jüngsten Schwester Dietlind, starb er. Seine Mutter war bei ihm und überbrachte den Geschwistern die Todesnachricht. Und noch am nämlichen Tag feierten sie Geburtstag und sangen fröhliche Lieder. Sie wirkte offenbar so ruhig, so versöhnt, dass die Kinder den Tod des Bruders nicht als endgültigen Verlust erlebten. Es scheint, als sei diese Frau tatsächlich von jenem die Toten und die Lebenden verbindenden Bewusstsein getragen worden, das Todesanzeigen immer wieder beschwören und das so schwer zu erlangen ist. Als habe dieses Bewusstsein, diese emotionale Sicherheit sie befähigt, auch ihren Kindern den Schrecken vor dem Tod zu nehmen.
Allerdings sei die Angst vor dem Tod, die er als Kind zwischendurch ganz verloren hatte, später doch wiedergekehrt, erzählt Mueller-Stahl. Aber erhalten geblieben ist ihm die Fähigkeit, nicht die Verluste und das Bedrohliche im Leben wahrzunehmen, sondern die Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Haltung, die die Zähigkeit erklärt, mit der er sein Leben immer wieder von Grund auf neu aufgebaut hat.
Nach Jahren des Chaos von Kriegsende und Flucht gehen die Kinder wieder täglich zur Schule, das Leben gerät in ruhigere Bahnen.
Aber nun ging es los mit den Krankheiten. Weil ich unterernährt war, bekam ich Typhus, Gelbsucht und Mittelohrvereiterung. Ich musste in die Klinik, in der man mir mit Werkzeugen wie beim Klempner die Ohren operiert hat. Dass ich nun sterben würde, fand ich normal, schließlich starben dauernd Menschen um mich herum. Ich hatte auch das Gefühl, schon ein wenig weg zu sein von dieser Welt. Meine Seele war ramponiert durch all das Elend, das ich gesehen hatte. Und wer das Ende immer wieder so dicht erlebt hat, für den verschwimmen die Grenzen zwischen Leben und Tod. Als ich aus der Narkose aufwachte, war ich eine Weile irritiert, fast ein wenig enttäuscht, dass ich immer noch lebendig war. Erst allmählich habe ich wieder ins Leben zurückgefunden.
Doch selbst schlimmste Katastrophen werden im Alltag der Überlebenden allmählich wieder blasser. Die vitalen Forderungen des täglichen Lebens haben in ihrer ganzen Banalität doch auch eine erlösende, Leben erhaltende Funktion. Denn »ein jeder will leben, solange er lebt«, wie es bei Musil heißt. Und so taucht auch der junge Armin nach und nach ein in die Abenteuerwelt der Jugendlichen, in der Eroberungen und Wettkämpfe, innige Freundschaften und dramatische Rivalitäten regieren.
In Prenzlau ging er nun auch wieder in die Schule. Die Knabenoberschule war ausgebombt, also besuchten Mädchen und Jungen gemeinsam das Lyzeum. Vieles wurde improvisiert. Da einige alte Nazilehrer in der sowjetischen Besatzungszone den Laufpass bekommen hatten, unterrichteten ältere Schüler die jüngeren. So konnte sich Hagen nicht nur als Schüler, sondern bald auch als junger Lehrer hervortun. Für Armin hingegen war die Schule eher ein lästiges Übel. »Der Mueller-Stahl kann, wenn er will«, hieß es unter den Lehrern; meist aber wollte er nicht. »Er war nicht nur faul, sondern hatte den Kopf voll dummer Streiche«, berichtet die Mutter in ihrem Tagebuch. »Oft kam er später nach Hause – er saß dann auf meiner Bettkante und berichtete von seinen Abenteuern. Mir standen doch manchmal die Haare zu Berge, als ich erfuhr, was Armin und Ocka Roch (ein Klassenkamerad von Armin) sich alles ausgedacht hatten. So wurde zum Beispiel einem Schüler der unteren Klasse der Auftrag erteilt, einen Laufzettel in alle Klassen hineinzureichen, in dem es hieß, daß bei dreimaligem Läuten sich Lehrer und Schüler in der Aula zu versammeln hätten. Ocka Roch hatte geschickt eine Klingelanlage unter seiner Bank angelegt. Als er dreimal läutete, zogen Lehrer und Schüler in die Aula. Die beiden Übeltäter versperrten von außen die Flügeltüre der Aula und triumphierten, Lehrer und die gesamte Schülerschaft eingeschlossen und den Schulunterricht in Unordnung gebracht zu haben.«
Ganz wohl war auch der Mutter bei solchen Geschichten nicht. Strafen für seinen Schabernack hatte ihr Jüngster trotzdem kaum zu befürchten. Armin war zwar kein strebsamer Schüler, aber zufrieden, künstlerisch produktiv und sozial erfolgreich. Besonders im Theaterspiel stellten die Mueller-Stahl-Brüder während ihrer Schulzeit einiges auf die Beine. In Erinnerung ist ihnen beiden Shakespeares »Ein Sommernachtstraum«. Hagen spielte den Oberon, Armin den Zettel. Feuer und Flamme seien sie gewesen. Eine Tante kam an dieselbe Schule, sie nähte die Kostüme, und so wurde das Familientheater der Mueller-Stahls wieder aufgenommen. Das Spiel im Leben, das Leben im Spiel ging weiter.
Und da war nicht nur das Theater. Kurz nach dem Krieg hatte Armin seine zweite Geige bekommen und wieder zu üben begonnen; immer mehr, immer begeisterter. Und eines Tages, im März 1948, packte er seinen Geigenkasten und fuhr nach Berlin.
2 Der erste Geiger
Dazu gehört ein entschiedener Kopf. Doch der von außen besehen unvermittelten Entscheidung, die Musik ganz in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen, ging eine Zeit voraus, in der die Geige zur treuen Begleiterin geworden war. Armin ist erfüllt vom Zauber der Musik, die er ihr entlockt, und von den ganz eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, die das Instrument ihm bietet. Und obwohl er mitten in der 10. Klasse steckt, spielt er bei der Musikhochschule vor. Dieser Versuch wird mit einer Absage beschieden. Die erste größere Enttäuschung, die er mit einem künstlerischen Anliegen erfährt. Es hat ihn schon getroffen, dieses »Nein«. Aber dieses Mal wird es ihm leicht gemacht, den Rückschlag zu verkraften. Denn der Ersatz, der sich auftut, ist eine reizvolle Alternative: Der damals weit über Berlin hinaus bekannte Professor Hans Mahlke bietet ihm Privatstunden an. Kostenlos. Das ist eine Chance, zugleich ein ungeheures Privileg. Mahlke, von vielen auch der »Intonationsteufel« genannt, will ihn zum Konzertviolinisten aufbauen. Allerdings befindet er: am besten sofort. Zu Hause aber wartet immerhin noch die Schule! Für Mahlke kein Argument: »Entweder Sie werden ein mittelmäßiger Geiger mit Abitur oder Sie werden ein erstklassiger Geiger ohne Abitur.« Armin entscheidet sich für den erstklassigen Geiger. Er bleibt in Berlin.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!