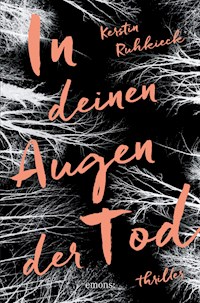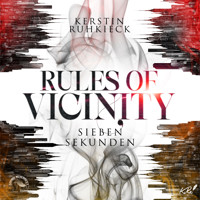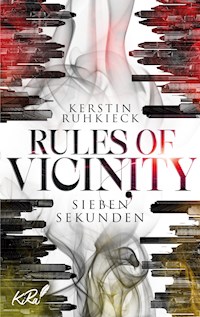Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jedes Mädchen hat ein schmutziges Geheimnis. Jedes. Auch du. Doch was würdest du tun, wenn dein Geheimnis eigentlich meins wäre, und nur ich, nicht du, die Wahrheit kenne? Einst waren Femke und Anouk beste Freundinnen, bis ein Verrat die beiden entzweite. Was blieb, war die Hassliebe zweier Mädchen, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt hatten. Doch als Femke eines Tages Anouk um Hilfe bittet, kommt es zu einem schrecklichen Unfall, der Anouks Leben für immer verändert. Von hässlichen Erinnerungsfetzen geplagt, versucht Anouk herauszufinden, was Femke widerfahren ist, und stößt dabei auf eine Mauer des Schweigens. Und auch die Zeit arbeitet gegen sie, als Anouk die Hauptverdächtige eines Verbrechens wird, das sie nicht begangen hat... *** Triggerwarnung: Dieses Buch enthält mögliche Auslösereize, die bei Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung zu einer Verschlechterung ihrer Symptome führen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was geschah mit Femke Star
Kerstin Ruhkieck
Copyright © 2018 by
Lektorat: Alexandra Fuchs
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Illustrationen: Nicole Homfeldt
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-442-0
Alle Rechte vorbehalten
Die Geschichte von Femke und Anouk widme ich allen, die dazu bereit sind, sich auf sie einzulassen.
Allen, die sie nachempfinden können.
Und allen, die verstehen,
warum sie so sein muss wie sie ist.
Dieses Buch ist für Euch.
Inhalt
Requiem
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Teil II
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Teil III
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Epilog
Requiem
Nachwort
Hilfestellen
Notes
Danksagung
Über die Autorin
Requiem
Tod einer Freundschaft
Ich erinnere mich gut an diesen letzten furchtlosen Tag. Jenen Tag, an dem noch alles in Ordnung war, bevor wir unserer Unschuld beraubt wurden und einander verloren. Wir wollten einen Neuanfang schaffen, ein gemeinsames Abenteuer erleben, das uns noch enger zusammenschweißen würde. Ein Aufbegehren gegen den gängigen Lauf der Dinge, gegen das ungeschriebene Gesetz, dass das Verfallsdatum einer Freundschaft in sichtbare Nähe kommt, sobald ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Dieses Abenteuer sollte etwas sein, an das wir uns erinnern konnten, sobald wir auf unterschiedlichen Wellen davongetragen wurden. Wir würden gegen den Strom schwimmen, der uns auseinanderzubringen versuchte, bis wir wieder die Freundinnen waren, die das Wesen der anderen verstanden.
Doch stattdessen war unser Versuch, etwas Unzerstörbares zu erschaffen, der Anfang vom Ende. Wir liefen mit offenen Augen auf einen Abgrund zu, und nichts konnte uns stoppen. Noch wussten wir das nicht, woher auch? Wir waren jung, unbedarft und ein Stück weit unverwundbar. Und wir glaubten, ewig zu leben. Zumindest damals.
Das Ende war ein unbekanntes, es würde plötzlich und ohne Vorwarnung kommen, kaum Tage nach diesem letzten furchtlosen Abenteuer. Unvorbereitet würde das Unwetter über uns hereinbrechen, obwohl wir sämtliche Vorkehrungen getroffen hatten, so glaubten wir.
Jede Verbindung besitzt eine Schwachstelle – irgendwo.
Wir waren Anouk und Femke. Beste Freundinnen seit dem Kindergarten. Wir kannten einander besser als uns selbst und manchmal kam mir der absurde Gedanke, dass nicht mehr viel fehlte, bis wir zu einer Person verschmolzen. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander, ich vertraute Femke bedingungslos. Und manchmal, in den einsamen Jahren nach Femke, versuchte ich mir weiszumachen, dass auch sie mir vertraut hatte.
Einer meiner traurigsten Irrtümer.
Prolog
Als wir am Tag unseres furchtlosen Abenteuers kichernd zusammen in Femkes Zimmer saßen, waren wir die glücklichsten Mädchen der Welt. Wir hatten es wirklich getan, aus einer albernen Idee war eine Mutprobe geworden und schließlich ein Zeichen unserer Freundschaft. Nun waren sie unter unserer Haut, untrennbare Symbole, die ebenso wie wir für immer zusammengehörten. Es war das Ende unseres Sommers, der ausgefüllt gewesen war mit tropfendem Schokoeis, verbotenen Streifzügen durch die Nacht und unbedarfter Schwärmerei. Uns blieben nur wenige Tage, ehe wir nicht mehr die kleinen Mädchen sein würden und von der Unter- in die Mittelstufe wechselten. Mittelstufe bedeutete, endlich nicht mehr von den Älteren als Babys gepiesackt, sondern von den coolen Typen der Schule mit anderen Augen wahrgenommen zu werden – in unserem Fall aber auch getrennte Klassen, unterschiedliche Hausaufgaben und ein anderer Freundeskreis. Wir würden uns voneinander lösen müssen, und das schien uns unvorstellbar.
Nein, nicht unvorstellbar.
Unmöglich.
Gegen Gefahren, so banal wie neue Freundschaften und unterschiedliche Interessen, waren wir gefeit, mit unserem neuesten Freundschaftsbeweis konnte uns nichts passieren.
Wir waren stärker als sämtliche äußeren Umstände der Welt.
Da gab es keine Zweifel.
»Tut deins auch weh?« Femke hatte ihre Shorts ausgezogen und saß im Schneidersitz auf ihrem Bett, das Bündchen ihres Slips ein Stück nach unten geschoben, und begutachtete vornübergebeugt ihr frisches Tattoo.
Ich kniete neben dem Bett auf dem Fußboden, meinen linken Knöchel von mir gestreckt, und stützte mich auf der Matratze ab, während ich Femke zusah.
Es fehlte ihr mal wieder an jeglicher Form von Geduld, weshalb sie sich die Klarsichtfolie von der geschwollenen Wunde puhlte, obwohl der Typ aus dem Tattooladen gesagt hatte, wir sollten damit ein paar Stunden warten. Femke liebte ihre kleine Blüte, kaum größer als ein Fünfcentstück, die mit feinen schwarzen Linien gestochen knapp über ihrem Schambein prangte.
»Ein bisschen, ist aber nicht schlimm«, antwortete ich und zeitgleich zuckte ein fieses Brennen durch meinen Knöchel. Anders als Femke ließ ich die Folie lieber dran. »Und bei dir?«
»Fühlt sich feucht an«, sagte Femke nachdenklich. Ihr blondes Haar hing ihr vor das Gesicht und verbarg die Sicht darauf.
»Feucht?« Stirnrunzelnd warf ich einen Blick auf meinen Knöchel. Die Wunde unter der Folie pochte empfindlich, feucht fühlte sie sich jedoch nicht an. Womöglich lag das an der Körperstelle. Bei diesem Gedanken kam ich mir auf einmal total verklemmt vor. Mein Tattoo war nicht ansatzweise so aufreizend wie das meiner besten Freundin.
Femke sprang von ihrem Bett und huschte zu dem bodentiefen Spiegel an ihrem Kleiderschrank. Wieder schob sie ihren Slip ein Stück hinunter, um aus dieser neuen Perspektive ihre Blume zu betrachten. Es war nicht ungewöhnlich, aber an diesem Tag bewunderte ich sie noch mehr als sonst. Wie selbstbewusst sie mit ihrem Körper umging.
Die Tatsache hingegen, dass sie seit einigen Wochen penibel darauf achtete, ihn durch Enthaarung und gezielten Sport zu perfektionieren, beobachtete ich mit gemischten Gefühlen. Ein wenig fürchtete ich, sie könnte mir entgleiten, selbst wenn ich nicht erklären konnte, auf welche Art und Weise. Also war ich dazu übergegangen, meine Sorge zu ignorieren.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Typ uns für volljährig gehalten hat«, lachte Femke und positionierte sich in unterschiedlichen sexy Posen vor dem Spiegel.
Die Erinnerung an den Tätowierer war mir unheimlich. Er war nett gewesen, wenn auch ein wenig einsilbig, aber als wir ihm mit unseren Namen die Erlaubnis für eine Körperverletzung geben sollten, hatte er mich ziemlich nervös gemacht.
Einverständniserklärung für eine Körperverletzung.
Wer unterschrieb denn so was?
Offensichtlich wir, wie die Farbe unter unserer Haut bewies.
Femke grinste bei der Erwähnung des Mannes, der ihr an einer sehr intimen Stelle eine verlangte Körperverletzung zugefügt hatte. »Ich glaube, der war ein Pädophiler oder so.«
»Das ist echt nicht witzig, Fem«, schimpfte ich, während ich mich angewidert schüttelte, konnte jedoch nicht verhindern, trotzdem zu lachen.
Und es stimmte. Irgendwas hatte mit dem nicht gestimmt. Niemals konnte der ernsthaft geglaubt haben, dass wir achtzehn waren, gefälschte Ausweise hin oder her. Immerhin waren wir erst dreizehn! Er hatte sicher erkannt, wie jung wir waren und der Versuchung nicht widerstehen können. Insbesondere als er gehört hatte, wohin Femke ihre Blüte haben wollte.
Wieder schüttelte es mich. Das war definitiv eine Erfahrung gewesen, die man nur einmal im Leben brauchte.
»Ich finde es so krass, dass du ein Tattoo direkt über deiner Muschi hast.« Ich kicherte über meine eigenen Worte.
Femke unterbrach ihr Gepose und hüpfte mit zwei leichtfüßigen Schritten zurück auf ihr Bett, wo sie erneut die Beine im Schneidersitz vor sich kreuzte. »Ja, oder? Und das Beste ist, dass ich vor meinen Eltern im Bikini rumlaufen kann und sie trotzdem nie davon erfahren werden. Das ist so geil!« Sie grinste mich breit an und ich erwiderte es.
Schritte auf der Treppe übertönten unser Lachen und Stimmengewirr drang durch Femkes geschlossene Zimmertür zu uns. Sofort verzog meine Freundin das Gesicht und verdrehte die Augen.
»Ätzend, Konstantin hat schon wieder seine Kumpels mitgebracht. Ich hasse es, wenn sie die ganze Nacht zocken und dabei rumgrölen wie Affen. Rücksichtnahme hat für die echt zu viele Silben.«
Ich grinste. Konstantin war ihr älterer Bruder. Er ging in die Oberstufe und Femke machte kein Geheimnis daraus, was für eine Zumutung es sein würde, wenn sie ihm nach den Ferien auch noch in der Schule regelmäßig über den Weg lief.
Wir lauschten dem Lärm und warteten darauf, dass die wilde Meute an Femkes Tür vorbeigepoltert war und sich zum Zocken in Konstantins Zimmer verbarrikadierte.
Dann hörte ich es. Unvorbereitet traf sie mich.
Seine Stimme.
Alles an meinem Körper verkrampfte, mein Herz beschleunigte sich und ich hielt angespannt die Luft an. Aber ich musste atmen. Ich musste! Mein Blick huschte zu Femke, die mich stumm beobachtete, und ich fühlte mich ertappt.
Natürlich. Sie wusste es. Erst vor ein paar Tagen hatte ich es ihr erzählt. Nachdenklich sah sie mich an, vielleicht sogar besorgt, obwohl es dafür keinen Grund gab.
Ich würde schon nicht das Bewusstsein verlieren. Vermutlich.
»Anouk, vergiss nicht zu atmen! Du bist ganz blass«, flüsterte Femke, und ich nickte, wagte es aber nicht, auch nur einen Ton von mir zu geben.
Schließlich holte ich Luft und horchte weiter auf die Stimmen, verstand aber keine Worte. Ob ich ihn noch einmal heraushören konnte? Konstantin und seine Freunde machten Krach, dumpfes Klopfen und Scheuern, Schritte, Lachen. Wieder musste ich mich daran erinnern, Luft zu holen. Das war Traum und Albtraum, ich stellte mir vor, was ich tun würde, wenn Konstantin die Zimmertür aufriss und uns aufforderte, ihnen Gesellschaft zu leisten. Das würde nicht passieren, niemals, aber allein die Möglichkeit kostete mich Nerven. Meine Muskeln zitterten vor Anspannung.
Als die Jungs von Konstantins Zimmer verschluckt wurden und die Tür krachend zuschlug, zwang ich mich zur Ruhe. Kein Grund, die Fassung zu verlieren! Ich sah zu Femke, die mich mitfühlend anlächelte. Niemand anderem hätte ich erlaubt, mich in diesem Zustand zu sehen, und selbst ihr gegenüber fühlte ich mich bloßgestellt. Nackt.
Beschämt vergrub ich mein Gesicht in den Händen. »O Gott«, jammerte ich theatralisch und hörte Femke lachen.
Ja, irgendwie war das ziemlich komisch.
»Nouk!«, grinste Femke so liebevoll, dass ich es ihr nicht übel nehmen konnte. »Ist doch nicht schlimm! Du bist in ihn verknallt! Na und? Ich bin ständig in jemanden verschossen und mir ist das nie peinlich.«
Das stimmte. Aber ich war nicht Femke und auch nicht bloß verknallt. Manchmal glaubte ich, meine Zukunft wäre leer und bedeutungslos, wenn ich diesen Jungen nicht bekäme. Einfach alles an ihm war perfekt. Sein Aussehen, seine Figur. Die Art, wie er sprach und sich bewegte. Mein Körper drohte jedes Mal vor Kribbeln und Prickeln zu zerspringen, sobald ich ihn von Weitem sah. Kaum auszudenken, was passierte, wenn ich das erste Mal mit ihm redete.
Ich war nicht nur verknallt in ihn. Das war Liebe.
Schließlich hob ich den Kopf und blickte zu Femke auf. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass er mit Konstantin befreundet ist?« Es sollte kein Vorwurf sein, und doch klang es wie einer. Mir wäre es einfach lieber gewesen, ich hätte gewusst, dass so ein Zwischenfall möglich war.
Femke zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Ich wusste bis neulich nicht einmal, dass du dich für ihn interessierst.«
Heißes Blut pulsierte in meinen Wangen. »Tue ich nicht.«
Femke verdrehte die Augen und hüpfte leichtfüßig von ihrem Bett. Als sie sich neben mich auf den Boden setzte und einen Arm um meine Schulter schlang, kam ich mir albern vor. Sie war meine beste Freundin. Dass mir meine Gefühle vor mir selbst peinlich waren, konnte ich nachvollziehen. Aber doch nicht vor Femke! Ich wusste, dass sie mich verstehen würde.
»Nouk, warum schämst du dich denn deswegen?«, wollte sie ruhig wissen und kuschelte sich an mich. Vielleicht konnte sie meine Gedanken lesen.
Das war eine gute Frage und der wahre Grund wollte sich mir nicht erschließen. »Weil … ich viel zu viel über ihn nachdenke und er nicht einmal weiß, wer ich bin. Was wahrscheinlich sogar besser ist, weil ich … ich weiß auch nicht. Zu langweilig bin?«
Femke rückte ein Stückchen von mir ab und sah mich ungläubig an. »Quatsch! Du bist nicht langweilig«, schimpfte sie und deutete auf den Knöchel am Ende meines ausgestreckten Beins. »Du hast ein Tattoo! Wie cool ist das bitte?«
Eine Weile betrachtete ich das von Folie unkenntlich gemachte Bild auf meiner Haut. »Nicht so cool wie deins«, sagte ich geknickt.
Femke schüttelte langsam den Kopf. »Meins ist nicht cool, meins ist feige.« Dann lehnte sie sich wieder an mich und legte ihren Kopf auf meine Schulter. Aus dem Nebenzimmer kamen die dumpfen Stimmen der Jungs, sie waren dazu übergegangen, einander mit wildem Geschrei anzufeuern. Irgendein Game, das sie spielten, vermutete ich. Trotz der Wand zwischen uns kam es mir vor, als säßen sie direkt in Femkes Zimmer.
»Ist er oft hier?«, überwand ich mich schließlich zu fragen.
Femke atmete heftig aus. »Keine Ahnung, ich blende das aus, wenn Konstantins Kumpels wieder da sind.«
»Habt ihr mal … über mich gesprochen? Ich meine, du und er?«, fragte ich weiter und spürte abermals das Gefühl von Scham in meiner Brust brennen.
Ihr langes Haar kitzelte an meinem Oberarm, während sie sich enger an mich drückte. »Ich rede nicht mit seinen Kumpels, Nouk. Konstantin würde mich umbringen.«
Weitere Fragen brannten auf meiner Zunge, doch ich verbot es mir, sie zu stellen. Auf keine von ihnen könnte sie mir eine zufriedenstellende Antwort geben und würde mich nur noch trauriger machen. Wie sehr ich mir wünschte, ihn besser zu kennen! Oder dass er von meiner Existenz wusste.
Femke setzte sich auf und blickte mir fest in die Augen. »Du wirst nie wissen, ob du ihm gefällst, Nouk, wenn du dich vor ihm versteckst. Und wenn er schlau ist, wirst du ihm gefallen, weil du nämlich toll bist.«
Ich nickte und wusste nicht, was ich erwidern sollte. Femke hatte recht. Das hatte sie meistens. Eine tiefe Dankbarkeit überkam mich.
»Femke?«, flüsterte ich über das Gegröle von nebenan hinweg und sie strahlte mich an, weil sie wusste, was ich sagen würde. »Ich hab dich lieb.«
Sie nahm meine Hand und drückte sie. »Ich hab dich auch lieb, Nouk. Sehr.«
Kaum ein paar Wochen später war es vorbei. Anouk und Femke im Doppelpack, die Beinahe-Siamesischen-Zwillinge waren Geschichte. Ich entfreundete mich von ihr, in den Social Medias gleichermaßen wie im Real Life, blockte ihre Versuche der Kontaktaufnahme ab und erzählte jedem in der Schule, ob er es wissen wollte oder nicht, dass es allein ihre Schuld gewesen war.
Wie die in den Historienbüchern, hatte auch diese Geschichte tragisch geendet. Sie gipfelte in einem großen Knall, einem Schlachtfest der Gefühle, doch das emotionale Blut sickerte nicht aus Wunden des Körpers, sondern in ihn hinein. Innere Blutungen, nur knapp überlebt.
Die Verletzte:
ich.
Teil Eins
Eins
Hier stehe ich nun, dreieinhalb Jahre später, und warte auf Femke, die nicht mehr meine beste Freundin ist. Nicht einmal mehr irgendeine Freundin. Sie ist nichts, ich habe sie aus meinem Leben gestrichen wie einen Unglückstag aus dem Kalender. Nichts wird das jemals umkehren können, was tot ist, bleibt auch tot.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, nicht zu kommen, nicht auf ihren verzweifelten Anruf zu reagieren. Über die alte Wunde hat sich zwar eine neue Haut gelegt, doch ihre poröse Oberfläche ist brüchig. Aber Femke klang am Telefon so ängstlich und aufgewühlt, dass mich die Unvernunft gepackt hat.
Und nun stehe ich im heranziehenden Herbststurm, es ist der erste in diesem Jahr, und werde den Eindruck nicht los, dass Femke mich verarscht hat. Vor fast einer Stunde hat sie das erste Mal seit langer Zeit meine Nummer gewählt – immer noch im Handy gespeichert oder nie vergessen. Das hat mich ehrlich gewundert. Sie klang verwirrt und aufgebracht und sagte, es sei toll von mir, weil ich mich bereit erklärte, sie zu treffen. Aber in Wahrheit bin ich nicht toll. Meine Hilfsbereitschaft trägt einen anderen Namen: Neugier. Welches Leid hat sie zu klagen, und werde ich Genugtuung empfinden, weil Karma sie endlich heimgesucht hat?
Stattdessen friere ich mir den Arsch in der hereinbrechenden Dunkelheit ab, und es sieht so aus, als wäre Karma zu mir zurückgeeilt, um mich für meine Neugier abzustrafen.
Missgelaunt sehe ich mich um. Es ist nicht spät und trotzdem scheint der Tag vorbei zu sein. Sie werden wieder kürzer und der Herbst fordert seinen Tribut. Vertrocknete Blätter fegen an mir vorbei, werden aufgewirbelt und durch die Luft getragen. Ich will das nicht, will, dass der Sommer für immer bleibt, doch mich fragt niemand.
Ich gebe Femke noch drei Minuten, bevor ich verschwinde. Fröstelnd ziehe ich meine schwarze Stoffjacke enger und schlinge die Arme um meinen Körper, eine einsame Umarmung in einer trostlosen Umgebung. Eine Erhöhung, ein angrenzendes Waldstück, eine gesicherte Böschung und an ihrem Ende ein Fluss, wilder und lauter als an jedem anderen Tag. Er lacht mich aus. Dieser Ort ist nichts Besonderes, kein geheimer Treffpunkt der Freundinnen aus einem anderen Leben, nichts dergleichen. Nur irgendeine Stelle auf irgendeinem Weg. Keine Ahnung, warum Femke mich hier treffen will. Ich bekomme eine Gänsehaut und es kribbelt in meinem Nacken. Unangenehm. Vermutlich sollte ich gehen, bevor Femke kommt und … zu spät.
Ich sehe sie die Anhöhe hochkommen, ihre Arme um ihren Körper gelegt genau wie ich, ihre Schritte fahrig und kraftlos. Ein Anflug von Wehmut überkommt mich und ich stelle mir die Frage, wer wir heute wären, hätte sie mich nicht hintergangen. Immer noch Freundinnen? Solche, die füreinander durchs Feuer gehen? Schwestern im Herzen? Wäre ich weniger ich und ein bisschen mehr wie sie? Wenn ich ihrem Ruf Glauben schenken will – und das will ich –, kann ich gut darauf verzichten. Einst kannte ich sie in- und auswendig, heute ist sie eine Fremde.
Eine Fremde, die ich ein bisschen mehr hasse als alle anderen Fremden.
Ja, ich bin ein Misanthrop.
Als sie näher kommt, schaudert es mich. Femke sieht schlecht aus. Ihr Haar ist strähnig, ihr Gesicht fahl und ihre Augen rot.
Sie hat geweint.
Eine schwarze Jeans und ein Sweatshirt schlackern um ihren dürren Körper, kein Minirock, kein enges Top. Sie hat abgenommen, das verbirgt selbst die weite Kleidung nicht. Die Flammen meiner alten Wut fangen an zu zischen, sie schrumpfen und werden erlöschen, als hätte ihr bemitleidenswerter Auftritt einen Eimer Wasser über das Feuer gekippt. Ich kämpfe dagegen an, will mich nicht von ihr täuschen lassen.
Nicht schon wieder.
Das äußere Erscheinungsbild lässt keinen Rückschluss auf ihr Inneres zu, es ist bloß ein Kostüm, um ihr wahres Ich zu verbergen. Ich setze einen abweisenden Gesichtsausdruck auf, sie soll nicht glauben, ich würde es ihr einfach machen.
Was auch immer sie von mir will.
Sie scheint ruhelos und sucht meinen Blick, doch ich weiche ihm aus. Aber als sie vor mir stehen bleibt, sehe ich doch in ihre Augen, und auf die Angst darin bin ich nicht vorbereitet. Ein ungutes Gefühl überkommt mich. Eine innere Stimme drängt mich, Femke stehen zu lassen, mich umzudrehen und wegzugehen. Damit willst du nichts zu tun haben, flüstert sie unheilvoll.
»Nouk«, sagt Femke vorsichtig und ich zucke bei dem Klang meines Spitznamens zusammen. So hat mich seit Jahren niemand mehr genannt. »Wie geht es dir?« Ihre Stimme ist rau und belegt. Sie hat wirklich geweint.
Es dauert genau zwei Atemzüge, ehe ich ihre Worte begreife, und die Wut flammt wieder auf. »Lass den Scheiß, Femke. Was willst du von mir?« Sie hat kein Recht, mich das zu fragen und es interessiert sie auch nicht. Die vier Worte, zusammengesetzt zu einem banalen Satz, sagt sie nur, weil sie etwas von mir will.
Femke zuckt zusammen, in ihrem Gesicht zittern mehrere Muskeln. Sie ist kurz davor, neuen Tränen nachzugeben.
»Ich wusste nicht … ich weiß, du bist sauer auf mich … aber …« Sie bricht ab. Ihr verkümmerter Körper strahlt nichts als Hilflosigkeit aus und sie sieht flehend zu mir auf.
Es passiert wieder, ihr Anblick lässt mich nicht kalt. Etwas in mir zieht sich schmerzhaft zusammen und es macht mir Angst, sie anzusehen. »Was willst du?«, wiederhole ich schroff und lehne mich gegen das Geländer vor der Böschung. Ich suche Halt, etwas, das mich gleichgültig und locker erscheinen lässt, wenn ich es schon nicht bin.
»Ich wusste nicht, mit wem ich … wer mir sonst …«, stammelt sie und eine einzelne Träne verfängt sich in ihren unteren Wimpern. Ich weiß viele schlechte Dinge über sie, aus eigener Erfahrung oder auf den Schulfluren aufgeschnappt, aber sie ist nicht manipulativ, Gefühle zu heucheln hat sie nicht nötig.
Ihr entsetzlicher Anblick erschüttert mich immer mehr, wie sie dasteht und leise weint.
»Du hast mir wehgetan, Femke«, quäle ich hervor. Auch mir fällt es schwer zu sprechen. Ein Kloß in meinem Hals drückt mir die Luft ab, eine schmerzhafte Erinnerung an das Gefühl von damals. Als ihr Verrat mir den Sauerstoff aus der Lunge gedrückt und den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Viele Jahre unter Wut begraben, ist nun die Traurigkeit zurück.
Sie sieht mich an, ihre bleichen Wangen glänzen feucht im Schein der Straßenlaterne ein paar Meter weiter. Ihre Arme sind so eng um ihren Oberkörper geschlungen, als versuche sie, ihre eigenen Rippen zu brechen. Oder sich zu wärmen, denn es wird immer kälter. Der beißende Wind reißt an unseren Haaren, an unseren Kleidern.
»Es tut mir so leid, Nouk! Ich … ich wollte das nicht, ich habe das alles nicht gewollt«, bricht es aus Femke heraus und mit den Worten kommen weitere Tränen. Verzweifelte, hoffnungslose Tränen.
Ich blicke weg, will das nicht sehen und schüttle leicht den Kopf. »Das hat dich trotzdem nicht abgehalten«, wispere ich gegen den Sturm. Ich bin unsicher, was ich will. Ob sie meinen Vorwurf hören oder er vom Wind verschluckt und davongetragen werden soll. Deswegen lasse ich das Schicksal entscheiden.
Hilflos befreit Femke sich aus der eigenen Umklammerung und wischt ein paar Tränen aus ihren Augen, dreht sich dabei verschämt von mir weg.
Sie kann nicht aufhören zu weinen, also lässt sie die salzigen Tropfen laufen.
»Nouk, bitte …!«, fleht sie und tritt einen Schritt auf mich zu. Sie streckt einen Arm nach mir aus, doch ich weiche vor einer Berührung zurück, stoße mich von dem Geländer ab und gehe an ihr vorbei. Ich möchte weg, niemals hätte ich mich auf dieses Treffen einlassen dürfen.
»Nouk, bitte geh nicht«, heult sie noch heftiger.
Ich bleibe stehen und wirble herum. »Hör auf, mich so zu nennen!«, fahre ich sie an, dabei brennt nicht länger die Wut von früher in mir. Stattdessen hat sich ihre Hilflosigkeit auf mich übertragen. »So nennen mich nur meine Freunde«, lüge ich, um sie zu verletzen, doch die Genugtuung bleibt aus. Stattdessen tut es mir weh. So sehr, als würden wir unsere Freundschaft aufs Neue beenden.
Auf Femkes Gesicht legt sich ein kalter Ausdruck. »Dürfte dann überschaubar sein.«
Ich stolpere zurück, obwohl sie das Gesagte sofort zu bereuen scheint. Ihr Gesicht spricht Bände, doch ihr Mund bleibt stumm. Keine Entschuldigung, keine Erklärung.
»Immerhin tuschelt nicht die ganze Schule darüber, was für eine Schlampe ich bin«, kontere ich, dieses Mal mit der Absicht, sie zu verletzen.
Femke presst ihre Lippen aufeinander, ein resignierendes Nicken verbindet sich mit einem neuen Schluchzen. »Anouk, bitte! Geh nicht weg!«, bettelt sie. Ihre Augen sind blutrot, ihre Nase läuft. Niemals zuvor habe ich sie so aufgelöst gesehen. Als würde ihr zitternder Körper zu einem See aus Tränen und Rotze werden. Ich sollte ihr helfen, ganz gleich, was sie von mir will, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht.
»Bitte doch eine deiner Leichtathletikfreundinnen um Hilfe, Femke. Ich bin echt nicht die Richtige dafür.«
Femke weint noch heftiger und schüttelt ununterbrochen den Kopf.
NeinNeinNein, scheint sie zu flehen, sie schluchzt und weint, verzweifelt und verloren, wie ein Baby, das gerade aus einem Albtraum erwacht ist.
»Bitte hilf mir!«, würgt sie zwischen all den Tränen und der Rotze hervor. Sie stürzt nach vorne und kurz glaube ich, sie wird vor mir auf die Knie gehen, um in meinem Schoß zu weinen. Stattdessen greift sie nach meiner Hand, hält sie fest, drückt sie. Ihre Finger sind kalt und klamm und ich erstarre. Ihr Anblick geht mir unter die Haut, ihre Verzweiflung, ihre rohen, ungefilterten Emotionen erschrecken mich.
»Lass mich los!« Ich befreie meine Hand und weiche zurück. Es ist mir unangenehm, von ihr in diesen Strudel der Verzweiflung gerissen zu werden.
Doch Femke gibt nicht nach, kommt erneut auf mich zu, vielleicht will sie mich erwürgen oder umarmen, ich weiß es nicht. Aber ich will ihre Nähe nicht, stoße sie von mir, ein Schubser, zu heftig, um neckisch zu sein. Femke, die zierliche, schmale Femke, stolpert rückwärts, und für den Bruchteil einer Sekunde empfinde ich endlich Genugtuung. Das ist der Befreiungsstoß, den ich gebraucht habe, um mich von meiner inneren Verletzung zu lösen.
Ja, ganz bestimmt.
Der kalte Wind zerrt an meinem Haar, wirbelt die langen silbergrau gefärbten Strähnen vor mein Gesicht. Ich muss sie bändigen, sie aus meinen Augen streichen, um zu sehen, was gleich passiert, aber im selben Moment wünsche ich, ich wäre auf ewig von meinem Haar verschleiert geblieben.
Femke ist gegen das Geländer gestoßen.
Sie hat ihr Gleichgewicht verloren, sucht Halt an dem Eisengestell, doch es gibt nach, löst sich aus der Erde wie aus Butter. Das Geländer stürzt ungebremst in die Tiefe unter sich.
Und mit ihm Femke.
Scheiße.
Zwei
Scheiße.
Ich kann mich nicht bewegen, bin erstarrt. Das darf nicht sein, ich muss träumen. Vermutlich ist dieses Treffen mit Femke ein einziger langer Albtraum. So muss es sein! Denn solche Sachen, schlimme Unfälle, Tragödien, passieren nur den anderen, nicht mir.
Wenn das wirklich wahr ist, ist es eine verdammte Katastrophe!
Doch ich wache nicht auf. Das Geländer bleibt verschwunden, es gibt keinen Rewind-Knopf, der alles rückgängig macht.
Hätte ich sie bloß nicht geschubst. Scheiß auf Genugtuung, das ist sie nicht wert. Nicht für ein Menschenleben.
Aber ich habe es getan. Ich habe Femke von mir gestoßen und ich habe Genugtuung empfunden. Das Geländer ist weg, Femke ist gestürzt.
Kein Albtraum.
Eine Katastrophe.
Nach dem Bruch unserer Freundschaft laufen Femke und ich uns in der Schule beinahe jeden Tag über den Weg. Das lässt sich nicht vermeiden, immerhin sind wir im selben Jahrgang. Aber es ist eine ganz bestimmte Begegnung weit in der Vergangenheit, die mir nun in den Sinn kommt.
Ich stand an meinem Spind, kämpfte gegen Hefte und Schulbücher, die sich meinem Willen nicht beugen und aus dem Schrank verabschieden wollten, und fluchte leise vor mich hin. Amy und Robin lehnten an der Schrankreihe und sahen mir ungeduldig zu.
Ich bemerkte Femke aus dem Augenwinkel, die wenige Türen neben meinem an ihren Spind trat, und schenkte ihr keine Beachtung. Stattdessen drehte ich ihr den Rücken zu, wie ich es immer tat, wenn wir uns zufällig trafen.
»Wird’s bald, Anouk?«, motzte Amy ungeduldig und verdrehte die Augen. Robin und ich tauschten irritierte Blicke.
»Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«, regte Robin sich auf.
Amy kam nicht dazu, Robins Frage zu beantworten. Ein Knall ließ uns zusammenzucken. Natasha Muller hatte mit ihrer flachen Hand auf die geschlossene Tür neben Femkes Spind geschlagen und funkelte sie zornig an. Tasha war ausgesprochen hübsch, doch als Spielerin des Basketballteams der Mädchen besaß sie eine Körpergröße, mit der sie nicht nur die meisten Jungs überragte, sondern auch ein wenig angsteinflößend wirkte.
»Du Schlampe!«, fuhr sie Femke an und drängte sie mit ihrem Körper an die Schränke. Femke reagierte nicht, ließ Tashas Wutanfall über sich ergehen, als würde sie ihn nicht bemerken.
Ich konnte nicht anders, ich musste hinsehen. Wie bei einem Autounfall, nur viel persönlicher.
»Du hast mit meinem Freund geschlafen!« Tasha wurde lauter, Femkes Schweigen machte sie noch wütender. »Sag was, du Miststück!«, forderte sie und gab Femke einen Stoß gegen die Schulter.
Soso, Femke war also mit Tashas Freund im Bett gewesen. Das wunderte mich nicht.
Femke schien durch den Schubser wie aus ihrem Dornröschenschlaf der Gleichgültigkeit erwacht. »Lass mich in Ruhe.« Sie blickte zu Tasha auf, die entrüstet nach Luft schnappte. Femke zeigte keine Angst, eine unerklärliche Arroganz ging von ihr aus, die bis zu mir hinüberschwappte und mich ebenfalls erzürnte.
»Dann gibst du es zu?«, beharrte Tasha weiter, und wieder gab sie Femke einen Hieb gegen die Schulter.
Femke wandte sich ab, klemmte sich ein paar Bücher unter ihren Arm und knallte den Spind zu. »Du scheinst es doch schon längst zu wissen. Was willst du noch von mir?« Ihr Blick streifte meinen und ich sah ein Schmunzeln, das über ihre Lippen huschte. Sie zeigte es nicht offen, nur mir, wie sehr sie sich über Tashas Anschuldigungen amüsierte. Da war keine Reue, kein schlechtes Gewissen, nur Erheiterung. Tashas zorniger Auftritt war bloß dazu da, um sie zu unterhalten.
Ich sah zuerst weg. Bei ihrem Anblick wurde mir schlecht. Für sie war das ein Spiel, die Gefühle anderer interessierten sie einen Scheißdreck.
»Ich will, dass du es zugibst. Hast du mit meinem Freund geschlafen?« Anfänglich schien Tasha verwirrt von Femkes Mangel an Reue, doch das hatte sich gelegt. Nun wollte sie Femke bloßstellen, und ich konnte es verstehen. Sonst nervten mich diese klischeebehafteten Schuldramen mit ihren komplizierten Sozialgeflechten, aber in diesem Fall war ich ausnahmsweise sensationslustig.
Femke stemmte sich ihre freie Hand in die Hüfte und sah Tasha herausfordernd an. »Woher soll ich wissen, wer dein Freund ist?«, fragte sie herablassend.
Ich hörte Robin neben mir nach Luft schnappen, aber ich konnte mich nicht zu ihr umsehen, konnte meinen Blick nicht von Femkes unverschämtem Schauspiel nehmen.
Tasha glotzte sie fassungslos an. »Willst du mich verarschen?« Ihre Stimme hatte einen Tonfall angenommen, der meinen Puls vor Spannung in die Höhe trieb.
Anscheinend bemerkte auch Femke die Veränderung. Während die Stimmung eben angespannt gewesen war, knisterte nun die Luft gefährlich. Vorbeigehende Schüler blieben stehen und beobachteten neugierig, was als Nächstes geschah – genau wie ich.
»Lass mich in Ruhe«, sagte Femke genervt, doch als sie an Tasha vorbeiwollte, stieß diese sie erneut an der Schulter zurück, sodass Femke gegen die Spinde knallte.
»Sag es!«, forderte Tasha mit drohender Stimme.
Femke richtete sich auf und sortierte die Bücher unter ihrem Arm neu, während sie überheblich die Augen verdrehte.
»Von mir aus«, begann sie gelassen, richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, mit der sie Tasha gerade bis zur Schulter reichte, und stöhnte theatralisch. »Ja, dein feiner Freund David hatte Sex mit mir. Zufrieden? Und jetzt lass mich vorbei!« Abermals versuchte Femke zu gehen, und wieder donnerte Tasha sie gegen die Schränke, diesmal noch grober. Immer mehr Schüler versammelten sich und ich hoffte, niemand würde eingreifen und für Femke Partei ergreifen. Was sich gerade vor unseren Augen abspielte, war längst überfällig.
»Du verdammte Hure!«, stieß Tasha aus und es war offensichtlich, dass sie mit sich rang. Sie wollte Femke schlagen, sie ihre Wut und ihre verletzten Gefühle physisch spüren lassen, aber noch beherrschte sie sich.
Nichts davon schüchterte Femke ein. Sie stellte sich dem großen Mädchen entgegen, die Nase erhoben, eine offensichtliche Provokation.
In Femkes Gesicht stand Verachtung. »Du kannst mich nennen, wie du willst, das ändert rein gar nichts. Statt mich mit deinem Beziehungsdrama zu belästigen, solltest du darüber nachdenken, warum du mich eine Hure nennst, und nicht deinen Freund. Du denkst, du bist das Opfer, weil er dich mit mir beschissen hat? Dann fang gefälligst bei ihm an.«
Tasha trat einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. »Du bist so billig! Du hast David in einem Moment der Schwäche ausgenutzt, das weiß ich. Er hat mir alles erzählt, weil er es nämlich bereut, auf dich hereingefallen zu sein.«
Femke lachte auf. »Wenn dein Freund es nötig hat, sich von einer Schlampe wie mir verführen zu lassen, obwohl er dich hat, ist das nicht meine verdammte Schuld. Anscheinend bringst du es einfach nicht.«
Ohne Vorwarnung knallte Tasha ihre flache Hand Femke ins Gesicht. Deren Kopf flog zur Seite, einige der Schüler quietschten überrascht auf und ich hielt die Luft an.
Femke strich sich ein paar Strähnen aus dem Gesicht, zeigte jedoch keinerlei Emotionen. »Geht es dir jetzt besser?«, fragte sie sarkastisch. »Dann hör mir gut zu: Du kannst mich schlagen, mich Schlampe und Hure nennen, das ist mir egal. Aber ich lasse mich von dir nicht zur Schuldigen machen. Hast du das verstanden? Und jetzt geh mir aus dem Weg!« Nun war Femke es, die Tasha einen groben Schubs gab, dann bahnte sie sich ihren Weg durch die Mitschüler und marschierte davon. Ich sah ihr sprachlos hinterher und war mir nicht sicher, was ich gerade beobachtet hatte.
Das war Femke. Das war in den letzten Jahren aus ihr geworden, und ich fühlte mich ihr so wenig verbunden, dass ich kaum glauben konnte, wie nahe wir uns einst gestanden hatten.
Früher war Femke ein Leuchten, sie war Glitzer, Gold und Pink. Sie war die Welt für mich, und sie hat nur für mich gestrahlt. Jetzt glitzert sie für jeden. Sie ist gleichgültig und egoistisch. Ein verzweifelter Auftritt und ein Schlabber-Outfit ändern daran nichts. Was ihre Verzweiflung auch hervorgerufen haben mag, vermutlich hat sie es sich selbst zuzuschreiben.
Aber solche Dinge spricht niemand laut aus. Jeder denkt es, keiner sagt es.
Das hier aber, das habe ich nicht gewollt, und das hat sie auch nicht verdient.
Scheiße!
»Femke!«, schreie ich. Ich springe nach vorn, um sie zu halten, am Sweatshirt, irgendwo, aber ich bin zu langsam, meine Arme zu kurz, meine Reaktionszeit durch den Schreck verzögert. Sie ist längst weg, nach hinten gestürzt, es ist nur mein Verstand, der das in den unendlichen Momenten der Starre nicht begriffen hat.
Jetzt begreift er.
Ich schreie, brülle ihren Namen und erreiche die Stelle, an der das Geländer weggebrochen ist. Ich sehe ihren Fall, sehe Femkes erschrockenen Blick, die aufgerissenen Augen, weil ihr bewusst wird, dass sie nicht bloß fliegt.
Als sie mit dem Rücken auf dem weichen Waldboden aufschlägt, sehe ich ihr Gesicht nicht mehr. Ich höre ihr Ächzen, schon rollt sie weiter. Der Abhang ist steil, Bäume verlangsamen ihren Fall. Immer wieder schlägt sie irgendwo an, mit dem Kopf, dem Rücken, den Beinen. Ihre Arme wedeln hilflos umher, sie versuchen, Halt zu finden, sich festzuhalten, doch es geht zu schnell, ist zu steil, zu überraschend. Der Sturm trägt ein Platschen zu mir hinauf, und bevor mein Verstand begreift, was das bedeutet, registriere ich, dass ich Femke nicht mehr sehe. Sie ist verschwunden, verschluckt von dem reißenden Fluss.
Scheiße.
Ich blicke mich Hilfe suchend um, aber es ist niemand in der Nähe. Niemand, der uns gesehen oder gehört hat. Panik überkommt mich. Was soll ich tun? Ohne nachzudenken, steige ich zu Femke in den Abgrund.
Meine Füße rutschen über den steilen Erdboden, während ich ihrer Fallspur folge. Ich schlittere mehr als dass ich laufe, und wiederholt muss ich mich an einem der Bäume festhalten, damit ich nicht stürze. Es ist schwierig, die Kontrolle über das Tempo zu behalten, und ich zwinge mich zur Vorsicht. Mein rasendes Herz treibt mich weiter, eine Stimme in meinem Kopf, unterschwellig, aber unnachgiebig, brüllt mich an, ich solle mich beeilen, bevor Femke von der Strömung mitgerissen wird. Vielleicht ist es ihr gelungen, sich irgendwo festzuhalten und sie ist noch da, wenn ich das Flussufer erreiche.
Einer meiner Füße verfängt sich und ich falle mit dem Kopf voran den Abhang hinunter, schreie erschrocken und lande auf meinem Bauch. Luft wird aus meiner Lunge gepresst, aber ich habe schnell die Kontrolle über meinen Körper zurück. Hastig rapple ich mich auf, mir ist schwindelig, aber Schmerz spüre ich keinen. Er hätte mich ohnehin nicht aufgehalten.
Ich nehme die Verfolgung wieder auf, vorbei an Bäumen und Sträuchern. Es ist nicht mehr weit, zum Glück, denn die Sonne ist bald verschwunden, die Finsternis wird mich umschließen, wie es die Angst bereits tut.
Endlich erreiche ich das Wasser. Ich muss abbremsen, um nicht hineinzustürzen. Am Horizont, da wo der breite Fluss den Himmel berührt, leuchtet ein warmes orangenes Licht, als stünde die Welt in Flammen. Ich japse nach Luft, bin es nicht gewohnt, derart schnell zu laufen, und sehe mich hektisch um.
Mit aller Kraft rufe ich Femkes Namen, genau einmal, aber sie ist nicht da.
Mit einem Mal bin ich ganz ruhig, als mir etwas klar wird.
Femke ist tot, von Bäumen erschlagen, vom Fluss mitgerissen und ertränkt. Doch das ist bloß die halbe Wahrheit.
Die ganze Wahrheit ist viel entsetzlicher.
Femke ist tot, und ich habe sie in den Abgrund gestoßen.
Drei
Erschöpft lehne ich mich an einen Baumstamm. Er ist kalt und unbequem, dennoch lasse ich mich an ihm herunterrutschen und setze mich auf den feuchten Boden. Noch immer geht mein Atem schnell, mein Herz rast, aber das ist nichts im Vergleich zu der Panik, die durch meinen Körper rollt und mich bewegungsunfähig macht.
Das darf nicht wahr sein, oh, bitte! Das darf einfach nicht passieren! Doch die Realität liegt in Gestalt des rauschenden Flusses und der Einsamkeit vor mir und deutet höhnisch auf mich.
Du hast Femke auf dem Gewissen!
Sie hat meine Hilfe gesucht und ich habe ihr den Tod gebracht.
Wenn das kein übler Scherz ist, hat mein Schubser eine Kettenreaktion ausgelöst, die zu Femkes Tod geführt hat. Welche Anklage wäre das vor Gericht? Fahrlässige Tötung? Komme ich ins Gefängnis? Und spielt bei alledem eine Rolle, dass ich das nicht gewollt habe?
Noch immer brennt der Himmel und ich sehe wie erstarrt dabei zu, wie die Sonne im Fluss versinkt. Bald wird der Mond am Himmel aufsteigen. Vielleicht bekommt Femke ihn zu fassen und wird von ihm ans Ufer getragen, trocken und geheilt von dem, was sie quälte.
Ich sitze eine ganze Weile im Verborgenen, die Beine an mich gezogen, weil ich sonst nichts habe, woran ich mich klammern kann, und zittere am ganzen Körper. Es ist kalt und ich muss geschwitzt haben, meine Kleider kleben an mir wie eine zweite Haut. Trotzdem bleibe ich und warte, ob Femke wieder auftaucht, aus einem Gebüsch springt und »Reingefallen!« schreit. »Du glaubst doch nicht, dass ich so einfach sterbe!«
Nein, das glaube ich nicht. Femke ist unverwüstlich.
Aber sie ist verschwunden. Niemand springt aus dem Gebüsch und macht sich über meine Leichtgläubigkeit lustig.
Als ich meine Füße und Finger nicht mehr spüre, zwinge ich mich auf die Beine. Der Mond hat seine Nachtschicht übernommen und Femke nicht mitgebracht. Die Finsternis des Waldes in meinem Rücken ist erdrückend. Was soll ich tun? Meine Leggings kleben eisig und klamm an meinem Po, ich werde mir sämtliche Organe verkühlen, die mein Körper zu bieten hat. Ich klopfe mir die Erde von der Brust, meine Hände sind zwei plumpe Stücke gefrorenes Fleisch. Mit meinem warmen Atem versuche ich, sie aufzutauen. Endlich wieder mit Gefühl in meinen Fingerspitzen, krame ich mein Handy aus der verdreckten Jackentasche. Ich spüre es kaum, als es in meiner Hand liegt, nur dem Licht des Displays verdanke ich, dass ich sehe, was meine ungeschickten Finger tun.
Femkes Nummer.
Vor ein paar Stunden hat sie mich angerufen, ich wusste nicht einmal, wer dran sein würde, da ich ihre Nummer längst gelöscht habe. Jetzt finde ich sie im Anrufprotokoll. Es ist sinnlos, ich weiß es, und trotzdem muss ich es probieren. Alles an mir zittert, ich brauche mehrere Versuche, meine Rufnummer zu unterdrücken, ehe es mir gelingt und mein Handy den Verbindungsversuch startet.
Das Telefon klingelt. Es ist nicht aus, nicht kaputt! Hoffnung steigt in mir auf. Unter Wasser hätte es keinen Empfang, wäre längst abgesoffen. Oder? Vielleicht hat Femke es geschafft! Vielleicht ist sie nur kurz ins Wasser gestürzt, konnte sich aber ans Ufer schleppen und lässt mich nun in dem Glauben, ihr sei etwas passiert, um es mir heimzuzahlen!
Doch je länger es klingelt, je länger mein Anruf unbeantwortet bleibt, desto mehr muss ich einsehen, dass es dabei bleiben wird.
Trotzdem lasse ich es läuten, bis mir eine elektronische Stimme mitteilt, dass der Teilnehmer im Augenblick nicht zu erreichen sei und ich es später noch einmal versuchen solle.
Das werde ich.
Meine Glieder sind steif und kalt, mein einziger Versuch, den Abhang zu erklimmen, scheitert kläglich und befördert mich beinahe ins kalte Wasser. Ich muss einen Umweg laufen, am Fluss entlang, bis ich zu der Brücke nahe der Hauptstraße komme. Es ist ein langer Weg, sicher fünf Kilometer, aber ich bin mit einer Gleichgültigkeit ausgefüllt, die diese Tatsache nicht weiter bejammert.
Und vielleicht finde ich unterwegs einen Hinweis auf Femkes Verbleib.
Als ich zu Hause ankomme, ist es kurz vor Mitternacht. Alles schmerzt, gleichzeitig fühle ich mich taub.
Unterwegs konnte ich keine Spur von Femke entdecken, als wäre sie niemals da gewesen. Doch die Sache mit ihrem Handy lässt mich nicht los. Es war an. Irgendwie kommt mir das seltsam vor.
Ich hole den Haustürschlüssel unter der Fußmatte hervor – ich bin zu chaotisch, um ihn bei mir zu tragen – und schließe mit bebenden Fingern und Kälte in der Brust die Tür auf.
In der Wohnung ist es dunkel. Alexa ist abgetaucht, bei ihrer Fernbeziehung irgendwo in Süddeutschland, und es ist gut möglich, dass ich sie erst in ein paar Wochen wieder sehe – Homeoffice macht es möglich. Obwohl meine ältere Schwester mein gesetzlicher Vormund ist, bin ich die meiste Zeit auf mich gestellt. Für gewöhnlich genieße ich meine Freiheit, und auch an diesem Abend bin ich froh, ihr nichts erklären zu müssen. Andererseits fühle ich mich unwohl bei dem Gedanken, nach diesem schrecklichen Abend allein zu sein. Obwohl ich Femke nicht gefunden habe, hat mich ein Schatten ihres Daseins bis nach Hause verfolgt und beobachtet mich bei jedem meiner Schritte. Die Schuld im Nacken wird mich um den Verstand bringen.
Ich schüttle diesen schaurigen Gedanken ab und quäle mich stattdessen mit realen Albträumen. Wie es aussieht, werde ich die nächsten Jahre im Jugend- oder Frauenknast verbringen und mit der Gewissheit leben müssen, ein Menschenleben ausgelöscht zu haben.
Femkes Leben …
Völlig durchgefroren streife ich meine Klamotten ab und stelle mich für die nächsten dreißig Minuten unter die Dusche. Mein ganzer Körper brennt, ein Vorgeschmack auf die Hölle.
Hart und heiß prasselt das Wasser über mein Haar, meine Schultern, meinen gekrümmten Rücken. Mein Kopf ist leer, Gedanken sind nicht möglich, nur Bilder tauchen auf. Der Moment, als Femke stürzt, eben noch da und nach einem Blinzeln verschwunden. Ein Schluchzen dringt aus meiner Kehle, doch niemand ist hier, niemand hat es gehört, also ist es nicht passiert.
Nach einer Weile habe ich das Gefühl, das Wasser hätte mir die Haut von den Knochen gekocht. Ich stelle es ab und trete aus der Duschkabine in mein mickriges Badezimmer. Sofort beginne ich zu frieren, obwohl der Spiegel direkt vor mir so heftig beschlagen ist, dass ich nichts darin erkenne.
Vielleicht ist das Bad leer, vielleicht bin ich gar nicht hier.
Vielleicht sehe ich deshalb nichts darin.
Ich wickle mich in ein Handtuch, doch auch das hilft nicht. Die Kälte ist in mir, breitet sich aus, bis ich zu einem Eisklotz werde. Ich trockne mein Haar und hole mir noch mehr Handtücher.
Wie eine Mumie verpackt husche ich ins Wohnzimmer, das gleichzeitig mein Schlafzimmer ist. Die Couch ist ausgezogen, Bettdecke und Kissen liegen so, wie ich sie zurückgelassen habe. Sofort krieche ich unter die Decke, kuschle mich bis zur Nasenspitze ein und warte schlotternd darauf, dass ich einschlafe.
Als die Müdigkeit kommt, fällt mir ein, dass ich Femke noch einmal anrufen wollte. Doch schon hat die bleierne Schwere mich im Griff und zieht mich in den Schlaf.
Morgen, denke ich, bevor ich verschwinde.
Ich bin in der Schule und fühle mich unwohl. Natürlich tue ich das. Immer wieder blicke ich mich um, und ich bin mir nicht sicher, ob ich nach Femke Ausschau halte oder darauf warte, dass ein Polizeiwagen vorfährt und mich verhaftet. Überhaupt habe ich das Gefühl, alle starren mich an. Anders als sonst, als könnten sie mir ansehen, was ich getan habe, als hätte ich Blut an meinen Händen.
Ich weiß, dass meine Schlampen am Hinterausgang sitzen und auf mich warten, also gehe ich mit gesenktem Kopf dorthin, obwohl ich es dann nicht mehr rechtzeitig zum Unterricht schaffe.
Ich sehe Amy und Robin von Weitem und bleibe zögerlich stehen. Noch haben sie mich nicht bemerkt und ich könnte einfach verschwinden. Nur wozu? Ich will mich nicht ewig verstecken. Je normaler ich mich verhalte, desto unverdächtiger bin ich.
So tun, als wäre nichts geschehen, kann ich nicht.
Ich atme tief durch und gehe auf sie zu. Während ich immer näher komme, fällt mir auf, dass Robin an diesem Tag einen schwarz-roten Petticoat trägt. Sie hat noch nie so etwas getragen, nicht in meiner Gegenwart und schon gar nicht in der Schule. Trotz der Irritation stelle ich fest, dass ihr der Look fantastisch steht, und bin ein bisschen neidisch.
»Hey«, begrüße ich sie befangen, meine Stimme kommt mir fremd vor. Sie klingt in meinem Kopf, als wäre dort ein Hohlraum, von dessen Wänden dieses eine Wort unaufhörlich zurückgeschleudert wird.
Beide blicken synchron auf und ihre Musterung ist seltsam. Ist etwas nicht in Ordnung? Ist an mir etwas falsch? Vielleicht habe ich es auf der Stirn stehen.
Ich habe Femke auf dem Gewissen!
Dann fällt mir der Grund für ihr distanziertes Verhalten ein und ich versuche verkrampft, mich zu entspannen.
»Sorry wegen gestern. Ich weiß, ich hab gesagt, ich komme vorbei, aber mir ist …«, ich schlucke trocken, »… etwas dazwischengekommen.« Nämlich der Tod meiner einst besten Freundin, den ich verursacht habe!
Vielleicht sollte ich es ihnen sagen, sie würden mich nicht verraten, da bin ich mir sicher.
Bis ich ihre finsteren, wütenden Blicke bemerke. Etwas stimmt nicht, fühlt sich falsch an, doch ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen.
»Was machst du hier?«, fragt Amy mit aufgebrachter Wut, die mir entgegenschlägt und mich umzuschmeißen droht. Es ist ein unausgesprochener Vorwurf, und ich weiß nicht, was verkehrt gelaufen ist.
Ich öffne hilflos den Mund, aber Robin kommt mir zuvor.
»Wir wollen dich nicht haben, also verschwinde, Schlampe.« Ihre Stimme ist so tief wie immer, dennoch schmerzt sie schrill in meinen Ohren.
Die beiden kommen langsam auf mich zu und ich weiche eingeschüchtert zurück.
Was habe ich euch getan?, will ich fragen, kriege aber keinen Ton heraus. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie etwas auf ihren Köpfen tragen, was ich im ersten Moment nicht zuordnen kann. Doch als sie synchron danach greifen und es vor ihre Gesichter ziehen, wird mir kotzübel.
Es sind Masken. Masken von Femkes Gesicht.
Meine Freundinnen beginnen, mich herumzuschubsen. Ich winde mich unter ihren Händen, versuche ihnen auszuweichen, doch sie haben zu viele Arme, mit denen sie mich von sich stoßen. Immer wieder stolpere ich rückwärts. Sobald ich mich wegdrehe, stehen sie wieder vor mir und die Femke-Masken auf ihren Gesichtern grinsen mich hämisch an. Als wären sie lebendig.
»Hört auf! Hört bitte auf!«, rufe ich hilflos, flehe geradezu und schlage ihre Hände von mir. Doch sie sind schneller – und sie sind wütend. Ich stoße gegen etwas hinter mir, verliere das Gleichgewicht und stürze auf meinen Hintern. Obwohl mir nichts wehtut, stöhne ich auf.
Als ich hochblicke, ist Robin verschwunden und Amy … Amy ist nicht mehr Amy mit einer Femke-Maske, sondern es ist Femke selbst, die über mir steht und mich mit einem Gesicht anglotzt, das puren Wahnsinn widerspiegelt. Ihre Augen sind aufgerissen, ihr blondes Haar klebt klitschnass an ihrem aufgedunsenem Gesicht, feine blaue Äderchen ziehen sich wie die Linien auf einer Straßenkarte über ihre Haut und eine brachiale Platzwunde, aus der immerzu Blut sickert, ziert ihre Stirn.
Mir bleibt die Luft weg. Wo sind Amy und Robin? Warum empfinde ich keine Erleichterung, dass Femke nicht tot ist? Mein Blick wandert an ihr herab und ich entdecke den Baseballschläger in ihrer rechten Hand. Mir ist klar, was das bedeutet: entweder sie oder ich. Einer muss bezahlen.
Ich will aufspringen, mich in Sicherheit bringen, aber ich komme nicht hoch. Mit einem Mal beginnt es zu regnen. Harte Tropfen, die sich wie Tritte auf Rücken und Kopf anfühlen, prasseln auf mich herab und drücken mich zurück auf den Boden. Ich versuche, zu Femke aufzublicken, muss wissen, ob der Regen, der sich in Hagel verwandelt, sie aufzuhalten vermag. Doch Femke scheint völlig ungerührt. Blut läuft über ihr Auge, färbt das Weiße darin rosa und lässt sie rote Tränen weinen.
»Ich habe das nicht gewollt!«, rufe ich gegen den Lärm des Hagels, der auf den Asphalt donnert. Die Worte sind mir vertraut, ihre Bedeutung jedoch bleibt mir verborgen.
Femke schreitet weiter auf mich zu, und plötzlich höre ich Stimmen. Um uns herum stehen Menschen, ich erkenne keine Gesichter, aber ich weiß, dass ich sie kenne. Sie stehen nur da, tun nichts. Ich möchte sie um Hilfe bitten, doch als ich den Mund öffne, ertränkt mich der Regen. Ich gebe auf. Es würde ohnehin nichts nützen. Niemand wird mir helfen.
Erneut sehe ich zu Femke, flehe sie an, es nicht zu tun. Sie schüttelt stumm den Kopf und holt aus. Der Schläger trifft mich unter dem Ohr, ich schreie auf und bemerke verblüfft, dass mein Unterkiefer verschwunden ist …
Ich sitze aufrecht in meinem Couch-Bett, schreie und zittere am ganzen Körper. In Panik taste ich nach meinem Unterkiefer. Er ist da und ich habe keine Schmerzen, nur mein Herz schlägt brachial gegen meinen Brustkorb, meine Rippen. Ich habe geschwitzt, mein Haar ist nass, aber wieder ist mir bloß bitterkalt. Nur langsam finde ich in die Realität zurück und benommen wische ich mir ein paar Strähnen von der Stirn.
Bloß ein Albtraum!
Eine Weile bleibe ich sitzen, lasse meinen Körper zittern und starre auf mein blinkendes Handy. Ich will wissen, wer mich zu erreichen versucht, aber die Angst, es könnte nicht Femke sein, lässt mich zögern.
Schließlich nehme ich das Telefon in meine klammen Finger und schalte das Display ein.
Eine einzige Nachricht hat mich erreicht.
Wo steckst du?, hat Amy geschrieben, heute Morgen um 9 Uhr 14. Entsetzt huscht mein Blick zu der Uhrzeitanzeige in der oberen rechten Ecke. Es ist bereits nach 11 Uhr! Ich habe meinen eigenen Rekord im Verschlafen gebrochen!
Krank, antworte ich Amy kurz angebunden und wickle mich schlotternd enger in meine unzähligen Decken und Handtücher.
Ich behalte das Handy in der Hand, um eine Antwort abzuwarten, die nicht kommt. Vermutlich sitzt Amy gerade im Unterricht, was sie sonst allerdings nicht abhält. Doch mein Gehirn ist zu voll mit anderen Fragen, dass mir keine andere Erklärung einfällt.
Schließlich wähle ich erneut Femkes Nummer. Niemand geht dran. Frustriert werfe ich das Telefon auf den Boden und es landet unbeschädigt auf dem runden Teppich.
Schließlich stehe ich auf, quäle mich von der Couch und verschwinde im Bad. Mit frischen Klamotten, eigentlich warm genug, sollte ich endlich nicht mehr frieren, aber es macht keinen Unterschied. Die Kälte frisst mich von innen auf und ich bin ihr schutzlos ausgeliefert.
Ist das Schuld? Fühlt sie sich so an?
Die Kapuze meines Sweatshirts tief ins Gesicht gezogen, gehe ich in die Küche und suche mir etwas zusammen, was annähernd einem Frühstück gleichkommt. Einkaufen vermeide ich für gewöhnlich, bis Kühlschank und Magen leer sind und die Entscheidung zwischen Einkaufen und Verhungern nicht mehr schwer ist.
Es fehlt nicht viel, dann ist es wieder so weit. Ich hole das eigentlich leere Glas Marmelade aus dem Kühlschrank und kratze die verbliebenen Reste von den Seitenwänden. Es ist nicht viel, was ich auf die vorletzte Scheibe Toast schmiere, aber immerhin verzögert es das Verhungern ein wenig.
Während ich auf dem trockenen Brot herumkaue, wird mir klar, dass ich mir das eigentlich auch hätte sparen können. Ich bekomme nichts runter, der Geschmack der Kirschmarmelade, die sich in meinem Mund verteilt, ruft nur einen Brechreiz hervor. Ich spucke den klebrigen Klumpen in die Spüle und wasche mir den Mund aus.
Zurück im Wohnzimmer hebe ich mein Handy vom Teppich auf und starte einen neuen Versuch. Dieses Mal versuche ich es nicht auf Femkes mobilem Telefon, sondern bei ihr zu Hause. Zuvor stelle ich erneut die Rufnummer-Unterdrückung ein und speichere es als Standardeinstellung.
Ich bin überrascht, dass ich Femkes Festnetznummer noch im Kopf habe. Früher, bevor wir unsere ersten Smartphones bekamen, habe ich sie oft gewählt, doch das ist inzwischen viele Jahre her und ich hätte nicht gedacht, dass sie sich unwiderruflich in meinem Gedächtnis eingebrannt hat.
Mein Herz klopft wild und ich frage mich, was ich mit diesem Anruf eigentlich beabsichtige, was ich ihrer Familie sagen soll, wer auch immer ans Telefon geht. Doch noch bevor ich mir darüber Gedanken machen kann, hebt jemand am anderen Ende der Leitung ab. Direkt nach dem ersten Freizeichen.
Als hätte derjenige auf den Anruf gewartet.
»Femke? Bist du das?« Femkes Mutter Manuela klingt abgekämpft und verweint. Mir stockt der Atem und ich presse meine Lippen aufeinander, dann lege ich auf. Es gibt nichts, was ich sagen könnte. Und meine Frage ist beantwortet.
Femke ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen.
Vier
Zusammengekauert sitze ich auf dem Couch-Bett, die Arme um meine Beine geschlungen, und weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte so sehr weinen, dass es wehtut. Ich möchte schreien, heulen, schluchzen, bis sich das Schicksal erbarmt und die Zeit zurückdreht. Doch ich bin still, wippe vor und zurück und gehe meine Möglichkeiten durch.
Die Polizei.
Es wäre das Vernünftigste. Vor allen Dingen das Richtige. Aber die Wahrheit ist: Ich habe Angst.
Angst, sie könnten mir nicht glauben, dass es ein Unfall gewesen ist. Femke und ich waren allein, niemand hat uns gesehen, und ich habe nicht sofort Hilfe gerufen, sondern Femke ihrem Schicksal überlassen. Selbst wenn sie meiner Aussage Glauben schenken, ist mein Nichthandeln unterlassene Hilfeleistung. Ich habe mich schuldig gemacht, und das nicht nur durch einen kleinen Schubser.
O Gott. Femke! Was habe ich getan? Wir waren schon längst keine Freunde mehr, haben uns vor diesem Abend hässliche Dinge an den Kopf geworfen, aber das darf kein Grund sein, dich im Fluss elendig ertrinken zu lassen!
Entsetzt schlage ich mir die Hände vors Gesicht, wische die Tränen aus meinen Augen, die mich immerhin ein bisschen davor bewahren, das zu sein, was ich bin.
Ein herzloses Ungeheuer.
Aber ich bin lieber das, als mich von der Schuld auffressen zu lassen. Deswegen muss ich sachlich bleiben, das Problem analytisch lösen. Es ist im Moment der einzige Weg, mit meiner Tat umzugehen.
Femkes Leben ist vorbei, völlig gleichgültig, was ich jetzt unternehme. Oder? Mein Leben hingegen, das geht weiter und ich habe das, was passiert ist, nicht gewollt. Es war ein Unfall, im Grunde hat Femke selbst schuld. Warum also soll ich büßen?
Weitere Tränen kommen, die ich mit meinem Handrücken sofort verschwinden lasse, und treffe eine Entscheidung.
Keine Polizei.
Die würde es mir anhängen, so oder so. Ich bin bereits aktenkundig, nur wegen Alkohol und Vandalismus, aber ich weiß aus Erfahrung, dass denen das genügt, um ein voreiliges Urteil über mich zu fällen. Dazu mein gefärbtes Haar, der schwarze Nagellack – für die alles ein Beweis meiner böswilligen Absicht.
Nein.
Ich werde es aussitzen. Warten, bis Femke auftaucht – falls sie auftaucht –, und dann sehen, was passiert.
Auch wenn ich im Augenblick noch keine Ahnung habe, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren soll. Trotzdem habe ich keine andere Wahl. Im Gefängnis würde ich qualvoll verenden.
Ich lege mich auf die Seite, zusammengerollt wie ein Embryo, und lasse mich zitternd in den Schlaf fallen. Vielleicht finde ich dort einen Ort, an dem ich mich für meine Entscheidung nicht verachte.
Ein brennender Schmerz lässt mich aus meinem unruhigen Schlaf aufschrecken. Sofort sitze ich aufrecht, bevor ich mich überhaupt orientiert habe, bevor die Erinnerung mich wie ein eiskalter Schlag ins Gesicht trifft, und greife mir an meinem Knöchel. Der Schmerz geht von dem Tattoo aus, zieht sich mein gesamtes Bein entlang bis in den Bauch, und als ich das Tattoo berühre, spüre ich Feuchtigkeit an meinen Fingerspitzen. Schmerz flammt unaufhörlich durch meine Nervenbahnen und ich presse die Lippen aufeinander. Ich halte mir die Finger vor die Augen, der festen Überzeugung, dass ich Blut an ihnen sehen werde, doch da ist nichts. Gar nichts.
Erst beim zweiten Blick, als ich die Haut näher betrachte, erkenne ich den feuchten Schimmer, den ich mir also nicht eingebildet habe. Mein Tattoo blutet nicht, dafür scheint es aus einem unerfindlichen Grund zu nässen.
Ich ziehe das Bein zu mir heran, um mir anzusehen, woher die Wundflüssigkeit kommt, und sofort dreht sich mir der leere Magen um.
Mein Tattoo, ein Blumenstängel mit einem herzförmigen Blatt, ist entzündet. Die Haut ist feuerrot und geschwollen, um das Motiv herum hat sich eine feine Linie gebildet, aus der die Feuchtigkeit an meinen Fingern sickert. Angeekelt komme ich auf die Füße und der brennende Schmerz pulsiert weiter durch mein Bein nach oben.
Ich bringe es nicht über mich, richtig aufzutreten, also humple ich ins Badezimmer, wo ich schließlich auf den Badewannenrand plumpse. Alles in mir sträubt sich dagegen, die Wunde noch einmal anzusehen, aber ich weiß auch, dass sie eine Behandlung braucht – waschen oder ein Pflaster, keine Ahnung.
Säubern, kommt es mir in den Sinn. Säubern sollte ich sie auf jeden Fall! Widerwillig stelle ich im Sitzen meinen nackten Fuß auf den Badewannenrand, beiße die Zähne zusammen und sehe hin.
Mir bleibt fast das Herz stehen. Das Tattoo, es wirkt irgendwie … verrutscht. Als befände es sich näher am Knöchel und wäre … schief.
Ich schüttle den Kopf, so ein Blödsinn! So was ist nicht möglich, sicher bin ich noch vom Schlaf verwirrt.
Auf einem Bein durchsuche ich das Spiegelschränkchen über dem Waschbecken nach etwas, mit dem ich die seltsame Wunde möglichst schonend säubern und anschließend verbinden kann. Doch ich finde bloß vorgeschnittene Pflaster, die viel zu klein sind, und einen abgenutzten Schwamm, den ich für kein Geld der Welt in die Nähe einer offenen Verletzung bringen würde.
Hilflos sehe ich mich um. Seit fast fünf Jahren wohne ich bei meiner Schwester, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie in dieser Wohnung ein Erste-Hilfe-Set aufbewahrt – und ob sie überhaupt eins besitzt.
Also greife ich mir die Klopapierrolle von der Halterung, reiße ein paar Blätter ab und befeuchte sie unter dem Wasserhahn.
Das muss reichen. Hoffe ich.
Zögerlich wende ich mich der Wunde zu. Das wird vermutlich ziemlich wehtun, auch wenn ich nicht kapiere, was da eigentlich passiert ist. Das Tattoo ist mehrere Jahre alt, längst verheilt und hat nie irgendwelche Probleme gemacht. Habe ich mich in der vergangenen Nacht an einem Ast oder etwas anderem verletzt, während ich den Abhang hinuntergeschlittert bin? Das erscheint mir sehr unwahrscheinlich. Außerdem hat es noch nicht wehgetan, als ich in der letzten Nacht geduscht habe, und auch nicht heute Morgen. Oder habe ich wegen dieser inneren Kälte nichts bemerkt?
Ich hole tief Luft und lege los. Vorsichtig tupfe ich mit dem feuchten Toilettenpapier über die Wunde und schaue nur mit einem Auge hin, weil der Anblick ein unwohles Gefühl in meiner Brust entfesselt, und konzentriere mich auf meine Atmung.
Es tut nicht so schlimm weh wie befürchtet, doch nach ein paar Tupfern spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Als wäre das Stück Toilettenpapier mit ätzender Säure getränkt, jagt ein Brennen durch meine Nervenbahnen. Angespannt presse ich die Lippen aufeinander, während ich weitermache. Das Papier wird erst blassrosa, dann verfärbt es sich tiefrot und ich bekomme es mit der Angst zu tun.
Entsetzt reiße ich den Mund auf. Meine Finger beginnen zu zittern und Schweiß bricht mir aus. Ungläubig starre ich genauer hin. Die Stelle sieht aus, als hätte sich das Tattoo vom Fleisch gelöst. Blutige Ränder, die Haut wirft unnatürliche Falten. Ich lasse das Toilettenpapier fallen und drücke mir beide Hände auf den Mund, um nicht aufzuschreien. Eben konnte ich nicht hinsehen, nun ist es mir unmöglich, wegzusehen. Was zur Hölle ist das? Es sieht aus, als würde mein Körper mein Tattoo abstoßen.
Das Tattoo, das ich mir mit Femke zusammen habe machen lassen. Ein Freundinnen-Tattoo, sie die hübsche Blüte, ich der starke Stängel, zusammen eine kräftige, wunderschöne Blume.
Eine Weile starre ich die Stelle an und weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Die Haut zurück in Position zu schieben, erscheint mir surreal, noch nie habe ich davon gehört, dass etwas Ähnliches passiert ist. Aber so lassen kann ich es nicht.
Mein Magen macht ein gequältes Geräusch und ich bin froh, dass ich das Toastbrot heute Morgen ausgespuckt und nicht runtergewürgt habe.
Die ganze Situation erscheint mir unerträglich, also beschließe ich, etwas zu unternehmen. Nicht zu viel darüber nachdenken, einfach machen. Sonst sitze ich vermutlich noch in drei Wochen hier.